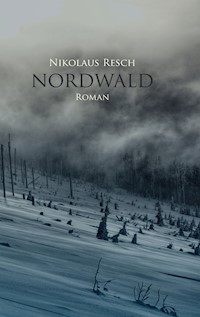Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Georg Gollinger, ehemaliger Häftling des NS-Regimes, lebt mit seinem Sohn in einem alten Zollhaus im Böhmerwald. Eines Tages bringt ein alter Brief die Vergangenheit zurück, und er begibt sich mit seinen Freunden auf die Suche nach einem vergessenen Goldschatz. Eine turbulente Jagd beginnt, auf der nicht nur alte Bekannte wieder auftauchen, sondern auch längst verloren geglaubte Erinnerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Gollinger, ehemaliger Häftling des NS-Regimes, lebt mit seinem Sohn in einem alten Zollhaus im Böhmerwald. Eines Tages bringt ein alter Brief die Vergangenheit zurück, und er begibt sich mit seinen Freunden auf die Suche nach einem vergessenen Goldschatz. Eine turbulente Jagd beginnt, bei der nicht nur alte Bekannte wieder auftauchen, sondern auch längst verloren geglaubte Erinnerungen.
Nikolaus Resch wurde 1974 in einer kleinen Mühlviertler Gemeinde nahe der Grenze zu Deutschland und der damaligen Tschechoslowakei geboren. Gollinger geht heim ist sein zweiter Roman.
Für Sophie, Finn und Jano;
und für alle anderen,
die die große Wanderung
noch vor sich haben.
Selig, die arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.
Inhalt
Die Wanderung beginnt
Mike
Das Zollhaus
Der Weltreisende
Der Wohltäter
Der Indianer im Hochwald
Arbeit macht faul
Ein Brief aus der Vergangenheit
Der Heimat so nah
Der Zufall
Gold
Eva
Die Kirche
Der große Jäger
Die Befreiung
Die Vergangenheit holt auf
Die Köhlerin
Die Liebenden
Die Ameisenkönigin
Die Verführung
Amerika
Der Stollen
Die Warnung
Die Entführung
Opa weg, Oma weg!
Die gerettete Jungfrau
Wenn der Vater mit dem Sohne
Ein schlechter Tausch
Feuer
1
Die Wanderschaft beginnt
Gerade bin ich aufgewacht, ob aus einem tiefen Schlaf oder aus einem anderen lähmenden Zustand, weiß ich nicht. Alles was ich weiß ist, dass ich nicht in meinem eigenen Bett liege. Jeder kennt dieses Gefühl - man erwacht, und noch ehe man die Augen öffnet oder das Licht anmacht, ist einem klar - das hier ist nicht das eigene Bett. Außerdem fühlt sich die Bettwäsche unangenehm seidig-glatt unter meinen Fingern an, ich bevorzuge aber seit jeher einfaches Leinenzeug, um meinen Leib darauf zu betten. Das Zimmer, soweit ich das im gedämpften Licht einer Nachttischlampe erkennen kann, ist eindeutig ein Frauenzimmer. Blumengestecke und Spitzendeckchen zieren die Kommoden, und an den Wänden hängen einige kleine gestickte Bildchen mit sinnreichen Sprüchen, zwischen Aquarellen von Klatschmohn und Kornblume.
Ich setzte mich auf und bin überrascht wie schwer mir das fällt. Wie lange muss ich geschlafen haben, dass sich meine Glieder so steif anfühlen? Ich öffne meine rechte Hand die zu einer Faust geballt ist, und bemerke tiefe Hautrunzeln die sich wie ein Netz darüber ziehen. Es ist eine alte Hand die da an meinem Arm hängt. Die Handfläche liegt rissig wie ein ausgedörrter Acker vor mir, und darauf schmiegen sich drei kleine rosa Kügelchen aneinander. Keine Ahnung wie die dorthin gekommen sind, aber da ich noch nie viel von Pillen gehalten habe, sehe ich mich nach einem Mülleimer um, weil ich aber keinen finde, stecke ich die Tabletten in meine Hosentasche.
Nun, ich weiß weder wo ich mich befinde, noch wie oder zu welchem Zweck ich hierhergekommen bin. Was ich aber weiß ist, dass ich hier nichts zu schaffen habe.
Die Luft ist stickig und stumpf, und ich gehe zum Fenster um es aufzumachen. Seltsamerweise ist es aber mit einem Schloss gesichert und lässt sich nur einen Spalt breit öffnen. Das gefällt mir nun ebenso wenig wie der Rest des Zimmers, und so gehe ich über einen weichen Teppich zur Tür. Aber auch die ist versperrt. Ich werde stutzig. Offenbar bin ich ein Gefangener.
Auf einem zierlichen Schränkchen aus Nussholz stehen ein paar Fotografien. Es ist zu dunkel um etwas erkennen zu können, und so knipse ich einen der Schalter neben der Tür an. Ein vergilbter, mit grobem Leinen bespannter Lampenschirm erhellt jetzt den Raum. Ich nehme eines der Bilder zur Hand und betrachte es. Es ist eine Schwarzweißfotografie. Sie zeigt eine kleine Familie – einen Vater, eine Mutter, und einen Jungen. Meine Augen sind nicht mehr die Jüngsten, und so muss ich das Bild nahe an mein Gesicht heranführen. Die Mutter kenne ich nicht, der Junge kommt mir irgendwie bekannt vor, den Vater aber erkenne ich. Als ich das Bild zurückstelle, sticht mir ein anderes, kleineres, ins Auge. Es steht etwas versteckt hinter einem tanzenden Harlekin aus Porzellan. Ich nehme das Foto zur Hand, und halte es ins Licht. Ein junger Mann, keine dreißig, er trägt eine Uniform der Waffen-SS.
Es gibt Gesichter, an die man sich erst wieder erinnert, wenn man sie vor sich hat. An andere braucht man sich nicht erst zu erinnern, sie haben sich ins Gehirn gebrannt wie das Alphabet - Gesichter, und die Menschen die dahinter lauern. Das hier ist ein solches Gesicht. Obersturmführer Carl-Uwe Obermaier. Es sieht also ganz so aus, als wäre ich im Moment in Obermaiers Schlafzimmer, oder im Schlafzimmer seiner Witwe, denn ich glaube vor einiger Zeit von seinem Tod gehört zu haben. Ich stelle das Bild zurück und nehme ein anderes. Dieses ist in Farbe und wohl neueren Datums. Es zeigt ein anderes Paar, und einen anderen Jungen. Der Vater hat durchaus Ähnlichkeit mit dem jungen Offizier auf der ersten Fotografie. Plötzlich fällt mir ein, dass ich dieses Gesicht, wenn auch gealtert, vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. War das nicht der Mann der mich hierher gebracht hat? Diese Erinnerung scheint mir noch recht frisch zu sein. Ein paar Stunden mochte das vielleicht her sein. Ich befinde mich also im Schlafzimmer von Carl-Uwe Obermaiers Witwe. Sie hat das Bild ihres Sohnes und seiner Familie auf der Kommode stehen. Und er war es auch, der mich hier eingesperrt hat. Ich erinnere mich jetzt. Aber warum hat er mich eingesperrt? Nun gut, es wird mir sicher wieder einfallen. Alles was ich jetzt brauche, ist ein wenig frische Luft.
Seit ich einmal für ein paar Jahre in einem Lager gefangen gehalten wurde hasse ich verschlossene Türen. Ich hielt es deshalb für angebracht, mich mit den gängigsten Schließmechanismen vertraut zu machen.
Ich bin kein Einbrecher, Gott bewahre, und mit neumodischem Firlefanz wie Alarmanlagen und dergleichen, habe ich nichts am Hut. Aber ein schlichtes Schloss vermag ich durchaus zu knacken. Zu diesem Zweck ziehe ich also mein Taschenmesser hervor, das neben einer scharfen Klinge noch mit einigen anderen hilfreichen Werkzeugen ausgestattet ist, und mache mich daran die Tür zu öffnen. So ein Taschenmesser ist doch immer wieder nützlich. Selbst wenn man es jahrelang unbenutzt im Hosensack mit sich trägt - irgendwann findet sich die Gelegenheit es einzusetzen. Das tue ich jetzt mit Erfolg, und bald springt das Schloss auf, und ich öffne leise die Tür.
Vor mir ein kurzer Flur, nur von einem schwachen Lichtschein beleuchtet, der aus einer anderen offenen Tür dringt. Am gegenüberliegenden Ende des Ganges, sind zu beiden Seiten Garderoben angebracht, und neben einem kurzen Läufer stehen einige Paar Schuhe fein säuberlich aufgereiht. Dort ist die Haustür. Ein paar Schritte, dann werde ich draußen sein.
Doch überfällt mich plötzlich die Neugierde wie ein Jucken, und ich schleiche langsam - schnell geht ja ohnehin nicht mehr, wie ich merke, schließlich bin ich zu alt dafür – zu der Tür zu meiner Rechten, aus der das Licht kommt. Das wäre dann wohl das Wohnzimmer. Ein paar Kästchen, ein riesiger Fernsehapparat, ein runder Tisch mit vier Stühlen, und eine Couch, auf der eine Gestalt liegt. Um den Atem der schlafenden Person zu hören, halte ich den meinen an, aber kein Laut ist zu vernehmen. Ich trete einige Schritte näher, und als ich bereits glaube es mit einer Leiche zu tun zu haben, da tut der Mensch einen erschrockenen Atemzug, als wäre ihm eben bewusst geworden, dass er im Schlaf zu atmen vergessen hat. Der Atem der Gestalt nimmt jetzt einen gleichmäßigen Rhythmus an, und ich gehe noch näher heran. Das Gesicht ist zur Seite gedreht und drückt sich an die Rückenlehne des Sofas, aber an dem langen, schneeweißen Haar, das zu einem losen Zopf gebunden ist, erkenne ich, dass es sich um eine Frau handelt. Das muss Carl-Uwe Obermaiers Witwe sein. Liegt sie etwa hier, um mich zu bewachen, und ist sie dabei eingeschlafen? Vielleicht hat sie ihren Sohn dazu angestiftet mich einzusperren? Aber ich habe ihrem Mann nie einen Schaden zugefügt, obwohl ich es sicherlich hätte tun können. Ich weiß so einiges über ihn. Allerdings - lohnt es sich, wenn man einen Verbrecher zur Strecke bringt, während einem darüber sein eigenes Leben davonläuft? Obermaier seiner Strafe zuzuführen, wäre ein mühsames, gar sinnloses Unterfangen gewesen, bei all den Freunden die ihn beschützten. So dachte ich, und so hatte ich Obermaier schließlich sein Leben gelassen. Sollte Gott, oder eine andere höhere Macht sich darum kümmern, ich hatte eine Familie, ich hatte mein Glück, ich würde diese Welt zufrieden verlassen. Ich glaube nicht, dass Obermaier dasselbe vergönnt war, denn das Gewissen regt sich im Augenblock des Todes, auch wenn es lange und tief geschlafen hat.
Obermaiers Sohn hat mich hergebracht, dessen bin ich mir jetzt sicher. Aber wo ist er, und warum schlief seine Mutter auf einem Sofa, während ich in ihrem Bett schlummerte? Die Sache erscheint mir äußerst rätselhaft. Irgend etwas muss zwischen dem jungen Obermaier und mir vorgefallen sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, aber wenn Rache auszuschließen ist, dann kann es nur eines bedeuten – Obermaier Junior ist hinter dem Gold her, dessen Versteck meine Frau und ich vor seinem Vater all die Jahre geheim gehalten haben. Carl-Uwe Obermaier wusste, dass vor seiner Nase, aber dennoch außerhalb seiner Reichweite, ein ansehnlicher Reichtum verborgen lag, und das war Strafe genug für ihn.
Ich will es nicht darauf ankommen lassen, meinem Entführer zu begegnen, vermutlich hält er sich in einem der anderen Zimmer auf. Ich schleiche also zurück in den Flur, und zur Haustür. Diesmal kann ich mein Messer in der Tasche lassen, denn an einigen Haken hängen Schlüssel, und nach einem Blick auf das Türschloss, greife ich nach dem, der meiner Meinung nach passt. Leise schließe ich auf, öffne die Tür, und trete über die Schwelle. Die Haustür versperre ich wieder und lege den Schlüssel unter einen Fußabtreter, das wird meinem Entführer ein Rätsel aufgeben. Dann richte ich mich auf, strecke meine knirschenden Knochen, und blicke mich um.
Ich erkenne das Dorf kaum wieder. Das ist eigenartig, denn ich habe mein ganzes Leben in dieser Gegend verbracht. Eine Allee aus Laternen beleuchtet die Straße die zur Kirche führt. Der Kirchturm steht ebenfalls in einer Lichtsäule, und ragt über die Häuserdächer hinweg, allerdings nur mit knapper Not, denn wo eigentlich Wiesen und Gärten die Lücken zwischen den am Dorfrand locker verteilten Häusern füllen sollten, stehen jetzt drei- und vierstöckige, hässliche Wohnblocks, die beinahe die Höhe des Kirchturms erreichen.
Diese Straße habe ich als schlichten Güterweg in Erinnerung, gesäumt von einigen wenigen Gebäuden. Aber an Stelle der Bäume und Felder sind nun Reihen von Häuschen gerückt, schmucke Vorgärten verbergen sich hinter hohen Zäunen und Mauern vor neugierigen Blicken, und vor den Garagentoren stehen grüne Mülltonnen zur Abholung bereit. Ich drehe mich um und betrachte das Haus aus dem ich eben gekommen bin. Es ist eines der älteren Häuser. Es hat immer einem alten Ehepaar gehört, den Haslingers; sie müssen schon lange tot sein. Jetzt scheint Obermaiers Witwe darin zu wohnen, denn sein Sohn würde sich kaum mit einer derart bescheidenen Bleibe zufrieden geben.
Ich weiß also jetzt wo ich bin, und welchen Weg ich zu gehen habe um nach Hause zu kommen. Aber es ist stockdunkel, zumindest außerhalb des Scheins der Straßenlaternen; meine Beine fühlen sich bereits nach den wenigen Schritten aus meinem Gefängnis bis hierher vor die Haustür müde an, und die Gegend hat sich erheblich verändert. Der Grund dafür erschließt sich mir nicht. Wo bin ich die letzten Jahre bloß gewesen, wie kann mir das Gesicht dieses mir vertrauten Dorfes so fremd sein? Ich muss unbedingt mit meinem Jungen sprechen, sobald ich zu Hause bin. Aber der Weg ist weit, und meine alten Beine sind schwer.
Vielleicht sollte ich einfach an eine Tür klopfen, und darum bitten mir einen Dienst zu erweisen. Die Tageszeit aber spricht dagegen. Niemand würde erfreut sein, eines alten Herumtreibers wegen aus dem Schlaf gerissen zu werden, und wenn schon die Witwe Obermaier in einem fremden Haus schläft, wer weiß da schon, ob nicht ihr Sohn die Tür eines anderen Nachbarhauses öffnen würde. Und außerdem steht mir mein Stolz im Weg, zumindest hat meine Frau das immer behauptet - und ich glaube sie hatte recht - denn ich habe mich Zeit meines Lebens nie dazu herabgelassen, jemanden nach dem Weg zu fragen. Männer finden bekanntlich ihren Weg alleine, selbst dann, wenn sie, so wie ich, weder über eine aktuelle Karte, noch über ein tadellos funktionierendes Gehirn verfügen. Ich werde es deshalb so halten wie Milliarden von Männern vor mir - ich werde mein Ziel langsam einkreisen, sollte ich mich tatsächlich verirren.
Da fällt mir ein Freund ein, der etwas abseits des Dorfes lebt. Ihm gegenüber könnte ich meine Ratlosigkeit zur Not eingestehen. Er ist ein junger Bursche, ein Freund und Teil meiner Familie. Ich versuche mir sein Gesicht vorzustellen, aber das Bild flackert, springt hin und her zwischen den Zügen eines bartlosen Jünglings auf einem Fahrrad, und dem Antlitz eines ungekämmten, bärtigen Burschen auf einem Motorrad; und doch weiß ich, dass es ein und derselbe ist.
Soll ich ihn um Hilfe bitten? Eine nächtliche Spritztour auf seinem Hobel wäre durchaus nicht zu verachten. Aber Mike ist jung, darauf gilt es Rücksicht zu nehmen. Möglicherweise hat er ein Mädchen bei sich, die Jugend ist ja in dieser Hinsicht unberechenbar. Mein Taktgefühl untersagt mir also ihn zu stören, und da der Mond fett und strahlend über mir hängt, und die Nacht warm ist, entschließe ich mich, den Heimweg zu Fuß in Angriff zu nehmen.
Ich gehe ein Stück auf dem glatten Asphalt die Straße entlang, und biege dann nach Norden in einen Feldweg der mir bekannt vorkommt, und der sich bald im Dunkel des Waldes verliert - und der mich nach Hause führen wird, so hoffe ich.
2
Mike
Mike streckte seinen Arm aus, um dem Wecker einen Schlag zu verpassen. Er verfluchte den Tag als die Zeit erfunden wurde, setzte sich mühsam auf und blinzelte durch die trübe Fensterscheibe hinaus in den jungen Tag. Da fiel ihm ein, dass heute Samstag war und er nicht zur Arbeit musste. Den Wecker hatte er nur aus Gewohnheit gestellt.
Er überlegte, ob er sich wieder unter die Decke verkriechen sollte, aber da er schon mal wach war, sein Magen ein deutliches Knurren hören ließ, und die Sonne bereits hinter den Hügeln hervorlugte, beschloss er, den Tag zu nützen. Mike erhob sich vom Bettrand und ging ins Badezimmer um die morgendliche Reparatur seines äußeren Hülle durchzuführen. Das war schnell erledigt, denn die Bürste hatte ohnehin keine Chance, durch seine schulterlange Mähne zu dringen.
Als er sich im Spiegel betrachtete, der ihm ein schmales Gesicht mit verschwollenen Augen zeigte, das umrahmt war von einem dichten, kurzgestutzen Bart, da gab er die Bemühung sich für die Öffentlichkeit zurecht zu machen, gänzlich auf. Ein wenig Fahrtwind würde die Spuren des vergangenen Abends und des darauffolgenden Schlafes am Rande der Bewusstlosigkeit, erfolgreicher vertreiben als Wasser, Kamm und Co.
Mikes Küche war ein recht trostloser Ort. Abgesehen von den Bergen an schmutzigem Geschirr, die für Mike ein gewohntes Bild darstellten, störte ihn vor allem das Fehlen von Kaffee. Gleichzeitig aber war er froh, dadurch auch gleich das erste Ziel des Tages festlegen zu können, ohne sich groß den Kopf darüber zerbrechen zu müssen.
Mike schlüpfte in Jeans und Stiefel, griff sich ein einigermaßen sauberes T-Shirt aus dem Kleiderhaufen neben dem Bett, und streifte seine Lederjacke über. Dann trat er aus der Haustür und ging hinüber zur Scheune.
Wenig später heulte ein Motor auf, und aus dem Scheunentor schoss eine alte Triumph Bonneville, die auf dem staubigen Zufahrtsweg Richtung Dorf davonfuhr.
Das Motorrad war Mikes ganzer Stolz. Er hatte es vor ein paar Jahren vor der Fäulnis gerettet, und es eigenhändig wieder instand gesetzt. Denn mit Motoren konnte er umgehen, das musste man ihm lassen. Und natürlich hatte Mike auch den passenden Job gefunden. Er arbeitete als Fachberater bei einem Händler für Autoersatzteile – oder zumindest als Berater, denn für das Fach davor hätte er seine Lehre erfolgreich beenden müssen, was er nicht getan hatte. Wozu erst etwas lernen, das man schon konnte, hatte er sich nicht ohne Grund gedacht, denn während die anderen Jungs in seinem Alter noch die Schulbank drückten, hatte Mike bereits unzählige Motoren zerlegt und wiederbelebt.
Dass sich aber diese fehlende ordentliche Ausbildung negativ auf seine persönliche finanzielle Situation auswirkte, und er lediglich als Hilfskraft entlohnt wurde, das war eben auch an seinem fahrbaren Untersatz ersichtlich. Mike wäre durchaus nicht abgeneigt gewesen, seinen für einen Mittdreißiger immer noch knackigen Hintern in das Leder eines Mustangs zu schmiegen; und ein Dach über dem Kopf wäre auch ganz angenehm gewesen, wenn man das Klima in Betracht zog, das in diesem Teil der Welt herrschte. Aber seine Ersparnisse hatten eben bloß für einen Helm auf seinem Haupt gereicht – den er ohnehin nur selten trug – und für einen Haufen Metall auf zwei Rädern. Aber Mike war keiner, der dem nachgetrauert hätte was er nicht besaß. Er kam über die Runden. Immerhin hatte er das alte Haus seines Vaters. Und wenn man das nötige Geschick besaß, und die Augen offenhielt, dann tat sich immer wieder mal ein kleiner Nebenjob auf.
So wie jetzt, als er aus einer Kurve heraus den Wald verließ, und dann eine lange Gerade vor sich hatte, die beiderseits von alten Obstbäumen gesäumt war, hinter denen sich reife Wiesen erstreckten. Er hatte seine Kopfhörer im Ohr, und Motörhead rotzten ihm einen Song ins Gehirn; er war eins mit der Maschine und der Landschaft, die er besser kannte als sein eigenes Gesicht. Aber gerade als das Gitarrensolo einsetzte, tauchte etwas auf, das er nicht kannte - ein seltsam buntes Gefährt hatte sich da am Straßenrand festgesetzt.
Ein Zirkus hat einen Teil von sich hier zurückgelassen, auf seiner Flucht in die Zukunft, dachte er. Er fuhr langsamer. Es war ein alter Hanomag, wie er jetzt zu erkennen glaubte. Vielleicht ein Blumenhändler, kam ihm in den Sinn, als er die Malerei auf dem Laster näher betrachtete. Allerlei Pflanzen waren detailliert darauf abgebildet, wie in dem botanischen Bestimmungsbuch der Mutter, das noch irgendwo auf den Bücherregalen im Haus vor sich hin schimmelte.
Mit Blumen hatte es Mike nicht so. Seine pflanzenkundlichen Kenntnisse begannen bei den Brennnesseln, und endeten auch dort. Die allerdings kannte er gut, denn im letzten Sommer hatte er eine Kurve zu schnell genommen, hatte einen Graben übersprungen, und war dann in einem regelrechten Wald aus dem brennenden Kraut gelandet.
Er bremste abrupt, denn vor ihm sprang plötzlich ein Mann auf die Straße und machte ein paar tänzelnde Schritte, bis er Mike auf seinem Motorrad entdeckte. Er hielt inne und sah sein Gegenüber an, als könne er es kaum glauben, hier in dieser Einöde einem Burschen auf einer Maschine zu begegnen. Dabei war doch wohl er es, mitsamt seinem Blumenkasten, der hier ein seltsames Bild abgab.
Der Typ sah aus, als hätte er eine lange Reise hinter sich. Das Haar war fast ebenso lang und mindestens ebenso verwildert wie Mikes Mähne, sein Bart hingegen war länger, und wäre nicht die runde Hornbrille gewesen, man hätte seine Augen in diesem haarumkränzten Gesicht kaum entdeckt. Seine Kleidung war ganz in Naturtönen gehalten, von einem hellen Braun wie Wüstenreisende sie tragen würden, und seine nackten Füße steckten in ausgelatschten Sandalen. Seine ganze Gestalt war hager und großgewachsen, und er rang nervös seine Hände, als er jetzt nähertrat.
»Servus!«, sagte er, um die Sprache der Einheimischen bemüht. Aber Mike merkte bereits nach dieser Begrüßung, dass er es hier nicht mit einem solchen zu tun hatte.
»Ich hab da ein kleines Problem mit meinem Wagen«, fuhr er fort.
Aha, ein Deutscher, dachte Mike.
»Ob du nicht vielleicht eine Möglichkeit wüsstest, wie ich die Karre in die nächste…äh, günstige Werkstatt schaffen könnte?«, wollte er wissen.
Mike erinnerte sich seiner guten Manieren und streckte ihm die Hand entgegen: »Servus. Mike, Mike Wallner.«
»Oh, Verzeihung«, besann sich der andere, und grinste verlegen.
»Adalbert. Adalbert Bader mein Name«, und dabei vollführte er eine Art Verbeugung.
Komischer Kauz, dachte Mike, behielt diese Einschätzung aber für sich, denn hier war sie, die Gelegenheit ein paar zusätzliche Scheine zu verdienen.
»Na Adalbert, das scheint ja dein Glückstag zu sein. Zufällig bin ich genau der Richtige. Egal was deinem Kasten fehlt, ich kann´s richten! Aber erst sollten wir mal raus finden wo das Problem liegt.« Mike stieg vom Bike und umkreiste den Laster. Abgesehen vom Design, das Geschmackssache war, sah er ja noch ganz brauchbar aus.
»Erst müssen wir ihn mal hier wegschaffen. Hier ganz in der Nähe wohnt ein Freund von mir, dort liegt das nötige Werkzeug. Also, wir machen Folgendes,« sagte er, und Adalbert nickte erwartungsvoll, »Du wartest hier, wird nicht lange dauern. Ich fahr dort hin, und komm mit meinem Freund und einem Traktor zurück, dann schleppen wir das Ding zu seinem Haus. Und sollte in der Zwischenzeit jemand auftauchen und dir Hilfe anbieten, dann lass dich nicht drauf ein. Du wirst in der Gegend keinen besseren Mechaniker finden«, pries sich Mike, bestieg seine Triumph und knatterte davon.
Zwanzig Minuten später hielt ein Traktor neben dem hilfsbedürftigen Adalbert Bader.
»Alles klar, es kann losgehen«, rief Mike, während er abstieg. »Das da ist übrigens mein Kumpel Gilgo«, und er zeigte auf den Mann, der den Traktor fuhr. Dieser machte keinerlei Anstalten abzusteigen, oder einen Gruß zu sprechen.
»Mach dir keine Gedanken, Gilgo spricht nicht viel zu dieser Tageszeit. Hab ihn aus dem Bett holen müssen. Er braucht etwas länger um aufzuwachen!«
Adalbert musterte diesen Gilgo. Der Traktor wirkte recht klein unter der riesigen Gestalt. Sein Körper war nicht fett, aber ungeheuer massig. Adalbert, selbst nicht klein, schätzte, dass der Freund seines Retters ihn um eine Kopflänge überragte. Sein Blick war müde, hatte aber dennoch etwas wachsames, während er gleichgültig den gestrandeten Lastwagen musterte. Der Kopf wurde bedeckt von ein paar dünnen Lockensträngen, die einstmals wohl blond gewesen waren, jetzt aber ins Grau schlugen, und fettig und strähnig bis über die auffallend kleinen Ohren hingen. Der Koloss musste die sechzig bereits überschritten haben, vermutete Adalbert.
Er wurde in seiner Betrachtung gestört, als Mike ihm das eine Ende einer massiven Eisenkette in die Hand drückte, und ihn aufforderte, sie an der Abschleppöse seines Lastwagens zu befestigen, und sich dann hinters Steuer zu klemmen.
»Ich fahr bei dir mit, Gilgo bekommt ohnehin den Mund noch nicht auf, und du kannst mir während der Fahrt die Symptome schildern, die deine Karre zeigt«, sagte Mike, und kletterte in den Hanomag, noch bevor Adalbert ihn dazu auffordern konnte.
Der Traktor fuhr schließlich an, und das seltsame Gespann bewegte sich gemächlich entlang der blühenden Wiesen. Tatsächlich besaß der Laster vor diesem Hintergrund den perfekten Tarnanstrich.
»Nun erzähl mal. Woher kommst du, und wohin soll die Reise gehen«, fragte Mike neugierig.
Adalbert zögerte, ehe er sagte: »Naja, ich bin auf dem Heimweg von einer Weltreise. Bin in Thüringen zu Hause, oder war es zumindest mal«, sagte er etwas schwermütig, und seufzte.
»Klingt nicht, als würdest du dich darauf freuen wieder heimzukommen.«
»Ach, das ist eine lange Geschichte...«, begann Adalbert Bader, aber die Fahrt dauerte nur kurz, und für eine lange Geschichte blieb keine Zeit, denn soeben verließen sie die Straße, und bogen in ein Waldstück ein. Die Fahrbahn war übersät mit Schlaglöchern, nicht viel mehr als ein Feldweg.
»Dein Freund lebt ganz schön abgelegen«, meinte Adalbert, denn sie drangen immer tiefer in den Wald ein, und vom Asphaltbelag waren schließlich nur mehr einige vereinzelte Brocken zu sehen.
»Ja. Er mag´s gern einsam, der gute Gilgo«, klärte Mike ihn auf.
Dann lichtete sich der Wald, das Haus tauchte auf, und Adalbert staunte nicht schlecht.
Gilgos Haus war anders als man es von einem Haus mitten im Wald erwartet hätte. Seine Hauptausdehnung lag in der Höhe. Es besaß drei Stockwerke, war aber in seiner Grundfläche nicht größer als ein Einfamilienhaus. Die Stirnseite passte proportional durchaus zur Höhe, die Seitenlänge allerdings betrug gerade mal ein paar Meter, und so sah der Kasten aus, als könnte der erstbeste Windstoß ihn umwehen. Auf Adalbert wirkte es auf jeden Fall unheimlich. Dazu trugen wohl auch die Schrottobjekte bei, die rund ums das Anwesen vor sich hin faulten. Zahllose Autowracks und ausgediente landwirtschaftliche Geräte, schufen einen Garten, in dem hauptsächlich der Rost seine Blüten trieb. Aber irgendwie wirkte alles dennoch sehr harmonisch, fand Adalbert, fast so, als hätte jemand die Autowracks zu Blumenkästen umfunktioniert. Aus den leeren Augenhöhlen der Karosserien wuchsen Kapuzinerkresse und Minze, und in einem offenen Kofferraum gar prächtige Kürbisse.
Gilgo bugsierte das havarierte Gefährt zwischen den Blechhaufen hindurch zur Rückseite des Gebäudes und hielt vor einem Schuppen an, der sich an die hintere Hauswand lehnte. Dann stieg er vom Traktor, und verschwand ohne ein weiteres Wort.
»Da wären wir« sagte Mike.
Als Adalbert im Schatten des turmhohen Gebäudes stand, und die Autoleichen rundherum lauern sah, da fragte er sich, ob es tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen war, sich diesen Burschen in die Hände zu begeben. Denn eine seiner großen Schwächen war seine Vertrauensseligkeit. Und die hatte ihn bereits mehr als nur einmal in Schwierigkeiten gebracht.
»Also«, begann Mike, »bevor wir uns an die Arbeit machen, sollten wir uns ein Frühstück genehmigen, denn dafür habe ich schließlich heute so zeitig das Bett verlassen. Komm mit, ich wette unser Gastgeber sitzt bereits vor einer vollen Schüssel.«
Er ging voraus, und Adalbert Bader folgte ihm. Was blieb ihm auch anderes übrig.
Die Einrichtung des Hauses überraschte Adalbert noch einmal. Bereits im Flur standen allerlei kunstvoll geschnitzte Möbelstücke, und die Wände waren geschmückt mit Gemälden und anderem Zierrat. Mike lotste den Weltreisenden durch eine Tür in einen Salon, der einer anderen Zeit zu entstammen schien. Er war ganz im Biedermeierstil eingerichtet, an den Wänden hingen Ölgemälde, und Regale voller Bücher nahmen den Platz dazwischen ein. Alles war sauber, wenn auch von einer Staubschicht überzogen. Der Besucher staunte nicht schlecht - da war er direkt von einem Schrottplatz in ein Museum gelangt.
Mike verschwand in einer offenen Tür, und Adalbert folgte ihm. Es war die Küche. Und da saß auch schon der Traktorfahrer vor einer dampfenden Tasse.
»Setz dich nur«, sagte Mike, holte Tassen und Teller aus einem Schrank, und stellte sie auf den Tisch. So üppig die Einrichtung auch war, das Frühstück war es nicht. In der Mitte des Tisches lag ein großer Laib Käse, und ein noch größerer Laib Brot.
»Oh Mann, Alter, kannst du nicht mal etwas anderes zu Essen besorgen als den ewigen Käse? Bißchen Speck vielleicht, ein paar Eier, oder etwas Obst?«, maulte Mike, und goss Kaffee in die Tassen.
Gilgo murmelte nur etwas Unverständliches und kaute weiter auf seinem Bissen herum.
Mike beugte sich zu Adalbert, und sagte: »Pass auf wenn er erst satt ist, du wirst ihn nicht wiedererkennen.«
Dann setzte er sich, drehte sich eine Zigarette und begann aus seiner Tasse zu schlürfen, während Adalbert sich zunehmend unbehaglicher fühlte, und lediglich an seinem Kaffee nippte.
Gilgo verschlang inzwischen Brot und Käse, und die großen Laibe wurden kleiner, und auch Mike griff zu, auch wenn ihm der Sinn nach etwas mehr Abwechslung stand. Nur Adalbert verspürte keinen Hunger.
Und dann war es soweit. Gilgo schluckte den letzten Bissen runter, spülte mit einem Schwall Kaffee nach, rieb sich den Bauch, und stöhnte vor Wohlgefühl. Dann begann er zu sprechen.
»Na, Freund der Berge, jetzt erzähl mal. Was hat dich hierher verschlagen?«, und aus Augen, aus denen plötzlich jegliche Müdigkeit gewichen war, schaute er Adalbert neugierig an.
Der fasste sich schnell, trotz des unerwarteten Erwachens des Goliath, denn in dessen Blick lag nichts Feindseliges.
»Er kommt von einer Weltreise, stell dir vor!“«, sagte Mike.
»Mit dem Ding da draußen?«, staunte Gilgo. »Kaum zu glauben!«
Adalbert räusperte sich. »Nun, wie gesagt, die Geschichte ist eine lange...«
»Um so besser, ich liebe lange Geschichten, und wir haben den ganzen Tag Zeit, nicht wahr Mike!«
3
Das Zollhaus
Ich habe mich noch keine hundert Meter vom Haus der Witwe Obermaier entfernt, als ich eine weitere verwirrende Entdeckung mache.
Der Feldweg verläuft das erste Stück an der Rückseite der Häuserzeile parallel zur Straße. Über streng geometrisch gestutzte Ligusterhecken hinweg, sehe ich im gelben Licht der Straßenlaterne ein ungewöhnliches Fahrzeug herannahen. Es handelt sich unverkennbar um einen Militärlaster, der so ganz und gar nicht hierher passt. Der Krieg ist längst vorbei, soviel weiß ich, auch wenn ich mit der Zeit im Clinch liege. Die Häuser, die Gärten, die Straßen, zeugen von Wohlstand, nicht von Notzeiten. Nun kann ein Mensch in meinem Alter schon mal ein wenig Unordnung in seinen Erinnerungen vorfinden, daran gewöhnt man sich allmählich, wenn auch unwillig. Aber das hier ist keine Erinnerung - ich setze einen Fuß vor den anderen, und höre deutlich das Knirschen des Sandes unter meinen Sohlen; ich spüre die kühle Nachtluft, die einen Hauch von Harz aus den Wäldern, und den Duft frisch geschnittenen Grases mit sich bringt. Das Brummen des Lastwagens vermählt sich mit dem Zirpen der Grillen, das Licht seiner Scheinwerfer verbündet sich mit dem der Straßenbeleuchtung. Der Lack des Ungetüms ist stumpf, kein verräterischer Glanz ist darauf zu sehen. Die Farbe des Fahrzeugs erkenne ich nicht, denn die Nacht und das elektrische Licht helfen sie zu verschleiern, aber ich bin fast sicher, dass es sich um einen Tarnanstrich handelt.
Es scheint mir, als wäre dieses kriegerische Fahrzeug mit der Nacht aus einer anderen Zeit gekommen, und nun kurvt es durch die schläfrige Ortschaft.
Der Wagen zieht vorbei und verschwindet hinter dem dunklen Umriss des nächsten Hauses. Ich stehe eine Weile wie angewurzelt auf einem Fleck und starre in den Lichtkegel der Laterne. Nach einer Weile werde ich unsicher. Habe ich tatsächlich soeben einen Militärlaster das Bild durchqueren sehen, oder ist es nur Einbildung gewesen? Und dann kommen mir andere Bilder in den Sinn. Ich sehe ein ganz ähnliches Fahrzeug hinter meinem Haus stehen, und ich sehe einen langen Kerl meine Hand schütteln. Dann steht der Laster in einem Steinbruch, kaum auszumachen zwischen hohen Fichten und dichtem Gestrüpp. Das alles verwirrt mich. Am besten wird es sein, ich denke nicht mehr länger darüber nach. Vielleicht ist es ohnehin erst mal an der Zeit mich vorzustellen.
Mein Name ist Georg Gollinger, die meisten sagen schlicht Georg zu mir, mancher nennt mich auch Schorsch, oder einfach nur Gollinger. Hier in unserer Gegend wird man ja üblicherweise geduzt. Selten stellt einer ein Herr oder ein Frau vor einen Namen, mit einem Sie werden überhaupt nur höher gestellte Persönlichkeiten beehrt, der Pfarrer vielleicht, oder der Bürgermeister, aber das auch nur, wenn sie einem jungen Menschen gegenüberstehen, vorausgesetzt, der bringt den nötigen Respekt auf. Das ist ja in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, sagt man. Und wissen sie was? Ich find´s gut so. Die Jugend soll sich ruhig auf die Beine stellen, und die Alten sollen sich ihren Respekt verdienen, jeden Tag aufs Neue.
Zu den Alten gehöre ich zweifellos auch. Mein Leben auch nur zu skizzieren, gelingt mir aufgrund der vielen Jahre die es umfasst, nicht. Auch könnte ich kaum in chronologisch geordneter Reihenfolge darüber berichten, da es mir, wie sie wohl schon bemerkt haben, gelegentlich schwer fällt, eine Erinnerung an ihren rechten Platz zu rücken. Aber eines weiß ich – alles begann mit meiner Geburt. Genau genommen begann es natürlich bereits vorher - mit der Geburt meiner Eltern, dann wiederum mit der Geburt meiner Großeltern und so weiter und so fort – aber das würde zu weit zurück, bis an den Ursprung der Menschheit führen. Ich bezweifle, dass mir genug Tage bleiben um derart weit auszuholen, und ich bezweifle auch, dass jemand Interesse an meinem Stammbaum hegt, also beginne ich einige Jahre vor meiner Geburt, dafür sollte die Zeit reichen, die ich für den Weg zum Zollhaus brauche. Dieses Zollhaus war übrigens Zeit meines Lebens mein Zuhause. Niemals habe ich mir eine andere Heimstätte gewünscht.
Da fange ich doch gleich mit dem Haus an, denn es hat durchaus eine Geschichte vorzuweisen, wenn auch eine kurze, wenn man die uralten Gehöfte und Ansiedlungen in meiner Heimat zum Vergleich heranzieht.
Es ist mit meinem Vater in den Besitz meiner Sippe gelangt. Golo Gollinger war ein überaus vielseitiger Mensch. Er schaffte es, unter nicht gerade günstigen Umständen, sich gesellschaftlich und finanziell zu etablieren. Er hatte sich auf den Handel spezialisiert. Golo verkaufte Alles an Jeden. Er hätte selbst dem Teufel eine Bibel verkaufen können, sagten die Leute. Er war geboren für dieses ehrliche Gewerbe, obgleich man munkelte, dass es in seinen Händen nicht immer ein ehrliches war. Allerdings konnte ihm nie etwas angehängt werden, und es entstand auch zu keiner Zeit ein erwähnenswerter Schaden. Und er hielt stets Maß. Wohl hatte er sich einen Polster erhandelt, aber es war kein seidener – aus schlichtem Leinen war er gewoben, könnte man sagen. Es hat aber gereicht um einige Jahre vor meiner Geburt das Zollhaus an der Grenze zu kaufen. Es reichte auch noch für die Ausstattung, und der Rest diente als Startkapital für ein zufriedenes Leben.
Mein Vater konnte nie einen vernünftigen Grund für diesen Kauf anführen. Seine Freunde hatten ihm davon abgeraten – die Lage, die Einsamkeit, die Kälte – aber Golo hat auf seinen Bauch gehört. Auch sah er keine Abgeschiedenheit, der Wald rings um das Zollhaus schien ihm ein Garten zu sein – und zugleich ein Schutzwall. Die Nachbarschaft der Bäume zog er jener der Menschen vor. Geselligkeit fand er auch anderswo, er konnte sich ihr ohnehin nur schwer entziehen, sie war sein wichtigstes Werkzeug als Händler. Das Zollhaus wurde zu seinem Ruheort, zu einer Zuflucht.
Sicherlich hatten seine zahlreichen Verbindungen den Kauf erst möglich gemacht. Golo erfuhr nämlich von einem befreundeten Zollbeamten, dass man den Standort der Zollkaserne recht unglücklich gewählt hatte, da kaum jemand die Straße benutzte, um Waren zu transportieren, auf die man Zoll hätte erheben können. So saßen die Beamten also, zu jahrelanger Untätigkeit verdammt, in dem Gebäude, und verursachten mehr Kosten als Nutzen. Und die Schwärzer, die in dieser Gegend ihr Schmuggelhandwerk betrieben, mieden seit dem Bau des Zollhauses den Weg ohnehin. Also machte mein Vater dem zuständigen Beamten ein Angebot, und man entschied, es anzunehmen. Unter einer Bedingung – der Besitzwechsel musste geheim gehalten werden, niemand sollte nach Möglichkeit erfahren, dass nicht mehr länger Grenzwächter in dem Gebäude stationiert waren.
Zu diesem Zweck ersann Golo einen Plan. Er bat die Grenzer, ein paar ihrer Uniformen zurück zu lassen, und meine Mutter bekam den Auftrag, am Waschtag nicht nur die Familienwäsche, sondern auch die Uniformen, gut sichtbar, auf die Wäscheleine zu hängen. Also flatterten dort neben Mutters Unterröcken und meinen Windeln stets auch ein paar graue Röcke der Grenzwache im scharfen Wind des Hochwaldes. Ob dieses kleine Täuschungsmanöver tatsächlich jemanden abgehalten hat Waren unverzollt über die Grenze zu schaffen, ist nicht überliefert. Die Zollbehörde hat sich von da an auf jeden Fall nicht mehr um den Grenzposten geschert, der so überflüssig war. Natürlich spricht es sich schnell herum, wenn einer in dieser Gegend ein Haus kaufte, noch dazu wenn das mein umtriebiger Vater tat. Aber der Beamte hatte seine Arbeit erledigt, Geld war in die Reichskasse geflossen, und er konnte sich wieder zurücklehnen und seine Pfeife schmauchen.
Golo war das ganz recht, denn er hatte von Anfang an etwas anderes im Sinn gehabt als den grenzüberschreitenden Transport von Waren aller Art zu erschweren. Er wollte das Gegenteil – er wollte die ganze Sache erleichtern. Das Zollhaus in dem seine Familie ab nun residierte, wurde zu einem geschäftsstrategisch wichtigen Umschlagplatz. Mit einigen vertrauenswürdigen Partnern von jenseits und diesseits der Grenze, unterhielt er von da an von den Behörden ungestörte Handelsbeziehungen. Die Händler aus dem Süden lieferten die Ware einfach in sein Haus, und die Abnehmer aus dem Norden holten sie dort ab, und umgekehrt. Wieder achtete mein Vater darauf, das ganze krumme Ding nicht zu groß aufzuziehen, um nicht den Argwohn irgendwelcher Neider zu erregen, und so profitierten alle Beteiligten für viele Jahre von seiner glücklichen Investition.
Zu diesem Zollhaus bin ich also unterwegs. Das Sternenmeer bietet mir dabei zumindest ein wenig Orientierung. Ich habe einen Weg von mehreren Stunden vor mir. Nun, heute wird es etwas länger dauern, befürchte ich. Meine Beine sind nämlich der Jugend längst davongeeilt. Aber ich habe ja Zeit und werde den Heimweg genießen.
Heimweg? Was habe ich denn eigentlich zu schaffen gehabt im Dorf? Ich weiß es noch immer nicht. Es verhält sich nämlich so, dass es mir leichter fällt mich an meine frühen Tage zu erinnern, die jüngsten Geschehnisse hingegen verlieren sich oft sehr rasch. Eigentlich macht mir das aber nicht allzu viel aus. Im Gegenteil, ich genieße es sogar. Ich wandere sozusagen zwischen den Zeiten, erinnere mich einmal an dieses, dann wieder an jenes, wie es mir gerade gefällt. Manchmal sind die wiederbelebten Erinnerungen von solcher Intensität, dass ich mich beinahe wachrütteln muss, um wieder heraus zu finden.
Am schlimmsten trifft meine - nennen wir es Verkalkung - aber nicht mich, sondern die Menschen um mich herum. Noch schwerer als in meinem Gehirn für Ordnung zu sorgen, fällt es mir nämlich oft meine Gedanken in Worte zu kleiden. Genau genommen gelingt mir das nur mehr selten. Es ist als würde eine fremde Macht die Kontrolle über meine Zunge erlangen. Ich habe dann keinen Einfluss mehr auf die Worte die aus meinem Mund kommen, und oftmals sage ich dann Dinge, die in keinerlei Zusammenhang mit der Gegenwart stehen. Das hat seinen Ursprung irgendwo im Gehirn, hat mir mal einer erklärt. Da oben sind nämlich etliche Schaltzentralen eingerichtet, fürs Sprechen und Rechnen, und für all die anderen nützlichen und unnützen Dinge die man so macht. Da kann´s dann schon mal vorkommen, dass sich wo ein Kurzschluss reinschleicht, und dann passiert genau das, was mir in letzter Zeit so oft passiert. Aber genau verstehe ich nicht was da abläuft, dürfte irgendein elektrisches Ding sein, und mit der Elektrik hab ich´s nicht so, obwohl ich ein begnadeter Handwerker bin, aber den Strom sehe ich nicht, und deshalb versteh ich ihn auch nicht. Man darf sich durchaus auch die ein oder andere Schwäche eingestehen - es sei denn das führt dazu, dass man nach dem Weg fragen muss.
Besonders mein Sohn hat unter meinem schwächelnden Gedächtnis zu leiden, denke ich mir, obwohl Gilbert sich kaum etwas anmerken lässt. Er ist eben ein lebensfroher Kerl, und ich bin froh, dass er darüber seinen Humor nicht verloren hat. Aber ich bemühe mich auch, meine Schwäche zu verbergen, wenn möglich.
Jetzt kann ich den Pfad vor mir kaum mehr erkennen. Er ist mehr eine Ahnung als ein Bild. Ich gehe deshalb langsam, schiebe da einen Stein mit der Schuhspitze beiseite, trete dort auf einen trockenen Ast um nicht auszurutschen. Die schlammigen Pfützen heben sich in ihrer absoluten Schwärze gut von der dunkelgrauen Fläche des ausgefahrenen Weges ab, und so komme ich trockenen Fußes voran. Und mit jedem Schritt fällt mir das Gehen leichter, dieser Marsch gibt mir Kraft. Ah, diese Luft – ich bleibe stehen und fülle meine Lungen bis ich husten muss; und diese Dunkelheit - wie Balsam für´s Hirn – und ich hebe meinen Blick und sehe die Sterne durch das Blätterdach blinzeln. Es fühlt sich an, als wären meine Augen aus dem Kopf getreten, als wäre ich ein einziges sehendes Auge, nichts als ein Auge, und alles verschmilzt ineinander, nirgendwo gleißendes Licht, das einem Kopfschmerzen bereitet, keine grellen Farben weit und breit. Ich sauge die schwarzblaue Dunkelheit und das weiße Sternenlicht in mich auf, und gehe dann weiter. Ich habe zuvor vom Zollhaus erzählt, und will dort fortsetzen.
Das außergewöhnliche Gebäude im finsteren Wald schien damals nicht nur von den Zollbehörden vergessen worden zu sein, sondern blieb auch während der kommenden Jahre vom Weltgeschehen beinahe gänzlich unberührt, und dadurch im Besitz meiner Familie. Während zwei weltumspannende Kriege und etliche andere Veränderungen sich über das Land wälzten und zahlreiche Häuser und Grundstücke ihren Besitzer wechselten oder zerstört wurden, stand das Zollhaus weiterhin unbehelligt an seinem schattigen Platz. Mein Vater Golo und meine Mutter Hildegard lebten bis zu ihrem Tod darin, und ich selbst verbrachte dort Kindheit und Jugend, und mein restliches Leben.
Wie sich herausstellte, verfügte ich nicht über den Geschäftssinn meines Vaters. Viel mehr zog es mich hin zum Handwerk. Vermutlich eine Hinterlassenschaft meiner Urahnen, die als Holzknechte und einfache Handwerker ein entbehrungsreiches Leben führten. Ich konnte mir früh einen gewissen Ruf aneignen. Manchmal ging ich den Bauern zur Hand, ein andermal sprang ich den Holzknechten bei, reparierte dort einen kaputten Pflug, beschlug anderswo die Pferde, und verdiente mir auf diese Art den ein oder anderen Groschen.
Schulbildung habe ich kaum eine genossen, lediglich ein paar Jahre bei einem Schulmeister in einem kleinen Dorf nördlich der Grenze. Aber das machte mir nie viel aus. Man lernt ja ohnehin mehr aus Taten, vor allem aus den eigenen, denn aus Büchern, wenn sie mich fragen.
Ich war ein recht unbeschwerter Bursche, und mutig obendrein, behaupte ich. Kein Wunder, bin ich doch groß und kräftig gewachsen, und hatte kaum jemanden zu fürchten. Deshalb fiel es mir auch leicht mir mein friedliches Wesen zu bewahren, und mich unter Menschen ebenso wohl zu fühlen, wie in Gesellschaft der Bäume und Tiere in den Wäldern, die mein Heim umgeben.
Doch Frieden ist ein flüchtiger Zustand, und so musste es schließlich kommen, dass die Welt ihre Tentakel ausstreckte, und auch meine Heimat in den Schwitzkasten nahm.
Es kam der zweite große Krieg in mein Leben. Vom ersten hatte ich ja kaum etwas mitbekommen, außer, dass der Vater mal eine Weile weg war. Ich war zu klein um die Gefahr zu erkennen und hatte ganz andere Sorgen. Der zweite Krieg aber verschonte zwar diesmal den Vater, auf mich selbst aber vergaß er nicht.
Der alte Schulmeister der uns Kinder unterrichtete, liebte die Geschichten von den biblischen Schlachten, von den Eroberungen der Antike und des Mittelalters, und von längst vergangenen Reichen. Er trug sie mit Leidenschaft vor, und malte mit flammenden Worten epische Bilder für uns Kinder. Heere, in Wolken aus Staub und Heldenmut gehüllt, und von prächtigen Bannern umweht, prallten aufeinander, majestätisch und gewaltig. Wenn aber mein Vater vom Krieg erzählte, und mir damit einen näheren Blick ins Schlachtgeschehen gewährte, dann war es vorbei mit dem edlen Rittertum. Ich erahnte das wahre Gesicht des Krieges – zerschlagene Körper und Ströme von Blut. Und immer wieder schlug der Mensch neue Schlachten, wie ein unbelehrbares Tier, einem Instinkt folgend, der verhinderte, dass sich seine scheinbar so überlegene Art weiterentwickelte. Vielleicht ist gerade der Krieg - den der Mensch längst zu einer Kunstform erhoben hat, die er mit besonderer Hingabe ausübt - der Beweis dafür, dass er eben doch nichts anderes als ein wildes Tier ist.
Im Frühjahr 1939 kam schließlich ein Gendarm als Bote dieses Krieges auf einem Motorrad angebraust, hielt vor dem Zollhaus und klopfte an die Tür. Er überreichte mir einen Brief, und trug dabei ein so ernstes Amtsgesicht zur Schau, dass ich gleich wusste – Obacht!
Es war das erste Poststück meines Lebens. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich aber gerne auf diese neue Erfahrung verzichten können, denn in dem Brief stand, ich hätte mich in zwei Wochen in einer Kaserne zu melden, an einem Ort, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich schob das Schreiben in meine Rocktasche. Während der nächsten Tage ging ich mehrmals in den Wald, setzte mich auf einen Stein, holte den Brief hervor, und las ihn immer und immer wieder, überprüfte die Adresse und meinen Namen, so als hoffte ich, dass diese sich in der Zwischenzeit geändert hätten, bis ich schließlich einsehen musste, dass alles seine Richtigkeit hatte. Also beschloss ich, einfach nicht hin zu gehen, denn kämpfen, und vielleicht sogar töten zu müssen, oder gar getötet zu werden, das war so ganz und gar nicht nach meinem Geschmack.
Natürlich war es aber dann doch nicht so einfach wie ich gehofft hatte, und drei Wochen später bekam ich erneut Besuch. Diesmal kam gleich ein Automobil den holprigen Waldweg hochgefahren und hielt vor dem Haus. Vier Männer in Uniformen stiegen aus dem Wagen, und wenn ihre kriegerische Bekleidung sie bereits unfreundlich wirken ließ - die ungemütliche Reise über Stock und Stein hatte ihre Laune noch zusätzlich verschlechtert. Und alles nur um einen Fahnenflüchtigen abzuholen. Das taten sie dann auch, ohne sich groß um die Einwände meiner Mutter zu scheren. Obwohl es mir widerstrebt hätte, überlegte ich, ob es nicht das Beste wäre, den ruppigen Kerlen eins auf die Nase zu hauen und mich in die Wälder zu verdrücken. Angesicht der Pistolen und Gewehre die sie bei sich trugen, hielt ich mich dann aber doch lieber zurück. Ich wäre wohl kaum als friedliebender Mensch durchgegangen, wenn ich mich der Verhaftung mit Gewalt entzogen hätte.
Man kann es ruhig sagen: Ich, Georg Gollinger, war ordentlich blauäugig, als ich dachte die Wehrmacht würde auf mich vergessen, angesichts der Massen die sie in den Krieg schickte. Der Mutter und dem Vater hatte ich nichts von meiner Einberufung erzählt, und die beiden fielen aus allen Wolken, auch wenn sie im Grunde wussten, dass das früher oder später passieren würde.
Als ich nun von den vier Soldaten mitgenommen, und in Haft gesteckt wurde, um auf meine Verurteilung zu warten, da bestieg mein Vater sein Fahrrad und suchte einen alten Bekannten und Geschäftspartner auf, um die drohende Exekution seines Sprösslings zu verhindern.
Der Mann in den Golo seine Hoffnungen setzte hieß Hugo von Schwarzenbach, seines Zeichens Kleinadeliger, Großgrundbesitzer und neuerdings SS-Hauptsturmführer. Er hatte ein Anwesen unweit des Zollhauses, und mit Golo einige lukrative Geschäfte abgewickelt. Schwarzenbach schätzte meinen Vater Golo als Vermittler zwischen den sturen Bauern, die im Besitz ausgedehnter Wälder waren, und seinen eigenen Interessen. Und er schätzte mich, der ich ihm oftmals als findiger und eifriger Handwerker auf seinen Besitzungen, die in der Gegend verstreut lagen, zur Hand gegangen war.
Hugo von Schwarzenbach war ein vorausschauender Mensch. Erst kürzlich hatte man ihm die Leitung eines Gefangenenlagers anvertraut. Er wusste, sollte die Seite auf der er stand, den Krieg verlieren, dann würde es nötig sein, sich nach einem anderen Wind zu drehen. Deshalb hielt er es für vorteilhaft, sich die Gunst seiner Nachbarn zu erhalten. Zu diesem Zwecke zeigte er sich diesen gegenüber gerne hilfsbereit, sofern es seiner militärischen Karriere nicht schadete; und dann war da noch seine junge Frau Gisela, die es verstand ihn soweit zu lenken, dass er sich wenigstens auch ein paar gute Taten auf die schuldbeladenen Schultern packen konnte, ehe er vor seinen Schöpfer trat. Gisela von Schwarzenbach sollte einige Jahre später den Namen Gollinger annehmen, und in dem verborgenen Zollhaus einen Jungen namens Gilbert zur Welt bringen, der in der Gegend fortan als Gilgo bekannt sein würde.
In diesem Moment fällt mir ein, dass mein Junge jetzt vermutlich zu Hause sitzt und sich Sorgen um mich macht. Vielleicht ist er auch bereits auf der Suche nach mir. Es ist also am vernünftigsten, wenn ich auf schnellstem Weg zum Zollhaus gehe.
Ich folge weiter einem Bach, die Bäume rücken immer näher zusammen und der Weg wird schmäler. Den hat lange niemand mehr befahren. Ich schlängele mich zwischen den jungen Bäumchen die auf dem Weg ihr Glück versuchen hindurch. Dann teilt sich der Weg in drei Pfade. An diese Gabelung kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, die muss neu sein. Aber auch die anderen Wege sind verwachsen und gehören bereits wieder mehr dem Wald als dem Menschen. Ich versuche mir das Bild der Landschaft die vor mir liegt vor Augen zu führen. Aber da sind Flecken auf der Karte, weiße Flecken, unentdecktes Land, vergessenes Land. Es will mir nicht gelingen mich für einen der drei Wege zu entscheiden. Warum nicht die Mitte? Dann werde ich zumindest weder zu weit nördlich, noch zu weit östlich gehen. Der mittlere Weg liegt in der Dunkelheit vor mir, aber plötzlich taucht ein winziges Licht auf. Ein grün leuchtendes Glühwürmchen tanzt da über dem Pfad, und bald darauf folgt ein zweites und ein drittes.
»Na also, eindeutiger geht ‚s nicht!«, lache ich erleichtert auf und folge den Irrlichtern.
Je tiefer ich in den Wald hineingerate, und je dunkler es wird, desto klarer kehren die Erinnerungen zurück. Gilgo steckt natürlich ebenso in der Sache mit Obermaier mit drin. Ganz sicher wird er auf der Suche nach mir sein.
Ich Narr! Der Lastwagen den ich vorhin gesehen habe. Er gehört doch diesem seltsamen Vogel der erst kürzlich bei uns aufgetaucht ist. Er ist was noch mal? Auf alle Fälle kein Fernfahrer, dazu fehlen ihm die rauen Manieren. Er ist aber ein Reisender, dessen bin ich mir sicher. Wäre da nicht der Bart gewesen, ich würde sagen es war Maza Canku, der Indianer. Aber für einen Indianer war der Bursche dann auch wieder einen Hauch zu blass. Egal, auf alle Fälle ist Gilgo jetzt vermutlich mit ihm in diesem alten Laster unterwegs um mich zu finden.
4
Der Weltreisende
Adalbert Baders Vater war Apotheker, wie sein Großvater und dessen Vater vor ihm. Die Apotheke im thüringischen Gera war seit Generationen in Besitz der Familie, bis schließlich der junge Adalbert sie übernahm.
Anfangs lief alles gut, und als Adalbert eine Frau gefunden hatte, da sah es so aus, als würde er, wenn erst mal ein Stammhalter gezeugt wäre, die Familientradition und das Geschäft weiterführen. Der Vater stand ihm mit Rat und Tat zur Seite, bis er, bereits zittrig und tattrig geworden, sich eines Tages mit dem Bunsenbrenner in Brand steckte und an den Verbrennungen verschied. Nun war Adalbert mit seiner Mutter und seiner Angetrauten auf sich allein gestellt.
Das war an und für sich kein großes Problem, bis sich auch die Mutter für immer verabschiedete. Nun begannen schwere Zeiten für Adalbert, denn hatte sich die Gemahlin auch unter das Joch der gestrengen Schwiegermutter gebeugt – bei Adalbert tat sie es nicht. Nach den Jahren der Enthaltsamkeit, die sie unter der Herrschaft der alten Dame erdulden musste, war sie jetzt befreit vom Baderschen Fluch der Sparsamkeit. Sie begann, das Leben in Saus und Braus zu genießen. Adalbert verzweifelte schier angesichts der Ausgaben die da auf ihn zukamen, aber bedauerlicherweise fehlten ihm jene Eigenschaften, die seine Mutter dazu befähigt hatten, über das junge Eheweib zu gebieten.
Im gleichen Maße in dem der Sparstrumpf des armen Apothekers schrumpfte, wuchsen zu allem Unglück auch noch die Hörner, die seine Liebste ihm bei jeder Gelegenheit aufsetzte. Es war also nur eine Frage der Zeit bis die Ehe als gescheitert gelten konnte.
Da stand er nun, der gute Mann, hatte sein Eheglück verloren, und seine Ersparnisse auch gleich mit, und alles was ihm geblieben war, war die Apotheke. Die allerdings lief längst nicht mehr so gut wie zu Vaters Zeiten.
Diese Folge von Unannehmlichkeiten ging natürlich nicht spurlos an Adalbert vorüber. Er spürte, dass es an der Zeit war seinem traurigen Leben eine neue Wendung zu geben.
Er hatte bis dahin nicht viel von der Welt gesehen. Sein Studium hatte er in Jena absolviert, und für seinen Drang zu reisen, hatten seine Eltern weder Verständnis, noch wollten sie sich für derlei lockere Vergnügungen, von ihrem hart erarbeiteten Geld trennen. Also fasste Adalbert den Entschluss eine Weltreise zu unternehmen. Zu diesem Zwecke verkaufte er das Haus in dem auch die Apotheke untergebracht war. Nun war aber der Erlös, nachdem die Schulden abgezogen waren, bei weitem nicht ausreichend, um ihm eine bequeme Erdumkreisung per Flugzeug oder Luxusdampfer zu ermöglichen.
Da Adalbert ein großer Naturliebhaber und geduldiger Beobachter war, kam ihm eines Tages, als er im Park saß und die Tauben fütterte, die rettende Idee. Da kroch eine dicke Schnecke vor ihm im Gras. Warum nicht gleich mitsamt einer passenden Unterkunft reisen? Ein Zelt wäre natürlich die billigste Lösung. Allerdings erschien es ihm nicht sonderlich verlockend, die weite Reise um die Erde zu Fuß und mit Rucksack anzutreten. Ein Wohnmobil musste her. Aber ein Wohnmobil schien ihm wiederum wenig geeignet, um die Wüsten und Sümpfe die ihm auf der Reise sicherlich unter die Räder kommen würden, erfolgreich zu durchqueren. Also etwas Solideres. Er durchblätterte die Zeitungen, und wenig später nannte er einen 56er Hanomag sein neues Zuhause.
Adalbert war handwerklich nicht ungeschickt, und so hatte er den geräumigen Kastenaufbau bald mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die eine Weltreise zu einem entspannten Ausflug machen würden, so hoffte er.
Der Hanomag war ein ausgedientes Militärfahrzeug, und Adalbert hielt es für klug, den Anstrich ein wenig zu verändern. Schließlich konnte man nie wissen in welchen Teilen der Welt gerade ein Krieg tobte, da schien es ihm wenig ratsam, mit einem derartigen Gefährt dort aufzutauchen. Außerdem wollte Adalbert eine friedliche Botschaft in die Welt hinaustragen, und da er der Pflanzenwelt sehr zugetan war, hatte er bald ein neues Design für den Laster vor Augen.
Einer seiner Freunde, von denen es nicht allzu viele gab, war ein ehemaliger Studienkollege, der sich von der Medizin verabschiedet und den bildenden Künsten zugewandt hatte. Leider war er als Künstler nur wenig erfolgreich, und so schlitterte er aus Gram darüber in eine Depression, was schließlich dazu führte, dass sich ihre Wege abermals kreuzten.
Er tauchte eines Tages in der Apotheke auf. Adalbert erkannte ihn kaum wieder, so abgezehrt und vorzeitig gealtert wie er aussah. Er wollte etwas Stimmungsaufhellendes, und ein wenig von den dämpfenden Sachen. Der Apotheker hatte ihn um der alten Zeiten Willen auf einen Kaffee ins Hinterzimmer eingeladen, und dort hatte ihm sein Freund das Herz ausgeschüttet. Von nun an war der Künstler sein Privatpatient, und er versorgte ihn unter der Hand mit den nötigen Präparaten. Anfangs tat er dies ganz im Sinne der modernen Pharmazie, aber um den Schaden an Geist und Seele des armen Malers nicht noch zu vergrößern, riet er ihm zu alternativen Methoden aus der Botanik. So gelang es ihm tatsächlich, den Freund einigermaßen aus seinem Teufelskreislauf zu befreien, und nebenbei wuchs in Adalbert die Begeisterung für die pflanzliche Heilkunde.
Dieser Maler erklärte sich also freudig bereit, das Reisemobil seines Freundes zu verschönern, und schmückte es mit einer wahren Blumenpracht. So konnte man sich in die Welt hinaustrauen, dachte Adalbert. Beim Anblick der grazilen Geschöpfe die da auf seinem Laster blühten, würde wohl niemand eine Bedrohung befürchten. Ein wenig schwermütig verließ er seine Heimatstadt, aber mit jeder Wegstunde die er sich davon entfernte, wurde ihm leichter ums Herz. Er durchquerte Österreich, unterzog den Laster auf steilen Alpenstraßen einem ersten Härtetest, folgte schließlich dem Lauf der Donau nach Ungarn, und hielt sich von dort östlich nach Rumänien, wo seine Reise ein unerwartet schnelles Ende finden sollte.
Die Landschaft dort schien ihm vertraut, wenn sie mit ihrem ausgedehnten Wäldern auch ungleich wilder war als die seiner Heimat. Auch die meisten Pflanzen erkannte er. Etwas völlig anderes war es da hingegen mit den Menschen. Nicht nur, dass er kein Wort ihrer Sprache verstand, auch ihre Lebensweise befremdete ihn. Er fühlte sich hundert Jahre in der Zeit zurückversetzt. Mit seinem blumengeschmückten Kriegsgerät tuckerte er durch ärmliche Dörfer und wurde allerorts neugierig bestaunt.
Adalbert hatte beschlossen, sich als Botaniker auf Forschungsreise auszugeben. Einen solchen konnte er durchaus glaubhaft verkörpern, und besonders an den Grenzen kam ihm diese Tarnung zugute. Was nämlich niemand wusste, und auch niemand wissen durfte, war, dass er, als er die Apotheke mitsamt all den Gerätschaften verkauft hatte, den Restbestand an Medikamenten behalten hatte. Diese versteckte er in einem eigens dafür montierten Behälter, der so gut wie unauffindbar zwischen dem rostigen Gewirr aus Wellen, Stangen und Blech, unter dem Fahrzeug verborgen war. Schließlich konnte man nie wissen wofür das Zeug einmal gut sein würde.
Er gab sich der Betrachtung der rumänischen Landschaft hin, als er, mit einem Blechkasten voller Pillen unter dem Hintern, hoch über der zernarbten Straße sitzend, die Wälder und Dörfer an sich vorbeiziehen ließ.
Er war den vierten Tag in Rumänien und hatte gerade Siebenbürgen hinter sich gelassen, in dem ihm hin und wieder sogar ein deutsches Wort zugerufen wurde. Zum Beispiel in Form einer Warnung, die ein Kaufmann ihm mit auf den Weg gab, und die besagte, dass er sich vor dem Zigeunervolk in acht nehmen sollte. Adalbert nahm sich vor den Ratschlag zu beherzigen, hatte ihn aber längst wieder vergessen als er sich einem seltsamen Dorf näherte. Da standen ein paar Gebäude, mehr Hütten als Häuser, über eine Ebene aus Wiesen und vereinzelten kleinen Wäldchen verteilt, und zwischen den Häusern hatten sich die verschiedensten Fahrzeuge niedergelassen. Von Pferden gezogene Lastwagen waren hier ebenso zu finden wie von klapprigen Autos gezogenen Pferdefuhrwerke. Und alles war bunt, so wie Adalberts Gefährt, und gleich fühlte er sich auf seltsame Weise hier heimisch. Er hielt auf einem staubigen Platz inmitten dieses Lagers und stieg aus dem Wagen. Es dauerte nicht lange, und er war umringt von kleinen Wesen, die ihn aus großen dunklen Augen neugierig anstarrten, die schmutzigen Mündchen geöffnet vor Staunen über den eigenartigen Reisenden. Adalbert wollte heulen vor Glück. Da standen sie, die Menschenkinder, wie der Ursprung seiner Spezies, barfuß, nur mit ein paar Lumpen bedeckt, und die kleinen Köpfchen von wilden schwarzen Locken gekrönt. Und dann kamen die Erwachsenen heran, und für Adalbert begann ein wahrer Freudenrausch. Ihm zu Ehren wurde ein Fest gegeben, so glaubte er, denn bald brutzelte ein Schafe am Spieß, und in großen Töpfen brodelten duftende Eintöpfe über den Feuern. Man reichte ihm Wein, und nach dem Wein kam der Schnaps, und überall war Musik. Adalbert war kurz davor, nackt ums Feuer zu tanzen, so überflutet wurde er vom Glück. Er unterließ es aber, denn noch behielt seine anerzogene Zurückhaltung bezüglich öffentlicher Entblößung die Oberhand. Statt dessen reichte er einer dunklen Schönheit, atemberaubend wie ein Zigeunermädchen aus dem Märchenbuch, die Hand zum Tanz, und wirbelte in ihren Armen im Schein der Feuer herum, spürte ihren erhitzten Körper, der sich an seinen kühlen germanischen Leib presste, und fiel in einen Traum aus dem er erst wieder am nächsten Morgen erwachte.
Er schlug die Augen auf, und hatte immer noch die Bilder vor sich, von denen er nicht wusste, ob sie Traum oder Wirklichkeit waren. Es begann damit, dass diese Göttin mit ihm in den Hanomag gestiegen war, und der Gedanke daran was weiter passierte, trieb ihm die Schamesröte ins Gesicht. Er hatte nicht gedacht, dass er zu derart leidenschaftlichen Heldentaten fähig war. Zu Hause, wenn er den Beischlaf mit seiner Frau über sich ergehen ließ, war ihm stets, als sei er nichts weiter als einer der Mörser in seiner Apotheke – das kalte Porzellan, die eintönigen Bewegungen – er war Mörser und Stößel zugleich, und er war der Stoff der da zu Staub zerstoßen wurde.
Bei diesem Gedanken merkte er, dass er fror, und er entdeckte, dass er splitternackt und unverhüllt auf seinem Lager ruhte. Er wendete den Kopf und sah seine Decke, die über etwas gebreitet war das nur ein menschlicher Körper sein konnte. Sie ist es, dachte er, es war kein Traum, und er frohlockte. Minutenlang lag er wach und überlegte was denn nun zu tun sei. Und da regte sich etwas bei ihm, etwas das ihm die Entscheidung erheblich erleichterte. Adalbert wollte seine Aphrodite mit einem zärtlichen Kuss zu neuem Leben erwecken und hob die Decke ein wenig an, um darunter zu schlüpfen. Ein Kopf, zerzaustes schwarzes Haar – ach, wie könnte ein Morgen schöner beginnen. Er schob eine Hand unter die Decke, und legte sie auf die Hüfte der Schönen, doch die Haut fühlte sich seltsam an, nicht so glatt und seidig wie erwartet. Da bewegte sich der Körper, ein Gesicht drehte sich ihm zu, doch wo er verlockende Lippen erwartet hatte, grinste ihn ein zahnloser Mund aus einem von Falten zerfurchten Gesicht an; und dann griffen auch noch klauenartige Hände nach seinem Kopf und zogen ihn diesem Gesicht entgegen, und der furchterregende Mund versuchte ihm eine Kuss zu rauben. Das war zu viel für Adalbert. Eben noch war er auf Wolken geschwebt, jetzt sah er sich plötzlich einem Dämon ausgeliefert. Er riss sich los, machte einen Satz zurück und fiel aus dem Bett. Die Schreckensgestalt ließ ein meckerndes Lachen hören, und Adalbert beeilte sich in seine Hosen zu fahren und aus dem Wagen zu stürmen.