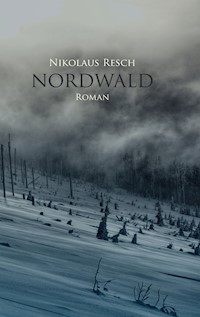
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt in Auszügen die Geschichte der Region um das Dreiländereck Österreich-Tschechien-Deutschland, deren Grundzüge geprägt sind von Wäldern und bäuerlichen Gesellschaftsstrukturen. Der Erzähler tritt in Gestalt eines älteren Mannes auf, der Aufgrund psychischer Veränderungen imstande ist, zumindest in seiner Vorstellung, sich an die Lebensgeschichten seiner Vorfahren zu erinnern. Nach der Einweisung in eine Pflegeanstalt und der darauf folgenden Flucht aus derselben, findet er sich zusammen mit zwei Freunden in einer abgelegenen Hütte im Hochwald wieder. Dort werden die Erinnerungen der drei Männer lebendig - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpfen sich. Anhand der Schicksale der drei Freunde werden mehr oder weniger bedeutende historische und zeitgeschichtliche Ereignisse aus der Region erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein alternder Mann spürt den Tod nahen und wird in seinen letzten Tagen noch mit der Erfahrung seines Lebens beschenkt. Er darf an den Erinnerungen seiner Ahnen teilhaben, wie er glaubt. Nach der Einweisung in eine Pflegeanstalt und der darauffolgenden Flucht, findet er sich zusammen mit zwei Freunden in einer abgelegenen Hütte im Hochwald wieder. Dort verknüpfen sich schließlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu Geschichten, die von Vertreibung und Flucht, von Schmerz und Rache, aber auch von Freude und Freundschaft erzählen.
Vor der rauen Landschaft des Böhmerwaldes begegnen uns historische Gestalten, die eng mit diesem Landstrich rund um das Dreiländereck Österreich-Tschechien-Deutschland verbunden sind.
Nikolaus Resch wurde 1974 in einer kleinen Mühlviertler Gemeinde nahe der Grenze zu Deutschland und der damaligen Tschechoslowakei geboren. Sein Interesse an der oft wenig spektakulären, aber dennoch berührenden Vergangenheit seiner waldreichen Heimat, bewegte ihn zu seinem ersten Roman Nordwald.
Keine Gabe wirkt mächtiger und hinreißender im Menschen als die Phantasie.
Adalbert Stifter
Gewidmet den Verfolgten und Vertriebenen aller Zeitalter, und meiner Mutter, die die Liebe zur Schöpfung nicht nur im Herzen trug, sondern auch weiterschenkte.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Drei Könige
Kapitel 2: Die Hütte
Kapitel 3: Die Ohnmacht
Kapitel 4: Die Wege der Ahnen
Kapitel 5: Alte Feinde, neue Freunde
Kapitel 6: Die Vertriebenen
Kapitel 7: Wurzeln
Kapitel 8: Fleisch
Kapitel 9: Blut
Kapitel 10: Baba Jaga
Kapitel 11: Die Anstalt
Kapitel 12: Die Flucht
Kapitel 13: Der geraubte Altar
Kapitel 14: Der Wächter
Kapitel 15: Wasser
Kapitel 16: Rache
Kapitel 17: Die Räuber
Kapitel 18: Die Verdorbenen
Kapitel 19: Der Bauer
Kapitel 20: Der Dichter
Kapitel 21: Erntezeit
Kapitel 22: Der Lenz
1
Drei Könige
Einst, vor langer Zeit, als die Wälder des Nordens noch Macht hatten über die Menschen die in ihnen hausten, da trafen sich drei Könige auf einem Berggipfel, der die höchsten Bäume überragte und an dem ihre Königreiche einander berührten.
Diesen Gipfel krönte ein mächtiger Felsblock, in den drei Sessel für die Herrscher gehauen waren. Dort sitzend, berieten sie über die Geschicke ihrer Länder – so besagt die Legende. Doch die Wahrheit ist eine andere.
Die Drei waren weder Könige noch Fürsten.
Zuerst war da ein Steinmetz, dann ein einfacher Bauer, und der dritte war ein Heilkundiger, ein Kräutersammler. Natürlich hatte jeder sein eigenes kleines Reich, aber keiner von ihnen herrschte darüber, keiner verfügte über Untertanen.
Zwar hatte der Bauer einen Bruder der zugleich sein Knecht war, den er aber nicht knechtete. Sie lebten zusammen und teilten die Arbeit gerecht unter sich auf.
Der Steinmetz war ebenfalls weit davon entfernt ein König zu sein. Vielmehr war seine Frau es die zu Hause das Zepter in der Hand hielt. Der Steinmetz begnügte sich mit seinem Hammer.
Das Reich des Heilers war der Wald. Und der duldete ohnehin keinen Herrscher über sich.
Man mag sich jetzt die Frage stellen, woher ich das wissen will, wie ich mir anmaßen kann, eine uralte Legende zu berichtigen, wo sich diese Begebenheit doch lange vor meiner Zeit zugetragen hat. Nun, ich war gewissermassen einer von den Dreien, ich war dabei wenn auch nicht körperlich anwesend, zumindest nicht mit jenem Körper den ich heute besitze.
Um zu erklären wie es dazu kam, müßte ich in vielen Wissenschaften bewandert sein. In der Psychologie oder in den Künsten der Medizin, in der Biologie, in der Chemie, vielleicht auch in schwer zu definierenden Grenzwissenschaften, oder in allen zugleich. Nun ist das aber ohnehin so eine Sache mit den Wissenschaften. Ich persönlich halte ja nicht allzuviel davon. Da wird erforscht und erklärt, manchmal widersprechen sich die einzelnen Wissenschaften, auftretende Lücken werden mit Thesen aufgefüllt, es wird gestritten und diskutiert, romantische Mythen und Legenden werden unter dem Mikroskop gnadenlos seziert und entzaubert. Das gleißende Neonlicht der Wissenschaft tilgt die Schatten aus dem Bild, macht es flach und plättet es. Vor allem dann, wenn es um den Menschen geht, der ja, so vermutet die Wissenschaft, aus mehr als nur aus Muskelmasse, Gewebe und Knochen besteht, sondern auch eine Seele besitzt. Und da fangen schon die Probleme an. Denn eine Seele hat noch keiner fotografiert, vermessen oder gewogen. Irgendwie kriegt man so eine Seele nicht recht zu fassen, bringt sie einfach nicht dazu sich in ein Reagenzglas zu zwängen oder sich ein paar Elektroden aufkleben zu lassen. Und vielleicht ist es auch besser so.
Sagen wir also der Einfachheit halber, die Seele ist das was die Wissenschaft nicht versteht. Immerhin aber wissen wir heute, dank der Wissenschaft, dass es die Seele überhaupt gibt. Sie wurde sozusagen anerkannt und genehmigt.
Früher war die Seele ja etwas rein Spirituelles, etwas das in den Himmel aufgefahren ist wenn es mit dem physischen Dasein vorbei war. Da hat es die Seele ja eigentlich besser erwischt als so manch andere Erfindung. Immerhin hat sie sich aus der Antike in die Neuzeit herüberretten können. Viele andere Errungenschaften hingegen sind in Vergessenheit geraten.
Heute gibt es ja fast schon so etwas wie einen Seelenboom. Die Seele ist eben zeitlos modern. Man denke an den Wirtschaftszweig Esoterik, oder an die ganzen Kriege die im Namen der Religionen geführt werden. Das die Religion nicht immer etwas mit der Seele zu schaffen hat, brauche ich an dieser Stelle wohl nicht zu erklären.
Immerhin aber sehen wir, dass gerade die Seele, obwohl wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen, etwas erstaunlich Beständiges ist. Und etwas Kompliziertes. Aber egal. Ich bin ja ohnehin in keiner der genannten Wissenschaften ausreichend geschult um etwas von solchen Dingen zu verstehen. Also wähle ich einen einfacheren Weg um dem Interessierten zu vermitteln, was hinter meiner Behauptung, ich oder meine Seele oder mein Geist, wie auch immer, hätte damals, vor einigen hundert Jahren, auf dem Felsen mit den drei Sesseln gesessen.
Ich werde einfach meine Geschichte erzählen, denn dazu braucht es keine Wissenschaft, lediglich etwas Phantasie, und davon besitze ich glücklicherweise ausreichend.
Zuerst steigen wir also durch dichten Hochwald über unzählige Felsblöcke hinauf auf den Bergrücken, wandern auf dessen Grat entlang in leichtem Auf und Ab, bis wir zu einer seiner höchsten Erhebungen gelangen. Dort steht der Stein mit den drei Sesseln.
Auf einem davon sitzt bereits der Steinmetz. Er kommt aus dem Land im Westen, das später Bayern genannt werden wird. Er hat diesen Ort entdeckt als er, wie so oft, auf der Suche nach lohnenswerten Steinbrüchen durch die Wälder streifte, um den uralten Fels durch sein Handwerk zu den prächtigsten und dauerhaftesten Dingen zu formen und sie so für den Menschen nutzbar zu machen.
Der Bauer aus dem östlichen Lande, Österreich wird es einmal heißen, durch dessen Augen ich den dort sitzenden Steinmetz betrachten darf, nimmt den zweiten Platz ein. Er hat diesen Ort gefunden, als er auf der Suche nach einer seiner Kühe war, nachdem sich die Herde auf der Flucht vor den Wölfen in den Wäldern verloren hatte. Er hegte nur mehr wenig Hoffnung das Tier noch in einem Stück zu finden. Doch als er sich oben auf dem Bergkamm, dort wo der Wald etwas lichter wurde, nach Westen bewegte und in der Hoffnung die Kuh würde die vertraute Stimme erkennen und zwischen den Bäumen erscheinen, seine Lockrufe aussandte, hörte er tatsächlich das ängstliche Klagen seines Viehs. Er fand das Tier schließlich, im Schatten jenes Felsens Schutz suchend, auf dem wir uns heute versammelt haben.
Der Bauer ist kein reicher Mann, aber er hat sein Auskommen. Die Arbeit ist eine harte. Sein Land, seine Wiesen und Felder, haben er und die seinen erst mühevoll dem Wald abgerungen und von den Steinen befreit, aus denen jetzt die Mauern ihres Hofes bestehen. Doch der Bauer ist zufrieden. Er liebt sein Land, gerade wegen der Mühen die es ihm bereitete, und er liebt den Wald der ihn umgibt und ihm das Land überlassen hat.
Der Dritte ist bereits ein alter Knabe. Der Heilkundige besitzt trotz seines hohen Alters, das sich in seinem schlohweißen Haar und den tiefen Runzeln im Gesicht kundtut, eine kraftvolle Anmut. Langsam aber sicheren Schrittes nähert er sich dem Stein und erklimmt dann den hohen Felsturm mit geschmeidigen Zügen, die ihn, nicht seiner Schnelligkeit wegen, wohl aber wegen der Sicherheit mit der er seine Griffe und Tritte wählt, wie eine Eidechse wirken lassen. Oben angekommen nimmt er erst mit ein paar tiefen Atemzügen die klare Luft in sich auf, während eine heftige Windböe sein weißes Haar in Richtung seiner Heimat wehen lässt. Er kommt aus den böhmischen Ländern, die sich nordöstlich des Berges befinden.
Er lässt sich schließlich auf dem dritten Sessel nieder. Dieser Ort ist ihm schon lange bekannt. Seine Suche nach Kräutern und Pflanzen, die nur in den Hochmooren und auf den von rauen Winden gepeinigten Höhenzügen wachsen, hat ihn schon in jungen Jahren hierhergeführt.
Keiner der drei kann sich der Kraft dieses Ortes entziehen, und so kommen sie immer wieder hierher, treffen sich stets am Tag nach dem ersten Vollmond einer Jahreszeit. Nur im Winter, wenn der Schnee hier mannshoch liegt und kein Durchkommen möglich ist, müssen sie auf ihre gegenseitige Gesellschaft verzichten.
Der Steinmetz hat irgendwann sein Werkzeug mitgebracht und die drei Mulden im Stein geglättet, damit sie bequem und lange dort sitzend können, eingehüllt in warme Felle, um dem kalten Wind zu trotzen der hier oben kaum jemals ruht.
So sitzen sie dort oft Stunde um Stunde und spielen ihre Gedanken hin und her, sprechen über die Dinge die sie kennen und über jene die sie nicht kennen, und einer lernt vom anderen. Und sie sprechen über Zeiten die waren und über die Zeiten die da kommen würden.
Und eines Tages, als sie wieder einmal da oben thronen, nimmt der Steinmetz einen langen Zug aus seinem Krug mit dunklem Bier und sagt:
»Wir haben hier das härteste Gestein, das den Elementen zu widerstehen vermag wie kein anderes, und wir haben viel davon. Ich könnte die stärksten Burgen und die herrlichsten Schlösser daraus bauen, aber wir haben keine Herren hier, um sie in Besitz zu nehmen. Dieses Land gehört dem Wald, und so sehr wir uns auch mühen, er gibt uns nur wenig Boden den wir bestellen können und er holt ihn sich ebenso schnell zurück, wie wir ihn gewinnen konnten. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber wir werden wohl nie Teil eines großen Volkes sein, das sich ob seines Reichtums und der Pracht seiner Häuser rühmen wird können.«
»Lass gut sein« sagt der Bauer, »die reichen Herren sind es, die ein Volk in die Armut treiben. Lieber habe ich meinen bescheidenen Hof, lebe mit meinem Vieh unter einem Dach und erfreue mein Herz an den bescheidenen Früchten meiner Arbeit, leide keinen Hunger und schütze mich und die Lebewesen um mich mit eigenen Händen vor den Wölfen und Bären, als mich den hohen Herren auszuliefern, die in ihrer Gier und Dummheit schlimmer sind als die wilden Tiere. Ich bin mein eigener Herr und danke dem Wald für das wenige das er uns gibt«, und nach dieser Rede setzt er sein Krüglein mit klarem Schnaps an die Lippen, tut einen kleinen Zug, schnalzt mit der Zunge und seufzt.
Da spricht der Alte: »Dieser Wald wird vieles sehen, und die Berge werden vieles sein. Heilige Männer werden kommen und das Land im Namen ihres Gottes urbar machen. Mächtige Könige werden sich an ihrem Fuße bekriegen und um die Macht streiten. Kriegsvolk wird über die Kuppen ziehen und die Menschen in den Tälern schinden.«
Er stopft seine Pfeife mit Kraut aus einem ledernen Beutel, nimmt einen brennenden Span aus dem Feuer vor ihnen und entzündet sie. Dann saugt er mit hohlen Wangen daran und entlässt eine dichte Rauchwolke aus seinem Mund. Und wie um seine Worte für die beiden Freunde zu unterstreichen, formt sich der Rauch vor dem Hintergrund der dunklen Wälder zu einem Bild. Gewaltige Heerscharen von Männern auf stampfenden Rössern hauen sich gegenseitig mit ihren Schwertern auf die behelmten Häupter, bis ein Windstoß das Bild verwischt, um aus dem Nebel ihre toten Leiber erscheinen zu lassen, die dahingemäht über die hügeligen Wiesen verstreut liegen. Sie sehen brennende Häuser und Weiler und vermeinen fast die Schreie der Menschen zu hören, die in den Flammen und unter den rasenden Schwertern der Krieger ihr Leben lassen müssen.
»Der Berg wird einst ein Wall sein, abweisend und unüberwindbar, und die Völker die an seinem Fuße leben, werden in Vergessenheit geraten – und wieder entdeckt werden. Viele werden durch die Wälder ziehen, fliehend und hoffend. Und viele werden hier ihr Glück finden und es doch nicht halten können«, und da seine beiden Freunde einfache Gesellen sind, nur mit bescheidener Vorstellungskraft ausgestattet, zieht der Alte erneut an seiner Pfeife und zeigt ihnen den Bergkamm, der überzogen ist von einem Netz aus Eisen, und seltsame Türme stehen wie einsame Burgen entlang eines Bandes, und Menschen laufen auf diese Grenze zu und fallen plötzlich. Und wieder verschwimmt das Bild und die Türme verändern ihre Form, werden zu riesigen Galgen, durch Seile verbunden, und daran hängen Menschen mit Brettern an den Füssen, auf denen sie über die verschneiten Hänge ins Tal rasen, nur um dort in eine kleine Hütte eingesaugt zu werden um die Höllenfahrt wieder von vorne zu beginnen. Und sie sehen lange Reihen von Menschen die nach Süden ziehen, zu Fuß, schwer beladen, mit kleinen Handkarren oder auf großen Wägen, sehen Kinder und Frauen, weinend und schwach, und Greise die gestürzt am Wegesrand liegen, und ganze Dörfer die verfallen und für immer im Wald versinken.
Ein Windhauch bläst die Bilder in die Lüfte und der Alte spricht weiter: »Auch werden die mächtigsten und edelsten Tiere des Waldes, die Wölfe und Bären und der heimliche Luchs, den Wald verlassen und erst nach langer Zeit zurückkehren. Der Wald selbst aber wird weiter bestehen, auch wenn ihm zahlreiche Wunden geschlagen werden. Die Menschen werden diesen Wald nicht bezwingen, denn er ist unbarmherzig gegen jene die ihn nicht verstehen und er weiß seine Schätze gut zu verbergen. Er belohnt nicht den, der nach Reichtum und Macht strebt und auf Raub aus ist. Er beschenkt nur diejenigen, die seine Geheimnisse erkennen und erlaubt ihnen, sie im Herzen mit sich zu führen.«
Zum Abschluss seiner Rede zieht er erneut an seiner Pfeife und zeigt ihnen friedliche Dörfer am Rande des grünen Meeres, sie sehen den Wolf und seine Jungen, die sich auf einer Lichtung balgen, und den Luchs der dieses Spiel von einem Felsen aus mit seinen scharfen Augen beobachtet. Und sie sehen einen Mann hoch über einem See sitzen und auf das schwarze Wasser blicken, dabei mit einem Stöckchen seltsame Zeichen auf ein weißes Brettchen malend. Und wieder holt sich der böhmische Wind die Bilder und durch den schwindenden Rauch sehen sie auf die unendliche Weite des großen Waldes, der sich in alle vier Himmelsrichtungen zu ihren Füßen erstreckt.
»Du weißt vieles, mein weiser Freund« sagt der Steinmetz nach einer Weile, »aber du machst mir doch Angst. Ich halte nichts von Kriegsvolk und Raub, und ich will unserem fleißigen Bauern recht geben – besser in der warmen Stube einer bescheidenen Hütte, als im feuchten Verlies eines prächtigen Schlosses.«
»Sorge dich nicht« sagt da der Alte, »du wirst diese Zeiten nicht erleben, und ich erst recht nicht. Es wird noch viele Jahre dauern, bis sie anbricht, und weitere Jahre werden vergehen bis der Wald seinen Frieden findet, und mit ihm die Menschen die um und in ihm leben. Und immer wieder werden hier welche sitzen, die verschiedenen Völkern entstammen und doch in Freundschaft miteinander verbunden sind. Diese Bergwälder werden die Irrtümer der Menschen wie ein Schwamm aufsaugen und die Wogen, die an die Flanken der Berge branden, glätten.«
Auf diese Weise sprechen die drei Männer noch oft miteinander, auf dem Berg mit den drei Sesseln.
Vielleicht hat die Legende doch recht, denn mir scheinen sie jetzt tatsächlich Könige gewesen zu sein. Könige ohne Untertanen, ohne Wappen und Reichtümer, aber Könige im schönsten Reich – Könige im Hochwald.
Gut, ich gebe zu, vielleicht hat meine blühende Fantasie ihren Teil zu dieser Geschichte beigetragen. Aber doch hat sie sich zugetragen, auch wenn die Sprache der drei Männer eine uralte ist, die ich nicht spreche, die ich aber doch verstehe, oder treffender gesagt, fühle. Da mischt nämlich schon wieder die Seele kräftig mit, wie man merkt. Kaum stößt man an Grenzen, in diesem Fall an die Grenzen der Erzählkunst, muss die Seele, die arme Haut, herhalten. Aber gut, dafür darf sie irgendwann ins Himmelreich auffahren, während mein bedauernswertes Fleisch in der feuchten Erde verrotten muss.
2
Die Hütte
Unweit dieses Felsens, nur wenige Kilometer in östlicher Richtung, steht eine Hütte inmitten einer Lichtung, umringt von Fichten, Buchen und Eichen. Eigentlich steht sie nicht, vielmehr hockt sie dort. Wie eine Katze vor dem Mäuseloch. Die gerade mal mannshohe Außenwand, einst weiß gekalkt, mittlerweile grau und fleckig, die beiden Fenster an der Südseite und dazwischen die Eingangstür aus altersgrauem Holz. Darüber gleich das verwitterte Dach, das sich in seinen Farben kaum von der dahinterliegende Wand des Waldes abhebt.
Gerade im Spätherbst wirkt alles recht düster. Der Waldrand, schwarz und geheimnisvoll, lässt selbst bei Sonnenschein den Blick nicht weiter als wenige Schritte in das Innere des Waldes eindringen. Bei Nebel, der sich oft in der kleinen Senke in der die Hütte steht, bildet, sieht man von der Hütte aus kaum den umgebenden Wald, obwohl die Lichtung nicht größer ist als ein halbes Fußballfeld.
Dieser Ort verbirgt sich geschickt vor neugierigen Blicken. Lediglich aus der Luft könnte man ihn ohne Schwierigkeiten entdecken. Wer sich aber am Boden bewegt, muss schon zufällig darauf stoßen, um ihn zu finden. Es gibt hier keine hohen Berge die über die Baumgrenze hinausragen und einen Blick in die Senke gestatten würden. Die einzige Zufahrt, die von Osten her an die Hütte heranführt, verdient kaum mehr diesen Namen. Mit dem Verlust der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gegend, die ohnehin nie besonders groß war, ging auch die zunehmende Rückbildung der einstigen Wege und Forststraßen einher. Der Wald holt sich die breiten Schneisen zurück.
Die Hütte sieht bei flüchtiger Betrachtung nicht mehr bewohnt, für moderne Verhältnisse auch nicht mehr bewohnbar aus, sofern nicht gerade Rauch aus einem der beiden Schornsteine aufsteigt. Das Dach ist moosbewachsen und in der Mitte zwischen den Rauchabzügen etwas durchhängend. Der hölzerne Anbau, der früher als Unterstand für die Pferde der Holzknechte gedient hat und mir heute als Holzlager zur Verfügung steht, ist zur Hälfte eingestürzt.
Die Mauern bestehen aus jenem Gestein das der ganzen umgebenden Landschaft ihre Form gibt. Jener steinerne Teil des Gebäudes wird wohl noch viele Jahrzehnte überdauern, und einst, wenn das Holz längst verfault ist, noch immer seine ursprüngliche Form erahnen lassen. Es wird aber dann keinem sterbenden Flüchtling mehr als Behausung dienen, sondern den kleineren und beständigeren Bewohnern des Waldes. Bis dahin wird sich wohl auch die Lichtung geschlossen haben, die Ruine wird inmitten dichten Waldes liegen, wird kein menschliches Bauwerk mehr sein, sondern nur ein weiterer Steinhaufen unter den vielen die man hier findet – und wer weiß, sollte ich das Glück haben, tatsächlich unentdeckt zu bleiben und vergessen zu werden, dann werden meine bleichen Gebeine vielleicht ihre letzte Ruhestätte unter diesem gestürzten Relikt menschlicher Bewirtschaftung finden. Ein schöner Gedanke – meine Knochen eine Brutstätte für die Ameisen, mein Becken ein Schoß für den Fuchs, mein Schädel eine behagliche Höhle für die Natter.
Aber noch steht die Hütte, und ich stehe vor ihr, wenn wir auch beide schon gebeugt sind vom Alter. Sie kann sicherlich nicht als Meisterwerk der Baukunst bezeichnet werden, wurde sie doch ausschließlich nach zweckmäßigen Gesichtspunkten errichtet, und doch kann ich mir kein anderes Gebäude vorstellen, das besser auf diese Lichtung passen würde. Wie aus dem Boden gewachsen steht sie da, und letztlich ist sie das auch – Granit und Holz, die gleichen Baustoffe, die auch der sie umgebenden Natur ihr Gesicht geben.
Es gibt nur drei Räume. Einer davon dient mir als Schlaf- und Wohnraum, der zweite ist die Schlafkammer meines Gefährten, und der dritte ist Werkstatt und Lagerraum.
Das Feuer in dem alten Kachelofen, der den Mittelpunkt meiner Stube bildet und Kochstelle und Wärmequelle ist, kommt heute nur schwer in Gang. Eigentlich besteht keine Notwendigkeit für ein Feuer. Obwohl Mitte November, ist es frühlingshaft warm – ungewöhnlich, aber nicht überraschend angesichts der seltsamen Veränderungen, die während der letzten Jahre mit dem Klima vor sich gehen. Ich liebe aber das Knistern der Holzscheite, den Geruch des Rauchs, der sich aus dem Spalt neben der eisernen Ofentür windet und sich in den beiden Lichtbalken, die von den kleinen Fenstern ausgehend durch den Raum streben, zu immer neuen Formen und Schleifen materialisiert.
An Brennholz mangelt es nicht. Neben dem Gestein ist es das Holz, das hier im Überfluss vorhanden ist. Die gesamte Nordwand der Hütte ist bis unter das Dach mit bereits gespaltenem Brennholz verkleidet, und rund um die Lichtung sind mehrere große Holzstöße verteilt.
Geht man einige Kilometer in nördlicher Richtung, was aufgrund der dichten Vegetation und der über das ganze Gebiet verstreuten Felsformationen nicht auf direktem Weg möglich ist, sondern nur indem man sich nach der geeigneten Geländeform richtet, dann erreicht man den Bergkamm, der auf seiner ganzen Länge vom Nordwald bedeckt wird. Dieser Kamm bildet nicht nur die Wasserscheide, sondern auch die Grenze zum nördlichen Nachbarstaat. Lange Zeit war diese Grenze stark befestigt und unüberwindbar, heute aber, so wie in den langen Zeiten vor der Befestigung, ist sie nur noch auf dem Papier als solche zu erkennen. Den Wald, das Wild, und auch die wenigen Menschen die sich heute noch in diesen Wäldern bewegen, kümmert es nicht, welcher Staat Anspruch auf das Gebiet erhebt. Der Fuß, wenn er über die Grenze steigt, spürt keinen Unterschied an der Bodenbeschaffenheit, die Luft atmet sich hüben wie drüben gleich, und der Himmel ist auf beiden Seiten derselbe.
Einige Unterschiede gibt es aber doch. Die Vegetation ist an der Nordseite der Berge manchmal recht unterschiedlich zu der auf der Südseite. Hier herrschen andere Winde, andere Bedingungen, und es finden sich mancherorts Latschenbestände, die sich über die Blockhalden ausbreiten und sich an die bemoosten Granitkolosse krallen, um den heftigen Winden standhalten zu können. Rund um den schwarzen See befinden sich Hochmoore mit Birkenbeständen, und auch die Flechten und das Moos, das die allerorts verstreuten Felsblöcke überzieht, scheint hier von anderer Farbe als in den dichten Wäldern auf der Südseite. Wenn es so etwas wie eine Grenze hier gibt, dann ist es eine natürliche, eine von Wettereinflüssen und der geologischen Beschaffenheit gebildete, und keine die Nationen voneinander trennt. Diese natürliche Grenze vermag auch das, was eine vom Menschen gezogene nicht schafft. Sie hält die Gemeinschaften auf den beiden Seiten des Bergrückens auf Distanz, ohne sie völlig voneinander abzuschirmen, sie bleibt durchlässig. Immer fanden sich Wege über die Berge, meist Handelswege, die den Kontakt der Menschen zueinander ermöglichten, die aber mühsam zu beschreiten waren. So wurde der nötige Abstand gewahrt und Konflikte verhindert. Bis schließlich größere und mächtigere Völker die Geschicke der Menschen in diesem Land in ihre Machenschaften verstrickten. Den Wald aber konnten diese Machenschaften kaum beeindrucken.
Diesen Wald habe ich nun zu meiner letzten Heimat erwählt, habe weiße Wände und glänzende Fußböden gegen die steinernen, grauen Mauern und gesplitterten Bodenbretter der Hütte getauscht, die asphaltierten Gehsteige gegen die von Wurzeln und Steinen durchzogenen Waldpfade, den von Stromleitungen und Kransilhouetten verunstalteten Himmel gegen die dunkle, lebendige Tiefe des Waldes, das Rauschen des Verkehrs vor den Fenstern gegen das Rauschen des Windes in den schwankenden Baumwipfeln. Die Kraft, die aus dem urzeitlichen Gestein unter meinen Füssen und aus den knarrenden Zweigen über meinem Kopf in mich zu fließen scheint, ersetzt jene, die mir in den erstickenden Zimmern und zwischen den einengenden Häuserfronten geraubt wurde. Und doch weiß ich, dass auch diese Kraft mich nicht retten kann, dass sie mir nur einen Aufschub gewährt. Eine Frist, die mir erlaubt, ein letztes Mal, vielleicht das erste Mal, glücklich zu sein.
3
Die Ohnmacht
Der erste Überfall der Ohnmacht kam sanft.
Ich saß unter meinem großen Nussbaum, vor einem knisternden Feuer. Es war ein Spätsommerabend und es wurde nachts bereits kühl.
Ich liebe das Feuer. Dieses Element, das so freiheitsliebend und zerstörerisch ist und doch gebunden an ein anderes Element. Es erlischt, wenn ihm die Luft entzogen wird. Wenn es aber atmen darf, dann lebt es auf, und allein der Blick in die schwelende Glut erwärmt den Betrachter, entfacht seine Gedanken zu einer lodernden Flamme.
Vielleicht war es das Feuer, das meine erste Ohnmacht ausgelöst hatte. Dass ich eine Weile weggetreten war, merkte ich, als ich aus meinem Zustand der Besinnungslosigkeit erwachte und nur mehr ein schwaches Glimmen unter der Asche zu erkennen war. Der Himmel hatte sich bereits tiefschwarz über das Land gebreitet. Ich konnte nicht eingeschlafen sein, denn ich war nicht müde, als ich mich hierher gesetzt hatte. Zudem war mein Sitzplatz nicht bequem genug und zum Schlafen ungeeignet. Ich bin ein Sesselwetzer und keiner der gerne und lange sitzt, schon gar nicht kann ich sitzend einschlafen. Auch war ich sofort hellwach, als ich wieder zu mir kam. Keine vorübergehende Benommenheit, wie sie sich oft zeigt, nachdem man aus dem Schlaf erwacht. Das Seltsamste aber waren die Erinnerungen, die ich aus der Ohnmacht mitgebracht hatte.
Ich hätte sie für einen Traum halten können, aber ich kannte die Flüchtigkeit meiner Träume, habe immer gerne geträumt und oft versucht, das Geträumte festzuhalten, mich daran zu erinnern, und doch ist es mir kaum jemals gelungen. Wie der Rauch aus der Pfeife des alten Kräutersammlers, haben sich die Traumbilder zu meinem Bedauern stets in Luft aufgelöst.
Dieses Mal aber war es anders. Ich konnte mich klar und deutlich an die Eindrücke während meiner Ohnmacht erinnern, auch wenn ich nur wenig damit anfangen konnte. Das Erlebte war überwältigend, und tatsächlich war mir, als hätte ich es am eigenen Leib erfahren.
Da waren nicht nur Traumbilder, sondern auch Gefühle, Gerüche, ich spürte Kälte und roch Schweiß, ich empfand Trauer, Freude und Angst.
Ich sah Landschaften die ich kannte und die mir doch fremdartig erschienen, ich sah Berggestalten die mir vertraut waren, die aber bedeckt waren von gewaltigen Gletschern, ich wandelte durch Wälder in denen ich mich oft aufgehalten hatte, die aber plötzlich unberührt schienen von menschlicher Hand. Ich sah Baumriesen, wie man sie heute nirgendwo mehr findet, stand dem Wolf gegenüber, ohne Zaun zwischen ihm und mir, und ich war selbst mehr Tier als Mensch, roch Dinge die ich nicht kannte, meine Sinne schwelgten in einer bislang unbekannten Fülle, die mich überflutete und mein Herz berührte. Ich spürte herannahende Gewitter, witterte den Schnee, Stunden, ja Tage bevor er auf mich herabfiel. Ich konnte die Stimmen der Vögel im Wald unterscheiden, obwohl es ein einziges tosendes Gezwitscher war.
Mein Leib blutete und war ein einziger Schmerz, und ich erlebte Momente des Glücks, wie ich sie nie zuvor erfahren hatte.
Ich wusste, ich hatte fremde Leben durchlebt, viele Leben. Ein gewaltiger Zeitstrom war durch mich hindurchgeflossen, unaufhaltsam, mit Wirbeln und bodenlosen Untiefen, wütend schäumenden oder friedlich dahin strömend hatte er meinen Geist mit sich fortgezogen und nicht wieder freigegeben.
Ich sah in die sterbende Glut und wusste nicht, wo ich war. Ich erkannte die vertrauten Umrisse des großen Nussbaumes, konnte aber nicht sagen, wo er stand, und ich sah das alte Haus und fragte mich, wer wohl darin wohnte. Erst nach und nach wurde mir klar, dass ich es war, der hier saß. Ich sah einen Krug mit Wasser neben mir stehen, ein Buch dort liegen, sah meine Hände und Füße und stand auf, um zu sehen, ob sie mich tragen würden. Langsam ging ich den Weg zum Haus entlang, den ich so viele Male gegangen war, ging durch die Tür und über die steinerne Treppe in meine Stube und setzte mich an den Tisch. Ich war zu Hause, das wusste ich, aber doch war ich auch woanders, war überall und nirgendwo, war hier und jetzt und doch tausend Jahre in der Vergangenheit. Die Bilder und Wahrnehmungen aus der Ohnmacht waren noch immer in mir, standen mir ständig vor Augen, sie ließen mich zittern und beben, und ich fürchtete, dass ich dem Wahnsinn nahestand. Mehr noch aber fürchtete ich die Krankheit.
Ich war nicht mehr der Jüngste und in einem Alter, in dem diese Krankheit viele Menschen befällt. Sie raubt ihnen, so meint man, die Erinnerungen und macht sie wieder zu Kindern. In früheren Jahren hatte ich oft mit Menschen zu tun gehabt, die davon befallen oder durch die Verzweiflung über das Leben in diesen Zustand gestoßen worden waren. Ich war vertraut mit dieser Krankheit und die Furcht davor war groß.
Ängstlich prüfte ich meine Erinnerungen. Noch wusste ich, wer ich war. Ich sagte meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Postanschrift laut vor mich hin. Ich ging mein Leben durch, holte Gesichter und Namen hervor, und sie erschienen unverzüglich. Danach war ich einigermaßen beruhigt.
Als ich zu Bett ging, hatte ich dennoch Angst, die Augen zu schließen, Angst, einzuschlafen und zu verschwinden, zu erwachen und nicht mehr zu wissen, wer, wo und wann ich war. Doch ich war erschöpft und schlief schließlich einen langen, vermutlich traumlosen Schlaf.
Die Furcht erwies sich schließlich als unbegründet. Ich erwachte, trug noch immer denselben alternden Kopf und war mir dessen bewusst. Ich setzte mich an den Tisch und trank Kaffee und dachte dabei an den vorangegangen Abend. Hatte ich alles nur geträumt? Durch das geöffnete Fenster strömte die laue Luft des Spätsommers herein. In den Zweigen der Obstbäume sangen die Vögel und hüpften auf der Jagd nach Insekten geschäftig von Ast zu Ast. Und wieder konnte ich die einzelnen Stimmen mühelos voneinander unterscheiden. Den Gartenrotschwanz von der Blaumeise, das Rotkehlchen vom Sperling, und über allem lagen die gurrenden Laute der Wildtauben und die scharfen Pfiffe der Turmfalken, die über der nahen Burgruine ihre Kreise zogen.
Ich wusste, ohne mir erklären zu können, woher und warum, dass heute noch Regen kommen würde, obwohl nichts darauf hindeutete. War es möglich, dass ich die geschärften Sinne die mich gestern so beeindruckt hatten, behalten hatte?
Abermals fragte ich mich, ob dies die Folgen einer Erkrankung sein konnten, ob irgendetwas mit meinem Gehirn nicht in Ordnung war. Aber selbst wenn es Symptome einer Krankheit sein sollten – welch ungeheuren Gewinn hatte ich dadurch erlangt.
Die zweite Ohnmacht kam nur wenig später.
Tatsächlich hatte Regen eingesetzt und ich war nicht einmal überrascht darüber. Ich sah den Regentropfen zu, die an mein Fenster prasselten. Dann kam sie, die zweite Welle, und wieder war es eine ungeordnete Flut unzähliger Eindrücke. Ich konnte keinen Sinn, keinen Zusammenhang der Szenen erkennen, aber es war nicht weniger überwältigend und beängstigend als beim ersten Mal.
Als ich zu mir kam – es war wohl eine halbe oder eine ganze Stunde vergangen und mein Tee war inzwischen kalt geworden – schien es mir aber, als hätten sich die Erinnerungen verdichtet. Ich konnte nun einige Eindrücke miteinander verknüpfen, so als hätte ich einem Puzzle ein paar fehlende Teile hinzugefügt.
Es ist nicht alltäglich, zu erwachen und plötzlich über die Erfahrungen und Erkenntnisse unzähliger Generationen zu verfügen. Ich war verwirrt und von Sinnen. Immer wieder stürzten neue Empfindungen und Bilder auf mich ein. Es kam mir gelegen, dass ich alleine lebte, dass ich anderen Menschen ohne Schwierigkeiten aus dem Weg gehen konnte. So hatte ich es nicht nötig, meine Verwirrung zu verbergen und konnte mir Zeit damit lassen, mich daran zu gewöhnen. Mein Haus lag sehr abgelegen, nur selten verirrte sich ein Spaziergänger oder der Briefträger hierher. Die nächste Stadt war nicht allzu weit entfernt, aber doch weit genug, um weitgehend von deren Einfluss verschont zu bleiben. Ich lebte inmitten von Wäldern, von tiefen Schluchten umgeben, und mit jenem Gestein unter meinen Füssen, das vielleicht einer der Auslöser für meine Ohnmachtszustände war.
Granit enthält radioaktive Elemente, zwar in geringen Mengen und nicht bedrohlich, aber immerhin. Man sagt diesem Gestein verschiedene Einflüsse auf Körper und Geist nach. Anregend soll es wirken, motivierend und konzentrationsfördernd, es erdet die Seele, heißt es, und es beeinflusst Träume und Schlaf.
Mit jeder neuen Ohnmacht erfuhr ich mehr über die Geschicke jener Menschen, deren Erinnerungen ich mir einverleibte. Noch berührten sie mich nur mäßig. Sie waren Fremde. Ihre Lebensumstände, ihre kulturellen Hintergründe, ihre Charakterzüge waren mir fremd. Zwar trug ich ihre Erinnerungen in mir, verspürte aber keine Verbindung zu meinem eigenen Dasein. Die Entdeckung, die ich später machte, die die Verbindung zu mir selbst herstellte, und die schließlich die Entdeckung meiner Krankheit zur Folge hatte – denn als solche sollte sie von Medizinern gedeutet werden – bestimmte mein weiteres Schicksal und führte mich hierher in diese einsame Hütte im Hochwald.
4
Die Wege der Ahnen
Ein Mediziner würde meine Ohnmachtsanfälle wohl kaum als solche bezeichnen. Ihr Wesen scheint viel mehr übersinnlicher Art zu sein. Visionen, Gesichter, Halluzinationen – alles ebenso falsch. Ich will daher das Wort Ohnmacht beibehalten, einfach weil es mir gefällt. Ohne Macht – das bin ich tatsächlich gegenüber der Fülle von Eindrücken, die dabei auf mich niederkommen.
Die Anfälle traten anfangs häufig auf, werden aber jetzt immer seltener. Heute werde ich kaum mehr davon heimgesucht, auch wenn ich bewusst versuche, einen davon hervorzurufen. Gelegentlich vermisse ich diesen Zustand. Ich möchte manche Bilder, die nur in Bruchstücken in meinem Kopf gespeichert sind, vervollständigen. Zu Beginn gelang mir dies ohne große Anstrengung. Hypnotischen Bilder von fließendem Wasser, von Feuer, aber auch von einer dicht vorbeirauschenden Eisenbahn oder den Drehungen eines Windrades, konnten leicht Auslöser für eine Ohnmacht sein. Ich konnte das Auftreten begünstigen, es fiel mir aber schwer, es zu verhindern.
War ich in der Stadt beispielsweise, musste ich ständig meinen Blick umherwandern lassen, um zu vermeiden, dass mich der Anblick der vorbeiziehenden Automassen in die Vergangenheit beförderten. Es scheint mir, als wäre ich anfangs mit dem Grundwissen über jene Menschen vollgestopft worden, deren Erinnerungen ich heute besitze. Danach wurden nur mehr Ergänzungen hinzugefügt, die die Einzelheiten schließlich zu einem Gesamteindruck vervollständigten. Es war, als hätte jemand mein Gehirn als Festplatte benutzt, sie erst mit unausgereiften Datensätzen gefüllt, um diese nach und nach durch ständige Aktualisierungen brauchbar zu machen. Bald war ich in der Lage, die ersten gespeicherten Daten auszuwerten und chronologisch zu ordnen. Jene Erinnerungen, die am weitesten zurückreichen, bestehen oft nur aus Fragmenten. Je mehr sie sich der Gegenwart annähern, desto deutlicher und geordneter zeigen sie sich.
War ich anfangs der Meinung, es handle sich um Ereignisse aus dem Leben von Menschen, die in keinerlei Zusammenhang zu mir stehen, wurde ich später eines Besseren belehrt. Bald fiel mir auf, dass ich die Erinnerungen ausschließlich mit Männern teilte, und als ich die Geschichte meines Großvaters miterlebte, wurde mir klar, dass es sich bei ihnen allen um Männer handeln musste, deren Blut heute in meinen Adern fließt – um die männlichen Vorfahren meiner Mutter. Warum es sich ausgerechnet um die Blutlinie meiner Mutter handelt, bleibt mir ein Rätsel. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Vielleicht ist der Granit die Ursache, seine Strahlung, die Kraft jener Landschaft, der die Ahnen meiner Mutter entsprungen sind und in der sie stets heimisch waren. Möglicherweise ist aber auch mein Blut dafür verantwortlich, oder es sind unerklärliche, mystische Kräfte am Werk.
Die am weitesten zurückreichenden Erinnerungen zeigen mir seltsamerweise nicht die Gegend um den Nordwald. Sie zeigen mir jene Gebirgslandschaft, aus der vor mehr als zweitausend Jahren die keltischen Salzhändler kamen und durch meine Heimat zogen.
Ich erkenne die Seen und die markanten Bergkämme dieser mir vertrauten Gebirgswelt wieder. Ich ziehe auf Saumpfaden durch Gebirgstäler und über verschneite Pässe, die auch ich selbst vor Jahren, als ich noch die Kraft dazu besaß, erwandert habe. Ich sehe aber auch andere Landschaften, die ich nicht auf den ersten Blick erkennen, deren Lage ich nur erahnen kann, denn das Land hat sich gewaltig verändert in dieser Zeit. Wald, Flüssen, Seen und Fels bestimmen diese Eindrücke, und die Sinneswahrnehmungen meiner Vorfahren unterscheiden sich ganz gewaltig von denen des modernen Menschen. Es ist, als würde man unsere abgestumpften Sinne denen des Wolfes, des Luchses oder des Falken gegenüberstellen.
Ich liebe es, mir diese Bilder vor Augen zu führen. Ein unberührtes Land das man von den Gipfeln überblickt, so wie ich es immer schon zu sehen wünschte, kaum beeinflusst von menschlicher Hand. Endlose grüne Waldflächen dort wo sich heute ein riesiges Feld an das andere drängt. Als glitzernde Bänder schlängeln sich die Flüsse durch die Ebenen, die heute von Autobahnen und Straßen zerschnitten sind, und auf denen sich wie Pockennarben die Städte ausgebreitet haben. Der Himmel, glatt und rein wie eine jungfräuliche Leinwand und ohne die Risse, die heutzutage Flugzeuge auf ihm hinterlassen. Das nächtliche Firmament von unzähligen Sternen gesprenkelt, die in der Gegenwart im Schein der städtischen Beleuchtung in die Unsichtbarkeit entschwinden.
Ich finde nicht mehr viele Gründe zum Weinen, aber diese Schönheit bewegt mich zutiefst. Der Gedanke daran, dass sie für den Menschen für immer verloren gegangen ist, dass ich vermutlich der einzige lebende Mensch bin, der dies erleben darf, ohne es mit jemandem teilen zu können, entlockt mir manchmal eine Träne.
Ich nehme an, diese ersten Bilder stammen von einem keltische Händler, der aus dem Süden kommend sich hier angesiedelt hatte, oder von einem Angehörigen der slawischen Völkern aus dem Norden, der seine Waren zu den Salzbergen brachte, um sie dort gegen das weiße Gold zu tauschen. Er oder seine Nachkommen mussten sich schließlich in diesen Wäldern niedergelassen haben, anfangs vielleicht, um den durchziehenden Handelsleuten eine Labstelle zu bieten, um die sich später kleine Siedlungen bildeten.
Die Erinnerungen sind schwach, sie umschließen Jahrhunderte, und ich vermag kaum, sie sinnvoll zu ordnen.
Aber nicht alles ist Idylle. Ich sehe einfache Hütten und in zerschlissene Felle und Lumpen gekleidete Menschen in tief verschneiten Siedlungen.
Ich bin mit Gefährten auf der Jagd. Sie haben sich die Gesichter geschwärzt, und obwohl ich selbst nie Jäger war, spüre ich die Erregung, als ich lautlos über die nassen Blätter des Herbstwaldes schleiche, den Wurfspieß in den Händen, und ich triumphiere, als ich den Speer in den rasenden Leib des Ebers stoße. Aber ich spüre auch die Notwendigkeit dieser Tat, denke an den Hungertod, der mir und den meinen ohne Nahrung droht.
Ich bin der Säumer, der sein bepacktes Pferd über den schmalen Steig durch den Wald führt. Da liegt eine Gruppe von Handelsreisenden neben dem Weg, die Jüngsten fast noch Kinder, ihre Schädel zerschmettert von den Knüppeln und Keulen der Wegelagerer, mit klaffenden Wunden am Leib, geschlagen von den groben Äxten der Mörder.
Und ich werde selbst zum Mörder. Wüte mit Spieß und Schwert, schlage meine schartige Schneide in Fleisch, aus Hunger, aus Hass, aus Angst, und ich fühle dabei nur wenig Mitleid, aber auch keine Freude, lediglich Erleichterung. Aufatmen. Das Leben kann kurz sein in dieser Welt, es endet früh für den Schwachen.
Es kommen Krankheiten, die meine Kinder, eines nach dem anderen, dahinraffen, und nur mich ungnädigerweise verschonen. Aber es ist kein Platz für Verzweiflung. Ein unbändiger Lebenswille beseelt mich, genährt von den schlichten Gedanken an Nahrung, Feuer und Fortpflanzung. Die Erde selbst kann zu einem erbitterten Feind werden. Ich spüre den Sturm, der mir eisigen Regen ins Gesicht peitscht und mir den Atem raubt. Meine Finger und Zehen sind erfroren, meine einfache Kleidung aus Leder, Fellen und groben Stoffen, bietet nur wenig Schutz, ist durchnässt und schwer. Meine Hütte und ein wärmendes Feuer sind fern, zitternd und um mein Leben fürchtend, suche ich Schutz in einem feuchten Loch unter einem Felsen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Bin ich Kelte, Römer oder Slawe, bin ich Mensch oder Tier. Immer wieder ist es der Anblick des brennenden Morgenhimmels über den sanften Hügeln, die flüsternde Stille im lichtdurchfluteten Wald, oder das Tosen der felsgesäumten Flüsse, aus denen ich neue Kraft schöpfe. Es sind die Elemente, die ich um Vergebung und Erlösung bitte. Die Natur ist keine Erfindung Erholungssuchender aus dem rasenden Industriezeitalter. Bereits für meinen Urahnen ist sie lebensnotwendig und die Quelle aller Kraft.
Erschüttert und angeekelt wird mir bewusst, wie sehr sich die Bedürfnisse des Menschen gewandelt haben, denn auch hier, unter diesen schwersten Bedingungen, erlebe ich Gefühle wie Liebe und Freude. Sie sind dort wo Bequemlichkeit und Überfluss in unerreichbarer Ferne liegen, oft das Einzige das an den Menschen der Neuzeit, als der ich geboren wurde, erinnert.
5
Alte Feinde, neue Freunde
Ich bin nicht allein in meiner Hütte.
Albert war einst mein schlimmster Feind. Doch das ist lange her, mittlerweile teilt er mein bescheidenes Heim mit mir und trägt seinen Teil zum Haushalt bei. Er ist, wenn man dies so bezeichnen darf, zu einem Freund geworden, und zu meinem geduldigsten Gesprächspartner. Wir stammen aus dem gleichen Dorf und gingen zusammen zur Schule. Ich habe aus dieser Zeit keine angenehmen Erinnerungen an ihn. Er war eine Plage. Obwohl von ähnlichem Körperbau wie ich, schlank und von durchschnittlicher Größe, war er mit unbändiger Kraft gesegnet. Dem Drang des männlichen Kindes folgend, musste er diese Kraft natürlich bei jeder Gelegenheit unter Beweis stellen und seine, zumindest körperliche Überlegenheit, demonstrieren. Verdrehte Handgelenke und Arme, Schwitzkasten, Kopfnüsse, all die Auswüchse kindlich brutaler Kampftechniken musste er an jenen Mitschülern ausprobieren, die ihm an Körperkraft oder Gewaltbereitschaft unterlegen waren. Ansonsten verband mich nicht viel mit ihm, außer eben jenem Umstand, dass wir Freud und Leid von Grundschule und Kirchendienst miteinander teilen durften. In meiner freien Zeit hielt ich mich verständlicherweise fern von ihm.
Später, als Jugendlicher, hatte er seine Freude an den entnervenden Spielen der Kindheit verloren, aber der Zug der Kameradschaft war bis dahin längst abgefahren. Nach und nach verflüchtigte sich der Kontakt, bis ich Albert schließlich gänzlich aus den Augen verlor. Ein Verlust der mich kaum betrübte.
Heute folgt mir Albert treu wie ein Hund, auch wenn ich nie eine derartige Beziehung anstrebte. Er tut mir schlichtweg leid, und der kindliche Hassgefühle den ich gegen ihn hegte, hat einem Verantwortungsgefühl Platz gemacht.
Albert ist ein nützlicher Gefährte. Er führt die einfachen Arbeiten aus, die ich ihm auftrage und scheint sich sogar darüber zu freuen. Ich versuche aber, diesen Umstand nicht auszunützen. Er sitzt gerne den halben Tag an der von der Sonne gewärmten Hauswand, betrachtet den Himmel oder den Waldrand, und trägt ein glückseliges Lächeln auf seinem Gesicht. Ich lasse ihn dann in diesem Zustand und erledige die Arbeit die getan werden muss selbst. Schließlich sind es auch für ihn, genauso wie für mich, die letzten Lebenstage, und ich freue mich, ihn zufrieden zu sehen. Mein Gewissen ist erleichtert. Es war die richtige Entscheidung, ihn auf meiner Flucht mit mir zu nehmen.
Wenn mir Albert betrübt zu sein scheint, machen wir ausgedehnte Spaziergänge durch die Wälder. Ich zeige ihm dann meine Lieblingsplätze und erzähle ihm von der Geschichte des Waldes und von den Schicksalen der Menschen darin. Oft mache ich ein Schläfchen unter einem der mächtigen alten Bäume, während Albert auf einem von Flechten überzogenen Granitblock sitzt und stundenlang in den Wald hineinhorcht. Nie habe ich ihn so entspannt gesehen, in der kurzen Zeit zwischen unserer Wiederbegegnung und unserem Ausbruch.
Mein zweiter Mitbewohner ist ein alter Kater. Ich fand ihn, oder er mich, einige Wochen nach meiner Ankunft in der Hütte, in einem aufgelassenen Steinbruch, den ich nach einigen Stunden Fußmarsch in nordwestlicher Richtung entdeckte. Dem alten Kanal folgend, der einstmals als Holzschwemme gedient hatte, sah ich durch die Bäume einen hellen Flecken leuchten. Solche Erscheinungen sind zumeist eine Erkundung wert, auch wenn es sich oft lediglich um gestürzte und blankgeschälte Baumriesen, oder um eine der Wollsackformationen handelt, die man hier so zahlreich findet. Dieses Leuchten aber kam von eben jenem Steinbruch.
Auf drei Seiten ragten glatte Felswände gut fünfzehn Meter in die Höhe. Da und dort hatte der Same einer Birke oder einer Fichte in einem Spalt Erdreich genug gefunden, um zu einem kleinen Bäumchen heranzuwachsen, das auf seinem winzigen Felsvorsprung ein kärgliches Dasein führte, und wohl dazu verdammt war, in Wuchs und Stattlichkeit ewig hinter seinen auf flachem Boden wurzelnden Brüdern zurückzubleiben. Das Becken am Grund des Steinbruchs war mit Wasser gefüllt, das aufgrund des torfhaltigen Bodens aussah wie schwarzer Kaffee.
Ich ließ mich auf einem Felsbrocken nieder, der vom Ufer ein Stück in den Tümpel hineinragte, blickte auf das Wasser und wartete auf die Ohnmacht. Ich hatte nicht zu befürchten, bewusstlos in das Wasser zu fallen und zu ertrinken. Mittlerweile wusste ich, dass ich während meiner geistigen Abwesenheit, anders als bei einer herkömmlichen Ohnmacht, nicht meiner Körperspannung verlustig gehen und schlaff zu Boden sinken würde. Vielmehr fiel ich in eine Starre, behielt Gegenstände die ich in den Händen hielt, bei mir bis ich erwachte. Erst dann entglitten sie mir meist, weil ein Zittern durch meinen ganzen Körper lief.
So saß ich also auf jenem Stein, doch die Ohnmacht kam nicht. An ihrer Stelle tauchte ein Stück weißes Fell am oberen Rand der Felswand auf, strich entlang des Buschwerks, das die Kante in Besitz genommen hatte, um an deren Ende auf einem Felssporn als großer schwarzweißer Kater zu erscheinen.
Wir sahen uns ein Weilchen an während er sein Fell putzte, und als er offenbar beschlossen hatte, dass ich keine Gefahr für ihn darstellte, sprang er mit lässiger Eleganz von Felsvorsprung zu Felsvorsprung nach unten, machte nochmals kurz Halt um mich zu mustern, und mit einem letzten großen Satz hatte er den Boden erreicht. Dort setzte er sich abermals, in gebührendem Abstand zu mir, auf einen flachen Felsen und kratzte sich ausgiebig hinter den Ohren.
Sein Körperbau ähnelte dem einer Wildkatze. Ein stämmiger, gedrungener Rumpf mit kurzem buschigen Schwanz. Sein überwiegend weißes Fell mit schwarzen Flecken auf Rücken und Kopf, verrieten mir, dass er, zumindest teilweise, von einer Hauskatze abstammen musste. Er hatte es sicher nicht leicht in den Wäldern, mit dieser wenig zur Tarnung geeigneten Färbung, und doch schien er wohlgenährt. Ihn als schön zu bezeichnen wäre maßlose Übertreibung gewesen, aber er strahlte so viel Kraft und Selbstvertrauen aus, dass es einem Löwen zur Ehre gereicht hätte. Sein Körper war von Narben übersät und sein linkes Auge zeugte von einem heftigen Kampf.
Er war mir auf Anhieb sympathisch. Ein Außenseiter unter den Tieren des Waldes, womöglich ein Ausgestoßener aus der Welt der Menschen, der in den Wäldern Zuflucht und Existenz suchte. War nicht ich in einer ähnlichen Situation?
Ich war hungrig nach dem langen Marsch, holte Brot, Speck und mein Messer aus der Tasche, und als er die blitzende Klinge sah, spannte sich sein Körper plötzlich wie zur Flucht bereit. Ich hielt das Messer in die Höhe und der Kater beruhigte sich allmählich wieder. Ich zeigte ihm den Ranken Speck, schnitt eine dicke Scheibe davon ab und warf sie ihm zu. Nichts geschah. Der Kater beäugte den Leckerbissen, machte aber keine Anstalten sich ihn zu schnappen. Ich selbst war weniger zurückhaltend, steckte mir ein anständiges Stück in den Mund und begann zu kauen. Erst dann regte sich das Tier, erhob sich und ging zögernd und mich im Auge behaltend auf den Speck zu, schlug seine Fänge hinein und trug seine Beute mit Würde zu seinem Sitzplatz zurück. Dann drehte er sich zweimal um sich selbst und legte sich hin. Den Speckstreifen zwischen den Vorderpfoten haltend, begann er ebenso gemächlich daran zu kauen wie ich. Wieder erinnerte er an eine große Raubkatze, die eine Büffelhälfte zwischen den Pranken hält und zufrieden die Mahlzeit genießt.
Wir beendeten schließlich unser gemeinsames Mahl. Um noch vor Sonnenuntergang bei der Hütte zu sein, musste ich aufbrechen. Es tat mir leid, diese seltsame Begegnung beenden zu müssen, und insgeheim hoffte ich, der Kater würde sich mir anschließen.
Ich habe Katzen immer bewundert und ihre Gesellschaft war mir stets lieb. Ein Haustier würde unsere seltsame Wohngemeinschaft vervollständigen, aber ich hegte wenig Hoffnung, dass dieses Tier, das mehr Wild- als Haustier zu sein schien, mir nach Hause folgen würde. Zumindest aber wollte ich nicht ohne Abschied gehen. Also ging ich langsam auf ihn zu, rechnete jeden Moment damit, dass er mit langen Sätzen eilig davon springen oder mir sogar mit Hilfe seiner zweifellos scharfen Krallen meine Grenzen bewusst machen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Ich war bis auf wenige Schritte an ihn herangegangen, hockte mich hin und streckte meine Hand aus, und zu meiner Überraschung und nicht geringen Freude, kam er ohne zu zaudern heran und legte seinen großen Schädel in meine Handfläche. Ich kraulte ihn hinter den Ohren und er schnurrte laut und hingebungsvoll. Vielleicht kannte er diese Berührungen einer Menschenhand aus Kindheitstagen und vermisste sie, einsam wie er hier in diesen feindlichen Wäldern lebte, immer Gefahr laufend, von einem Luchs schwer verletzt oder von den Wölfen und Bären, die in diesen Tagen wieder häufiger durch die Gegend streiften, getötet zu werden.
Dass mir der Abschied nun noch um vieles schwerer fiel als zuvor, lässt sich denken, und nochmals hoffte ich, er würde mir folgen. Aber als ich ihm das letzte Mal sanft auf den Rücken klopfte, wie man einem alten Freund auf die Schulter klopft, aufstand und mich entfernte, ging er zurück auf seinen Stein und sah mir nach.
Erfreut ob der unerwarteten Begegnung und doch schweren Herzens, ging ich meines Weges, zurück zur Hütte, zurück zu Albert. Manchmal blickte ich mich um, doch kein weißes Fell folgte mir im Schatten der Bäume, und ich begrub meine Hoffnung, nahm mir aber vor, bald wieder an den Steinbruch zurückzukehren, um diese neue Freundschaft zu pflegen.
Schließlich war es Albert, der den Kater in unsere Hütte brachte.
Es passiert nicht oft, dass Albert die Lichtung ohne meine Begleitung verlässt. Die dunkle Wand der Bäume ist wie eine Grenze für ihn. Wenn er mir aber nachfolgt und wir den Wald betreten, zeigt sich keinerlei Angst in seinem Gesicht. Manchmal folgt er auch aus eigenem Entschluss einem Eichhörnchen, das sich kurz am Waldrand zeigt, um dann wieder mit leichten Sprüngen zwischen den Bäumen zu verschwinden, oder er erhascht einen Blick auf den braunen Rücken eines Rehs, das ein paar Gräser von der Lichtung naschen will. Aber diese Ausflüge sind selten und enden für ihn meist nach wenigen Schritten. Sobald ihn das kühle Dunkel des Waldes umfängt und das Objekt seiner Neugierde sich seinem Blick entzieht, wendet er sich um und strebt wieder der hellen Lichtung zu. Ich habe mir angewöhnt, die hohen Gräser entlang des Waldsaums auf einigen Metern Breite unberührt zu lassen, während ich das Gras auf der übrigen Fläche der Lichtung einigermaßen kurz halte. Manchmal lasse ich auch Albert ein Weilchen die Sense schwingen, und tatsächlich führt er sie besser als ich. Offenbar hat er darin einige Übung. Allerdings muss ich ihn dann und wann bremsen, ansonsten würde er wohl den Wald gleich mit mähen.
Der Grasstreifen am Waldsaum hat den Vorteil, dass ich die Spuren die Albert dort hinterlässt, auch noch einige Stunden nach seinem Durchschreiten erkennen und so feststellen kann, wo er Wald betreten hat. Das zeigt mir die Richtung, die er, sollte er wirklich einmal tiefer in den Wald eindringen, eingeschlagen hat. Im Wald selbst sind die Möglichkeiten des Vorwärtskommens eingeschränkt. Dichter Bewuchs, Felsformationen, Windwurf, steiles Gelände oder andere Hindernisse, lassen eine Wegwahl zumindest grob erahnen. Im Winter wäre es ohnehin kein Problem, den Spuren zu folgen, solange nicht ein Schneesturm wütet, was allerdings hier oben keine Seltenheit ist. Aber wenn es heftig stürmt, bleibe ich ohnehin in der Hütte und kann ein Auge auf Albert werfen.
Ich kann und will seine Freiheit nicht beschränken, kann ihn nicht einsperren oder anketten, selbst in seinem gegenwärtigen Zustand, und schließlich weiß ich, dass Albert meist dem Licht zustrebt. Zudem kenne ich jede Lichtung im Umkreis von vielen Kilometern. Und schließlich ist da noch Wenzel, der diesen Wald kennt wie kein anderer, und der, wenngleich seine Nase auch meist vom Schnaps betäubt ist, ihn überall aufspüren könnte. Aber zu Wenzel später, vorerst erzähle ich von jenem Tag, als Albert den Kater, oder richtig herum, der Kater Alfred nach Hause brachte.
Ich hatte ein Mittagsschläfchen gehalten, während mein Hausgenosse auf der Bank vor der Hütte saß und in seiner Welt versunken war. Als ich erwachte und nach draußen ging, fand ich seinen Platz leer. Das Messer mit dem er gerne Späne aus Fichtenscheiten schneidet und sein begonnenes Werkstück, lagen auf der Bank, nur von Albert war nichts zu sehen. Ich versuchte es erst mit Rufen, während ich den Waldrand abschritt, um seine Fährte aufzunehmen.
Im Norden, hinter der Hütte, entdeckte ich schließlich niedergetretenes Gestrüpp, und obwohl ich nicht sicher sein konnte, ob es von Albert oder doch von einem Wildtier stammte, folgte ich der Schneise in den Wald. Ich ging etwa hundert Schritte nach Norden, einem schwach ausgetretenen Pfad mit erst kürzlich geknickten Pflanzen folgend, der schließlich durch eine schlammige Pfütze führte, in der ich die deutlichen Abdrücke eines Rehs entdeckte. Ich machte kehrt und ging schnellen Schrittes zurück zur Hütte. Als ich die Lichtung betrat und mich anschickte, den Saum auf weitere Spuren zu untersuchen, trat aus dem Schatten des gegenüberliegenden Waldrandes Albert – und ihm voran der Kater.
Albert folgte ihm, mit leicht vorgestreckten Händen, als wollte er jeden Moment nach ihm greifen. Der Kater schien aber keine Angst vor diesem Schicksal zu haben, vielmehr machte es auf mich den Anschein, als würde er Albert hinter sich herlocken. Mal wurde er langsamer oder blieb stehen und blickte sich um, um dann, wenn Albert ihm zu nahe kam, wieder weiter zu laufen.
Auf diese Weise gelangten die beiden bis zur Hütte. Ich stand staunend am Waldrand und kam schließlich näher, während Albert sich auf seine Bank setzte, sich sein Messer und das Fichtenscheit nahm und weiter Späne schnitt. Der Kater legte sich ins Gras und beobachtete mich. Ich ging zu ihm, setzte mich vor ihn hin, blickte abwechselnd zu ihm und zu Albert und staunte wortlos vor mich hin. Schließlich kraulte ich das Tier und begrüßte es, holte ein großes Stück Speck aus der Küche und legte es vor den Kater, der die Gabe wie selbstverständlich annahm.
Er war mir also doch gefolgt nach unserer ersten Begegnung und musste sich in der Nähe der Hütte herumgetrieben haben. Albert hatte ihn wahrscheinlich entdeckt und war ihm in den Wald nachgegangen, woraufhin der Kater ihn zurückgelockt hatte. Oder aber der Kater hatte Albert durch Zufall im Wald entdeckt und ihn nach Hause gebracht, aber selbst dann musste er gewusst haben, wo Albert zu Hause war. Oder der Kater war eben jenen unergründlichen Sinnen gefolgt, die Katzen nachgesagt werden, und hatte Albert auf den richtigen Weg geführt. Es würde ein ewiges Geheimnis zwischen den beiden bleiben.
Auf jeden Fall nimmt Albert seither kaum mehr Notiz von seinem Retter, wenngleich er ihn auch ausdauernd streichelt, wenn sich der Kater auf seinen Schoß legt oder an seiner Seite auf der Bank sitzt. Seit diesem Tag ist der Schwarz-Weiße ein regelmäßiger und gern gesehener Gast in unserer bescheidenen Hütte und Alberts treuer Begleiter auf seinen kurzen Alleingängen in den Hochwald.
6
Die Vertriebenen
Der Winter naht. Nur noch wenige Wochen, dann werden die weißen Monate anbrechen. Die Landschaft wird in gedämpfte Stille getaucht sein, die Bäume werden Bärte aus Eis tragen, und die Kälte wird die Zeit einfrieren. Vorerst aber toben die Herbststürme.
Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie sich die Stimmung verändert, wenn der böhmische Wind kommt. Vom einschläfernden Rauschen an den letzten warmen Tagen des Jahres, wechselt er plötzlich zu einem bedrohlichen Fauchen, das er über die Baumwipfel atmet, die sein Bemühen, furchteinflößend aufzutreten, durch ihr Knarzen und Knirschen noch unterstützen. Dann lässt sich kaum ein Plätzchen finden, das tatsächlich windstill ist. Der Wind rast aus den Ebenen im Norden gegen die Berghänge und über die Pässe, verwirbelt sich an den Kämmen, taucht ab in die Täler und zerstiebt in alle Richtungen, dringt in den Wald ein und sucht hinter dem Felsen, hinter dem man Zuflucht zu finden hofft, nach seinem Opfer.
Meine Streifzüge durch den Wald werden jetzt kürzer. Der Wind bringt auch die Kälte mit sich, und ich bin alt genug, um mich an einem warmen Feuer im Ofen erfreuen zu dürfen. Albert und ich bereiten Brennholz vor, sägen die langen Stämme, hacken sie zu Scheitern und schlichten sie an die Wand der Hütte. Als der Wind zunimmt und unangenehm wird, füllen wir zwei Körbe mit Holz und bringen sie in die Hütte um anzuheizen und die zunehmende Feuchtigkeit aus den Mauern zu vertreiben.
Alberts Zustand verschlechtert sich. Hat er, als wir hierher kamen, gelegentlich noch ein paar Worte gesprochen, wenn zumeist auch ohne erkennbaren Sinn, so wird er jetzt immer schweigsamer. Er wirkt aber dennoch nicht unglücklich. Im Gegenteil, es scheint, als würde er lediglich immer genügsamer werden. Er sitzt da und schaut aus dem Fenster, oder er liegt auf seinem Bett und schaut den Weberknechten an der Decke zu, die dort ihre Arbeit verrichten, und er selbst verrichtet jene einfachen Arbeiten, die ich ihm auftrage. Er hört mir noch immer aufmerksam zu, wenn ich ihm meine Geschichten, oder die Geschichten der Anderen erzähle, und doch habe ich manchmal den flüchtigen Eindruck, als sähe er durch mich hindurch, als befände er sich, ähnlich mir selbst, in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit.
Ich spüre, dass jemand sich der Hütte nähert. Ich weiß auch wer. Die Tür öffnet sich, ein paar rotbraune Blätter wehen herein, und ihnen folgt eine Gestalt in klobigen Schnürstiefeln, einem zerschundenen Ledermantel und olivgrünen Arbeitshosen. Unter der grauen ausgebeulten Strickmütze blicken mir aus einem wettergegerbten Gesicht, das von einem grauen Bart umrahmt wird, zwischen zusammengekniffenen Lidern zwei braune lebhafte Augen entgegen. Das ist Wenzel, neben Albert und dem Kater mein einziger Vertrauter in diesen Zeiten.
Er nimmt die Mütze vom Kopf und schüttelt ihn, und das strähnige graue Haar, von einzelnen schwarzen Strähnen durchzogen, verteilt sich in wirrer Unordnung um sein Haupt. Als er den prallen Rucksack in die Ecke stellt und sich aus dem Mantel schält, verteilt sich der ihn stets begleitende Geruch von Schnaps und feuchter Erde in der Stube. Auch das ist Wenzel. Ihm gehört dieser Flecken Erde und die Hütte die darauf steht.
»Was sitzt´s denn in der Stubn wie die Sacklpicka, traut´s euch nicht raus wegen dem bisserl Wind?« begrüßt er uns.
»Servus Wenzel! Kannst ja draußen essen wenn´s dir herinnen zu stark nach Schnaps riecht!« entgegne ich.
Das war das Stichwort. Wenzel öffnet seinen Rucksack und stellt fünf Flaschen Selbstgebrannten auf den schweren Eichentisch. Wenzel brennt alles was er in die Finger bekommt zu Schnaps – Obst, Beeren, Getreide, Kartoffel, sogar Rüben und Karotten hat er schon versucht.
»Weil man ja auf seine Gesundheit schaut. Wenn ich das Zeug schon nicht fress, dann sauf ich´s zumindest!« hat er gesagt, und es auch getan, denn Wenzel ist kein verschwenderischer Mensch.
Trotz seines unbändigen Verlangens nach Schnaps und seines hohen Alters, das meines noch übertrifft, strotzt Wenzel vor Gesundheit. Wenn er nicht gerade in seiner Brennerei tätig ist oder irgendwelche zwielichtigen Geschäfte zu erledigen hat, dann zieht er durch die Wälder. Früher mit seinem Pferd, heute zu Fuß. Auch er findet dort seinen Frieden, und nicht nur diesen. Wenzel findet alles und jeden der sich im Wald verirrt. Er kennt jedes Sumpfloch, jede verborgene Höhle und jeden gefallenen Baum im Umkreis von zehn Kilometern. Wenzel ist tatsächlich der Waldgeist, oder hat den Geist des Waldes zumindest ebenso in sich aufgesaugt, wie die unzähligen Liter Schnaps die er gebrannt hat.
Trotz seiner Sauferei ist er ebenso treu und zuverlässig wie außergewöhnlich. Ich erinnere mich gut an jenen Abend, als wir auf der höchsten Kuppe des Waldes auf einem Felsblock saßen, und er mir seine Geschichte erzählte. Wir blickten dabei nach Nordosten, dorthin, wo sein Leben begann.
Der Junge beobachtet das geschäftige Treiben das auf dem Platz vor der Kirche vor sich geht. Das halbe Dorf hat sich versammelt. Er sieht die Umrisse der Leute durch den dichten Nebel. Aufgeregt gestikulierend stehen die wenigen Männer beisammen, die Frauen, manche weinen, stehen etwas abseits, haben die Kinder an sich gedrückt, als bestünde die Gefahr, sie zu verlieren, obwohl sie doch hier zuhause sind und jeden Winkel des Dorfes kennen, in dem sie tagtäglich zusammen spielen. Keines der Kinder hat sich jemals hier verirrt, selbst die Umgebung ist ihnen vertraut, die Wälder und ihre Bäche, die Wiesen ringsum. Warum laufen sie nicht über den Kirchplatz wie sonst auch? Der kleine Wenzel, der zu dieser Zeit noch einen anderen Namen trägt, versteht die ganze Aufregung nicht. Die Mutter liegt krank in ihrem Bett und niemand hat ihm bisher erklärt, warum das ganze Dorf herumläuft wie aufgeschreckte Hühner. Immer wieder hört er die Worte Abschied und Ungewissheit heraus, und kann sich nicht erklären, warum die Menschen deshalb so aufgeregt sind.





























