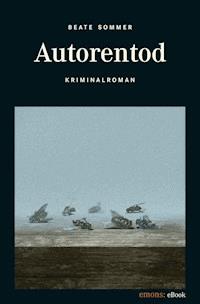Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Personenschützer wird in einen schmutzigen Handel mit Kunstobjekten verwickelt, der ungeahnte Folgen für ihn und seine Familie hat. Eine Lehrerin muss sich gegen eine Schmutzkampagne zur Wehr setzen, die sie vernichten soll. Wer steckt dahinter und nimmt sogar in Kauf, dass ein Schüler stirbt? Auch Anwältin Marilene Müller steht unter massivem Druck, denn ein Stalker bedroht die Menschen, die sie zu ihrer Familie gemacht hat. Und weder ihr noch der Kripo Leer bleibt genügend Zeit, um die tödlichen Fäden zu entwirren . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beate Sommer, geboren 1958 in Schleswig-Holstein, verbrachte ihre Kindheit auf Wanderschaft, darunter drei prägende Jahre in den USA. Nach dem Abitur zog sie der Liebe wegen nach Hessen, wo sie zusammen mit ihrem Mann eine Buchhandlung gründete. Die Leidenschaft für Kriminalromane führte zum Wechsel ans andere Ende der »Nahrungskette Buch«, und so lebt sie heute als freie Autorin in Leer.www.beatesommer.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Sabine Lubenow/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-851-9 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Prolog
Schwer zu sagen, wer an jenem Morgen zuerst aufwachte.
War es die Amsel, diese eine, die irgendwo leise zwitscherte, den neuen Tag zu begrüßen? Kaum mehr als ein Flüstern zunächst, hallo, hallo, ist denn da wirklich noch gar niemand wach?, dann hartnäckiger, lauter, raus aus den Federn mit euch!, und endlich ertönte hier und da ein zögerliches Tschilpen aus sicherlich jungen Kehlen, schnell lauter werdend und fordernd, das Geschrei, dem die Alten nie etwas entgegenzusetzen haben, bis schließlich die ganze Schar krakeelte, dass es eine wahre Pracht war. Dabei war es noch nicht einmal hell, nur eine Andeutung von lichterem Grau war mit viel gutem Willen erkennbar, doch bald schon würde das strahlendste Blau den Himmel überkommen und ein ungetrübter Frühlingstag anbrechen.
Oder war es der Pendler am Anfang der Straße, der schlaftrunken mit der Hand nach dem Wecker schlug, sich aus dem Bett wälzte und nach einem neiderfüllten Blick auf seine leise schnarchende Frau ins Bad wankte? Der seine Morgentoilette mit halb geschlossenen Augen absolvierte, bis die Rasierklinge ihm in die Wange fuhr, ein rotes Rinnsal im weißen Schaum hinterlassend– und wo, verdammt, war der Alaunstift? Der sich zu guter Letzt mit ins Gesicht gepappten Klopapierschnipseln behalf, bevor er Unterwäsche und Socken anzog, Hemd und Anzug, alles ordentlich von seiner Frau bereitgelegt wegen seines Talents, farblich danebenzugreifen. Nur nicht die Schnipsel vergessen, nachher im Auto, beschwor er sich, es wäre nicht das erste Mal, dass er den Kollegen Anlass zur Häme bot. Die Haare noch, dann stieg er auf Zehenspitzen die Treppe hinab, nur die knarrende Stufe betrat er absichtlich mit seinem ganzen Gewicht. Er wusste, seine Frau würde unwirsch vor sich hinmurmeln, sich umdrehen und weiterschlafen. Er erreichte die Küche und stellte die Kaffeemaschine an.
Oder waren es die Mütter, die in dieser Straße wohnten und aus ihren Betten schnellten, als hätten sie nicht seit Jahren zu wenig geschlafen? Binnen Sekunden von null auf Höchstform, ein paar Spritzer Wasser ins Gesicht, Treppensprint, Frühstück machen, bevor das große Chaos einsetzte: Mama, wo ist…?, Mama, kann ich…?, Mama, ich brauch…! Pausenbrote schmieren, Kleidung zurechtzupfen, vielleicht Schuhe schnüren, und mittendrin der Ehemann, ebenfalls auf der aussichtslosen Suche nach diesem oder jenem.
Die Kinder jedenfalls waren es nicht, denn in dieser Straße wuchs keines ohne Mutter auf. Vierzehn Schulkinder, je nach Alter von Wecker oder Mutter aus dem Bett getrieben, schnell, schnell, schnell, ein Ton wie auf dem Kasernenhof, ab ins Bad und Zähne putzen, dein Vater muss auch noch rein, und zwar plötzlich. Schultaschen, die eines Sherpas bedurften, wurden polternd die Treppen hinabgeschleift, Frühstück verschlungen oder verweigert, und dann setzten all die mütterlichen Ermahnungen ein, die, flögen sie zum Fenster hinaus, einen unermüdlichen, doch nicht eben homogenen Chor bildeten, eine absonderliche Mischung aus Opern- und albernem Kinderchor, der gelegentlich abglitt in Kriegsgeheul: Vergiss deine Mütze nicht! Hast du deine Sportsachen, das Referat, die Hausaufgaben eingepackt? So gehst du mir aber nicht aus dem Haus!– beantwortet mit einem genervten »Mann ey«, wenn nicht überhaupt nur mit indigniertem Augenverdrehen.
Auf jeden Fall war der Pendler der Erste, der das Haus verließ. Er schloss sorgfältig die Tür des Seiteneingangs hinter sich ab, öffnete den Kofferraum des Firmenwagens, warf seine Aktentasche hinein und knallte den Deckel mit Wucht zu, wissend, dass seine Frau davon wiederum nicht richtig wach würde, wohl aber vom prompt einsetzenden Gekläffe des Nachbarhundes, einer veritablen Töle, die neuerdings im Zwinger gehalten wurde. Er stieg in den Wagen, startete den Motor und setzte die Einfahrt zurück. Mit einem Blick in Rück- und Seitenspiegel stellte er sicher, ungehindert auf die Straße einschwenken zu können. Erst letzte Woche war der kleine Streber aus dem Haus am Ende der Straße, der immer viel zu früh zur Schule preschte, ihm mit seinem Rad ins Auto gerauscht und hatte den Zusammenstoß natürlich ihm angelastet. Auf eine Wiederholung der Auseinandersetzung mit dessen Mutter konnte er gut und gern verzichten. Er erreichte die Bundesstraße, die zur Autobahn führte, und gab Gas.
Als Nächstes waren die Schulkinder an der Reihe. Der vermeintliche Streber verließ zuerst das Haus, nicht weil er es kaum erwarten konnte, in die Schule zu kommen, er war eigentlich eher ein mittelmäßiger, unauffälliger Schüler, sondern weil ihm sehr daran gelegen war, zwei älteren Jungen nicht zu begegnen, und das aus gutem Grund. Kaum war er außer Sichtweite, taumelten die restlichen dreizehn hinaus, wie auf ein geheimes Signal hin. Sie wuchteten ihre Ranzen in die überdimensionierten Fahrradkörbe, sprangen auf ihre Räder und fuhren schlingernd los, sich zu kleinen, vom Alter diktierten Gruppen zusammenrottend, die die gesamte Breite der Straße einnahmen. Ihr Gejohle war weithin vernehmbar und geeignet, eine Vorstellung von Völkerwanderung zu bekommen.
Zwei, vielleicht drei Minuten später kehrte wieder Frieden ein in diese idyllisch anmutende Wohngegend. Väter senkten für einen Moment die Zeitungen, nur um sich kurz darauf abermals dahinter zu verkriechen, nicht ohne einen Blick zur Uhr, noch war Zeit, drei Minuten, fünf, höchstens zehn, dann mussten auch sie los. Mütter atmeten hörbar aus, setzten sich zum ersten Mal an diesem Morgen auf eine Tasse Kaffee oder Tee an den Küchentisch und langten, mangels Gesprächspartner, nach einem Teil der Zeitung oder starrten ermattet auf den Toaster, als würde der schon ausspucken, was ihm noch nicht gegeben war, wenn sie nur lange genug warteten.
So kam es, dass kein Anwohner sah, wie der Mann zum Wagen ging, und jemand, der in den Wagen eines anderen stieg, wäre hier auf jeden Fall beobachtet worden, obgleich er die Autoschlüssel deutlich sichtbar vor sich hertrug, wie um möglichen Verdächtigungen zuvorzukommen. Selbst derjenige, der ihm soeben die Schlüssel übergeben hatte, blieb nicht, um ihm hinterherzuschauen, sondern wandte sich ab und schloss die Haustür. Möglicherweise rettete ihm dies das Leben, zumindest aber bewahrte es ihn vor gravierenden Verletzungen. Denn in dem Augenblick, als der Mann die Fahrertür des Wagens aufzog, detonierte ein Sprengsatz, der ihn regelrecht zerfetzte.
Einen Monat zuvor
10
Das Quietschen des Tors zur Garage unter dem Haus warnte ihn. Andere würden es kaum registrieren, doch für ihn war es schon so lange das Signal, auf der Hut sein zu müssen, dass er es sogar im Schlaf wahrnahm. Hastig klappte er das Buch zu und stellte es zurück an seinen Platz im Regal, die Lücke im dritten Fach von oben, millimetergenau. Vorsichtshalber wischte er mit der Hand über die gesamte Länge des Regals, damit keine Schleifspuren ihn verrieten. Was eigentlich Quatsch war, er hatte erst vorhin Staub gewischt, aber sicher war sicher. Er klopfte sich lautlos die Hände ab und huschte in die Küche. Gerade noch rechtzeitig.
»Wieso bist du nicht fertig!«
Er gab sich erschrocken und ließ den Kartoffelschäler fallen. »Ihre Frau hat gesagt, dass ich erst anfangen soll, wenn Sie zurück sind«, stammelte er.
Massa grunzte.
Er hielt den Atem an. Manchmal war das Grunzen der Anfang von einem Wutanfall, doch er hatte Glück. Heute nicht. Massa verschwand aus der Küche. Er lauschte, hörte, wie im Flur die Aktentasche auf dem Boden aufschlug, die Wohnzimmertür gegen den Türstopper ploppte und am Ende Glas gegen Flasche klirrte. Vorläufig würde er ihn in Ruhe lassen. Beruhigt wandte er sich wieder den Kartoffeln zu.
Er mochte das schabende Geräusch, das leise Klappern des Schälers, und er war schnell mittlerweile. Überhaupt war ein ziemlich guter Koch aus ihm geworden, auch wenn niemand sonst das je zu ihm sagen würde. Im Gegenteil, das Lob, den Dank bekam immer nur sie. Sie, für die ihm noch kein passender Name eingefallen war. So wie Massa. Missus war zu nett für sie, und nett war sie nicht, auch wenn sie längst nicht so schlimm war wie ihr Mann.
Massa würde ausrasten, wenn er wüsste, wie er ihn bezeichnete. Und woher er das Wort kannte. Niemand wusste, dass er richtig gut lesen konnte. Kochrezepte bat er die Frau vorzulesen, und dabei fuhr er mit dem Finger die Zeilen nach, stockte bei langen Wörtern, so wie Jan, als er in die Schule gekommen war. Damals, als alles anders geworden war.
Bis dahin hatte er geglaubt, Jan sei sein Bruder, und er hatte Massa Vater genannt, die Frau Mutter. Sie hatten Jan bevorzugt, aber wie sehr, hatte er erst später verstanden. Damals hatte er so getan, als wenn ihm das nichts ausmachen würde. Immerhin hatte Jan alles mit ihm geteilt, Essen, Kleider, Spielsachen. Nur Liebe nicht, davon gab’s einfach nicht genug für zwei.
Eine eigene Schultüte, eigene Bücher hatte er gar nicht erst erwartet, trotzdem hatte er sich auf den ersten Schultag gefreut. Jan und er waren die Treppe runtergestürmt, Jan war schneller gewesen, schon zur Tür raus, da hatte Massa ihn im Genick gepackt. »Du bleibst hier«, hatte er gesagt. »Morgen dann?«, hatte er gefleht. »Nein, du wirst überhaupt nicht zur Schule gehen.« Und dann hatte er ihn in den Keller gezerrt und dort eingesperrt. Er hatte nicht geheult, da noch nicht, er hatte geglaubt, dass das gar nicht sein konnte. Jeder ging schließlich zur Schule, etwa nicht?
Am Abend war Massa gekommen. Mit einer Decke, einem Stück trockenem Brot und einer Flasche Wasser. »Du bist nicht unser Kind«, hatte er gesagt und dass seine richtige Mutter ihn nicht habe behalten wollen, sondern ihn an böse Männer verkauft habe. Es war nicht viel, was er wusste: Massa habe ihn vor denen gerettet und sehr viel Geld dafür bezahlt. Das sei ein ganz großes Geheimnis, und niemand dürfe davon wissen. Also dürfe ihn auch nie jemand sehen, sonst könne der ihn verraten. Das Schlimmste sei nämlich, dass er keine Papiere habe, und das sei, als würde es einen gar nicht geben und außerdem streng verboten.
»Wenn die Polizei dich findet, schickt sie dich zurück zu den bösen Männern. Das willst du doch nicht, oder?«, hatte Massa gefragt.
Er hatte stumm den Kopf geschüttelt. Manchmal fragte er sich, ob er das auch gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, dass der böseste der bösen Männer direkt vor ihm gestanden hatte. Aber das hätte wohl auch nichts geändert.
»Ab jetzt wirst du unser Diener sein«, hatte Massa gesagt. »Wir mussten so viel Geld für dich bezahlen, jetzt bekommst du die Gelegenheit, das abzuarbeiten.«
Er hatte das erst viel später verstanden. Trotzdem hatte er genickt und gehofft, er könnte wieder hinauf in sein Zimmer. Aber Massa war gegangen und hatte ihn eingeschlossen.
Niemand war gekommen, um ihn zu holen. Niemand hatte ihn besucht. Nicht mal Jan. Drei Tage lang. Da hatte er geheult. Und wie. Erst am vierten Tag war Massa wiedergekommen. Von da an hatte Massa ihm immer morgens, wenn Jan in der Schule war, beigebracht, was ein Diener machen musste. Wenn Massa weg war, hatte die Frau das gemacht. Das war nicht ganz so schlimm gewesen, weil sie nicht so wütend wurde, wenn er was falsch machte. Nur nachmittags oder in den Ferien, eben wenn Jan da war, durfte er ganz normale Sachen machen. Deswegen war es auch so schlimm gewesen, als Jan ins Internat gekommen war, weil er ab da im Keller wohnen musste und überhaupt keine normalen Sachen mehr machen durfte.
Heute war er der perfekte Diener. Sie nannten ihn Adam. Er war ungefähr fünfzehn Jahre alt und unsichtbar.
***
Bestechlich? Sie? Ausgerechnet sie?
Verdammt, sie war diejenige, die sich schon so oft in die Nesseln gesetzt hatte, weil sie die Beurteilungen ihrer geschätzten Kollegen hinterfragte. Die um jeden einzelnen Schüler kämpfte, wenn sie glaubte, dass seine schlechte Note allein auf seiner Herkunft fußte und nicht auf seinen Fähigkeiten. Sie hatte keine Angst vor Auseinandersetzungen, nie gehabt, seit jeher war sie gegen Ungerechtigkeit vorgegangen, sogar während ihres Referendariats. Andere hatten da nicht anecken wollen und die Klappe gehalten, sich angebiedert bei Mentoren und Ausbildern, ihnen nach dem Mund geredet um des Examens willen und weil man leichter in den ach so erlauchten Kreis der Kollegen aufgenommen wurde, wenn man sich unter der Keule ihrer Erfahrung duckte und dabei nicht mal mit der Wimper zuckte. Sie nicht!
Es war ihr egal, dass mittlerweile unverhohlenes Stöhnen einsetzte, wenn sie sich während der Konferenzen auch nur zu Wort meldete und den geheiligten frühen Feierabend gefährdete. Selbst schuld, Hohlköpfe!, dann mussten sie sich eben im Vorfeld mehr Gedanken machen, statt in die unterste Schublade ihrer Vorurteile zu greifen. Mittlerweile tuschelten sie auch, hinter vorgehaltener Hand, gerade laut genug, um alle in ihrer Umgebung aufhorchen zu lassen; man konnte förmlich sehen, wie die Ohren gespitzt wurden und Neugier in den Augen blitzte. Es focht sie nicht weiter an. Sie wusste, was sie konnte und was nicht, sie war beliebt bei ihren Schülern. Und das war vermutlich der Hauptgrund für diese elende Misere.
Steckten Björn und Uwe dahinter? Ursprünglich, als sie nach der Babypause an diese Schule gekommen war, hatten die beiden sich hilfsbereit gegeben, wenn auch auf eine reichlich gönnerhafte Weise. Sie hatten sich geradezu überschlagen, sie im Kollegium einzuführen, sie aufzuklären über Seilschaften und Antipathien und all die ungeschriebenen Gesetze, die zu befolgen ihr das Leben gewiss vereinfacht hätte. Drauf gepfiffen. Sie war schließlich kein Neuling mehr gewesen, nicht frisch von der Uni und beeinflussbar. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie das begriffen und versucht hatten, ihren verletzten Stolz mittels Anmache wiederaufzurichten. Sie hatte sie abblitzen lassen. Hormongesteuerte Schwachköpfe! Seither galt sie als frigide. Was nicht unbedingt von Nachteil war.
Mit alldem konnte sie umgehen. Sie war stark, das hatte schon Klaas erkannt, als er sie mit Babybauch sitzen gelassen hatte. Es waren immer die starken Frauen, die verlassen wurden, nicht die Mäuschen, die sich verloren glaubten ohne ihren vermaledeiten Ritter in scheppernder Rüstung. Aber das jetzt, das war zu viel! Das kratzte an ihrer Ehre, ihrem Selbstverständnis.
Obendrein würde es ihr Leben völlig auf den Kopf stellen. Versetzungsantrag! Mein Gott, wie leichtgläubig konnte man sein? Wieso fiel Kraushaar auf ein bloßes Gerücht herein? Ein vollkommen aus der Luft gegriffenes und zudem unlogisches Gerücht. Sie bevorzugte niemanden, nicht mal die absoluten Lieblingsschüler, die es natürlich gab, auch wenn sie das vehement abstreiten würde, eher im Gegenteil, die nahm sie erst recht hart ran. Sie galt als streng, aber gerecht, da konnte man jeden Schüler fragen, und sie hatte Erfolg. Die besten Schüler der Schule besuchten ihre Kurse.
Wo kam diese schwachsinnige Behauptung her? Kraushaar hatte sich gewunden, das tue nichts zur Sache, er müsse an den Ruf der Schule denken, bla, bla. Sie konnte sich nicht recht vorstellen, dass Björn oder Uwe dahintersteckten. Ihre Schikanen waren direkter, offener, ihnen lag daran, dass sie mitbekam, woher der Wind wehte. Und wenn, hätten sie sich eine glaubwürdigere Diffamierung überlegt. Nur– glaubwürdig oder nicht, es funktionierte.
Sophie Barkowitz ließ den Kopf gegen das Lenkrad sinken. Die Hupe gellte ohrenbetäubend, und sie fuhr augenblicklich wieder hoch, sich vergewissernd, dass niemand Zeuge ihrer Schmach war. Nein, der Parkplatz war verwaist bis auf Kraushaars Uralt-Corsa. Ein demonstratives Understatement, erkannte sie auf einmal, wo sie bislang nur amüsiert gewesen war: Der Fahrer dieses Wagens ist erstens unterbezahlt und zweitens absolut unbestechlich.
Sie hingegen, sie lebte gut und hatte nie einen Grund gesehen, diese Tatsache zu verbergen. Klaas zahlte Unterhalt für Roman, freiwillig sogar, und mit der Überschreibung des Hauses auf sie hatte er seinen Ablass erwirkt. Ihre Fixkosten waren überschaubar, es stellte also kein Problem dar, sich und Roman anständig zu kleiden, statt wie Kraushaar in fadenscheinigen Klamotten aus dem letzten Jahrhundert rumzulaufen. Und ihr Porsche Cabrio– wäre sie ein Mann, niemand würde ihr den übelnehmen. Ungerecht, das war es. Wütend donnerte sie mit den Fäusten aufs Lenkrad. Ups, schon wieder die Hupe. Ein Konzert für Kraushaar?, wie verlockend, doch sie widerstand dem Impuls, lieber nicht. Stattdessen klappte sie die Sonnenblende herunter und schaute in den Spiegel.
Tränen. Hatte sie gar nicht wahrgenommen. Heulerei hatte sie sich abgewöhnt. Nachdem Klaas ihr damals seine neue Beziehung gebeichtet hatte, netterweise in den Ferien, ansonsten super Timing, hatte sie ihren positiven Schwangerschaftstest in der Hosentasche verschwinden lassen und Klaas rausgeworfen. Dann hatte sie das letzte Mal geweint, sie hatte gar nicht mehr aufhören können; ein zwei Tage währender Exzess. Ihr Vorrat an Tränenflüssigkeit war damit versiegt, hatte sie angenommen, und seither achtete sie darauf, gar nicht erst in Beziehungen oder Situationen zu stolpern, die sie erschüttern könnten. Bis heute.
Und nun? Sie wischte mit dem Zeigefinger die verlaufene Wimperntusche fort. Mit mäßigem Erfolg. Ach, was soll’s, dachte sie, sie musste Oskar ohnehin ins Bild setzen. Vielleicht wusste er ja sogar Rat. Wenn er sie verurteilte, und das würde sie erkennen, ganz sicher, dann würde sie auch unter diese Beziehung einen Schlussstrich ziehen. Es war nicht so, dass sie ohne ihn nicht leben konnte, auch wenn es ganz nett war, einen Mann im Haus zu haben. Im Bett, gab sie zu. Roman jedenfalls würde jubeln. Vielleicht wäre es das wert.
***
Er sollte nicht hier sein.
Der Gedanke kam Westerkamp wie aus dem Nichts in dem Augenblick, als er das Tor passierte. Er stellte den Wagen links in eine kleine Bucht neben der gekiesten Auffahrt und schaltete den Motor aus. In der Stille hörte er, wie sich hinter ihm das Tor schloss. Ihm war schwummerig, ein Gefühl, das ihm vollkommen fremd war. Ach was, tat er sein Unbehagen ab, wahrscheinlich waren ihm die Matjesfilets vorhin nicht bekommen.
Eigentlich hatte er heute frei, und er wünschte, er hätte Fraukes Genöle nachgegeben und wäre mit ihr ins Kino gegangen, statt für Folkert einzuspringen. Aber er hatte keinen Bock auf Schnulze gehabt, und so war ihm der Anruf gerade recht gekommen. Im Übrigen sprang Folkert oft genug für ihn ein, wenn mal was war, hatte sich sogar extra mit Kira vertraut gemacht, damit sie ihn auf den Runden begleiten konnte. Kira, die neuerdings im Zwinger hausen musste, weil die Weiber Schiss hatten. So ein Schwachsinn.
Kira tat niemandem was, wenn er es nicht befahl. Sie sah bloß gefährlich aus. Er wandte den Kopf nach hinten, wie um sich zu vergewissern. Doch, sie war schon furchteinflößend, vor allem, wenn sie das Maul aufmachte. Dobermann-Schäferhund-Mix, fast komplett schwarz. Perfekt für ihn. Sie gehorchte aufs Wort und bellte praktisch nie. Bloß wenn Nachbar Priewe zur Arbeit fuhr, dann drehte sie kurz durch, nervig, aber er konnte nichts dagegen tun. Insgeheim stimmte er Kira zu. Priewe war schräg. Das morgendliche Gebell war wahrscheinlich der wahre Grund für ihre Verbannung nach draußen. Von wegen Angst. Kiras seelenvoller Blick verriet das Lamm in ihr.
Es klopfte an der Seitenscheibe, und er schnappte nach Luft. Als der Strahl einer Taschenlampe ihn traf, hatte er sich gerade wieder unter Kontrolle. Kira knurrte. Er hob die Hand vor die Stirn, nickte und stieg aus. »Westerkamp«, sagte er übers Dach des Autos hinweg, »ich vertrete Folkert Dübbelde. Seine Tochter hatte einen Unfall.«
»Zeigen Sie mir Ihren Firmenausweis.«
Westerkamp zog die Brieftasche aus der Innentasche seiner Lederjacke, klappte sie auf und reichte sie übers Auto hinweg.
Der Mann schnappte sie sich mit der linken Hand, während er Westerkamp mit der rechten direkt ins Gesicht leuchtete. Der Abgleich von Foto und Mensch dauerte entsprechend lange, doch endlich warf er die Brieftasche in hohem Bogen zurück.
Westerkamp sprang und fing, mehr Glück denn Können. Seine Qualitäten lagen anderswo, trudelnde Frisbees zu fangen gehörte nicht dazu, schon gar nicht im Dunkeln. Seine Kiefer mahlten beim Versuch, sich ein Grinsen zu verkneifen.
»Ich erwarte fünf Parteien. Die Kennzeichen der Fahrzeuge habe ich Ihnen ausgedruckt. Sobald alle da sind, bleibt das Tor verschlossen und Sie drehen Ihre Runden. Keiner rein, keiner raus, bis ich es sage. Ihre Handynummer?«
Westerkamp ging um den Wagen herum, nahm Zettel und Fernbedienung entgegen und leierte seine Nummer runter. Der Typ schien über ein gutes Gedächtnis zu verfügen, denn er schrieb weder mit, noch gab er die Nummer irgendwo ein. Er wandte sich ab, grußlos natürlich, und eilte Richtung Haus. Villa, verbesserte Westerkamp sich. Ein zweistöckiger riesiger Klotz, in dem eine ganze Klinik Platz hätte. Nicht zum ersten Mal überlegte er, wieso Reichtum und Manieren sich so oft ausschlossen. Er knallte die Fahrertür zu und öffnete die Heckklappe.
»Na, dann wollen wir mal, Süße«, sagte er und ließ Kira raus. Wie gewöhnlich tollte sie ein paarmal ums Auto herum, und wie immer musste er dabei an das Kuckuck-Spiel denken, von dem Kim früher nie genug bekommen hatte. Er schnappte sich seine LED-Taschenlampe, ein Weihnachtsgeschenk von Frauke, die seinen Wunsch nur widerwillig erfüllt hatte, mächtig teuer war das Ding, aber es hatte locker sechshundert Meter Reichweite. Dann drückte er den Kofferraum zu und klopfte sich zweimal kurz aufs Bein. Kira bremste mitten im Lauf und ließ sich hechelnd neben ihm nieder. »Brav«, lobte er und schaute auf die Liste, um sich die Kennzeichen einzuprägen.
Normalerweise bekam er seine Kunden kaum zu Gesicht. Seinen Dienst versah er meist als Wachmann. In einem ausgeklügelten Rotationssystem lief er Patrouille auf dem Gelände von Firmen, in denen nachts keiner arbeitete, oder er sah bei den Bonzen nach dem Rechten, wenn die verreist waren. Gelegentlich setzte der Chef ihn als Türsteher ein, wenn jemand anderes ausgefallen war. Am liebsten waren ihm die Promi-vor-Fans-schützen-Einsätze, aber die kamen nur sehr selten vor. Musste an seinem Äußeren liegen, die Security-Leute waren eher gelackt, aber mit jeder Grippewelle stiegen seine Chancen wieder.
Scheinwerfer. Er blickte auf. Hamburg. Nummer zwei der Liste. Trotzdem glich er das Kennzeichen noch einmal ab, bevor er das Tor öffnete und den Weg freigab. S-Klasse, modifiziert, wenn er sich nicht täuschte, kam ihm länger vor als normal. Demnach war die Geldbörse des bebrillten Silberhaarigen, der am Steuer saß, vermutlich ziemlich prall. Ungewöhnlich, dass so einer so weit ohne Chauffeur reiste.
Der nächste Wagen traf ein, noch bevor er das Tor wieder geschlossen hatte. Nummer fünf, das war der mit dem Diplomatenkennzeichen, ein Phaeton, sein Neid wuchs, und es wunderte ihn fast, dass der Hausherr nicht von ihm verlangt hatte, seinen ollen Ford zu tarnen. Der trübte das Gesamtbild doch gewaltig. Seufzend trat er wiederum beiseite. Kira wenigstens bedauerte ihn und fiepte verständnisvoll. Dieser Gast war wesentlich jünger als der vorige, glaubte er, allerdings handelte es sich um einen Spanier oder so was, da konnte man sich schon mal vertun.
Er hatte sich kaum wieder umgewandt, da fuhr schon der nächste Wagen vor, der erste auf der Liste, Berliner Kennzeichen, ein fetter SUV, derX5 von BMW, diesmal eine Frau am Steuer, mittelalt, wilde schwarze Mähne. Irgendwie hatte sie was Gehetztes im Blick, fand er, aber vielleicht war das auch bloß Einbildung.
Zuletzt und zeitgleich trafen die Nummern drei und vier ein, Tiefstapler vergleichsweise, eine C-Klasse aus Bonn und einA4 aus Hannover, am Steuer jeweils Männer um die sechzig, schätzte er, die ihn keines Blickes würdigten.
Westerkamp betätigte abermals die Fernbedienung, steckte sie in die Jacke und verfolgte, wie das locker zwei Meter zwanzig hohe, mit Zinnen bewehrte Tor, das in eine ebenso hohe, vierzig Zentimeter tiefe Sichtsteinmauer eingelassen war, ruckelnd ins Schloss glitt. »Keiner rein, keiner raus«, murmelte er kopfschüttelnd. In der Tat, hier würde weder ein ungebetener Gast hereinkommen, noch ein unfreiwilliger hinaus.
Ein Lichtreflex erregte seine Aufmerksamkeit. Was war das? Er traute seinen Augen nicht und schaltete die Lampe ein. Nicht nur waren hochstehende Glasscherben in die Mauerkrone eingelassen, nein, darüber war außerdem Stacheldraht gespannt. Die reinste Festung. Das war nun echt extrem, erst recht für Ostfriesland, wo kaum jemand überhaupt Zäune aufstellte.
Er schwenkte den Lichtstrahl einmal ringsum. Das Gelände war riesig, überwiegend Rasenfläche, ein paar kahle Bäume, in denen er Bewegungsmelder erkannte, enttarnt über den Winter und im Sommer eher nutzlos. Die Mauer war von einer Kirschlorbeerhecke weitgehend verdeckt, vom Sicherheitsstandpunkt aus keine so gute Idee, sollte es doch mal jemand wagen, rüberzuklettern. Das Gleiche am Haus. Wuchernde Rhododendren konnten Schutz vor Entdeckung bieten und obendrein als Kletterhilfe dienen, jedenfalls für Leichtgewichte. Nicht sein Problem.
Es war kalt, eine unangenehme, feuchte Kälte, die schnell in die Knochen kroch. Westerkamp zog den Reißverschluss seiner Jacke bis unters Kinn hoch, streifte Handschuhe über und setzte sich die Wollmütze auf: Tarnkappe, sein rotes Haar war das reinste Leuchtfeuer. So aber würden er und Kira mit der Dunkelheit verschmelzen. Das war sein Job, auch wenn er eigentlich gar nicht hier sein sollte. Schon wieder dieser blöde Gedanke. »Bei Fuß«, sagte er leise und schaltete die Lampe aus. Kira sprang auf.
Es war wichtig, ein Gespür für das Areal zu bekommen, darum wollte er einmal das gesamte Grundstück umrunden, nur so konnte er eventuelle Schwachstellen entdecken, die er dann besonders im Auge behalten würde. Er wandte sich zunächst nach rechts, und seine Schritte quietschten leise im nassen Gras.
Er bewegte sich im gleichbleibenden Abstand von etwa zwei Metern an der Mauer entlang, die im schwachen Licht, das vom Haus herdrang, harmlos wirkte, eine Lärmschutzwand, nichts sonst, und diesen Zweck erfüllte sie hervorragend: Von außen drang kaum ein Laut hierher, dabei war das Gelände keineswegs völlig abgelegen und die Hauptstraße nicht weit entfernt. Trotzdem musste er sich richtig anstrengen, um den Verkehrslärm überhaupt zu hören, er brummte nicht lauter als sein altersschwacher Radiowecker. Ab und an raschelte etwas im Gebüsch, doch solange Kira nicht mit ihrem Darf-ich-hinterher-Blick zu ihm aufschaute, kümmerte ihn das nicht weiter, eine Maus, vielleicht eine Ratte, nichts, worauf einer von ihnen scharf wäre.
Er trat in ein Erdloch, strauchelte und fing sich wieder, marschierte stumm fluchend weiter. Kira hechelte, und ihrer beider Atem stieg in Schwaden hoch, geradeso, als würden sie rauchen. Pfeife, stellte er sich vor, und ein Lachen grummelte in seinem Bauch. Kira bleckte die Zähne und grinste.
Wieder stolperte er. Eine Sandkiste, verdammt, er sollte besser aufpassen. Kira nickte zustimmend. Er rappelte sich auf und klopfte sich den nassen Sand von Händen und Hose. Komisch, mit Kindern hätte er dies Haus irgendwie nicht in Verbindung gebracht. Tatsächlich würde er den Hausherrn nicht mal mit einer Ehefrau in Verbindung bringen, aber so konnte man sich täuschen. Seine Menschenkenntnis schien allmählich zu verkümmern, kein Wunder, er traf selten genug auf Übungsobjekte. Er bedauerte das nicht wirklich. Frauke und Kim, das war schon in Ordnung so, und selbst die bekam er fast nur an seinen freien Tagen zu Gesicht. Das würde sich in Bezug auf seine pubertierende Tochter bald ändern. Kim schlug in letzter Zeit schwer über die Stränge, und er fürchtete, es würde nicht mehr lange dauern, bis sie, genau wie er, erst zum Frühstück heimkam.
Meine Fresse, war das Grundstück riesig, er befand sich gerade mal parallel zur rückwärtigen Seite des Hauses. Bislang hatte er weder Sicherheitslücken noch verdächtige Bewegungen entdeckt. War auch nicht zu erwarten. Er drehte bei. Aus antrainierter Gewohnheit heraus vermied er es, in den Radius eines Bewegungsmelders zu geraten. Er klopfte sich aufs rechte Bein. Kira ließ sich augenblicklich zurückfallen und blieb ab jetzt dicht hinter ihm.
In einem seltsamen Schlingerkurs steuerten sie auf die Terrasse zu, deren Ausmaße die seines kompletten eigenen Hauses übertrafen. Er wusste nicht, ob Terrasse wirklich das richtige Wort war für diesen von einer Balustrade umgebenen– Freisitz? Vier Stufen führten hinauf zu ausladend unter Hauben buckelnden Gartenmöbeln, die vermutlich irgendwas mit Lounge hießen. Kira stupste ihn in die Kniekehle und schnüffelte, als nehme sie Witterung auf. Er schüttelte knapp den Kopf.
Der Raum, der zur Terrasse zeigte, war hell erleuchtet, aber menschenleer. Sah aus wie der Empfangsbereich eines Luxushotels, fand er, nicht sonderlich gemütlich, bis auf das lodernde Kaminfeuer, für wen auch immer das brannte, denn es war niemand zu sehen.
Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte er ein kurz aufblitzendes Licht. Er wandte den Kopf in die Richtung. Nichts zu sehen. Seltsam. Hatte er sich das nur eingebildet? Er schlich ein paar Meter nach rechts, Kira auf den Fersen.
Die Vorhänge hinter den Fenstern hier waren bis auf einen schmalen Spalt zugezogen, und das Licht im Innern brannte gleichmäßig. Überdies schien ihm der Blitz von weiter unten gekommen zu sein. Behutsam schob er die Büsche auseinander und ging in die Knie. Vor ihm befand sich der Lichtschacht zu einem vergitterten Kellerfenster. Er rüttelte am Gitter. Felsenfest. Aber da war es wieder, nur ganz kurz, und es sah aus wie von einer Taschenlampe. Handelte es sich um den Hausherrn, der Nachschub aus dem Weinkeller holte? Quatsch, der würde das Licht einschalten, statt mit einer Taschenlampe herumzugeistern. War einer der Gäste auf Abwegen?
Westerkamp stand wieder auf. Die Fenster oben waren zu hoch, als dass er hineinschauen konnte, um sich zu vergewissern, ob die Gesellschaft vollzählig war. Er musterte die Rhododendren. Da, der dritte, der überragte ihn um mehr als einen Meter, war mehr Baum als Strauch und schien ihm einigermaßen kräftig, aber würde er seinem Gewicht standhalten? Er hatte keine Wahl. Die Blöße würde er sich nicht geben, dass unter seiner Verantwortung etwas aus dem Ruder lief.
Er schaute zurück zu Kira. Die legte die Ohren an. Kein Wunder, sie hielt nichts von Bäumen, die ihrer Erfahrung nach allzu oft durchgeknallte Katzen beherbergten. »Bleib«, flüsterte er. Kira ließ sich auf den Bauch fallen und legte die Pfoten über die Augen. Auch recht, dachte er, keine Zeugen.
Vorsichtig scharrend, damit nicht etwa ein knackender Zweig ihn verriet, setzte er einen Fuß vor den anderen und schob sich sachte an den vorgelagerten Sträuchern vorbei, bis er den Baum erreichte. Er inspizierte den ausgreifend gewachsenen Stamm und kletterte in die unterste Gabelung. Reichte nicht. Um einen Teil seines Gewichts zu verlagern, ließ er sich mit den Händen gegen die Hauswand fallen, bevor er mit den Füßen die nächsthöhere Gabelung erklomm und zuletzt die Hände Stück für Stück Richtung Fensterbank bewegte, wie im Turnunterricht früher, schoss es ihm durch den Kopf, Schubkarre, bloß ohne Partner.
In einer verqueren Art von Liegestütz prüfte er blitzschnell, ob jemand in seine Richtung schaute, und zog den Kopf wieder ein. Nein, die Herrschaften waren beschäftigt, alle sechs Personen standen im Kreis um einen Tisch herum, die Köpfe gesenkt, bis auf den des Hausherrn, und der stand mit dem Rücken zum Fenster. Sah aus, als ob sie beteten. Unwahrscheinlich, befand er, dafür würde man wohl kaum eine so weite Anreise auf sich nehmen.
Es ging ihn nichts an, keiner der Gäste streunte auf Abwegen, also befand sich jemand anderes im Keller. Trotzdem konnte er es nicht lassen, den Kopf noch einmal zu heben, ganz langsam diesmal, und durch den schmalen Spalt zu spähen. Ja, dachte er, vielleicht handelte es sich in der Tat um eine Art Gebet, um Anbetung vielmehr, die Mienen der Anwesenden wirkten äußerst andächtig, wie sie betrachteten, was auf dem Tisch stand: altertümlich wirkende Figuren und Gefäße, eine Maske, irgendwas Südamerikanisches, glaubte er, und in der Mitte thronte eine recht große Skulptur, ein sitzender Typ mit einer Schüssel auf dem Kopf.
Ein Geräusch wie von reißendem Stoff drang zu ihm, hatte Kira sich–, nein, verdammt, der Ast, auf dem er stand, gab langsam nach. Schubkarre rück- und abwärts war schwieriger als andersherum, seine Hände rutschten die Fassade runter, schon wieder ein neues Paar Handschuhe, hörte er Frauke meckern, als wenn das sein größtes Problem war, er verlor das Gleichgewicht und jeden Halt und rollte sich im Fallen zusammen. Der Aufprall hörte sich in seinen Ohren an wie Donnergetöse.
Kira war augenblicklich bei ihm und schleckte ihm das Gesicht ab. Er drückte den Hund an sich, versuchte, ihrer beider Hecheln unter Kontrolle zu bekommen, und blieb, wo er war. Hoffentlich schützten die nichtsnutzigen Sträucher ihn wenigstens vor Entdeckung, sollte jemand den Lärm gehört haben. Er zählte Sekunden, zwei Minuten müssten reichen, nichts geschah, lieber noch eine draufgeben. Denn eins war klar: Es war besser, nicht ausgerechnet unter dem Raum erwischt zu werden, in dem garantiert irgendein illegaler Handel stattfand. Warum sonst sollte man einen solchen Aufwand treiben?
Plötzlich ging im Keller wieder das Licht an. Der reinste Scheinwerfer. Ausgerechnet jetzt! Er robbte näher an den Schacht, um ihn abzudecken, tastete mit der linken Hand nach Halt und griff ins Leere. Sein Oberkörper klappte vornüber in den Schacht. Er erstarrte, lauschte, lauschte länger– von oben war nichts zu hören. Schließlich drehte er den Kopf und fand sich Auge in Auge mit einem vielleicht vierzehnjährigen Jungen, der den Zeigefinger auf den Mund presste und wild den Kopf schüttelte, dass seine zu langen dunklen Haare um ihn herumflogen.
Wer, ich? Westerkamp war verwirrt und zeigte auf sich. Der Junge nickte und legte wie zum Gebet die Hände aneinander, die Augen riesig vor Angst und Verzweiflung. Okay, dachte er, zeigte im Gegenzug auf den Jungen und hielt sich selbst den Finger vor den Mund. Er hob in stummer Frage die Brauen. Wieder nickte der Junge, so übereifrig, dass er beinahe hätte lachen müssen.
Nur war das Ganze überhaupt nicht komisch. War der Junge im Keller eingesperrt, eine drastische Erziehungsmaßnahme, die er seinem Auftraggeber durchaus zutrauen würde, oder befand er sich bloß auf verbotenem Terrain? Er musste in Ruhe darüber nachdenken, und zwar bestimmt nicht hier. Er fuhr sich beschwichtigend mit dem Finger über die Lippen, sie sind versiegelt. Der Junge grinste über beide Backen und verschwand aus seinem Blickfeld. Dann ging das Licht aus.
Dunkelheit. Stille. Fast war Westerkamp geneigt zu glauben, dass er sich die Begegnung nur eingebildet hatte. Er wünschte, es wäre so. Die grenzenlose Erleichterung im Gesicht des Jungen, bevor er sich abgewandt hatte, raubte ihm die Fassung. Und würde ihm den Schlaf rauben.
***
Marilene Müller schloss die Spülmaschine und schaltete sie ein. Den übrig gebliebenen Topf füllte sie mit Wasser und öffnete das Fenster für eine schnelle Zigarette. Lothar war kurz nach oben gegangen, um Eierlikör fürs Eis zum Nachtisch zu holen, ohne sei es ungenießbar, und Gerrit hatte sie hinüber ins Wohnzimmer gescheucht. Heute war sie mal dran gewesen mit Kochen, und das beinhaltete auch den Küchendienst. Wahrscheinlich hatten Lothar und Gerrit das gemeinsam ausgeheckt, damit sie nicht auf die Idee kam, die beiden hielten sie für eine schlechte Köchin. Aber ihr Lob war ziemlich kärglich ausgefallen.
Seit sie vor einem knappen Jahr nach Leer gezogen war, hatte sich Marilenes Leben grundlegend verändert. In jeder Hinsicht. Die Anwaltskanzlei, die sie übernommen hatte, war von Anfang an gut gelaufen, so gut, dass sie kaum zum Luftholen gekommen war. Daher war sie sehr erleichtert gewesen, als ihr Vermieter Lothar Männle im Januar die Arbeit in ihrer beider Sozietät aufgenommen hatte, eine Verbindung, die sie nicht vorbehaltlos eingegangen war, die jedoch reibungslos funktionierte.
Sie arbeiteten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und kamen sich dadurch nicht in die Quere, sondern ergänzten sich. Die Mittagspause verbrachten sie meist gemeinsam, mal in seinem, mal in ihrem Büro, sodass sie einander stets auf dem Laufenden halten konnten. Rein beruflich, klar. Renate Heeren, ihre gemeinsame Sekretärin, sah die Sache zunehmend anders. Und der Rest der Welt wohl auch, vermutete sie, obgleich sich bislang niemand aus der Deckung gewagt hatte, zumindest nicht mit Worten.
Theoretisch lebte sie allein in dieser Wohnung oberhalb der Kanzlei. Blanke Theorie, wahrlich, denn allein war sie kaum noch. Lothar hatte die Wohnung im zweiten Stock bezogen und Gerrit, sehr zu ihrer Verwunderung, angeboten zu bleiben, bis dessen Berufspläne konkrete Form erlangten. Oder falls. Gerrit hatte sein Informatikstudium geschmissen und schien ganz zufrieden mit diesem Männer-WG-Arrangement. Ihr schwante, dass sein verlängerter Aufenthalt nichts mit Nestflucht oder Selbstfindung zu tun hatte, sondern im Gegenteil mit Nestbau, denn Gerrit war heftig verliebt.
Immerhin machte er sich nützlich. Nicht nur hatte er Lothars Wohnung komplett renoviert, mittlerweile übernahm er auch die meisten Rechercheaufgaben für sie beide, unterstützte Renate und ging einkaufen. Neuerdings kochte er sogar und gar nicht schlecht, obwohl das Neuland für ihn war, da seine drei Schwestern ihn seit jeher bemuttert hatten. Überdies hatte Gerrit die Herrschaft über sämtliche Elektronik an sich gerissen, was nicht ganz unproblematisch war, denn er beharrte auf einem hohen Sicherheitsstandard und hatte einen Haufen neuer Passwörter eingestellt, die sich kein Mensch merken konnte.
Marilene drückte ihre Zigarette aus, schloss das Fenster und stellte die Glasschälchen bereit. Sie gähnte, der Tag war anstrengend gewesen. Gerichtstage laugten sie meist mehr aus als andere. Aber vielleicht hinkte sie auch nur ihrer eigenen Entwicklung hinterher: von der Einzelgängerin zum Herdentier, von der nicht ausgelasteten Anwältin zu einer, die über Langeweile beileibe nicht klagen konnte. Kein Wunder, dass sie ständig so erledigt war. Alles war noch ungewohnt, und das galt besonders für dies schräge Gefüge, das sich hier zusammengefunden hatte. Es kam ihr vor wie Vater-Mutter-Kind-Spielen mit eigenwilliger Wohnungs- und Rollenverteilung. Dabei waren sie allesamt Stümper auf diesem Gebiet.
Die Flurdielen knarrten und kündigten Lothars Rückkehr an. Sie füllte Eis in die Schälchen und trug sie hinüber.
»Was um Himmels willen machst du da?«, fragte Lothar, der in der Wohnzimmertür stehen geblieben war.
Marilene stellte sich auf die Zehenspitzen und lugte ihm über die Schulter. »Ich schließe mich der Frage an«, sagte sie irritiert.
Gerrit saß auf dem Fußboden, die Kiste mit den unsortierten, nie in Alben eingeklebten Fotos vor sich, daneben die mit den Negativstreifen aus früheren Jahrzehnten.
»Es geht mir nicht aus dem Kopf«, sagte Gerrit. Er hielt einen weiteren Streifen gegen das Licht, kniff die Augen zusammen und legte ihn, sichtlich enttäuscht, auf einen wachsenden Stapel. »Weißt du noch«, er schaute Marilene nicht im Mindesten verlegen an, »als du mir dieses Foto gezeigt hast, von dir und Olaf? Du hast dich nicht dran erinnert, dass es das überhaupt gab. Vielleicht hat er es manipuliert.«
»Du hättest sie fragen müssen«, tadelte Lothar ihn.
»Nachher hätte sie Nein gesagt, was dann?«, entgegnete Gerrit. »Wenigstens hab ich’s nicht heimlich gemacht, ist doch auch was. Außerdem bin ich diskret, ich guck gar nicht richtig hin.«
»Ha!«, lachte Lothar. »Du weißt überhaupt nicht, was diskret ist. Außerdem mangelt es deiner Aussage an elementarer Logik. Wie willst du was finden, wenn du nicht hinschaust?«
»Glaub mir, den Fettklops finde ich, wenn es ihn hier denn wirklich gibt. Ist das okay?«, wandte sich Gerrit an Marilene.
»Fettklops?« Lothar schnitt eine übertrieben angewiderte Grimasse.
»Jugendsünde«, winkte Marilene ab. »Ich kann mich eh nicht daran erinnern, mit dem zusammen gewesen zu sein. Aber die Fotos… Meinetwegen such weiter«, gab sie nach, »ich weiß bloß nicht, was die Erkenntnis bringen soll.«
»Konkret nix, stimmt schon.« Gerrit kratzte sich am Kopf. »Aber wenn ich recht habe, zeigt es, dass Olaf nicht die Computer-Niete ist, für die er sich ausgegeben hat. Außerdem würdest du echt in meiner Achtung steigen, Jugendsünde hin oder her.«
»Ich glaub, ich ruf Paul mal an die Tage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer noch keine Spur von ihm gibt.«
»Da hätte er dich längst angerufen. Oder mich, um genauer zu sein«, entgegnete Gerrit.
»Stimmt auch wieder.« Marilene stellte die Schälchen auf den Tisch und bedeutete Lothar, für die alkoholhaltige Verzierung zu sorgen.
Im Grunde konnte sie verstehen, dass Gerrit nicht lockerlassen mochte. Er war im November von einem Hund dermaßen schwer verletzt worden, dass er mehrere Tage im Koma gelegen hatte. Olaf war dafür verantwortlich gewesen, wie die Polizei ermittelt hatte. Leider war es Olaf gelungen, zu fliehen, und seither war er wie vom Erdboden verschluckt. Sie wünschte, es wäre so.
Er war heimlich in ihrer Wohnung gewesen, sie wusste bis heute nicht, warum und wie oft, er hatte sich in ihr Leben gedrängt. Nach anfänglicher instinktiver Abneigung hatte sie ihn sogar als recht angenehm und vor allem als hilfsbereit empfunden. Selten so getäuscht. Okay, das stimmte nicht, sie hatte bloß gehofft, derlei mit ihrem Umzug hinter sich gelassen zu haben. Stattdessen hatte sie diesen Stalker sozusagen aus Wiesbaden hierher mitgebracht.
»Ich schätze, er hat sich falsche Papiere besorgt.« Gerrit rutschte auf dem Hosenboden an den Tisch heran, schnappte sich eins der Schälchen und begann zu löffeln, was ihn nicht daran hinderte, weiterzusprechen. »Ein Olaf Grünberger taucht jedenfalls nirgends auf. Hast du der Kripo eigentlich erzählt«, wandte er sich an Marilene, »dass Olaf angeblich lange in Australien gelebt hat? Vielleicht bringt ein Amtshilfeersuchen Ergebnisse. Könnte ja sein, dass er jetzt auf die Papiere von damals zurückgegriffen hat.«
»Ich glaub nicht«, sagte Marilene, »ich ruf Paul morgen wirklich an.«
»Ich komm nicht drüber weg, dass ich auf den reingefallen bin.«
»Das geht uns allen so«, stimmte Marilene zu. »Sogar mein Vater macht sich rar. Er glaubt wirklich, dass das Zusammentreffen mit Olaf im Restaurant damals Zufall war und nichts passiert wäre, wenn er sich nicht zuvor mit ihm angefreundet hätte. Dabei war das wahrscheinlich genau umgekehrt: Olaf hat sich an ihn rangemacht, um mir näherkommen zu können. Hat ja auch geklappt. Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls«, schränkte sie ein. »Am schlimmsten für meinen Vater ist, glaube ich, dass er sich in seiner Berufsehre gekränkt fühlt.«
»Kann ich mir vorstellen«, sagte Lothar, »doppelt schwer für einen ehemaligen Richter.«
»Er hatte ein ausgesprochen gutes Gespür, die Schurken von den Unschuldigen zu unterscheiden. Ich glaube, er hat gegen sich selbst gewettet. Mir ist da mal ein Zettel in die Finger geraten, auf dem er eine statistische Auswertung notiert hat, Trefferquote neunzig Prozent. Aber wehe, einer von euch lässt je durchblicken, dass ich davon weiß.« Marilene belegte Gerrit mit einem strengen Blick.
Gerrit hob die Hand zum Schwur. »Keine Bange, dies Geheimnis nehme ich mit–«
»Ganz schlechte Redewendung«, würgte Lothar ihn ab.
»Stimmt«, Gerrit gab sich zerknirscht, »wo doch Marilene so abergläubisch ist.«
»Ich?«, entrüstete sie sich. »Du spinnst.«
»Hättest du jetzt etwa nicht auf Holz geklopft?«
»Doch, aber du sitzt zu weit weg«, entgegnete Marilene.
»Autsch.« Gerrit zog den Kopf ein. »Was ist mit Leitern, gehst du drunter durch? Oder schwarze Katzen, meidest du sie? Und was ist, wenn der Dreizehnte auf einen Freitag fällt, hm?«
»Ist mir alles wurscht, ehrlich gesagt.«
»Na, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dauernd irgendwelchen Psychopathen in die Quere kommst.«
»Und du meinst, das lässt sich verhindern, wenn ich ab sofort die Fugen im Pflaster meide?«
»Weiß man’s? Du glaubst doch auch an so übersinnlichen Kram wie Gedankenlesen, da wäre das doch naheliegend.«
»Aah«, Lothar dehnte die Silbe, »daher weht der Wind. Das ist nicht im Geringsten übersinnlich.«
»Dann kann man es lernen?«
»Wer hindert dich?«, fragte Lothar ungerührt.
Gerrit ließ den Kopf am Hals abknicken.
Ein Bild des Jammers, fand Marilene, darüber hinaus recht ungesund. Sie rieb sich an seiner statt den Nacken.
»Wisst ihr, es macht mich wahnsinnig, dass ich nichts über ihn finde. Und es muss ja was geben, sonst hätte er nicht Schiss gehabt, dass ich dahinterkomme«, sagte Gerrit.
»Ja, aber ich glaub, er wollte bloß verhindern, dass ich von seiner Gerichtsverhandlung erfahre. Und von der Therapie, zu der er verdonnert worden war. Er wusste, dass das seine Chancen bei mir zunichtegemacht hätte.«
»Da täuschst du dich«, widersprach Gerrit. »Jede Wette. Wenn das nämlich alles wäre, dann würde ich irgendeine Spur von Olaf Grünberger finden, in Australien oder sonst wo. Da mir das nicht gelungen ist, muss schon der Name falsch sein. Genauso wie sein jetziger.«
»Ich stimme dir zu«, sagte Lothar und stand auf, »aber das Rätsel werden wir heute nicht mehr lösen.«
»Och«, Gerrit blickte enttäuscht auf, »wir gehen schon? Ich bin noch nicht fertig. Außerdem wollte ich doch noch Feuer im Ofen machen.«
Feuer gibt’s heute nur unterm Hintern, dachte Marilene.
9
Er klappte das Buch zu und wuchtete es zurück an seinen Platz. Ein Lexikon. Normalerweise griff er nach dünneren Büchern, weil keiner die Lücke entdecken würde, wenn er die anderen in der Reihe ein wenig auseinanderschob. Außerdem passten dicke Bände nicht in sein Versteck hinter dem losen Stein, wo er die gestohlene Taschenlampe aufbewahrte, ein paar Kekse, eine halbe Tafel Schokolade. Aber das Wort Lexikon hatte ihn neugierig gemacht, und als sich ihm erschlossen hatte, was es bedeutete, las er darin, wann immer er konnte. Er fragte sich, ob das, was er aus dem Buch lernte, so gut war, wie in die Schule zu gehen. Wahrscheinlich nicht, es gab zu viel, wovon er keine Ahnung hatte. Computer zum Beispiel.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!