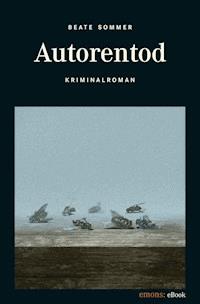Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor fünf Jahren hat Christian Körber ohne ein Wort des Abschieds Lebensgefährtin Lilian Tewes und Tochter Antonia verlassen. Nun hat Antonia einen anonymen Brief entdeckt, aus dem hervorgeht, dass er gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Als Körbers skelettierte Leiche gefunden wird, begibt sich Anwältin Marilene Müller auf eine gefährliche Suche: nach Lilian Tewes' geheimnisvoller Vergangenheit, nach Antonias leiblichem Vater - und nach Christian Körbers Mörder. Ein psychologisch dichter Kriminalroman, der unter die Haut geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Beate Sommer, geboren 1958 in Schleswig-Holstein, verbrachte ihre Kindheit auf Wanderschaft, darunter drei prägende Jahre in den USA. Nach dem Abitur zog sie der Liebe wegen nach Hessen, wo sie zusammen mit ihrem Mann eine Buchhandlung gründete. Die Leidenschaft für Kriminalromane führte zum Wechsel ans andere Ende der »Nahrungskette Buch«, und so lebt sie heute als freie Autorin in Leer.www.beatesommer.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2013 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.de/giftgruen Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-309-5 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Für meine Schwestern Petra und Martina
Prolog
Er wusste genau, was sie vorhatten, und sie spielte ihnen direkt in die Hände. Er lehnte mit dem Rücken am Tresen, ein Bier in der Hand, das zu ergründen er unter halb geschlossenen Lidern vorgab. Auf den ersten Blick mochte er gelangweilt wirken, bei näherem Hinsehen eher weltschmerzgeplagt, vielleicht nicht mehr ganz nüchtern. Tatsächlich hielt er sich schon lange an diesem einen Bier fest, nippte nur hin und wieder daran, und ihm entging nicht das Geringste.
Gerade war Kelling an der Reihe, sich danebenzubenehmen, Breitbach derjenige, der sich als Retter aufspielte. Sie wechselten etwa alle halbe Stunde die Rollen, eingeleitet durch ein kaum merkliches Nicken, und immer fiel es dem Retter anheim, für frische Getränke zu sorgen. Sie füllten sie gemeinschaftlich ab, und nicht mal der Barkeeper erkannte, was da vor seinen Augen geschah. Oder es war ihm egal. War es derselbe wie in den Jahren zuvor? Wahrscheinlich nicht, nahm er an, sonst würde der Gute doch wohl einschreiten angesichts dieses offensichtlichen Rituals, dieses Kampftrinkens mit ungleichen Mitteln. Wenigstens nachfragen, ob sie nicht doch genug habe. Aber da schau her, auf einmal gab es ein Wasser für sie. Da erwiesen sie sich gar als lernfähig, das hatte er nicht erwartet.
Betrunken sollte sie sein, jedoch nicht volltrunken wie die im letzten Jahr, die ihnen einfach weggekippt war, der ganze Spaß dahin und viel zu spät, um von vorn zu beginnen, weil jedes potenzielle Opfer sich längst anderen zugewandt hatte; auf Betriebsfeiern blieb niemand lang allein, nicht mal die Hässlichsten, vielleicht gerade die nicht.
Diese nun war keineswegs hässlich, ganz im Gegenteil, nur war ihr das anscheinend nicht bewusst. Blickte sie nie in den Spiegel und sah, wie ihr Haar glänzte, überzogen war von einem goldenen Schimmer mit dem zartesten Hauch von Rot darin? Wie edel ihr Gesicht geformt war mit dieser schmalen, geraden Nase, den hohen Wangenknochen, dem Mund, der wie geschaffen war fürs Lächeln? Wie einzigartig ihre Augen waren, die ihr Gesicht dominierten, so groß und vom tiefsten, klarsten Blau, das man sich nur vorstellen konnte? Allein ihr Passfoto hatte ihn dazu bewogen, sie einzustellen, sie sah absolut hinreißend darauf aus, die Gazelle, die den Löwen wittert. Ihr Abschlusszeugnis hätte ihr vermutlich nirgends eine Stelle beschert, er hatte es kurzerhand aus ihrer Mappe entfernt und sie zum Vorstellungsgespräch geladen. Eine Katastrophe auch das, trotzdem hatte er nicht widerstehen können und ihr eine Stelle im Lager angeboten.
Das war fast ein Jahr her. Kelling und Breitbach hatten erwartungsgemäß zu geifern begonnen, sobald sie ihrer ansichtig geworden waren, musste sie doch, gemessen an ihrem üblichen Beuteschema, unerreichbar erscheinen. Sie kamen nicht an sie heran. Es hatte Monate gedauert, bis sie von sich aus mehr als einen Gruß äußerte oder auch nur Fragen in vollständigen Sätzen beantwortete. Man sah sie selten, und wenn, dann gesenkten Kopfes und in Eile. Niemand wusste, wo sie ihre Pausen verbrachte, sie war in der Zeit einfach nicht aufzutreiben und auch nach Feierabend augenblicklich verschwunden.
Gestern hatte er sie gerade noch abgepasst, ihr eine letzte Gelegenheit geboten, ihrem Schicksal zu entgehen, und sie gefragt, ob sie heute Abend seine Tischnachbarin sein wolle. Danke, nein, hatte sie gesagt, ihn nicht mal angesehen dabei, und war fortgehuscht.
Sie hatte einfach nicht begriffen, wie ähnlich sie sich waren, mehr als das, sie waren seelenverwandt. Füreinander bestimmt. Mit jedem bloßen Nicken auf ein Kompliment, jedem Kopfschütteln auf eine Einladung, jeder weiteren stummen Zurückweisung all dessen, was er ihr zu Füßen hatte legen wollen, war seine Gewissheit stetig gewachsen. Jetzt war es zu spät.
Der Tanz begann. Breitbach forderte sie gestenreich auf, doch sie schüttelte nur den Kopf. Er gab den Clown, den dicken, verbeugte sich ungelenk vor ihr, sagte etwas, und sie lachte errötend hinter vorgehaltener Hand. Doch dann gab sie auf einmal nach, folgte ihm unsicheren Ganges auf die Tanzfläche und ließ es zu, dass er sie an sich zog, nicht zu nah, noch nicht, doch mit erkennbar festem Griff. Es dauerte ein paar Takte, bis sie ihre Füße sortiert hatten, dann steuerte Breitbach sie geschickt an den anderen Paaren vorbei. Bei der ersten Drehung haperte es noch etwas, die zweite klappte schon recht gut, und sie überließ sich seiner Führung und begann, sich wohlzufühlen, ihre Schultern strafften sich, und ihre Augen strahlten. Sie wirkte eifrig wie ein Kind, das zum ersten Mal Fahrrad fährt, und erhitzt, I fell into a burning ring of fire, schneller, die Band zog das Tempo an, und trotzdem kam sie mit, geriet nicht ein Mal ins Straucheln, als habe der Alkohol ihr Flügel verliehen, I went down, down, down, and the flames went higher, die Atmosphäre schien zu knistern. Breitbachs plumpe Hand ruhte auf ihrem Rücken, natürlich Breitbach, bei ihm konnte sie sich sicher fühlen, würde sie denken, die Dicken stellten niemals eine Gefahr dar, waren ja so genügsam und gemütvoll, und wenn nicht – einerlei, sie genoss sichtlich den Augenblick, und es schien ihm fast, als geschehe dies zum ersten Mal in ihrem Leben.
Ein Tusch, und sie lösten sich voneinander. Verhaltener Applaus hob an, bevor schon das nächste Stück einsetzte, hart und schnell diesmal, Sympathy for the Devil, zu wahr, um schön zu sein. Die Tanzfläche leerte sich fast vollständig, das Lied nichts, worauf sich schwofen ließe, und Breitbach und sie tanzten nun jeder für sich. Freilich gab Breitbach eher vor zu tanzen, wie er mit den Füßen auf den Boden tappte, halbherzig im Wechsel die Hände hob, ein schwitzender Bär, der als Zirkusattraktion nicht taugte. Sie hingegen schien in ihrem Element: nicht Wasser, Feuer! Sie warf die Arme in die Luft und stampfte mit den Füßen, wirbelte um ihre Achse herum und herum, ein eitler Derwisch, ihr Haar eine wehende Fahne von flüssigem Gold, tanze, Gerda, tanze, tanz die ganze Nacht, er konnte den Blick nicht lösen, sich nicht sattsehen an ihrer Darbietung und war ganz und gar hingerissen.
Er war nicht der Einzige. Die Männer begannen zu starren, Gier in den Augen, und die Frauen wandten sich kopfschüttelnd ab. Die Aufmerksamkeit, die ihr zuteilwurde, musste jeden Plan vereiteln, und nun kam Kelling ins Spiel, zu retten, was noch zu retten war. Eine Handbewegung in Richtung Band genügte, und sie wechselte abrupt zu etwas Langsamem, I will always love you, ein Hohn, denn Liebe war es nicht, was sie im Sinn hatten. Dennoch glitt sie wie selbstverständlich in Kellings Arme, und dieser Tanz war so unschicklich wie der vorige. Seine rechte Hand glitt tiefer und tiefer ihren Rücken hinab, er vergrub seinen Mund in ihrer Halsbeuge, und sie kam ihm arglos entgegen, schmiegte sich an ihn, der in ihren Augen das große Los sein musste, verglichen mit Breitbach jedenfalls.
Allmählich füllte sich die Tanzfläche wieder, und beinahe hätte er verpasst, wie Kelling ihr auf den Fuß trat. Sie stürzte. Die anderen Paare wichen zur Seite, und jetzt hatte er wieder freie Sicht. Sie lag gekrümmt auf dem Boden und hielt sich den Knöchel. Jetzt könnte er noch einschreiten, überlegte er, Kelling einfach zur Seite schieben und sie nach Hause bringen. Doch danken würde sie ihm das nur, wenn er ihr erzählte, was die beiden mit ihr vorgehabt hatten. Würde sie? Würde sie ihm überhaupt glauben? Er ließ den Moment verstreichen. Sie hatte nicht nur eine Chance gehabt und keine genutzt.
Kelling winkte Breitbach herbei, und gemeinsam halfen sie ihr auf und stützten sie auf dem Weg nach draußen, in die Klinik, wie Kelling behauptete.
Das Schauspiel war vorbei. Er forderte die Sekretärin vom Chef zum Tanz auf, um sein Desinteresse an dem Intermezzo zu bekunden, und blendete deren fades, anhimmelndes Geplapper einfach aus.
War sie zu betrunken, um zu begreifen, wie ihr geschah? Würde sie sich wehren, überlegte er, oder angstvoll Folge leisten? Vor morgen früh würden sie sie nicht gehen lassen, wusste er, und fast tat sie ihm leid. Doch letztlich war sie selbst schuld. Wenn sie ihn ein einziges Mal richtig angesehen hätte, statt durch ihn hindurch. Wenn sie nur auf einen seiner Briefe reagiert hätte. Er hätte sie niemals den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.
1
Der Brief hatte ihr Leben zerstört. Vollständig. Vom einen Moment auf den nächsten war nichts mehr so gewesen wie zuvor. Jetzt würde sie den Brief zerstören. Ihn verbrennen. Die Zeit war gekommen.
Sie setzte sich an den alten Sekretär ihrer Großmutter, zog die unterste Schublade heraus und tastete nach dem Umschlag. Nichts. Sie kniete sich hin und spähte hinein. Zu dunkel. Verwirrt zerrte sie auch die oberen beiden Schubladen heraus und vergewisserte sich, dass der Brief sich nicht irgendwie an den Unterseiten verfangen hatte. Raues Holz, kein Papier. Auch nicht in dem jetzt leeren Fach. Seltsam. Sie war sicher, dass der Umschlag hier sein musste. Aus unerfindlichen Gründen waren Schubladen immer kürzer als die Schränke, in denen sie steckten, und dieser Hohlraum war ihr wie das perfekte Versteck erschienen. Hektisch ging sie den Inhalt der Schubladen durch. Vergeblich. Der Brief war fort. Oder irrte sie sich und sie hatte ihn doch anderswo versteckt?
Vielleicht war es nicht so wichtig, dass sie ihn gerade heute verbrannte. Es wäre mehr ein symbolischer Akt gewesen, ein Freudenfeuer, nun, da die schlechten Zeiten vorbei waren. Pech. Dann musste das eben warten, bis sie Gelegenheit hatte, eine richtige Suchaktion zu starten. Hauptsache, Antonia war nicht darauf gestoßen. Aber warum sollte die nach etwas suchen, von dem sie nicht wusste, dass es existierte?, beruhigte sie sich. Nein, sicherlich trog sie nur ihre Erinnerung. Kein Wunder, sie war wirklich nicht bei Verstand gewesen.
Sie hatte sich schon an jenem Morgen schlecht gefühlt und angenommen, dass sie sich Christians Erkältung eingefangen hatte. Trotzdem war sie mit Antonia nach Oldenburg gefahren. Es war der letzte Ferientag gewesen, die Shopping-Tour lange versprochen, sie hatte es nicht übers Herz gebracht, Antonia zu vertrösten. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sie nur zu Hause gewesen wäre. Oder wenn Christian zur Arbeit gegangen wäre. Dann hätte nicht er den Briefkasten geöffnet, sondern sie selbst. Und einen Brief ohne Absender hätte sie bestimmt nicht für ihn liegen gelassen. Oder doch? Zumindest hätte sie die Chance gehabt, ihn zum Bleiben zu bewegen. Ihm wenigstens ein »Leb wohl« mit auf den Weg zu geben. Stattdessen war er einfach fort gewesen.
Sie rammte die Schubladen zurück an ihren Platz. Nicht heute, beschwor sie sich, sprang auf und lief hinüber ins Schlafzimmer.
Alles war dort, wo es hingehörte. Unterwäsche und Strumpfhose lagen auf dem Bett bereit. Die Pumps standen ordentlich davor, gestern hatte sie sie noch einmal poliert, nachdem sie die letzten zwei Wochen jeden Tag eine halbe Stunde geübt hatte, in ihnen zu gehen. Sie war solche Absätze nicht gewöhnt, aber es hatte genau dieses Paar Schuhe sein müssen, jedes andere hätte die Wirkung des Kostüms völlig zunichtegemacht.
Sie wirbelte herum und betrachtete zum tausendsten Mal, was Kostüm zu nennen der Sache einfach nicht gerecht wurde: ein schmales Bolerojäckchen und ein weit schwingender Rock, knapp oberhalb der Knie endend, aus einem seidig schimmernden blaugrünen Stoff, der perfekt zu ihren Augen passte. Viel zu teuer natürlich und absolut nicht alltagstauglich, trotzdem hatte sie nicht widerstehen können, eigens zwei der Münzen aus der Sammlung ihres Großvaters versetzen müssen. Das war es wert. Frank würde Augen machen. Sie grinste, ungefähr so breit, wie Antonia ihren Teddy angestrahlt hatte, als sie noch fast ein Baby gewesen war. Den Teddy gab es heute noch, er saß auf dem Bettkasten und bewachte den Schlaf ihrer Tochter. Das Grinsen war selten geworden. Wo trieb sie sich nur herum? Es war nicht mehr viel Zeit, bis sie losmussten.
Sie ging ins Bad und schaltete das Licht über dem Spiegel ein, bevor sie sich zu schminken begann. Da waren sie wieder, die trüben Gedanken. Wie sie damals heimgekommen war und sofort gewusst hatte, dass etwas nicht stimmte. Das Haus hatte sich so leer angefühlt, dass sie gar nicht erst nach Christian gerufen hatte. Wie sie ganz sachte die Haustür hinter sich zugedrückt hatte und in die Küche geschlichen war, um die Einkäufe abzulegen. Von dort ins Wohnzimmer. Niemand da. Die Couch war verwaist gewesen, die Wolldecke halb auf dem Boden, ein fast volles Glas auf dem Tisch, sie hatte daran geschnuppert, Zitrone, längst erkaltet. Vielleicht war er nur zum Arzt gegangen, hatte sie noch gehofft, wider besseres Wissen, sie konnte sich nicht erinnern, dass er überhaupt je bei einem Arzt gewesen war.
Und dann war ihr Blick auf den Brief gefallen, der auf ebenjenem Sekretär gelegen hatte wie achtlos vergessen. Schon von Weitem hatten die großen, steilen Buchstaben sie förmlich angesprungen, und je näher sie herangetreten war, desto bedrohlicher war ihr die Schrift vorgekommen. Das konnte unmöglich Christian geschrieben haben, sicher nicht. Mitten auf dem Brief hatte der kleine Anhänger gelegen, das halbe Herz, dessen Gegenstück sie um den Hals trug, und da hatte sie Bescheid gewusst. Jemand hatte ihr Geheimnis verraten, aber wer?
Der Brief trug keine Unterschrift. Mit zitternden Händen hatte sie das Blatt zurück in seinen Umschlag und den hinter die unterste Schreibtischschublade gestopft. Ja, sie nickte bekräftigend, sie hatte ihn dorthin verbannt, aber wo war er dann jetzt? Sie hätte ihn besser gleich zerrissen oder verbrannt, überlegte sie. In dem Moment war es ihr nur darum gegangen, ihn vor Antonias Augen zu verbergen, reiner Instinkt. Erst als diese Gefahr gebannt war, hatte sie sich Zweifel an ihrer Schlussfolgerung einreden können: Sie war grundlos in Panik ausgebrochen, es gab bestimmt eine vollkommen harmlose Erklärung. Atemlos war sie ins Schlafzimmer gestürmt, keiner da, sie hatte die Schränke aufgerissen, leer, verdammt, seine Sachen waren fort, er war fort, er hatte sie Hals über Kopf sitzen lassen, wegen ein paar Buchstaben, die das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen, einfach fort.
Sie vermochte bis heute nicht zu sagen, woher sie die Kraft genommen hatte, die Scherben aufzulesen, jede einzelne. Und an jeder einzelnen hatte sie sich geschnitten. Bis aufs Blut. Nicht immer unabsichtlich. Einmal, sie spürte, wie sie vor Scham errötete, hatte sie bereits Wasser in die Wanne eingelassen, die Rasierklinge in der Hand, sorgsam die Badezimmertür verschlossen, damit es nicht Antonia wäre, die sie fände. Antonia, der es bei einer Pflegefamilie so viel besser ginge als bei ihr. Versagerin, die nicht mal einen Mann halten konnte. Und auch sonst nichts zuwege brachte. Letztlich hatte Antonia sie gerettet, oder der Lehrer, dessentwegen sie früher als gewöhnlich aus der Schule gekommen war. Fröhlich trällernd.
Antonia sang so gern, so unbekümmert, wenn auch leicht schief, traf zumeist haarscharf neben den geforderten Ton. Nur wenn sie gemeinsam sangen, konnte sie mithalten. Bloß kein Kanon, keine Harmonien. Irgendwas am Gehör, nahm sie an. Antonia bekümmerte es wenig. Leider. Sie hätte sich gewünscht, dass Antonia ihr Talent geerbt hätte und wahr machte, was sie selbst nicht konnte. Stellvertretend ihren geheimen Traum lebte. I will survive,hatte sie gesungen. Ausgerechnet. Kein Text für eine Zwölfjährige. Aber sie hatte mit wachsender Inbrunst geschmettert, als wüsste sie, wovon sie sang. Ein Zeichen, hatte sie gedacht, das musste etwas zu bedeuten haben. Sie hatte die Klinge fallen lassen, zugesehen, wie sie trudelnd auf den Grund der Wanne gesunken war. Leicht. Tödlich. Nicht einmal das kriegte sie hin. Ein Schluchzen war ihr in die Kehle gestiegen, unvermittelt in ein Lachen mündend, hysterisch und schrill, aber doch ein Lachen. Und sie hatte die Tür aufgeschlossen, um mitzusingen. I will survive.
Ab da war es aufwärtsgegangen. In winzigsten Schritten. Und jetzt war sie angekommen. Ganz oben.
Lange hatte sie sich kaum getraut, an diesen Neuanfang zu glauben, an ein neues Glück, aber heute war es so weit. Frank würde sie heiraten, auf den Tag genau fünf Jahre, nachdem ihr ohne jede Vorwarnung der Boden unter den Füßen fortgerissen worden war. Sie hatte überlegt, ob sie sich gegen das Datum sträuben sollte, und hatte doch darauf verzichtet. Natürlich wusste er, dass sie verlassen worden war, aber davon abgesehen war Christian kein Thema zwischen ihnen. Vielleicht war es genau richtig, auf diese Weise etwas Schlimmes durch etwas Gutes zu ersetzen. Sie wünschte nur, Antonia könnte das auch so sehen.
So. Fertig. Sie klimperte mit den Wimpern. Nicht schlecht, befand sie, zog sich aus, wusch sich und tänzelte zurück ins Schlafzimmer. Slip, BH, Top, noch ein kurzer Blick voller Vorfreude auf das Kostüm, und dann, Konzentration bitte, streifte sie ganz vorsichtig die Strumpfhose über. Geschafft. Sie holte noch einmal tief Luft, nahm den Rock vom Bügel und stieg hinein, schloss den Reißverschluss und zog das Jäckchen über, bevor sie in die Pumps schlüpfte und sich vor den Spiegel stellte. Perfekt. Erschrocken fuhren ihre Hände zum Mund, bild dir bloß nichts darauf ein, schalt sie sich und verengte die Augen zu Schlitzen, als würde sie laut mit ihrem Spiegelbild schimpfen. Sie hielt inne. Ließ die Hände langsam wieder sinken. Nur heute, bat sie, lass mich nur heute einmal glauben, dass ich jemand Besonderes bin. Eine geheimnisvolle, schöne Frau, der man hinterhersieht. Vielleicht pfeift? Sie gestattete sich, wieder zu lächeln.
Sie stolzierte hinüber ins Wohnzimmer. Lichtdurchflutet. Was für ein Glück. Sie würde nicht mal einen Mantel brauchen. Wär auch zu schade gewesen. Was eigentlich längst Herbst sein sollte, war seit gestern strahlender Spätsommer. Über zwanzig Grad. Irre für Ende Oktober. Sie wandte sich zur Musikanlage, zögerte, warf einen Blick auf die Uhr. Noch zehn Minuten. Das reichte. Sie schaltete den CD-Player ein und drehte die Lautstärke hoch, bevor sie in der Mitte des Raums Aufstellung nahm.
Gott, wie sie dieses Stück liebte. »Barkarole«, sagte sie laut, allein das Wort war Musik, und wiegte sich im sanften Rhythmus der Einführung, die die Melodie schon erahnen lässt, die Vorfreude hinauszögert, bis endlich, endlich die erste Stimme erklingt, dann die zweite, und sie stimmt ein, obwohl sie den Text nicht kann, kein Wort versteht, der totale Kitsch wahrscheinlich, doch sie spürt die Tragik, die Heiterkeit, das ganz große Gefühl und lässt sich tragen, dreht sich im Kreis, die Arme weit ausgebreitet, wechselt mal zur einen, mal zur anderen Stimme und wünscht, sie könnte beide sein, die perfekte Harmonie, in der die eine nichts ist ohne die andere.
Als das Stück zu Ende war, verbeugte sie sich und schaltete die Anlage wieder aus.
»Antonia?«, rief sie, hoffte für einen Augenblick, dass sie sie bloß nicht kommen gehört hatte. Sie stieß die angehaltene Luft wieder aus. Wie sollte sie das Frank erklären? Er hatte sich so sehr um Antonia bemüht, und jetzt kam sie nicht mal zur Hochzeit? Sie konnte es nicht ändern, und vielleicht, malte sie sich aus, hatte sie sich nur verspätet und beschlossen, direkt zum Standesamt zu kommen. Es hupte. Frank! Sie suchte ihre Brille und legte sie aufs Sofa zwischen die Kissen, bevor sie zur Tür stürmte. Erst draußen bemühte sie sich um einen würdevollen Gang.
* * *
Antonia drückte sich an die Hauswand neben der Terrassentür. Dieses verdammte Gejaule! Sie konnte es echt nicht mehr hören. Permanent dudelte ihre Mutter das behämmerte Lied und sang auch noch dazu. Ohne Text, klaro, nur la, la, la. »Schade, dass ich kein Italienisch kann«, hatte sie neulich gejammert. Als wenn das helfen würde, hatte Antonia gedacht und darauf hingewiesen, dass es sich um Französisch handelte. Okay, ihre Stimme war schon voll krass, könnte sie was draus machen. Wenn.
Auf jeden Fall war sie gut drauf in letzter Zeit. Direkt high. Und alles wegen Frank. Der tat ihr gut, das musste sie zugeben. Trotzdem mochte sie ihn nicht. Einfach so, ohne Begründung. Konnte sie natürlich nicht laut sagen. Na ja, wollte sie auch nicht. Das hätte bloß endlose Vorträge zur Folge, über das, was er alles konnte, hatte, war. Ihre Mutter nervte sowieso schon dauernd mit ihrem Frank-sagt-auch-dass. Wann immer der glaubte, seine Meinung sei gefragt. Also eigentlich immer.
Die Grübelei brachte nichts. Sie schlug mit dem Hinterkopf gegen die Hauswand. Mann ey, das tat weh! Zerknirscht rieb sie sich die schmerzende Stelle. Es war eh zu spät. Sie würde ihn heiraten. In – sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr – einer halben Stunde. Gab es dieses »Ist jemand hier, der gegen diese Verbindung etwas einzuwenden hat, so spreche er jetzt oder schweige für immer« eigentlich nur in amerikanischen Filmen, oder war das tatsächlich so üblich? Das würde natürlich auch nichts ändern, sie würde sich bestimmt nicht trauen, was zu sagen. Was auch? Mehr als »Ich bin dagegen« und mit dem Fuß aufzustampfen wie ein Kleinkind hätte sie nicht zu melden. Und genau dafür würde man sie halten: ein trotziges Gör, das der Mutter ihr Glück nicht gönnte, weil es Schiss hatte, sie künftig teilen zu müssen.
Dabei war es genau umgekehrt. Sie hatte überhaupt nichts dagegen, sie zu teilen, etwas weniger Aufmerksamkeit zu erhalten. Und sie liebte ihre Mutter wirklich. Auch wenn sie das im Moment nicht so raushängen ließ. Sie hatte es echt verdient, dass sie wieder glücklich wurde. Nur nicht mit Frank. Da war was in seinem Blick, das sie nicht mochte. So was Berechnendes irgendwie. Oder bildete sie sich das bloß ein?
War es vielleicht wirklich so, dass sie ihren Vater vermisste und nicht wollte, dass ein anderer seinen Platz einnahm? Was, wenn er doch noch zurückkäme? Glaubte sie zwar nicht, schließlich war das jetzt schon fünf Jahre her, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte, ohne Abschied, ohne Erklärung. Und sich die ganze Zeit nicht ein einziges Mal gemeldet hatte. Tat man so was seiner eigenen Tochter an? Sie wusste nicht, ob sie ihm das verzeihen würde. Okay, wahrscheinlich schon. Nach einer Weile. Einer langen Weile, Strafe musste schließlich sein. Du spinnst, schimpfte sie innerlich, eher friert die Hölle zu. Der war korrekt untergetaucht. Hatte wahrscheinlich sogar seinen Namen geändert. Im Netz hatte sie ihn bis jetzt jedenfalls nicht finden können. Dass sie ihn suchte, hatte sie ihrer Mutter lieber nicht erzählt.
Die Musik war verstummt. Wie lange schon? Es hupte vorn. Das würde Frank sein. Sie lauschte. Ja, das war unverkennbar ihre Mutter, die ihm etwas zurief. Eine geschätzte halbe Oktave höher als normalerweise. Die Autotür knallte, und der Motor jaulte auf. Angeber.
Sie atmete tief ein und aus. Wie vorm Sprung vom Zehner. Genauso fühlte sie sich. Trotzdem war ihr klar, dass sie das nicht bringen konnte. Dort nicht aufzukreuzen, würde ihrer Mutter das Herz brechen. Und einmal reichte ja wohl. Sie biss die Zähne zusammen, rannte nach vorn und ließ sich zur Tür hinein. Eilig stopfte sie ein paar Klamotten und Waschzeug in ihren Rucksack. Sie hatte keinen Bock, hier auf Familie zu machen, besser, sie übernachtete bei Kathrin. Wenigstens würde sie so von der Hochzeitsnacht nichts mitkriegen. Ab morgen würde sowieso alles anders. Sie seufzte.
Einer Eingebung folgend, schloss sie ihr Zimmer ab und stopfte den Schlüssel in die Tasche ihrer Jeans, zu dem Brief, den sie im Sekretär im Wohnzimmer gefunden hatte. Ungelesen, immer noch.
Sie hatte gestern nach einem Umschlag gesucht, natürlich keinen gefunden, in der ersten Schublade nicht, der zweiten auch nicht, und dann war sie so sauer gewesen, dass sie viel zu heftig an der dritten gezogen hatte. Die war ihr auf den Fuß gedonnert, Mann, hatte das wehgetan. Als der Schmerz nachgelassen hatte, war sie in die Hocke gegangen, um nachzusehen, ob noch alles dran war, am Fuß und an der Schublade. Ihr Fuß hatte eine mächtige Beule davongetragen, die Schublade keinen Kratzer abbekommen. Sie hatte ihr gerade einen Tritt versetzen wollen, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, da hatte sie den Umschlag entdeckt. Der konnte nicht unabsichtlich dort gelandet sein, das war ihr sofort klar gewesen, denn in den Schubladen steckte so wenig, dass er nicht einfach über den Rand hätte rutschen können. Sie hatte zögernd die Hand nach ihm ausgestreckt, das geht dich nichts an, hatte eine innere Stimme sie gewarnt, und sie war zurückgezuckt. Doch dann hatte sie den Schlüssel in der Haustür gehört, wieso kamen Mütter immer im blödesten Moment nach Hause?, und sie hatte den Brief eingesteckt, ohne weiter drüber nachzudenken, die Schublade wieder eingesetzt und sich beeilt, den Fernseher einzuschalten.
Sie schloss das Haus ab, holte ihr Fahrrad aus dem Schuppen und machte sich lustlos auf den Weg zum Rathaus. Sie kam gut durch, selbst die Ampel Bremer Straße, an der man sonst warten musste, bis man schwarz wurde, zeigte Grün. Sie würde pünktlich dort sein, dabei war Pünktlichkeit keine ihrer hervorstechenden Eigenschaften. Ah, super, Scherben auf dem Radweg! Sie fuhr drüber und hoffte auf einen Platten. Nichts passierte. Jetzt konnte sie nur noch ein Unfall retten, ein klitzekleiner? Sie. Nicht ihre Mutter, die sich gleich ausliefern würde an diesen, diesen … ihr fiel kein passendes Wort ein. In guten wie in schlechten Zeiten. Schlechte, darauf würde sie wetten. Bis dass der Tod uns scheidet. Das konnte dauern, er war nur zehn Jahre älter als ihre Mutter. Warum passierte nicht noch irgendetwas, das die Hochzeit in letzter Sekunde verhinderte?
Du schiebst echt voll die Panik, wetterte sie und trat kräftiger in die Pedale. Sie begann zu keuchen. Irgendwie war es zu warm heute. Trotzdem wünschte sie, es wäre Frühling, nicht Herbst. Bald wäre es zu kalt, um über längere Strecken dem Familiengetue zu entkommen. Zu Kathrin mochte sie nur in Ausnahmefällen. Wie heute. Sie hoffte, dass deren Vater wirklich noch auf Montage war. Ihre Brüder waren schlimm genug, da brauchte es den Alten nicht noch.
Hauptsache, Frank schaffte es nicht, Kathrin zu vergraulen. Er hatte schon ein paar Andeutungen über ihren Umgang abgelassen. Bis jetzt hatte ihre Mutter weggehört. Aber wie lange würde sie durchhalten? Kathrin war nun mal ihre beste Freundin, und sie konnte sich nicht vorstellen, wie das werden sollte, wenn sie sich nicht mehr zu Hause treffen konnten. Zumal ihr Bauch ihr sagte, dass es bestimmt kein Fehler war, gut auf ihre Mutter aufzupassen. Also da zu sein. Sich sein falsches Gesülze anzuhören. Und ihre Reaktion darauf zu ertragen. Sie war total unterwürfig. Auch wenn andere, die sie nicht so gut kannten, das wahrscheinlich nicht merkten. Hatte voll Angst, was falsch zu machen.
Aber ihre Mutter war glücklich, widersprach sie ihrer eigenen Einschätzung. Wie auch immer das zusammengehen sollte. Sie konnte sich keinen Reim drauf machen, echt nicht. An Liebe glaubte sie jedenfalls nicht. Sie nicht. Darin waren Kathrin und sie sich einig. Zu vieles sprach dagegen.
War das etwa Liebe gewesen zwischen ihren Eltern? Sie konnte sich gar nicht mehr richtig erinnern. Es war, als hätte ihr Vater, als er abgehauen war, auch die Erinnerungen mitgenommen. Was ja nun ziemlich unmöglich war. Wenn man jemanden liebte, haute man jedenfalls nicht einfach ab. Also war es keine Liebe gewesen. Oder keine mehr? Und war es überhaupt Liebe gewesen, wenn es keinen Bestand gehabt hatte? Warte mal, konnte es sein, dass es sich bei dem Brief um den Abschiedsbrief ihres Vaters handelte? Es stand nämlich kein Absender auf dem Umschlag, und eine Briefmarke gab es auch nicht. Darauf war sie gestern gar nicht gekommen. Da hatte sie sich bloß wie ein Dieb gefühlt und ein megaschlechtes Gewissen gehabt. Trotzdem konnte sie nicht sagen, was sie davon abgehalten hatte, ihn zu lesen. Da war nur so ein Gefühl gewesen, dass es besser wäre, nicht allein zu sein, wenn sie es tat. Und ihre Mutter kam als Beistand nicht in Frage, denn sie war es ja wohl, die ihn versteckt hatte. Dann also heute Abend, bei Kathrin, nahm sie sich vor. Hoffentlich waren die Brüder unterwegs und ließen sie in Ruhe.
* * *
»Wenn du nicht mitfahren willst, solltest du jetzt besser aussteigen«, mahnte Arne und schob Marilene von sich.
»Recht hast du.« Sie wuschelte ihm kurz durchs Haar, was er zwar mit einem indignierten Augenaufschlag bedachte, aber noch ließ er sie gewähren. Bald schon würde er sich für entschieden zu groß für Zärtlichkeiten vor Zeugen halten, nahm sie an und war froh um den Aufschub. »Also bitte pass auf dich auf«, sie senkte die Stimme, um ihn nicht in noch größere Verlegenheit zu bringen, »und ruf mich an, sobald du in Koblenz im Zug sitzt, ja?«
»Das hatten wir doch schon. Ich vergesse nie etwas.« Er stemmte entrüstet die Hände in die Hüften.
Das stimmte wohl, setzte aber voraus, dass er ihr auch zugehört hatte, anstatt auf Durchzug zu schalten, durchaus normal für einen Jungen seines Alters, wenn es Ermahnungen hagelte, vermutete sie. »Ja, ja, ich weiß«, wiegelte sie ab, »ich geh ja schon.« Es mangelte ihr eindeutig an Gelassenheit im Umgang mit ihm, aber das war vielleicht auch nicht so verwunderlich angesichts all dessen, was er schon durchgemacht hatte. Sie stolperte rückwärts, hob andeutungsweise die Hand zu einem verstohlenen letzten Winken und sprang die Stufen hinab. »Schön, dass du da warst!«, rief sie ihm über die Schulter zu.
»Ich komm wieder, keine Frage!«, tönte es hinter ihr, und schon knallten die Türen des Zuges zu.
Wo kam jetzt der Satz her? Sie kicherte und wagte nun doch, sich umzudrehen, um dem rasch schneller werdenden Zug hinterherzuschauen, beidarmig winkend. Erst als der Zug außer Sichtweite war, ließ sie die Arme wieder sinken. Hoffentlich kam er gut an, gewann ihre Besorgnis abermals die Oberhand. Den Begleitservice der Bahnhofsmission hatte Arne rundweg verweigert, nun wünschte sie, sie hätte sich durchgesetzt. Da allerdings nicht mal seine Großmutter auf dieser Sicherheitsmaßnahme bestanden hatte, war ihr gar nichts anderes übrig geblieben, als nachzugeben. Okay, er war reif für sein Alter und sehr selbstständig, absolut nicht auf den Mund gefallen, er hatte ein Handy dabei, der Akku war aufgeladen, es gab keinen Grund, sich verrückt zu machen. Außerdem hatte er einen Platz an einem Vierertisch, und wie sie ihn kannte, würde er in Nullkommanichts die ältere Dame ihm gegenüber in ausufernde Gespräche verwickeln, bis diese entweder den Platz wechselte oder anbot, den Jungen zu adoptieren. Sie wäre gern als Mäuschen dabei.
Marilene mied das Gewimmel in der kleinen Bahnhofshalle und verließ das Gelände über den Fahrradparkplatz. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr und legte einen Schritt zu. Um drei hatte sie einen Termin wegen einer Sorgerechtssache, die zu eskalieren drohte, was sie noch zu verhindern hoffte. Man sollte meinen, dass den Eltern an einer gütlichen Einigung gelegen war, aber die bekämpften sich derart, dass es sie nicht wundern würde, wenn ihr Kind einen bleibenden seelischen Schaden davontrug.
Der Fall setzte ihr zu, ohne dass sie den Grund dafür so richtig benennen konnte. Vielleicht, überlegte sie, lag es daran, dass er ihr Bild von der heilen Welt Ostfrieslands beschädigte. Natürlich war ihre Wahrnehmung ziemlich blauäugig, wenn nicht gar naiv, das musste sie zugeben. Sie runzelte unwillkürlich die Stirn, während sie darauf wartete, dass die Fußgängerampel auf Grün sprang. Aber irgendwie hatten all die jungen Familien, die vielen Kinder den Anschein erweckt, dass Ehen hier für die Ewigkeit geschlossen wurden. Als seien Scheidungen ein rein großstädtisches Phänomen. Gab es da ein Stadt-Land-Gefälle? Vielleicht insofern, als Geschiedene vermutlich selten auf dem Land blieben, wenn der Partner die Biege machte. Idylle war nichts für Singles, und dörfliche Gemeinschaft sicher ebenso wenig. Um eine solche Statistik zu erheben, müsste es natürlich eine objektive Definition für »Stadt« geben: Nach hiesigen Maßstäben war Leer eine Stadt. Aber Marilene kam aus Wiesbaden, ihr eigener Eindruck war da ein ganz anderer. Dennoch war Leer für sie der ideale Kompromiss zwischen beiden Lebensformen, ein Touch Idylle gepaart mit städtischer Infrastruktur. Ins Umland wäre sie jedenfalls nie gezogen.
Grün, endlich. Ein Pulk radfahrender Jugendlicher kam ihr entgegen und teilte sich wie von Zauberhand so kurz vor ihr, dass sie schon fürchtete, sie würden sich gegenseitig umfahren, aber nichts passierte. Dabei fuhren die meisten auch noch freihändig. Ziemlich früh für Schulschluss, fand sie. War ein Lehrer krank, oder hatte es heute Schönwetterfrei gegeben? Nachvollziehbar wäre es. Der Sommer war in diesem Jahr ausgefallen oder hatte noch vor ihrem Umzug im Mai stattgefunden, und bis er sich vor ein paar Tagen entschlossen hatte, doch noch mal aufzukreuzen, hatte es fast nur geregnet. Es hatte sie nicht groß gestört, sie hatte wahrlich genug zu tun gehabt.
Sie hatte erwartet, dass man ihr, einer Zugezogenen, obendrein einer Frau, beruflich mit Vorbehalten oder zumindest mit Zurückhaltung begegnen würde, aber das war nicht der Fall gewesen. Ein einziger Mandant war bislang abgesprungen, und der war über achtzig, würde also ohnehin nicht mehr allzu lange juristischen Beistand brauchen. Sie schmunzelte. Der Alte hatte sich eine Anzeige wegen sexueller Nötigung eingehandelt, ein kniffliger Fall, denn sie hätte selbst Grund genug gehabt, ihn deswegen anzuzeigen. Als sie ihn mit deutlichen Worten in seine Schranken verwiesen hatte, war er wutentbrannt davongerauscht, im wahrsten Sinne, hatte er doch einige Papier- und Aktenstapel im Vorbeigehen wie unabsichtlich von ihrem Ablagetisch gefegt.
Spieker, ihr Vorgänger, der auf einen Besuch vorbeigekommen war, hatte sie auf dem Fußboden liegend vorgefunden, wo sie versuchte, mit einem Lineal auch die Blätter zu erwischen, die sich unter den Schränken verkrochen hatten. Auf seine Frage, was denn passiert sei, hatte sie nur etwas von sexueller Nötigung schimpfen müssen, schon hatte er gewusst, um wen es sich handelte. »Regelmäßige Einnahmequelle«, hatte Spieker versprochen, »einmal im Jahr. Mir war nur nicht klar, dass er es auch bei Ihnen versuchen würde, sonst hätte ich Sie vorgewarnt.«
Nein, sie hatte gut daran getan, diesen Ortswechsel zu wagen. Sie hatte das Gefühl, ihrer Vergangenheit entkommen zu sein, und fühlte sich befreit. Dabei war manches beim Alten geblieben. Lothar Männle war ihr in ihr neues Leben gefolgt. Nicht nur hatte er hier das Haus gekauft, in dem sich die Kanzlei und ihre Wohnung befanden, sodass er, wie schon in Wiesbaden, ihr Vermieter war. Obendrein hatte er das Notariat von Spiekers Kompagnon übernehmen wollen, zumindest hatte er ihr das weisgemacht, aber da es Notaren nicht gestattet war, mehrere Geschäftsstellen zu unterhalten, sie auch nicht einfach das Bundesland wechseln konnten, würde er nun seine Tätigkeit in Wiesbaden ganz aufgeben und hierher übersiedeln, um mit ihr eine Anwaltssozietät einzugehen.
Sie hatte lange mit sich gerungen, ob sie zustimmen sollte, schließlich waren ihre Erfahrungen mit Sozietäten nicht die besten. Aber letztlich hatte sie keine große Wahl gehabt. Die Büroräume gingen ohnehin ineinander über, und es gab nur einen Empfangsbereich, dessen Hüterin sich schon ihre Vorgänger geteilt hatten. Was sie indes am meisten umtrieb, war die Frage nach seinem Motiv für den Ortswechsel. Seine Antwort hatte sie nicht entfernt zufriedengestellt: Es sei an der Zeit für neue Herausforderungen. Mal ganz davon abgesehen, dass sie vermutete, er müsste überhaupt nicht arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, konnte sie nicht nachvollziehen, wieso er seine Kanzlei aufgab, um sich in ein mittleres, finanziell betrachtet sogar ein größeres Abenteuer zu stürzen. Vom mondänen Wiesbaden, das mit Zerstreuungen wie Kasino und Oper lockte, in die Provinz. Das passte nicht zu ihm, jedenfalls soweit sie das beurteilen konnte.
Sie erreichte die Bergmannstraße. Ein Radfahrer zischte von hinten an ihr vorbei, streifte sie am Arm, leicht zwar, trotzdem wäre sie beinahe gestürzt. »Depp!«, schimpfte sie, »auf der falschen Seite unterwegs und dann nicht mal klingeln!« Oder hatte sie ihn überhört? Sie erinnerte sich an ihren ersten Besuch hier, als sie sich um die Kanzleinachfolge beworben hatte. Auch damals war sie fast gestürzt. Und auch damals war ein Radfahrer in einem Affenzahn an ihr vorbeigesaust. Und damals war weiter vorn jemand gestürzt, der sie an Lothar erinnert hatte. Er hatte sie ganz schön hinters Licht geführt, war erst in Erscheinung getreten, als sie die ganze Sache nicht mehr hatte platzen lassen wollen.
Gut, sie konnte ihm das nicht mal verdenken. Ihm musste bewusst gewesen sein, dass sie sich auf eine derartige Verquickung von Beruf und Privatleben niemals eingelassen hätte, dafür war ihr ihre Unabhängigkeit viel zu wichtig geworden. Nun würden sie nicht nur eine gemeinsame Kanzlei betreiben, sondern auch noch im selben Haus wohnen. Alles unter einem Dach. Hoffentlich würde das glattgehen. Zwar hatte sie klargestellt, dass ihre künftige Verbindung rein beruflicher Natur wäre, »selbstverständlich«, hatte er zugestimmt, aber sie zweifelte dennoch an seinen Absichten. Und, wenn sie ganz ehrlich war, an ihrer eigenen Standfestigkeit ebenso.
Sie seufzte. Er war schon ein Bild von einem Mann. Natürlich sprach genau dieser Umstand am meisten gegen eine Beziehung zwischen ihnen. Sie hörte im Geiste schon das Getuschel: Wie hat die Alte den bloß rumgekriegt? Was findet der nur an ihr? Ob sie Geld hat? Nein, so etwas würde sie sich nicht antun.
Sie fragte sich, ob er darunter litt, dass er auf blond und schön reduziert wurde. Okay, Leiden war nichts, was man mit ihm in Verbindung bringen würde, Lothar hatte ein hochgradig sonniges Gemüt, nach außen hin wenigstens, trotzdem musste diese beschränkte Wahrnehmung verletzend sein. Oder war das ein Frauending? War Schönheit für Männer mit Grips nicht so ein Handicap wie für Frauen? Jens Hartmann, der Wiesbadener Kommissar, mit dem sie oft zu tun gehabt hatte, und keineswegs nur beruflich, hatte Lothar als Schönling tituliert, und der hatte das gewusst, nur war es anscheinend an ihm abgeprallt. Einerlei, Ende Dezember würde er endgültig hierherziehen, und dann würde sich herausstellen, wie sie klarkämen. Jetzt gab es keinen Grund, sich über seinen Seelenzustand den Kopf zu zerbrechen.
Sie erreichte das Haus, das so schnell zu einem Zuhause für sie geworden war, wie Arne zu ihrem Erstaunen angemerkt hatte, und sprintete die Stufen hinauf zu ihrer Wohnung für eine halbe Zigarette vor ihrem Termin. Sie schloss die Tür auf und hielt inne. Schnupperte. Da war wieder dieser seltsame Geruch, der ihr schon ein paarmal aufgefallen war, jedoch nie so intensiv wie heute. Nach Karamellbonbons? Sie zweifelte an ihrer Wahrnehmung. Sie aß so etwas nicht, schon allein wegen der Zähne. Arne vielleicht? Nein, das wäre ihr aufgefallen. In der vergangenen Woche hatte sie es nicht gerochen. Das war vorher gewesen. Nicht so oft, dass es sie beunruhigt hätte, und auch stets nur schwach, sodass es ihr leichtgefallen war, als Einbildung abzutun, was sie nun doch irritierte.
Sie ging ins Wohnzimmer, öffnete das große, zum Garten zeigende Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Wie in ihrer alten Kanzlei, überlegte sie, dort hatte sie gegen den hartnäckigen Geruch von Räucherstäbchen anstinken müssen, den sie trotzdem nie ganz losgeworden war. Immerhin hatte sie den Ursprung des Geruchs gekannt. Es war kaum vorstellbar, dass hier hinter irgendeiner Wand ein paar Bonbons ihrem Ende entgegengammelten. Die würden eher vertrocknen, vermutete sie, und eben nicht riechen. Aber nun würde sie der Sache auf den Grund gehen, sich nicht wieder einreden, dass sie spann, und kein Vergessen zulassen. Nur wie? Sie konnte ja nicht gut die Wände einreißen. Ein Hund musste her, das war es, ein Suchhund. Vielleicht hatte Renate Heeren, ihre Sekretärin, eine Idee, wie man an einen herankam. Sie würde sie nachher fragen.
Entschlossen drückte Marilene ihre Zigarette aus, verschloss sorgfältig das Fenster und ging nach unten, um sich dem Rosenkrieg zu stellen.
* * *
Gott, war sie aufgeregt! Ihr war schlecht. Der Standesbeamte hatte zu reden begonnen, und seine Worte rauschten an ihr vorbei. Sie hatte das Gefühl, dass die Luft zum Atmen einfach nicht reichte. Wie vorm Zahnarzt, dabei sollte dies doch ein Tag der Freude sein, der schönste Tag ihres Lebens.
Eigentlich hatte sie sich das ganz anders vorgestellt. Obwohl Frank ausdrücklich darauf bestanden hatte, keine große Sache draus zu machen. Nur Standesamt. Und nur sie drei. Die Familie. Noch hatte er kein Wort darüber verloren, dass Antonia nicht da war. Eine armselige Veranstaltung war das. Sie wünschte, sie hätte nicht so viel Geld für dieses Kostüm ausgegeben. Es war viel zu vornehm. Nicht für den Anlass, das nicht, aber neben Frank, der eine schwarze Jeans und ein graues Jackett trug, der nicht mal einen Schlips angelegt hatte, musste sie wirken wie verkleidet. Eine Hochstaplerin, die mehr darstellen wollte, als sie tatsächlich war. Nämlich eine graue Maus. Ihr Hochgefühl von vorhin war komplett verflogen.
Sie verzog das Gesicht und hoffte, Frank würde nicht mitbekommen, wie ihr auf einmal zumute war. Kalte Füße. Sie war so sicher gewesen, dass er der Richtige für sie war, und nun beschlichen sie auf einmal Zweifel. Sie musterte ihn verstohlen von der Seite. Er wirkte irgendwie distanziert, als sei die Heirat nicht weiter wichtig, etwas, das man eben so machte, wenn man sich länger kannte. Dabei war nicht sie es gewesen, die das Thema überhaupt angeschnitten hatte. Das war allein von ihm ausgegangen, und seinerzeit schien es von großer Bedeutung für ihn zu sein, fast dringlich war ihr sein Antrag vorgekommen.
Natürlich hatte sie davon geträumt, eines Tages zum Altar zu schreiten, aber auf eine standesamtliche Trauung hatte sie nie Wert gelegt. Schon mit Christian nicht. Und mit Frank seltsamerweise erst recht nicht. Frank, der sie entfernt an jemanden erinnerte, jemanden von ganz früher, glaubte sie, aus ihrer schlimmen Zeit, doch sie war nie darauf gekommen und hatte es schließlich als Einbildung abgetan. Er war so schön. So selbstsicher. So gewandt. Sie selbst war nichts von alledem. Wie sollte das funktionieren? Irgendwann würde er sie als Klotz am Bein empfinden, und dann stünde sie wieder allein da. Sie wusste nicht, ob sie einen solchen Verlust ein zweites Mal verkraften könnte.
Meine Güte, schalt sie sich, es hat noch nicht mal angefangen, und du denkst schon ans Ende? Das ist nicht normal. Aber genau das war sie ja auch nicht: normal. Das durfte natürlich niemand wissen. Normal. Was für ein wunderbares Wort. Schon immer hatte es für sie Sicherheit verheißen. Nichts war ihr je erstrebenswerter erschienen. Nicht mal eine Ehe. Wider Erwarten stahl sich ein winziges Lächeln auf ihr Gesicht. In diesem Moment betrat Antonia das Trauzimmer. Wie schön! Jetzt würde alles gut werden. Sie warf einen Blick auf Frank. Er stieß sie mit dem Ellenbogen an, oh, sie hatte ihren Einsatz verpasst, aber er zwinkerte ihr zu.
»Ja, ich will«, sagte sie.
2
»Immer ich«, schimpfte er, »das ist voll gemein!« Er knallte wütend die Tür hinter sich zu. Balou hielt das Geräusch für den Startschuss und raste los, er hinterher. Er war nicht schnell genug. Balou zerrte an der Leine, aber er gab nicht nach, hatte sie sich extra um die Hand gewickelt, damit er diesmal nicht entwischte und sein Häufchen an seinem Lieblingsplatz hinterließ. Mitten auf dem Rasen seiner Englischlehrerin. Balou war eben kein Hund wie jeder andere. Den erkannten alle wieder, auch Frau Dr.Zimmermann, obwohl die eine Brille mit irre dicken Gläsern trug.
Auch jetzt steuerte Balou mit wehenden Ohren nach links. »Sitz!«, brüllte er. Krass, der Hund gehorchte! Jedenfalls fast. Er wurde langsamer und drehte den Kopf nach ihm um. »Sitz«, wiederholte er und konnte es echt nicht glauben. Balou setzte sich. Mitten auf die Straße. Natürlich kam ausgerechnet in diesem Moment ein Auto. Es hielt direkt vor ihm an, und die Scheibe wurde runtergelassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!