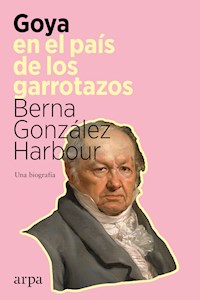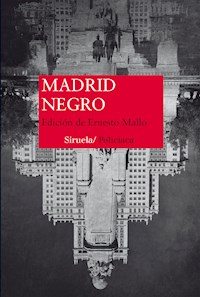Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
So hat sich Comisaria María Ruiz ihre Rückkehr nach Madrid nicht vorgestellt : eine Reihe von seltsamen Tiermorden bringt die Gerüchteküche in der Hauptstadt zum Brodeln. Die Annahme, dass es sich um einen okkulten Ritus handelt, wird schnell verworfen, als kurz darauf an einem Wehr die Leiche der Kunststudentin Sara gefunden wird. Kann es Zufall sein, dass die Szene stark an eine Zeichnung des Künstlers Goya erinnert? Comisaria María Ruiz, die sich aufgrund ihrer Suspendierung zurückhalten müsste, ist dennoch fest entschlossen, den Fall aufzuklären. Hilfe bekommt sie dabei von einem Kellner, einem jugendlichen Ausreißer und einem Journalistenduo.Doch ist diese bunt zusammengewürfelte Gruppe in der Lage, einem gefährlichen Täter das Handwerk zu legen, der vor nichts Halt macht, um seine Visionen Wirklichkeit werden zu lassen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berna González Harbour
GOYASUngeheuer
Comisaria Ruiz ermittelt in Madrid
Aus dem Spanischen von Maike Hopp
Mit Abbildungen von Francisco de Goyaund einem Gespräch mit der Autorin
Für dich, dem meine Tür stets offen steht,solltest du je zurückkommen.
Inhalt
I. Dragona
Album Y Nummer 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
II. Eloy
Album Y Nummer 2
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
III. Tesón
Album Y Nummer 3
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
IV. Yago
Album Y Nummer 4
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
V. Irrenhaus
Album Y Nummer 5
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Album Y Nummer 6
Danksagungen
In der Malerei gibt es keine Regeln,und der Zwang oder die unterwürfige Verpflichtung,alle den gleichen Weg einschlagen zu lassen,ist ein großes Hindernis.
Francisco de Goya y Lucientes(Madrid, 1792)
Er ist sehr arrogant und malt wie ein Verrückter,ohne jemals etwas, das er gemalt hat, korrigieren zu wollen.
Leandro Fernández de Moratín(Bordeaux, 1825)
I.
Dragona
Album Y Nummer 1
Es geschah in den frühen Morgenstunden, als die Betrunkenen sich der Kälte beugten und die Wohlhabenden noch nicht gemerkt hatten, dass sie unter die Armen geraten waren. In völligem Rausch drängten wir uns fröstelnd aneinander. Lauter und lauter wurden unsere Stimmen, ein leidenschaftlicher Gesang in der Dunkelheit. Um unsere Schultern lagen zerschlissene Umhänge und auf unseren Gesichtern sprossen nach den vielen durchfeierten Tagen Bärte. Die Augen hatten wir weit geöffnet, um dem Schlaf nicht zu erliegen. Die Menge ließ sich vom Rhythmus leiten und folgte singend dem Tempo, das der Mann mit der Gitarre vorgab. Es war nicht sicher, ob es sehr spät oder sehr früh war.
Der Festzug – wenn man diese Menschenansammlung überhaupt noch so nennen konnte – war so gut wie vorbei und wir wussten nicht mehr, wie oder warum wir an diesem kalten Morgen in Madrid zusammengekommen waren.
Die Nacht war schwarz. Einige Nachzügler stießen auch jetzt noch hinzu, angezogen von der Musik und der angenehmen Wärme unserer Körper. Uns störte all dies nicht und wir nahmen die Neuankömmlinge mit in den Kreis auf. Sie machten nicht den Eindruck, als wollten sie uns zum Schweigen bringen und schienen sich auch am Gestank von verfilzter Wolle, Schweiß und altem Wein nicht zu stören.
Und dann sah ich ihn. Einen Mann, abseits in der Dunkelheit, der uns nicht aus den Augen ließ. Auch ich hatte viel getrunken, doch der Anblick dieses sonderbaren Beobachters ließ mich auf einen Schlag nüchtern werden. Korpulent, elegant, Koteletten an beiden Wangen: Das konnte nur er sein. Es war offensichtlich, dass er nicht zu uns gehörte. Doch was um Himmels Willen hatte ihn dann hergeführt? Er kam sicher nicht für einen Spaziergang auf diese abgelegene Wiese, und zu stehlen gab es bei uns auch nicht wirklich etwas. Er schien einzig gekommen zu sein, um uns zuzuschauen. Ich beschloss, niemanden auf ihn aufmerksam zu machen, aber dennoch wachsam zu bleiben.
Einzig der Mann an der Gitarre war noch einigermaßen bei Sinnen, doch in Anbetracht seiner Blindheit sagte ich auch ihm nichts.
Wir taten nichts Unrechtmäßiges, doch sollte dieser Eindringling zu den Großen und Mächtigen gehören, war er hier nicht willkommen. Nicht im Madrid dieser Morgenstunden, die uns ganz allein gehörten.
Wenn wir uns eines im Leben verdient hatten, dann war es das hier – ein gemeinsamer Rausch bis zum Sonnenaufgang, ohne jegliche Überwachung. Bevor das Tageslicht uns daran erinnern konnte, dass wir schleppen, kehren und gehorchen mussten, um über die Runden zu kommen. Ich würde nicht zulassen, dass uns jemand diese Stunden nimmt.
Ich wusste, wer er war. Die Arroganz, die er ausstrahlte, war unverkennbar.
Es war der 15. Mai 1823.
Und auch wenn es scheint, als habe sich dies vor vielen Jahren zugetragen, passiert es doch in Wirklichkeit heute.
1
María nahm gleich zwei Stufen auf einmal. Sie trug ein lässiges T-Shirt, Jeans und bequeme Schuhe. Als sie den Platz erreichte, hielt sie kurz inne, um sich zu orientieren. Der Wohnblock lag direkt vor ihr – wie befürchtet am oberen Ende einer steil ansteigenden Straße. Gelbe Fassade, leicht heruntergekommene Eingangspforte, schöne Aussicht. Auf der linken Seite eine Dönerbude und auf der rechten ein chinesischer Imbiss. Langsam kam sie wieder zu Atem. Auch wenn sie fit war, hatte der Aufstieg von den Ufern des Manzanares sie ziemlich geschlaucht. Mit den Händen in den Hosentaschen schaute sie sich um. Ein Mann wühlte in einem überquellenden Mülleimer nach etwas, das er vielleicht noch brauchen konnte. Er schien nicht sonderlich arm zu sein, aber die Abfalleimer Madrids gehörten längst nicht mehr nur den Bettlern und dem Recyclinghof, sondern auch den Senioren und Kleinstverdienern, die mit den herausgefischten Schätzen ihre Rente aufbessern oder dubiose Geschäfte machen wollten. María ließ ihren Blick weiter umherschweifen. Es war Sonntag und deshalb kaum Verkehr auf der Straße. Zwei Afrikaner saßen im Gras, neben ihnen ein beeindruckender Haufen Handtaschen, die sie später sicher auf der Gran Vía verkaufen würden.
Martín hatte sie um ein Treffen auf diesem Platz gebeten, aber es war ihr ein Rätsel, was genau er hier im Viertel vorhatte. Madrids eitelster Polizist war erst vor kurzem nach Carabanchel gezogen, zusammen mit seinem durchtrainierten Körper, flotten Haarschnitt und Hipster-Bart. Zwar herrschte hier auch eine gewisse Weltoffenheit, doch dieser Teil Madrids war dann doch etwas rückständig. Einer dieser Orte, wo die Frauen morgens noch in Morgenmantel und Hausschuhen Brot holen gingen und die Männer abgenutzte und ausgeleierte Unterhemden trugen.
„Netter Basar!“, sagte eine Stimme hinter ihr, die deutlich an sie gerichtet war. María wirbelte herum, und siehe da, sie hatte richtig gehört.
„Luna!“ Der nicht mehr so ganz junge Journalist kam aus einem Taxi gestiegen und glättete die Falten seines weißen Hemdes. Hinter ihm folgte Esteban, viele Jahre lang Marías Stellvertreter auf der Wache und enger Freund von Luna. Martín hatte anscheinend beschlossen, sie alle mit einem Wiedersehen zu überraschen. „Richtig schön, euch zu sehen!“
„Comisaria!“, kam es von Esteban pflichtbewusst.
„Die Comisaria kannst du dir sparen.“ María hatte die Hände aus den Hosentaschen genommen, aber nicht für eine formelle Begrüßung, sondern für eine herzliche Umarmung, die dieses Mal keiner von ihnen verweigerte. Als sie den brillanten Journalisten und ihren ehemaligen Kollegen das letzte Mal gesehen hatte, hatten sie sich nach einem komplizierten Einsatz ein Bett geteilt und dabei nichts als Unterwäsche getragen. Die üblichen Formalitäten waren also ziemlich überflüssig, vor allem angesichts Marías Suspendierung und des noch laufenden Disziplinarverfahrens.
„Das reicht, das reicht, du erdrückst mich ja!“ Luna befreite sich aus der Umarmung.
„Ich freu mich, dich zu sehen, Comisaria.“ Auch Esteban trat einen Schritt zurück.
María steckte die Hände wieder in die Hosentaschen und schaute die beiden glücklich an. Trotz ihrer eigenen Suspendierung, Lunas Vorruhestand und Estebans Versetzung in eine andere Abteilung waren alle drei halbwegs guter Dinge. Sie lebten noch, und das sollte vorerst reichen.
„Du siehst gut aus“, bemerkte Luna, „der Zwangsurlaub scheint dir zu bekommen.“
„Man tut, was man kann“, erwiderte María trocken.
„Also, wo wird hier Ramadan gefeiert?“, scherzte er. Der Rollladen der Dönerbude wurde geräuschvoll nach oben gefahren und die beiden Afrikaner machten sich auf den Weg runter zum Fluss, die Handtaschen in eine Decke gewickelt.
„Hey, nicht so laut“, zischte María.
„Wen kümmert’s schon?“
„Mich kümmert’s. Jetzt, wo ich hier wohne.“
Die drei hatten nicht bemerkt, dass Martín hinter ihnen aufgetaucht war. Auch er hatte an diesem Sonntag seine Uniform gegen Jeans und ein enganliegendes T-Shirt eingetauscht, unter dem sich durchtrainierte Brustmuskeln und Bizeps abzeichneten.
„Mann, siehst du schwul aus“, kam es von Luna. „Wie viele Stunden hast du im Fitnessstudio verbracht?“
„Ach, fahr zur Hölle.“
Esteban lachte still in sich hinein. Weil Martín bei der Polizei über ihm stand und weil er die Anweisung hatte, auf politische Korrektheit zu achten, sagte er nichts dazu. Doch im Grunde dachte er dasselbe wie Luna: dass Martíns zahllose Freundinnen ihn zwar deutlich als Heterosexuellen kennzeichneten, dass er es aber allmählich mit den Bauchmuskeln, Proteinshakes und der Bartpflege übertrieb. Wenn man dieses verfilzte Gestrüpp, das jeden Morgen entwirrt und mit Gel in Form gebracht werden musste, überhaupt Bart nennen konnte.
María lächelte. Auch wenn sie sich lange nicht gesehen hatten, fühlte es sich an, als wäre es erst gestern gewesen.
„Also, zeigst du uns nun deine Wohnung?“
„Die muss erst einmal warten.“ Martín runzelte die mit Feuchtigkeitscreme gepflegte Stirn. Er hatte sein neu geerbtes Apartment als Vorsatz genommen, um sie alle zusammenzubringen, aber aus irgendeinem Grund wurde die Wohnungsbesichtigung spontan verschoben. „Dafür lade ich auf ein Bier ein.“
„Bekommen wir hier denn überhaupt irgendwo Alkohol?“, fragte Luna, der erst in Richtung Dönerbude und dann zum chinesischen Imbiss blickte. „Oder wollen wir etwa Shisha rauchen?“
„Extra für dich habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen“, lachte Martín. „Wie wär’s mit der Kneipe Doña Urraca?“
Das nach der kastilischen Königin benannte Lokal lag direkt hinter der Calle Doña Berenguela, deren Namensgeberin ebenfalls Königin von Kastilien gewesen war. Tatsächlich waren einige der Straßen hier nach Königinnen benannt, die mit Luna nur allzu gern in den Krieg gegen die Mauren gezogen wären. Bevor Martín all ihre Namen runterrasseln konnte, war es dann doch besser, einfach mitzugehen.
„Hört sich doch gut an“, sagte Esteban heiter.
„Doña Urraca passt“, erwiderte Luna trocken. „Doña Urraca im Herzen von Marrakesch.“
„Du übertreibst mal wieder, Luna. Das nennt sich kultureller Austausch.“ Martín wurde langsam ungeduldig. „Oder hast du etwa noch nie davon gehört, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen friedlich zusammenleben?“
„Austausch? Für mich riecht es hier nach Pisse“, schnaubte Luna. „Und damit wir uns verstehen, ich will einen carajillo, einen Kaffee mit Kognak.“
Die vier betraten lachend die Kneipe. Es war das erste Mal, dass sie seit dem unerwarteten Tod ihres Chefs, Comisario Carlos, zusammengekommen waren. In der Freude über ihr Wiedersehen lag eine gewisse Nostalgie, der aber keiner nachgeben wollte. Schließlich musste es weitergehen, und in den vergangenen Monaten war so einiges passiert: Martín war umgezogen und María war aus Soria zurückgekehrt, um sich auf das Disziplinarverfahren vorzubereiten. Sie hatten sich alle vermisst und wollten sich nun einfach gegenseitig auf den neusten Stand bringen.
Die Kellnerin kam zu ihrem Tisch. Trotz der Hitze hatte sie ein schwarzes Tuch um Kopf und Schultern geschlungen, das gerade noch ihr hübsches, ungeschminktes Gesicht zeigte. Sie stellte drei Gläser Bier und Lunas carajillo auf den dunklen Holztisch.
„Das mit dem kulturellen Austausch glaubst du doch wohl selbst nicht“, grummelte Luna, sobald die Kellnerin weg war, und hob seine Tasse zum Prost.
„Du bist so altmodisch“, sagte María, „mit deinem Kognak um ein Uhr mittags, wie so ein typischer alter Spanier.“
„Ach, altmodisch? Und was ist mit den enthaupteten Schafen? Hm? Das war doch genau hier im Viertel, wo gestern ein paar Schafe mitten auf der Straße geköpft wurden, oder nicht? Ist das auch kultureller Austausch?“
Marías Augen verengten sich und sie funkelte Luna an. Er hatte nicht nur fürchterlich veraltete Ansichten, sondern konnte einem auch gewaltig auf die Nerven gehen. Selbst die nostalgische Freude dieses Nachmittags konnte das nicht völlig überdecken. Außerdem wollte sie viel lieber hören, was Martín zu sagen hatte. Warum hatte er sie herbestellt und warum wollte er ihnen die Wohnung plötzlich nicht mehr zeigen? Esteban war auch keine große Hilfe.
„Das ist normal am Ende vom Ramadan“, erklärte er. „Die Schafe werden durch einen Schnitt am Hals getötet und die Reste bleiben dann einfach auf der Straße liegen.“
„Könnten wir bitte über was anderes sprechen?“ Auch Martin klang langsam genervt.
„Was zum Teufel willst du überhaupt, Luna?“, fragte María. „Wir sind doch wegen Martín hier.“
Luna blieb störrisch. „Fakt ist, dass hier im Viertel für den Ramadan Schafe geopfert wurden. Das kam gestern in den Nachrichten. Stimmt doch, oder, Martín?“
„Das waren nicht einmal Schafe, Mann, das haben deine Journalisten-Kollegen nur wieder in den falschen Hals bekommen. Das waren Hähne. Und ich will echt nicht darüber sprechen.“
„Hähne?“ Luna wurde plötzlich ernst. Er hatte in der Vergangenheit schon mal über schwarze Magie berichtet, wenn auch nur ungern. Noch heute lief ihm ein Schauer über den Rücken, wenn er von Ritualen hörte, die Federn, Schnäbel und Blut beinhalteten. „War da auch eine Art Schale bei?“
Martín nickte. María beobachtete ihn. Er wirkte beunruhigt und schien es fast zu bereuen, dieses Wiedersehen organisiert zu haben, nun, da er aus irgendeinem Grund seinen Plan hatte ändern müssen. Außerdem war er von dem Thema eindeutig nicht begeistert. María konnte das gut nachvollziehen. Es war eine Sache, Fälle mit Kollegen zu besprechen, doch wenn man solche Diskussionen vom Beruflichen ins Private verlagerte, ging es meistens schief.
„Können wir bitte das Thema wechseln?“, drängte er erneut.
Dieses Mal mit Erfolg.
Er und sein Stiefbruder hatten je eine Hälfte der Wohnung ihrer Großmutter geerbt, und Martín hatte schließlich beschlossen, sein geliebtes Orcasitas zu verlassen, um näher am Stadtzentrum zu wohnen. Er hatte die Wohnung komplett entrümpelt, das Bad renoviert und eine neue Küche eingebaut, und nun war er guter Dinge. Luna schrieb, mal wieder, an den letzten Seiten eines neuen Buches. Esteban, unerschütterlich wie eh und je, unterstützte weiterhin den neuen Chef J. S., auch wenn eine gewisse Unzufriedenheit immer wieder durchschien. Und María? Alle wollten mehr über den Stand ihres Disziplinarverfahrens hören. Was war ihr Plan? Hatte sie einen guten Verteidiger? War sie zuversichtlich?
Sie fasste ihre Strategie kurz zusammen. Sie wollte aufs Ganze gehen. Nie würde sie ihren Job als Polizistin aufgeben.
Und Tomás? Wie ging es Tomás?
Sie waren gerade mit der dritten Runde fertig – Luna war direkt vom Kaffee mit Kognak zu Wermut übergegangen – und die Kellnerin hatte ihnen die vierte Portion patatas bravas gebracht, als die Frage alle verstummen ließ. Sie galt der Comisaria.
Doch dieses Mal war sie es, die das Thema wechselte.
„Und was wissen wir sonst noch so über diese Hähne?“
2
Angeschlagen, aber nicht in die Knie gezwungen. Seit ihrer Suspendierung sagte sie sich das jeden Morgen – mehr zur Stärkung ihrer Willenskraft als aus purer Überzeugung – während sie auf den Ausgang ihres Disziplinarverfahrens wartete. María setzte sich mal wieder vor den großen Stapel Anklagepapiere, die ihr gemäß Organgesetz 4/2010 des spanischen Gesetzblattes Gehorsamsverweigerung vorwarfen. Dazu kam die mutmaßliche unerlaubte Offenlegung von Unterlagen.
Optimisten waren der Ansicht, dass sie mit einer Anklage wegen grober Fahrlässigkeit davonkommen könnte, wenn sie aus der „Gehorsamsverweigerung“ irgendwie „Ungehorsam“ machen könnte.
Pessimisten hingegen rieten ihr, zu warten, dass sich J. S. selbst etwas zu Schulden kommen lassen würde. Im Moment ging es jedenfalls ums bloße Überleben. Beziehungsweise ging es darum, ihn zu überleben. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, den sie sich immer wieder in Erinnerung rufen musste.
Sie würde nicht nachgeben, bis alle Anschuldigungen gegen sie fallen gelassen werden würden. Alles andere bedeutete den Sieg von Lügen und Verzweiflung.
Weil María Ruiz, Comisaria der Nationalen Polizeibehörde, sich einfach nur um die Fälle gekümmert hatte, die ihr zugeteilt worden waren, einen nach dem anderen, ohne sich von ihrem Ziel abbringen zu lassen. Wenn sie einen Fehler gemacht hatte, dann nur den, starr geradeaus geschaut zu haben ohne auf mögliche Gefahren in ihrer Umgebung zu achten. Sie wurde angeklagt, weil sie eine dieser Gefahren übersehen hatte: den neuen Chef der Madrider Polizei. Er hatte sie zuerst festgenommen und später vom Dienst suspendiert, da sie sich über seine Anordnungen hinweggesetzt hatte.
„Gehorsamsverweigerung.“
María schaute sich dieses Wort noch einmal genau an und versuchte, sich in den Anwalt hineinzuversetzen, den sie bald kennenlernen würde.
Gehorsamsverweigerung war eine schwerwiegende Anschuldigung, die vorsätzlichen Ungehorsam gegenüber der rechtlichen Hierarchien bedeutete. Und es stimmte, dass sie ihrem Chef mit Absicht den Gehorsam verweigert hatte und – hätte sie dieselben telepathischen Fähigkeiten gehabt wie Professor X aus X-Men – ihn sogar ausgeschaltet hätte.
Heute musste sie all ihre Selbstbeherrschung aufbringen, um ihre immer wieder aufkochende Wut im Zaum zu halten. Was nun zählte, war, die feinen Unterschiede zwischen den Tatbeständen „Gehorsamsverweigerung“ und „Ungehorsam“ zu verstehen. Und zwar bis ins kleinste Detail.
María würde ihren Anwalt am Vormittag zum ersten Mal treffen. Sie hatte weder Kaffee trinken noch essen gehen wollen, wie von ihm vorgeschlagen, sondern entschieden, direkt zu ihm ins Büro zu kommen. Ohne Umschweife. Schließlich blieben ihnen nur noch fünfzehn Tage, um eine gute Verteidigung aufzubauen. Sie nahm ihr Handy und die Akten, verstaute alles in einer großen Tasche und ging zum zigsten Mal zu der Kommode, in der sie sonst immer ihre Pistole versteckt hatte. In den ersten Wochen hatte sie noch die Schublade geöffnet und mit ihrer Hand reflexartig hineingegriffen, nur um festzustellen, dass das Fach genauso leer war wie die andere Seite ihres Betts.
Gelegentlich vergaß ihre Hand diese Tatsache noch immer und öffnete die Schublade. Das Fehlen ihres Dienstausweises und der Pistole wurden ihr schmerzlich bewusst. Und jetzt hatte sie nicht einmal mehr Tomás.
In solchen Momenten hielt sie einige Sekunden lang ihre rechte Hand mit der linken fest, bis die Fingerknöchel ganz weiß wurden, um das Gefühl der Leere zu unterdrücken. Wie auch genau in diesem Moment. Wenig später machte sie sich auf den Weg, denn Vicente Velázquez, Anwalt für Polizei- und Ordnungsrecht, erwartete sie schon. María brauchte all ihre Energie, um sich dem Disziplinarverfahren in Ruhe widmen zu können, doch eine Sache gab es auf dem Weg zu seinem Büro noch zu erledigen.
Martín saß am Schreibtisch und füllte gerade polizeiliche Formulare aus, als María anrief. Eigentlich freute es ihn immer, den Klingelton zu hören, den er auf seinem Handy für sie eingestellt hatte. Aber gleichzeitig machte es ihn auch nervös, da es ihn jedes Mal daran erinnerte, dass sich sein Leben durch nur einen Anruf schlagartig ändern könnte. So war das eben mit María Ruiz. Ein Wirbelsturm, der einen mächtig aufrütteln konnte. Und er wusste natürlich, dass ihre Suspendierung nicht bedeutete, dass sie völlig untätig zu Hause saß.
„Hallo, Martín.“
„Hallo“, antwortete er knapp und wartete auf das, was unweigerlich kommen würde.
Dieses Mal hatte er sie weder „Chefin“ noch „Ruiz“ genannt, was María etwas zu überraschen schien. Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort.
„Geht’s dir gut?“
„Ja“, erwiderte er kurz angebunden, „warum?“
„Gestern schienst du ein wenig besorgt zu sein, keine Ahnung warum, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass etwas passiert ist.“ María in Version Mensch? Martín erhob sich von seinem Schreibtisch und ging zu der Tür, die ins Treppenhaus führte. Eine Kollegin holte sich dort gerade einen Kaffee vom Automaten, bevor sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte.
„Aber … Chefin“, er konnte Marías Lächeln bei dieser Anrede am Ende der Leitung förmlich hören, „solltest du nicht gerade bei deinem Anwalt sein?“
„Ich steh quasi vor seiner Tür. Aber vorher wollte ich dich noch kurz anrufen.“
„Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Ruiz, wir sprechen später.“
„Warte, Martín … warte. Sind es diese toten Hähne, die dich beunruhigen?“
„María … Ich kann hier nicht darüber reden.“
„Was ist denn los?“
Martín schwieg. War das María in Zivil oder María, die Polizistin? Inzwischen stand bereits eine andere Kollegin am Kaffeeautomaten, also ging er durch die Tür ins Treppenhaus. Doch hier gab es nirgendwo einen Ort, an dem man in Ruhe telefonieren konnte; seine Chefs waren ganz in der Nähe und außerdem musste er noch Unmengen an Papierkram erledigen. Er hatte keine Zeit, mit ihr zu sprechen.
„Interessierst du dich wirklich für ein paar tote Hähne, Ruiz?“
„Ich interessiere mich für dich. Mir kannst du nichts vormachen. Als du mich in deine neue Wohnung eingeladen hast, strahltest du noch vor Glück, und gestern hast du es dir dann einfach so mir nichts, dir nichts anders überlegt. Irgendetwas ist passiert, und wenn es an diesen toten Hähnen liegt, interessiert mich das natürlich.“
„Das ist eine hässliche Angelegenheit, Ruiz.“
„Ich weiß nicht warum, aber hässliche Angelegenheiten scheinen in letzter Zeit mein Spezialgebiet zu sein.“
Martín gab nach. María in Zivil oder María, die Polizistin, eigentlich war das völlig egal. Sie war eben Ruiz. Sie verabredeten sich für abends bei ihm um die Ecke, um über alles zu reden. Er hatte letzte Nacht kaum geschlafen und war eigentlich nicht in der Stimmung, so spät noch groß etwas zu unternehmen, aber er wusste auch, dass er heute Nacht wieder keinen Schlaf finden würde.
Das Treffen mit dem Anwalt war eine reine Formalität. Als María das Büro verließ, war ihr mehr danach wegzulaufen, als die Unterlagen zu holen, um die der Anwalt sie gebeten hatte. Deshalb schleuderte sie, als sie zu Hause ankam, ihre Tasche in die Ecke, schmiss Blazer und hochhackige Schuhe direkt hinterher, sodass sich ein etwas wackeliger Haufen bildete, und zog sich rasch Jeans, T-Shirt und Sneakers über. Schnellen Schrittes ging sie in die Tiefgarage und entfernte das Vorhängeschloss von ihrem Fahrrad, mit dem sie in letzter Zeit regelmäßig die neuen Radwege Madrids unsicher machte. Sie schaute nach, ob sie Portemonnaie und Handy eingesteckt hatte und schwang sich auf den Sattel.
María hatte festgestellt, dass ein Leben ohne Job ihr nicht nur die Arbeitszeit ersparte, sondern auch die Tasche für den ganzen Kram, den sie normalerweise benötigte: Pistole, Dienstausweis, Akten, Berichte oder Bücher mit Informationen zu den Fällen, an denen sie gerade arbeitete, und in letzter Zeit auch medizinische Fachliteratur zum Thema Wirbelsäulenverletzungen. Was brauchte sie mehr außer zwei Rädern an einer ölverschmierten Kette, zwei bewegungsfreudigen Beinen, einem Handy und 20 Euro für den Fall der Fälle?
Manchmal schien es María, als ob ihre Suspendierung sich auf jedes einzelne ihrer Neuronen auswirkte, die sonst stets in Alarmbereitschaft waren. Anfangs hatten sie protestiert und nach ihrer üblichen Routine verlangt, doch mittlerweile waren sie schon viel ruhiger geworden. Nach dem Tod von Carlos und der Lösung des letzten Falles hatte María etwas Zeit in Soria verbracht, einer Kleinstadt nördlich von Madrid. Dort war sie noch offiziell im Dienst gewesen, bis klar wurde, dass Suspendierung auch wirklich Ende bedeutete und sie nicht mehr auf die Wache kommen sollte. Erst danach war sie nach Madrid zurückgekehrt, wo sie jeden Tag radelte, um den Kopf freizubekommen und begann, sich langsam aber sicher an die Einsamkeit zu gewöhnen. Sie glaubte, oder wollte jedenfalls glauben, dass ihre Freunde auf sie warten würden, dass ihr Team in gewisser Weise immer ihr Team bleiben würde, und dass sie von Zeit zu Zeit ihre Mutter und ihre Geschwister besuchen könnte, die froh waren, dass sie eine Weile lang gezwungen war, die Dinge ruhiger angehen zu lassen. Auch Tomás schwirrte in ihrem Kopf herum und sie dachte oft an ihn, während sie schwitzend in die Pedale trat. Doch wenn es um ihn ging, konnte sie nicht viel tun, auch wenn die Versuchung stets da war. Deshalb probierte sie, ihre übereifrigen Gehirnzellen zu beruhigen, indem sie beim Radfahren Autos und stylische Jogger mit Schrittzählern am Arm hinter sich ließ. All das erinnerte sie ein bisschen an die künstlich heile Welt von The Truman Show. Sie nahm die Parks voller rumänischer Kindermädchen und Boule spielender Rentner in den besser gestellten Gegenden der Stadt nur flüchtig wahr, bevor sie den bevölkerungsreichen Süden erreichte, der den Manzanares überblickte. Mit seinen Graffiti, den Scherben und überquellenden Mülltonnen, wo der Geruch von Joints und Urin in der Luft lag, wo es heiß war und die Mücken stachen, aber wo es auch mehr Leben, mehr Lärm, mehr Welt gab. Ihr gefiel es hier.
An der Puente de Segovia stieg María vom Fahrrad. Ihr blieb noch genügend Zeit, um die Gegend zu erkunden und sich im Parque Caramuel etwas umzusehen, bevor Martín kam. Sie schloss ihr Fahrrad an ein Geländer, trank einen Schluck Wasser aus einem kleinen Brunnen und trocknete sich das Gesicht mit den Ärmeln ihres Shirts ab. Sie suchte nach der Treppe, die sie zu der Stelle führen würde, wo jemand auf so grausame Art und Weise ein paar Hähne getötet hatte, dass damit bestimmt keine Suppe gekocht werden sollte. Sie hatte weder herausfinden können wie viele noch um welche Art von Tieren es sich genau handelte – im Internet kursierten die unterschiedlichsten Versionen. Fest stand, dass alles auf eine Art Ritual hindeutete. Die Tat hatte sich nachts ereignet, als sich die ganze Stadt bei den Feierlichkeiten zum Fest von San Isidro, dem Schutzheiligen Madrids, vergnügt hatte. Morgens hatten ein paar Kinder die Vögel entdeckt und waren schreiend zu ihren Eltern gerannt, die wiederum die Polizei benachrichtigt hatten. Da alle Nachbarn einen Blick auf den Tatort hatten werfen wollen, hatte die Stadtverwaltung die toten Tiere entfernen lassen und nun war nichts mehr zu sehen.
María war im Park angekommen und sah, dass das Café, das ihr am Sonntag aufgefallen war, geöffnet hatte. Bevor sie den Tatort genauer unter die Lupe nahm, würde sie eine Kleinigkeit essen.
„Was kann ich dir bringen?“
Der Kellner hatte einen ausländischen Akzent, der nach Deutschland klang, und Dreadlocks bis zur Hüfte. Wahrscheinlich waren die einmal blond gewesen und würden es nach einer ausgiebigen Dusche auch wieder sein. María bemerkte eine kleine Anstecknadel an seinem T-Shirt mit dem Schriftzug: „Ich bin Hausbesetzer“ und warf einen Blick in die handgeschriebene Mittagskarte.
„Eine Cola und ein Käsesandwich, bitte.“
„Jetzt ist nicht die Uhrzeit für Sandwiches“, erwiderte er, „jetzt ist Kaffee- und Kuchenzeit.“
María betrachtete ihn. Er war eindeutig Ausländer, aber verhielt sich schon wie ein waschechter spanischer Kellner. Barsch und aufdringlich.
„Und wo steht das?“
„Hier.“ Er tippte an seine Schläfe. Die Dreadlocks hatte er mit einem Stirnband aus Stoff gebändigt, das María am liebsten sofort in den nächsten Waschsalon gebracht hätte. „Aber weil du es bist, mache ich dir ein Sandwich.“
Dieses Mal erwiderte María nichts. Sie wusste, dass sie ihm laut Madrider Verhaltenskodex für den Umgang mit Kellnern wahrscheinlich dafür danken sollte, dass er ihr genau das bringen würde, was sie bestellt hatte, und nicht das, was seine Majestät für angemessen hielt. Doch sie war zu erschöpft vom Fahrradfahren und dem üblichen Großstadtwirrwarr. Es dauerte nicht lange, bis er mit einem trockenen Sandwich zurückkam, das in zwei ungleiche Hälften geschnitten und mit einer einzigen dünnen Käsescheibe belegt war, bei der sich niemand die Mühe gemacht hatte, die Rinde zu entfernen. Die Cola schwappte aus dem Glas mit Eiswürfeln und besprenkelte den Tisch mit dunklen Tropfen. Es wäre natürlich viel zu einfach gewesen, das Glas nicht so vollzugießen.
„Soll ich dir was sagen?“, fragte der Deutsche, offenbar fest entschlossen, die Wünsche seiner Kundin zu ignorieren.
Nein, aber du wirst es garantiert trotzdem tun, dachte María und schluckte die Bemerkung herunter.
„Was denn?“
„Dein Gesicht kommt mir bekannt vor.“
Auch das war hier nicht ungewöhnlich. Nach dem schlechten ersten Eindruck wurden die Kellner plötzlich freundlich und zeigten statt Gleichgültigkeit großes Interesse.
„Ich bin zum ersten Mal hier.“ María ging auf ihn ein. Schließlich wollte sie etwas von ihm.
„Komisch, ich könnte schwören, dass ich dich schon einmal gesehen habe. So ein hübsches und interessantes Gesicht wie deines vergisst man nicht so schnell.“
So einen Idioten ohne Einfallsreichtum hätte ich sicher auch nicht vergessen, dachte María, nahm einen Bissen vom Sandwich, trank einen Schluck Cola und sagte: „Kann ich dich etwas fragen? Vielleicht kannst du mir helfen.“
Der Deutsche verschränkte die Arme, seine Sternstunde schien endlich gekommen zu sein.
„Was willst du wissen?“
„Stimmt es, dass hier letztes Wochenende ein paar Tiere getötet wurden?“
„Das stimmt.“
„Hier in diesem Park?“
„Korrekt.“
Der Kellner war nun merklich wortkarger und wollte sich wichtig tun, indem er sie zappeln ließ. Gleichzeitig machte er aber auch keine Anstalten, sich von ihrem Tisch zu entfernen. Er wartete eindeutig auf weitere Fragen. María widmete sich unbeeindruckt ihrem Essen, bis er schließlich fragte: „Und was genau willst du wissen?“
„Waren es Lämmer oder Hähne? Ich habe beides gehört.“
„Weder noch.“
„Sondern?“
„Darf ich fragen, warum dich das so interessiert?“
María betrachtete ihn genauer. Der Mann wirkte auf einmal ernst und wachsam. Sie bemerkte, dass er die Stirn runzelte. Er nahm einen Lappen aus seiner Tasche, den María gerne zu seinem Stirnband in die imaginäre Waschmaschine gesteckt hätte, und fing an, den Tisch abzuwischen. Sie ahnte, dass er Tieropfer genauso verabscheute wie sie selbst.
„Wegen der Tiere.“ Das war zwar nicht gelogen, aber sie musste auch nicht unbedingt weiter ins Detail gehen. „Und aus Neugier.“
„Es sind schon ein paar Tierschützer dagewesen. Es scheint, als ob es in Madrid noch weitere solcher Fälle gegeben hat.“
Endlich holte der Kellner etwas weiter aus. Es waren weder Lämmer gewesen, wie einige böse Zungen im Viertel behauptet hatten, um die Tat auf den Ramadan zu schieben, noch Hähne, wie von den Kindern schreiend verkündet worden war, die die Gräueltat entdeckt und in ihrem Leben außer auf einer Packung Cornflakes noch nie einen Hahn gesehen hatten. Es waren Truthähne gewesen. Drei tote Truthähne mit halb geschlossenen Augen, aufgerichtetem Schnabel und schräg nach oben gereckten Flügeln, als wollten sie abheben. Ihre Körper waren noch weich und warm gewesen, sodass einige gemurmelt hatten: „Man sollte sie rupfen und braten. Oder einfrieren. Sie wären das perfekte Festmahl für Weihnachten.“
„Ihr habt sie angefasst?“
„Mein Chef schon. Ich hab nur Fotos gemacht.“
María legte den Rest ihres Sandwiches beiseite – das Toastauf-Toast, das übriggeblieben war, nachdem sie die einsame, dünne Käsescheibe aufgegessen hatte. Der Kellner hatte sein Handy hervorgeholt und zeigte ihr die Fotos.
Drei Truthähne mit schwarzen Federn lagen in einer unnatürlichen Haltung auf dem Boden, die Beine und Füße unter sich gefaltet und die Flügel weit nach oben gereckt. Die Schnäbel waren in die entgegengesetzte Richtung gekrümmt und schienen fast aus dem Bild zu fallen.
Ihre geschlossenen Augen wirkten so entkräftet, dass man nur Mitleid haben konnte. Das Ganze sah mehr nach einem detailreich ausgearbeiteten Stillleben als nach einem Schauplatz des Grauens aus. Dass alle drei Tiere dieselbe Position einnahmen, konnte kein Zufall sein.
„Warum hast du Fotos gemacht?“
„Keine Ahnung. Ihr Spanier seid sehr grausam. Das Einzige, was ich an Spanien nicht mag, ist die Tierquälerei. Manchmal gehe ich sogar auf Demos.“
María zog es vor, nicht mit Verallgemeinerungen über die Deutschen zu antworten, denn der Mann hatte recht. Trotzdem war das hier etwas völlig anderes: Drei tote Truthähne in einer so gezwungen wirkenden Haltung mitten auf einem öffentlichen Platz deuteten eher auf ein Ritual oder eine gezielte Botschaft hin, bei dem Tiere als Opfer dienten. Sie ging die Fotos noch einmal durch.
„Waren da auch Schalen? Für das Blut?“
„Nein, das war alles“, erwiderte der Kellner erstaunt. „Warum fragst du?“
„Ist es nicht möglich, dass jemand die Schalen bereits weggeräumt hatte, als du die Truthähne gesehen hast? Ich habe gehört, dass das Blut der Tiere in einer Schale gesammelt wurde. Dann sähe das alles ganz nach schwarzer Magie aus.“
„Schwarze Magie? Du hast ja gar keine Ahnung, wovon du sprichst, Mädchen.“
María hob die Augenbrauen. Der Deutsche war wieder zum unfreundlichen spanischen Kellner geworden und es galt zu warten, bis er sich dazu herabließ, sie aufzuklären.
„Es war ein Tierserienmörder. Spanien ist voll davon. Die Stierkämpfer gehören auch dazu. Und wer Tiere töten kann, der kann auch Menschen töten.“
María bedankte sich für die Informationen und bat um die Rechnung. Sie gab dem Kellner ihre Telefonnummer, damit er ihr die Fotos schicken konnte, und wartete, bis er sie auf WhatsApp hinzugefügt hatte.
„Willst du mal mit zu einer Demo kommen?“, fragte er. „Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Wenn du magst, gebe ich dir gerne Bescheid.“
María wurde sich plötzlich ihres Zustands bewusst. Der einzige Nachteil am Fahrradfahren war es, dass sie danach immer völlig zerzaust war. Doch so war es ihr ein Leichtes, sich mit der Sorte junger Menschen anzufreunden, die sich nicht um ihr Aussehen scherte, dafür aber alles für die Umwelt und gegen den Kapitalismus tun würde. Eine Dusche bei Martín würde das sicher ändern – wenn er sie denn heute in seine Wohnung lassen würde. Jetzt bezahlte sie jedenfalls erst einmal und verabschiedete sich.
„Man sieht sich.“
3
Normalerweise freute sich María immer auf die Treffen mit Martín, denn sie verstanden sich hervorragend. Auch wenn bei ihm immer das Risiko bestand, dass sie auf Tomás zu sprechen kamen, was sie lieber vermeiden würde – gerade heute. Tomás war zwar aus dem Koma erwacht, allerdings hatten die Ärzte nur mit den Schultern gezuckt, als María gefragt hatte, ob er für immer in einem kraftlosen Körper mit schmerzenden, widerspenstigen Gliedern leben müsse. „Man kann nie wissen“, war die Antwort. „Er ist am Leben und das ist die Hauptsache.“ Von einer Rückkehr in die IT-Abteilung der Polizei war keine Rede gewesen, und was die Fortsetzung seiner privaten Beziehungen anging, so schien es unangebracht, auch nur darüber nachzudenken.
Aber natürlich hatte sie darüber nachgedacht.
Sie beide hatten es getan.
Sie waren, nachdem Tomás aus dem Koma erwacht war, eine Weile lang wieder ein Paar gewesen. Sie waren sogar zusammen verreist, hatten hoffnungsvolle Blicke und Zärtlichkeiten ausgetauscht und auch ihr Verlangen nacheinander wieder entfacht, was jedoch immer in nervösem Lachen geendet hatte. Aber die Dinge hatten eine Wendung genommen, über die sie nicht sprechen wollte.
„Comisaria!“
„Martín!“
Die beiden umarmten sich innig. Das war der Vorteil davon, suspendiert zu sein – María war niemandes Chefin mehr und damit zweifelsohne etwas menschlicher geworden. Martín hingegen war angespannt, als hätte er es eilig.
„Wo kommst du denn her?“, fragte er in Anspielung auf ihr zerzaustes und völlig verschwitztes Äußeres.
„Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Kann ich mich kurz bei dir frisch machen?“
„Dafür ist jetzt keine Zeit, Ruiz“, murmelte Martín, der, ohne María Zeit für eine Antwort zu lassen, auf sein Handy starrte, eine Nachricht las und plötzlich bleich wurde. „Los, komm mit!“
María schwieg. Nicht aus Enttäuschung, dass Martín auch heute keine Besucher in seiner Wohnung haben wollte, sondern weil er einen merklich unruhigen und nervösen Eindruck machte. Da war keine Spur des üblichen Leuchten auf dem Gesicht, das sie so schätzte. Schnellen Schrittes ging er los. María folgte ihm.
„Was ist denn passiert?“
Doch Martín schwieg. Er starrte nur auf sein Handy und ging zügig weiter. Auf den Stufen, die den Park vom Manzanares trennten, nahm er zunächst zwei, und schließlich drei auf einmal. Am Fuße der Treppe angekommen, bog er nach rechts.
„Kannst du mir bitte wenigstens sagen, was passiert ist?“
„Folg mir einfach. Ich erklär alles später.“
Sie gingen weiter die Straße entlang. María konnte nicht sagen, ob sie einen Verbrecher jagten oder selbst aus dem Viertel flohen, doch sie folgte wortlos. Jedes Mal, wenn er auf sein Handy schaute, beschleunigten sich seine Schritte. Den letzten Teil der Strecke legten sie rennend zurück.
„Hier ist es.“ Endlich hielt er an. Martín bückte sich und stützte seine Arme auf den Oberschenkeln ab, um tief Luft zu holen. Es war heiß und er war mittlerweile genauso verschwitzt wie María, die nicht nur völlig aus der Puste, sondern auch verwirrt war.
„Wir müssen suchen.“
„Aber was genau suchen wir denn, Martín?“
„Eine Baustelle. Wir suchen eine Baustelle.“
María sah sich um. Sie befanden sich zwischen der Kapelle San Isidro und dem gleichnamigen Park. Mehrere junge Männer warteten auf beiden Seiten der Straße zwischen unzähligen leeren Parkplätzen und kämpften darum, für ein bisschen Trinkgeld den ankommenden Autos beim Einparken zu helfen, was bei all den leeren Parkplätzen völlig überflüssig war. Die Straße führte leicht bergauf und María erspähte weiter oben einen Betonmischer auf dem Gehweg.
„Da, eine Baustelle.“ María wies mit dem Finger darauf.
„Nein, komm mit.“ Martín starrte weiter auf sein Handy. Er fing an, den Hügel zu erklimmen, bog aber kurz vor der Kapelle rechts ab, wo der Abhang die Friedhofsmauer traf. „Hier ist es. Scheiße.“
Vor ihnen tat sich ein Sumpf auf. Und direkt in der Mitte war ein kleiner Hund, der bis zum Hals im Morast steckte. Es war ein ungewöhnlicher Anblick, denn von der Dürre, die im Mai die Parks von Madrid austrocknete, war hier nicht viel zu erkennen. Die Schläuche, die der Bewässerung des Friedhofrasens dienten, waren beschädigt und das Wasser floss in Strömen nach unten. Die Mauer machte genau an dieser Stelle eine Biegung, sodass ein Gemisch aus Sand, Erde und Wasser die Talmulde in eine Art Staudamm verwandelt hatte. Der Hund, ein kleiner schwarzer Foxterrier, war beim Versuch, den Hang neben der Friedhofsmauer zu erklimmen, mitgerissen worden.
Er war bis zu den Ohren mit Schlamm beschmiert und versuchte, seine Schnauze über Wasser zu halten. Er gab ein kurzes, aber verzweifeltes Jaulen von sich, den Blick starr auf einen Punkt rechts am oberen Ende des Hangs gerichtet, den sie nicht sehen konnten. Er war noch am Leben, aber wenn sie nicht sofort etwas unternahmen, würde er bald ertrinken.
„Der Arme, wie ist er denn bloß da hingekommen?“, stieß María verzweifelt hervor.
„Oder wie wurde er dahin gebracht?“, entgegnete Martín. „Das hier ist kein Zufall.“
Sie versuchten, den Hund zu erreichen, aber auch sie versanken im Schlamm und kamen nicht voran. Martín probierte, sich dicht an der Wand entlang zu hangeln, aber sie war glatt und schmutzig und hatte keine Risse oder Pflanzen, an denen er sich hätte festhalten können. Auf einmal wurde der Hund ganz still, der Kopf noch über der Oberfläche, der Körper gefangen im Schlamm. Wahrscheinlich versuchte er, sich mit den Beinen nach oben zu stemmen, einen festen Punkt zu finden, von dem aus er seinen Oberkörper hochdrücken könnte, der wegen des ganzen Schlamms in seinem Fell immer schwerer wurde. Dabei starrte er weiterhin unentwegt nach oben, so konzentriert, dass er gar nicht auf die beiden Menschen achtete. Es war, als ob er immer noch vorwärts kommen wollte, anstatt zu einer sicheren Stelle zurückzukehren. Mittlerweile war selbst seine Schnauze mit Schlamm beschmiert und auch den Körper konnte er nicht mehr bewegen. Gleichzeitig fixierte er mit seinem Blick immer noch diesen einen Punkt weiter oben. Martín schien verzweifelt nach einem Weg zu suchen, den Hund zu retten. Er blickte sich hektisch um, erspähte eine herumliegende Plastiktüte, riss sie auf und breitete sie etwas unbeholfen auf dem Schlamm aus. Er versuchte draufzutreten, denn würde die Tüte sein Gewicht irgendwie halten können, bestand eine Chance, den Hund zu erreichen. Auch María suchte die Umgebung nach etwas ab, das ihnen im Schlamm Halt geben könnte. Sie hatte auch überlegt, ihren Gürtel abzunehmen, um das Tier einzufangen, aber das war unmöglich. Nur in Comics wussten Hunde, wie sie sich mit Hilfe eines Seils aus Gängen und Brunnen herausziehen konnten, als wären sie Menschen.
Martín sank langsam mit der Plastiktüte unter den Füßen ein, als ihnen beiden klar wurde, dass der Foxterrier bereits tot war. Vor Angst gestorben. Sein Kopf schaute gerade noch so aus dem Schlamm hervor. Wenigstens war er nicht ertrunken. Kurze Zeit später verschwand er ganz, verschlungen vom Morast. Sein winziger Körper hatte keine Spuren im Schlamm hinterlassen. Er war noch ein Welpe gewesen.
Die beiden retteten sich aufs Trockene und sanken zu Boden.
„Erzählst du mir vielleicht jetzt endlich mal, was los ist?“, wollte María wissen.
Martín rang noch immer nach Atem. Er stand auf, aber nur, um sein Handy wütend zu Boden zu werfen. María hatte ihn noch nie so aufgebracht erlebt.
„Was ist denn los, Martín? Hat das irgendwas mit diesen Truthähnen zu tun?“
„Was für Truthähne?“
„Na, die Lämmer, die eigentlich Hähne waren, sich zuletzt aber als Truthähne entpuppt haben.“
„Woher weißt du das nun wieder?“
„Mann, du kennst mich doch.“
Martín sah sie überrascht an. In seinem Zustand schien er eine solche Flut an Informationen nicht verarbeiten zu können. María hob sein Handy vom Boden auf und gab es ihm zurück, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Beide waren von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt, und in diesem Moment bemerkte sie, dass Martín weinte. Plötzlich verstand sie, was los war.
„Scheiße. Das war dein Hund!“
„Er war erst vier Monate alt“, sagte Martín, in Tränen aufgelöst wie ein kleines Kind. „Wer tut denn so etwas?“
María umarmte ihn. Dann nahm sie seine Hand und zog ihn auf die Straße.
„Ich glaube, du schuldest mir jetzt eine Dusche. Und frische Klamotten. Und danach erzählst du mir alles.“
Der im Schlamm versunkene Hund war nur die letzte in einer ganzen Reihe von Absurditäten, die Martín seit seinem Einzug widerfahren waren: die Schockierendste davon war die toten Truthähne, die vor seiner Haustür zur Schau gestellt worden waren. Die Grausamste der Tod seines Hundes. Die Nachrichten, die ihn zum Tatort geführt hatten, die Unerklärlichste. Weder María noch Martín glaubten an wilde Verschwörungstheorien, aber eben auch nicht an solche fatalen Zufälle. Insbesondere, wenn diese so kurz aufeinander folgten. Sie hatten beide gesehen, wie der Hund, den er morgens in seiner Wohnung zurückgelassen hatte, ohne Halt in einem Sumpf aus Sand und Schlamm versunken war, den irgendein Geisteskranker durch das Beschädigen der Wasserschläuche erschaffen hatte. Es war kein Unfall. Es war kein Versehen. Es war keine Drohung. Und es ging auch nicht lediglich um die Opferung der drei Truthähne im Park.
„Wir sind verrückt geworden“, murmelte María, mehr zu sich selbst als zu Martín.
„An was denkst du gerade?“, fragte er.
Sie dachte an den deutschen Kellner mit den Dreadlocks und den Tierserienmörder, von dem er gesprochen hatte, aber das konnte einfach nur Schwachsinn sein. Wäre sie doch nur in Soria geblieben, statt in diese Stadt der Verrückten zurückzukehren. Aber das sprach sie nicht laut aus. Stattdessen fragte sie zurück: „Und warum wolltest du uns nicht deine Wohnung zeigen? Hattest du Angst?“
„Das hat damit nichts zu tun. Ich habe die Wohnung nur zur Hälfte von meiner Großmutter geerbt, die andere gehört meinem Stiefbruder. Der ist am Wochenende überraschend aufgetaucht. Er will seinen Anteil an dem Geld, und zwar sofort. Wir haben uns gestritten, deshalb ist er jetzt eingezogen, und ich will nicht noch mehr Ärger.“ Er sprach leise, fast etwas hektisch, und machte keinen Versuch, sein Unbehagen zu verbergen. „Darum können wir auch nicht lange bleiben.“
In seiner Wohnung angekommen, hatte Martín sie direkt ins Badezimmer gelotst. Nachdem er sich in seinem Zimmer umgezogen hatte, war er schnell zum Bad zurückgekehrt, um ihr frische Klamotten zu bringen, und wartete ungeduldig auf sie.
„Heute willst du mir die Wohnung wohl auch nicht zeigen, was?“, fragte María, als sie ihn merklich angespannt im Flur vorfand.
„Ein anderes Mal, María, ich versprech’s dir. Wir müssen gleich wieder los. Zieh das hier an.“
María zog Martíns Hose und T-Shirt an, aber als er sah, wie ihr zierlicher Körper in den für einen großen, muskulösen Mann gedachten Klamotten versank, musste er lachen. „Moment. Warte kurz.“
Kurz darauf kam er mit einem kurzen Rock und einem Tank-Top zurück. María hob skeptisch eine Augenbraue, aber zog beides an. Es passte perfekt.
„Und wo hast du dieses Outfit her?“
Martín errötete. Er bandelte immer mit mehreren Frauen gleichzeitig an und hatte sich nie auf eine von ihnen festgelegen können, aber dass nun eine dieser Frauen ihre Kleidung in Martíns Wohnung gelassen hatte, deutete darauf hin, dass er María etwas verschwieg.
„Hier stimmt doch etwas nicht“, sagte María. „Ich weiß nicht, ob du deinen Stiefbruder vor mir versteckst oder vielleicht doch eine heimliche Geliebte irgendwo hier in dieser riesigen Wohnung gefesselt hast. Irgendetwas verheimlichst du jedenfalls.“
„Komm schon“, sagte er ungeduldig, während er die Schlüssel holte. „Lass uns was essen gehen.“
Diesmal wollten sie zum Paseo de Extremadura, kamen aber nicht sehr weit. Sie waren kaum losgegangen, als aus der entgegengesetzten Richtung mehrere Polizeiautos und Krankenwagen mit lauten Sirenen kamen. María und Martín brauchten sich nicht anzuschauen. Sie drehten sofort um und liefen dem Lärm nach. Sie kannten diese Geräusche sehr gut, und wenn sie sich nicht irrten, deuteten sie daraufhin, dass sich möglicherweise ein Mord ereignet hatte.
Alles, aber wirklich alles, fing wieder von vorne an.
4
Die Polizeiwagen standen mit blinkenden Lichtern aber ohne Sirenen am Ufer des Manzanares und versperrten die Sicht auf den Tatort. Es war bereits dunkel und die wenigen Passanten und Radfahrer, die noch unterwegs waren, näherten sich schweigend dem Absperrband.
„Da liegt eine tote Frau“, sagte einer.
„Es ist nicht sicher, dass sie tot ist. Und übrigens scheint sie noch sehr jung zu sein, fast noch ein Mädchen“, erwiderte ein anderer. Wie immer in solchen Situationen akzeptierten die Schaulustigen jedes Gerücht als Wahrheit.
Martín und María gingen schnurstracks weiter.
„Ich bin von der Mordkommission“, sagte Martín. María schwieg. „Ich wohne hier in der Gegend, vielleicht kann ich helfen.“
Die Polizisten schenkten ihm keine große Aufmerksamkeit und ließen ihn passieren. María folgte ihm. Ihr Anwalt hätte dem sicher nicht zugestimmt. Sein erster Rat war es gewesen, ruhig zu bleiben, sich von jeglichen polizeilichen Aktivitäten fernzuhalten und die Zwangspause als Urlaub anzusehen. Urlaub, was für ein überladenes Wort, hatte sie gedacht.
Sie erreichten den Tatort an einer der Stauanlagen des Manzanares. Eine tote Frau stand an das Geländer gefesselt. Eine Schelle um ihren Hals hielt sie aufrecht und ihre Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Ihr Kopf war zur Seite gedreht, soweit es die Halsschelle zuließ. Sie war sehr jung mit blassem Gesicht, die Augen waren nach oben verdreht, der Mund ausdruckslos geöffnet. Ihr schwarzes Haar, lockig und dicht, hatte sich aus dem Band gelöst, das es zusammengehalten hatte. Ihre Füße, ebenfalls gefesselt, blitzten nackt unter einem langen Rock hervor. Die Frau war attraktiv und strahlte, selbst im Dunkeln stehend, noch ein gewisses Leuchten aus.
Die Leiche befand sich in dem für Passanten unzugänglichen Bereich der Mauer, die beide Wehre in der Mitte des Flussbetts miteinander verband. Die Form des Geländers, an das sie gefesselt war, ähnelte einem Kreuz. Wie jemand diese Frau mit so vielen Utensilien an einem öffentlichen und doch unzugänglichen Ort im Zentrum von Madrid hatte foltern können, war eine Frage, die María und Martín noch nicht beantworten konnten. Noch unvorstellbarer war es, wie jemand so grausam sein konnte, einem anderen Menschen dieses Leid überhaupt zuzufügen. Dort, am Ufer des Manzanares, wo üblicherweise die Madrider ihre Fahrräder anschlossen oder die Enten vor fröhlichen Kinderaugen füttern, hatte der Täter – oder waren es mehrere gewesen? – eine Art Schafott nachgebildet und eine fast filmisch anmutende, mittelalterliche Schreckensszene nachgestellt.
María ging einen Schritt zurück. Die Spurensicherung hatte begonnen, Fingerabdrücke zu nehmen, und die Ermittler der Mordkommission, der sie vor ihrem Exil in Soria ebenfalls angehört hatte, sahen sich um, fotografierten und liefen den engen Tatort auf und ab. Glücklicherweise ohne sie zu bemerken. Martín meldete sich freiwillig, bei der Ermittlung zu helfen, aber ihm wurde gesagt, dass nur noch der Tod des Opfers durch einen Arzt bestätigt werden musste und es vorerst nichts weiter zu tun gab.
María ging in Richtung Ufer. In Gedanken vermaß sie das Gelände und kam zu dem Schluss, dass der Mörder nur auf dem Wasserweg hatte fliehen können. Vielleicht war er sogar von dort gekommen. Wegen des hohen Polizeiaufgebots war es zu riskant, sich das Flussufer genauer anzusehen, aber sie erinnerte sich, dass man auf vielen Abschnitten über rostige Leitern zum Flussbett gelangen konnte. Wenn man vom Manzanares sprach, waren Flussbett und Wasserlauf zwei verschiedene Dinge, besonders im Sommer, wenn nur ein dünnes, schmutziges Rinnsal die Mücken der Gegend anzog. Sie wusste, dass die Bürgermeisterin von Madrid die Wehre geöffnet hatte, um den natürlichen Verlauf des Flusses wiederherzustellen, auch wenn er kaum mehr Wasser führte. Es sollte nicht schwer sein, den ungefähren Wasserstand jenes Montagnachmittags herauszufinden. Wenn sich alles so zugetragen hatte, wie sie vermutete, war der Täter im Dunkeln auf einem Boot oder Lastkahn mit all seinen Utensilien angekommen, hatte der noch lebenden Frau oben die Halsschelle angelegt und die Hände zusammengebunden, und war anschließend wieder verschwunden. Das war eine Möglichkeit. Aber wann hatte er sie dann getötet? Beziehungsweise wann war sie gestorben?
Und konnte es wirklich sein, dass ihn niemand dabei gesehen hatte?
Eine zweite Möglichkeit war, dass sie auf andere Weise hergekommen waren, doch dann wäre der Widerstand des Mädchens, falls sie denn welchen geleistet hatte, oben viel auffälliger gewesen. Und die Frage, wie und wann er sie getötet hatte, beantwortete das auch nicht. Man musste auf Zeugen warten. Und auf die Obduktion, die weitere Informationen liefern würde – die zeitliche Abfolge, Anzeichen von Gewalt, in welchem Zustand sich das Mädchen zuvor befunden hatte. Die Warnung des deutschen Kellners mit den Dreadlocks ließ sie nicht los: „Wer Tiere töten kann, der kann auch Menschen töten.“
„Vergiss es, Ruiz. Das hat nichts miteinander zu tun“, sagte sie zu sich selbst.
Sie war so weit gegangen, dass sie die Polizeiabsperrung nicht mehr sehen konnte.
„Wo willst du hin?“ Martín war ihr gefolgt.
„Komm mit!“
Sie hatten die Stauanlage hinter sich gelassen und liefen noch immer am Flussufer entlang, weg vom Tatort. Endlich fand María, wonach sie suchte, raffte ihren Rock hoch und ging auf die Leiter zu, die zum Flussbett führte.
„Bist du verrückt?“
„Klar, das weißt du doch.“
Sie stieg die Stufen hinunter und er folgte ihr. Das letzte Stück mussten sie herunterspringen, da die Leiter für Boote gedacht war und das Wasser nicht einmal hoch genug stand, um die unterste Stufe zu erreichen. Sie begannen, den Fluss hinabzulaufen. Wie vermutet war das Flussbett am Ufer trocken. Als sie sich dem Tatort wieder näherten, blieb María stehen.
„Nach was suchst du?“
„Er kann nur über den Fluss geflohen sein.“
„Aber hör mal, es gibt kaum Wasser. Wir sind nicht im Dienst, wir sind nicht bewaffnet, selbst wenn wir ihn finden, können wir nichts tun. Und wenn du erwischt wirst, hast du noch ganz andere Probleme.“
María schwieg. Sie ging langsam weiter am Ufer entlang, ohne die blauen Lichter, die sich dort oben drehten, aus den Augen zu lassen. Zwar war noch kein Polizist die Leiter beim Tatort hinuntergestiegen, aber dann und wann spähte ein Beamter hinab zum Fluss. Im Dunkeln waren María und Martín nicht zu sehen.
Endlich war sie am Ziel angekommen. Ihre Turnschuhe, gerade erst vom Schlamm befreit, waren schon wieder schmutzig.
„Hier“, sagte sie zu Martín.
„Was ist denn?“
María holte ihr Handy hervor und leuchtete die Wand an. Eine Wolke von Stechmücken schwirrte im Lichtkegel umher. Dahinter stand zwischen zwei Stufen der Leiter in frischer schwarzer Farbe geschrieben:
PR LIBERAL
María machte mehrere Fotos von dem Graffito und dem schlammigen Boden. Es waren keine Fußabdrücke zu sehen, und auch wenn es welche gegeben hätte, waren sie wahrscheinlich schon von der Strömung weggespült worden. Plötzlich kam eine Stimme von oben.
„Ist da jemand?“
María schaltete ihr Handy aus und begann zu rennen. Martín folgte ihr. Loyal gegenüber seiner ehemaligen Chefin zu sein war eine Sache, aber er durfte sich auf keinen Fall in das rechtliche Chaos verwickeln lassen, in dem sie sich befand. Er hatte ohnehin schon genug Probleme.
Luna hatte seit mehreren Tagen versucht, den Termin im Café Comercial hinauszuzögern, aber es war ihm einfach keine Ausrede mehr eingefallen. Er trug ein makellos weißes Hemd, eine gestreifte Hose und Mokassins aus glänzendem Leder, sein Bart war ordentlich getrimmt und die Haare nach hinten gegelt. Er lächelte in Erinnerung an etwas, das seine ehemaligen Kollegen bei der Zeitung El Diario immer zu ihm gesagt hatten: „Wenn Luna glänzende Schuhe trägt, ist die Welt in Ordnung. Daran sieht man, dass er sein Leben im Griff hat.“
An dem Spott seiner Kollegen war etwas Wahres dran.
In seinem langen Leben hatte es schon viele Höhen und Tiefen gegeben, und die weniger glücklichen Zeiten hatte er in Gesellschaft von ziemlich viel Alkohol und einer allgemeinen Vernachlässigung seines Äußeren überstanden. Was Andere dachten, war ihm dann herzlich egal. Doch seine Arbeit hatte er nie vernachlässigt, und dank seines sechsten Sinnes hatte er sich bis jetzt stets über Wasser halten können. Gott sei Dank.
Auch in den guten Zeiten trank er, da gab es nichts zu leugnen, aber wenigstens schaffte er es dann, seine Schuhe auf Hochglanz zu bringen.
Luna setzte sich blendend gelaunt an die Bar des Cafés, während er auf seinen alten Freund wartete, der ihn unbedingt hatte treffen wollen. Aus unerfindlichen Gründen war Jacinto Fernández der Meinung, dass ein Journalist mit mehr als vierzig Jahren Berufserfahrung eine wunderbare Ergänzung für die Kommunikationsabteilung der BBVA-Bank wäre, bei der Jacinto arbeitete.
Wie gewöhnlich bestellte Luna einen carajillo. Zuerst hatte er es für Wahnsinn, einen Witz oder einfach einen Akt des Mitleids seines Freundes gehalten, der selbst in den Vorruhestand treten wollte. Nichts lag seiner Berufung ferner, als auf die dunkle Seite überzulaufen, die Informationen lieber tröpfchenweise durchsickern ließ, statt sie klar zu kommunizieren. Leidenschaftliche Journalisten wussten, dass sich unternehmensinterne Kommunikationsabteilungen zur Kommunikation verhielten wie die Orwellschen Ministerien für Liebe und Überfluss zur Liebe und zum Überfluss: Es war ein Widerspruch in sich. Eine Möglichkeit, sich über andere lustig zu machen. Informationen zu verheimlichen. Einfluss auszuüben.
Sein Instinkt hatte also ganz klar nein gesagt. Sein Konto jedoch …
Sein Konto sagte etwas anderes. Es sehnte sich förmlich nach einem geregelten Einkommen. Von der freiberuflichen Zusammenarbeit mit El Diario hätte er eigentlich gut leben sollen, nachdem er von seinem Chef auf die Straße gesetzt worden war, aber das hatte sich leider schnell erledigt. Zwar gab es immer wieder Nachfragen zu Artikeln und Recherchen, aber die Bezahlung war lächerlich und wurde von Jahr zu Jahr immer schlechter, während die jungen Leute, die gerade von der Uni kamen, dieselbe Arbeit sogar kostenlos anboten. Er hatte einige erfolgreiche Reportagen auf der Webseite der Zeitung veröffentlicht, wie eine Serie über Unternehmerinnen, die beim Publikum gut angekommen war, weil er sich natürlich die attraktivsten und vollbusigsten Frauen herausgesucht hatte. Als meistgelesene Serie der Zeitung hatte sie ihm einen ordentlichen Batzen Geld eingebracht, doch der Gedanke, seinen Lebensunterhalt mit der Bedienung der niederen Instinkte seiner Leser zu verdienen, verursachte ihm Übelkeit. Der Artikel war zwar gut geschrieben, doch die meisten guckten sich wahrscheinlich nur die Fotos an. Und wenn es um niedere Instinkte ging, hatte er schon genug mit seinen eigenen zu tun.
Er hatte ein paar Bücher veröffentlicht, doch auch in dieser Hinsicht konnte er sich nichts vormachen. Mit denen konnte er gerade mal ein paar Löcher in seinem Geldbeutel stopfen und einige feuchtfröhliche Nächte in Madrids Bars verbringen, die er dann am liebsten direkt wieder vergessen würde.
Die Aussicht auf ein geregeltes Einkommen, das seinen näherrückenden Lebensabend finanzierte, hatte definitiv ihren Reiz.
Jacinto war endlich gekommen und sie setzten sich an einen Tisch im hinteren Teil des Lokals. Das alte Café Comercial hatte nach einer Renovierung neu eröffnet und war so sauber und ordentlich wie nie zuvor, mit modernen Tischen und Stühlen und einem glänzenden Boden, auf den die Stammkundschaft sicher nicht mehr ihre schmutzigen Servietten und Zahnstocher werfen durfte. Die Kellner aber waren noch dieselben.
„Hast du drüber nachgedacht? Kann ich auf dich zählen?“
„Bis wann gibst du mir noch Zeit zum Überlegen?“
„Verdammt, ich hab doch gesagt, dass es eilig ist. Mein Chef drängt schon. Was meinst du, wie schnell sich jemand anderes bewirbt, wenn du die Chance nicht ergreifst? Jemand, der deutlich weniger Gehalt verlangt?“
Luna hatte niemandem von Jacintos Angebot erzählt. Er hatte darüber nachgedacht, es als Druckmittel für Neuverhandlungen mit seinem Chef bei El Diario zu nutzen, was er aber immer noch nicht getan hatte. Irgendwas sagte ihm außerdem, dass keine Zeitung der Welt auch nur annähernd bereit wäre, die 5 000 Euro pro Monat zu zahlen, die er bei der Bank bekommen würde.
„Eine Frage hätte ich noch … Ich nehme an, dass ich nebenbei nicht schreiben darf?“
„Was denkst du denn? Natürlich musst du ein Geheimhaltungsabkommen unterzeichnen. Das ist doch klar.“
„Und was ist mit Reportagen zu anderen Themen? Einem Verbrechen?“
„Hast du noch alle Tassen im Schrank, Luna? Über wie viele Verbrechen hast du denn in letzter Zeit berichtet? Du selbst hast mir doch tausend Mal in tausend verschiedenen Bars vorgeheult, dass sie dich nur noch für Reportagen über Frauen mit großer Oberweite haben wollen.“
„Und Bücher? Auch keine Bücher?“
„Ach, hör doch auf.“
Jacinto hatte Recht und Luna wusste das natürlich. Kein Abend in fröhlicher Runde war vergangen, ohne dass Luna über das Ende des „wahren Journalismus“ gejammert hatte. Wechselte er jetzt die Seiten, würde er den Journalismus also eigentlich gar nicht aufgeben, weil es ihn ja schon längst nicht mehr gab. Er war verschwunden. Vorbei. Game over. Mist.
Luna spürte sein Handy in der Hosentasche vibrieren. Eine neue Nachricht. Nein, drei sogar. In kurzer Abfolge. Eine war von einem seiner Kontakte bei der Polizei: „Mord am Manzanares. Irgendein Gothic-Ritual. Das interessiert dich sicher.“
Die andere war von seinem Chef: „Ein Mädchen wurde tot bei der Puente de Segovia gefunden. Gefoltert. Ganz große Sache. Können wir auf dich zählen? Das Internet ist am Brodeln. Wir brauchen sofort einen Bericht!“
Die dritte war von María Ruiz: „Bist du online?“
Luna sah Jacinto an und stand auf. Er tat, als wolle er seinen Geldbeutel herausnehmen, aber sein Freund wies ihn mit einer verständnisvollen, wenn auch müden, Geste ab.
„Entschuldige. Es hat einen Mord gegeben. Eine junge Frau.“
„Luna …“
Aber Luna ließ ihm keine Zeit, den Satz zu beenden. Wenn er schon zur Bank wechselte, sollte er sich doch wohl wenigstens einen letzten Wunsch erfüllen dürfen. Schließlich konnten selbst Insassen des Todestraktes ihre Henkersmahlzeit wählen, bevor es auf den Stuhl ging, und für Luna war es nun einmal dieses tote Mädchen. Irgendein Gothic-Ritual oder so was Ähnliches.
Das Taxi setzte Luna vor der Polizeiabsperrung ab. Einige Passanten lungerten noch immer am Tatort herum, denn zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Einzelheiten des makabren Verbrechens herumgesprochen. Luna hatte seine Kontaktperson angerufen und wusste bereits, dass das Mädchen an Hals, Händen und Füßen an das Geländer gekettet worden war und er ahnte, dass der Polizeichef bald eintreffen würde. Jetzt war die beste Gelegenheit, sich zum Tatort zu schleichen.
Er suchte nach einem bekannten Gesicht und wurde fündig.
In Madrid wurde in diesen Wochen das Fest zu San Isidro gefeiert und die gesamte Polizei war im Dauereinsatz, um Terroranschläge zu verhindern. Die Angriffe mit Lastwagen und Messern auf Partys und Konzerten in Nizza, Paris und Manchester hatten die Politiker und hohen Funktionäre in Panik versetzt. Sicher würde es also angesichts dieses Mordes ein ganzes Aufgebot an Uniformen geben. Er hatte augenscheinlich nichts mit Terrorismus zu tun, aber offenbarte eine unbegreifliche Handlungsfreiheit des Täters direkt vor den Augen der Öffentlichkeit und mitten in den Feierlichkeiten.
Luna erblickte den Polizeichef in der Menge und rief Esteban an.
„Was wisst ihr?“
„Die Wahrheit und exklusiv für dich? Nichts“, erwiderte Esteban ehrlich.
„Kommen die Täter wirklich aus der Gothic-Szene?“
„Wir wissen genauso viel wie du, Luna, mehr kann ich dir im Augenblick auch nicht sagen. Eine gefesselte tote Frau mitten im Zentrum von Madrid ist alles, was wir haben.“
„Und woran ist sie gestorben?“
„Das wissen wir noch nicht. Sie kann unmöglich tot dorthin geschleppt worden sein. Es ist aber genauso undenkbar, dass sie noch lebend mit Gewalt zum Tatort gebracht wurde.“
„Kann es sein, dass sie sich gar nicht gewehrt hat? Dass es eine Art Opferritual war?“
„Ich weiß es nicht, verdammt noch mal. Es ist noch zu früh. Bald wissen wir mehr.“
„Wo bist du gerade?“
„Auf der Wache. Am Tatort sind schon zu viele von uns.“
„Und Ruiz?“, erkundigte sich Luna.
„Keine Ahnung, warum willst du das wissen?“, fragte Esteban.
„Einfach nur so.“
„Veräppeln kann ich mich selbst.“
„Ich schwöre es. Sie hat mir nur eine Nachricht geschrieben.“
„Ich hoffe, dass sie sich nicht einmischt. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt.“
„Mach dir keine Gedanken. Das wird sie schon nicht.“
Sie beendeten das Gespräch mit dem Wissen, sich gegenseitig etwas vorgemacht zu haben. Sie kannten María nur zu gut und waren sich im Klaren darüber, dass sie wahrscheinlich ganz in der Nähe war. Beide wussten, dass sie ihren Feind – den neuen Polizeichef – von ihr fernhalten sollten.
María und Martín waren verschwitzt und erschöpft wieder an Martíns Haustür angekommen. So langsam machte sich die Anstrengung des Tages bei María bemerkbar: Erst war sie auf dem Fahrrad quer durch Madrid geradelt, dann auf der Suche nach Martíns Hund durch die Gegend geirrt und schließlich die vielen Kilometer zum Tatort erst hin- und wieder zurückgerannt. Sie zitterte. Er ebenfalls.
„Mann, bin ich fertig.“ Martín strich sich schnaufend die Haare von den Schläfen zurück.
María bekam die Worte des deutschen Kellners einfach nicht aus dem Kopf, auch wenn sie sich strikt weigerte, solche wilden Spekulationen für voll zu nehmen.
„Wer Tiere tötet, der kann auch Menschen töten.“