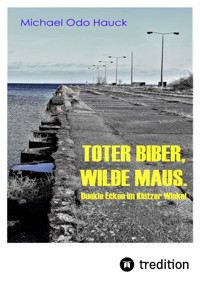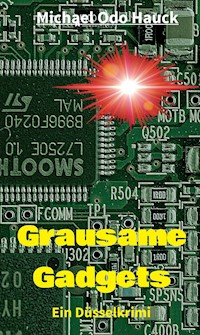
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anja ist dick und treu - aber nicht doof - und ihrem Chef Peter verfallen. Peter ist erfolgreich, selbstsüchtig und ein stadtbekannter Schwerenöter. Als seine Dauerfreundin Christine ihn sitzen lässt, will er seinem Nebenbuhler Enrico das Leben zur Hölle machen. Dann geschehen lebensbedrohliche Anschläge auf die Familie von Christine und Enrico. Steckt Peter dahinter, oder doch das organisierte Verbrechen, wie Kommissar Eloglu vermutet? In jedem Fall hat der Attentäter seine Rechnung ohne Christine gemacht. Und Christine ihre ohne Anja. Zum bösen Ende tragen so alle bei - weil Gerechtigkeit auch schrecklich sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Odo Hauck
Grausame Gadgets
Ein Düsselkrimi
© 2020 Michael Odo Hauck
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-17160-2
Hardcover:
978-3-347-17161-9
e-Book:
978-3-347-17162-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind unbeabsichtigt und zufällig.
Null
Familie Schüssler genoss die Ruhe und Gemütlichkeit am Morgen des zweiten Weihnachtstags. Allzu selten waren die vier zusammen. Obwohl, so richtig zusammen waren sie auch an diesem Tag nicht.
„Schatz, bist Du bald fertig? Wir wollten doch spazieren gehen.“
Enrico saß an seinem Schreibtisch und sah abwechselnd auf seinen Laptop und durch die großen Fenster in den alten, winterlichen Garten. Der lag ruhig da, hinter der zwei Meter hohen, weiß gestrichenen Ziegelmauer, die nur vom Tor der kleinen Garage und von der Gartenpforte unterbrochen wurde. Das Haus im Bauhausstil stand am Hang, dort wo die Stadt Düsseldorf die Hügel des Bergischen Lands hinaufwächst. Enrico führte ein Architekturbüro und ein Bauunternehmen und hatte die Villa aus den 60er-Jahren aufwendig saniert. Von außen ein in mehrere Quader gegliederter Baukörper mit Flachdächern, dessen weiße Kuben in reizvollem Kontrast zum dunkelgrün der hohen Tannen des Waldes dahinter standen. Von innen schlicht und gradlinig, aber höchst funktionell eingerichtet. Wenige Designermöbel und einige hochwertige Kunst- und Kunsthandwerk-Gegenstände.
Das Architekturbüro lief gut. Enrico war in viele Neubauprojekte der Stadt eingebunden. Düsseldorf hatte in den letzten Jahren eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung gehabt, war zu einer kleinen, aber feinen Weltstadt herangewachsen. Eine internationale Stadt mit einem weit überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, deren Bevölkerung fast zur Hälfte ausländische Wurzeln hatte. Enrico hatte familiäre Bande mit Süditalien, und auf seinen Baustellen arbeiteten viele Menschen aus Südosteuropa. Anders war man nicht wettbewerbsfähig, handelte sich aber Probleme ein. Eine spannende Zeit auf dem Bau. Jedenfalls musste er auch an Feiertagen nach seinen E-Mails sehen.
„Ich bin gleich durch. Einen Terminvorschlag muss ich noch rumschicken.“
Christine saß in dem hellen, großen Wohnraum auf dem Teppich und spielte mit Alexander. Sie musste immer wieder feststellen, dass sie, engagierte berufstätige Eltern, die sie waren, das Aufwachsen des gemeinsamen Sohnes mit zu wenig Nähe erlebten. Ein ums andere Mal war sie erstaunt, wie viel der Vierjährige über die Woche, im Kindergarten und wenn sich die Tagesmutter um ihn kümmerte, dazulernte. Aber wegen ihrer Orthopädiepraxis blieb abends meist nur Zeit für das Abendbrot und ein paar Seiten in einem Kinderbuch. Umso mehr genoss sie die Wochenenden und die Feiertage.
Wie an jedem Sonn- und Feiertag war das Haus erfüllt von klassischer Musik aus den Lautsprecherboxen im Wohnzimmer. Christines Blick fiel auf den wunderschönen antiken Art-Deco-Ring mit dem großen Brillanten im Baguette-Schliff. Ein ausgesuchtes, wertvolles Weihnachtsgeschenk. Manchmal konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie war gesund und lebenslustig, hatte einen liebevollen, aufmerksamen, kultivierten Ehemann, sie waren wohlhabend und angesehen und führten ein interessantes, ausgefülltes Leben. Das hätte dem dünnen blonden Mädchen aus einfachen Verhältnissen wohl niemand vorhergesagt. Alles war gut.
Alexander hatte eine Hot-Wheels-Autorennbahn zum Fest geschenkt bekommen und baute sie nun mit nicht nachlassender Begeisterung auf und ab, ließ die Autos durch die Gegend rasen und untermalte das Ganze mit den verschiedensten Geräuschen aufheulender Motoren und quietschender Reifen.
Anna hatte sich ein Over-Ear-Headset gewünscht und bekommen. Erst nach leichtem Zögern ihrer Eltern, die besorgt waren, sie könne sich noch mehr abschotten. Enricos 16-jährige Tochter war seit dem tödlichen Reitunfall ihrer leiblichen Mutter ohnehin oft schweigsam und verschlossen. Andererseits konnte sie seitdem nicht gut alleine sein und suchte die Nähe ihrer neuen Familie. Das gemeinsame Frühstück hatte sie verweigert, aber nun kam sie aus ihrem Zimmer die Treppe hinunter:
„Mann ey, an jedem Sonntag läuft im ganzen Haus immer dieser Klassik-Scheiß, aber wenn ich mal meine Musik spiele, muss ich immer leise machen und Türe zu!“
„Guten Morgen, liebe Anna. Hast Du ausgeschlafen? Möchtest Du ein Brötchen?“
„Morgen.“
Sie lümmelte sich auf das Sofa neben ihren Bruder und ihre Stiefmutter.
„Und der Zwerg nervt auch mit seinem Gequieke und Gebrumme!“
Sie setzte die Kopfhörer auf und zog ihr Handy aus der Hosentasche. Das Festnetztelefon im Haus klingelte.
„Kannst Du mal rangehen, Rico? Ich muss mit Alex die Rennbahn aufbauen.“
„Ja, klar.“ rief Enrico aus seinem Zimmer im Mezzanin. Er nahm das Telefon zur Hand und drückte auf die Taste mit dem grünen Hörer.
„Enrico Schüssler, guten Tag.“
„Hallo, hier ist Peter.“
„Peter! Mensch, das ist ja eine Überraschung. Frohe Weihnachten! Du willst bestimmt Christine sprechen, oder?“
„Nein. Ich will Dich sprechen.“
„Und, was kann ich für Dich tun?“
„Nichts. Ich hab‘ Dir was zu sagen.“
„Schieß los.“
„Hör zu, Enrico. Ich sage das jetzt nur einmal. Also merk es Dir. Du hast mein Leben zerstört. Ich hab‘s jetzt fast fünf Jahre versucht, aber ich komm damit nicht klar. Ich habe lange nachgedacht und habe jetzt beschlossen: Ich werde Dein Leben auch kaputtmachen.“
Dann legte er auf.
Einundvierzig
Eigentlich ist das Leben doch schön. Gerd atmet lange durch die Nase ein und genießt den Duft des jungen Grüns am Morgen. Die Luft weht durch die geöffneten Seitenscheiben in das Mercedes Cabrio. Vor sich die eindrucksvolle Motorhaube, unter der die Landstraße dahinfließt, dahinter der Horizont und der blassblaue Himmel. Ein wunderschöner Frühsommertag, noch ist es etwas frisch, später wird es warm werden, aber nicht so heiß, wie es in ein paar Monaten so oft in dieser Landschaft ist. Er genießt die Fahrt. Dann geht sein Blick nach rechts.
„Geht es Dir gut, mein Schatz?“
Seine Frau hat den Kopf an die Kopfstütze gelehnt. Ein Lächeln geht über ihr immer noch attraktives Gesicht. Das Hermès-Tuch vom Polenmarkt hat sie gebunden wie Grace Kelly. Mit der schildpattfarbigen Sonnenbrille, dem schokoladenbraunen Hosenanzug und der kamelhaarfarbigen Jacke ginge sie auch als wohlhabende Arztgattin durch. Sie sieht Gerd an und lächelt als Antwort.
„Eine schöne Gegend ist das hier in der Schorfheide. Wieso sind wir noch nie hier hingefahren. Schöne Straßen gibt es hier, alle neu. Die Dörfer finde ich auch ganz nett. Und dann die Wälder, das erste Grün, die kleinen Seen, und Hügel gibt es auch…“
„Ja und sonntags keine Radarfallen.“
„Dazu ein schönes Auto, ein bisschen besser gepflegt könnte es sein, aber eigentlich eine Luxuskarre.“
„Da hast Du recht. Eigentlich viel zu schade.“
„Kann uns doch egal sein. Jedenfalls bestes Cabriowetter, eine abwechslungsreiche Landschaft, und kein Mensch unterwegs. Ist gar nicht so weit weg von Berlin. Die DDR-Bonzen hatten ja hier ihre Datschen. Hier sollten wir wirklich öfter mal hinfahren.“
Diese Fahrten, bei denen er mich mitnehmen kann, sind tatsächlich viel zu selten, denkt sie. Heute Nachmittag würden sie in Posen sein, in einem netten Hotel, ein wenig durch die Altstadt spazieren, vielleicht noch ins Nationalmuseum, am Markt gut zu Abend essen und morgen mit dem Fernbus zurück nach Berlin.
-
Mit nicht ganz sechzig hatte Gerhard Schröder seine Stelle als Autoverkäufer verloren. Die zufällige Prominenz seines Namens, die zum Ende seines Berufslebens seine Bekanntheit bei der Kundschaft ausgemacht hatte, reichte nicht mehr, um gegen die Informationsflut des Internet bestehen zu können. Dann war das Geld natürlich etwas knapp geworden. Das Leben in Berlin, insbesondere die große Wohnung, wird immer teurer. Aber Gerd wollte nicht, dass sie wieder arbeiten geht. Er fand dieses Logistikunternehmen, das Autoüberführungen anbietet. Viele, die ihr Traumauto im Internet gefunden haben, nehmen sich nicht die Zeit, es auch selbst abzuholen. Oder Pressefahrzeuge, die zu den Redaktionen gefahren werden müssen. So ist er beschäftigt, meist dauert so ein Auftrag zwei bis drei Tage, und er bringt ein paar Hunderter mit nach Hause.
Noch besser ist natürlich so eine Fahrt wie heute. Gerd hatte bei seinen Touren einen Kollegen kennengelernt, der von einer noch einträglicheren Variante erzählt hatte. Autos, meist sehr wertvolle, müssen schonend, schnell und unauffällig außer Landes gebracht werden. Gut, die Leute, mit denen man da in Kontakt kommt, sind nicht sehr vertrauenserweckend. Aber sie zahlen bar, prompt und gut. Üblicherweise 500 Euro und alle Spesen. Wo die Fahrzeuge herkommen, sollte man aber besser nicht wissen. Die Kennzeichen und Papiere sind allerdings immer so gut wie echt. Bei dem Mercedes heute sind die Papiere sogar ganz echt und es gibt eine Bestätigung, dass Gerhard Schröder das Auto nutzen darf. Was sollte da schon passieren? Die Dokumente liegen in verschlossenen Umschlägen im Handschuhfach. Falls Gerd sie wegen einer Kontrolle öffnen muss, soll er den Auftrag abbrechen und das Auto nach Neuruppin zurückfahren.
Ganz wichtig ist immer die perfekte Tarnung. Gerd bekommt mit den Auftragsdetails am Telefon immer den Typ des Autos mitgeteilt, sodass er sein Äußeres so gestalten kann, dass es zum Stil des Autos passt. Heute hat er ein olivfarbenes Tweed-Sakko zu einer beigen Cordsamthose und einem Rollkragenpullover gewählt, dazu eine Burberry-Mütze. Die beiden sehen aus wie das typische, gut situierte, pensionierte Paar auf seinem Sonntagsausflug.
Gestern am Samstagabend kam der Anruf. Seine Frau packte schnell einen kleinen Trolley. Der Regionalexpress braucht von Spandau eine gute Stunde nach Neuruppin. Dort sollten sie um neun Uhr am Westbahnhof sein. Der Parkplatz liegt etwas abgelegen und ist leer bis auf ein paar billige alte Anwohnerautos und den blaumetallicfarbigen Mercedes. Mit kundigem Blick umrundet Gerd das Auto einmal, um nach etwaigen Beulen oder Kratzern zu sehen. Wirkliche Schäden kann er zwar nicht feststellen, aber das Auto macht einen vernachlässigten Eindruck. Das dunkelblaue Stoffverdeck ist an den Kanten voller Moos, die Scheinwerfergläser sind matt, der Lack ebenso, dazu fleckig von toten Insekten, Vogeldreck und Baumharz. Der Schlüssel klebt, wie üblich, mit Gewebeband im vorderen rechten Kotflügel. Im Handschuhfach liegen die Zulassung und die Vollmacht – und ein Papierfetzen, auf dem mit krakeligen Buchstaben steht:
„Koferaum Kaputt Slussel breche in Sloss“
Und tatsächlich leuchten zwei gelbe Kontrollleuchten in den Armaturen, als Gerd den Motor startet. Nun ja, das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Sorge. Nur schade, dass sich das Verdeck deswegen nicht öffnen lässt. Seine Frau legt den Trolley auf den Rücksitz und sie machen es sich in den grau-blauen Ledersitzen bequem.
-
Kurz vor Schwedt, bei der riesigen Raffinerie, staut sich dann doch der Verkehr. Verkehrskontrolle. Die Polizei hat die Grenzkontrollen, die ja seit dem Schengener Abkommen eigentlich abgeschafft sind, auf diese Weise praktisch auf die Zufahrtswege der Oderquerungen verlegt. Dabei gehen natürlich meist nur ein paar kleine Fische ins Netz. Die großen Schmuggler von Autos, Waffen, Drogen, Zigaretten, Flüchtlingen erfahren schnell von den Kontrollen, weichen auf Nebenstrecken aus und machen sich dadurch verdächtig. Gerd reiht sich brav in die Schlange ein, setzt ein Allerweltsgesicht auf und fingert zur Sicherheit schon mal die Papiere heraus.
Polizeiobermeisterin Mandy Pietsch steht auf der Mittellinie, mit der Kelle unter dem Arm, schwitzt und langweilt sich und macht ein entsprechendes Gesicht. Wenn die Autos neben ihr anhalten, beugt sie sich hinunter und schaut sich die Insassen genau an. Immer wenn die Kollegen in der Haltebucht Platz haben, winkt sie ein Auto raus. Gerd rollt ganz langsam auf sie zu, lächelt sie durch das offene Fenster an und hält ihr seinen Führerschein entgegen. Sie nimmt ihn nur ganz kurz in die Hand, beugt sich wie gewohnt etwas hinunter, um – mehr aus Neugier, als dass sie einen Verdacht hätte, – ins Auto zu schauen. Dann liest sie den Namen und muss schmunzeln. Gerd lächelt zurück, und unbehelligt gleitet der Mercedes hinein nach Schwedt, vorbei an endlosen Wohnblocks, über die zwei Oderbrücken, hinüber nach Polen.
Bald erreichen sie Chojna, mit deutschem Namen Königsberg, die erste Stadt nach der Grenze.
„Na, das hat ja reibungslos geklappt, bis hier her.“
„Ja, alles prima, noch drei Stunden und wir haben es geschafft.“
Gerd fährt rechts an den Straßenrand.
„Ich muss mal kurz anrufen.“ Er wählt die Nummer, die man ihm am Vorabend gegeben hatte. „Ja, ich bin jetzt in Polen. Ich fahre weiter nach Posen. Vielleicht noch drei Stunden. Irgendwie geht das Dach nicht auf. - Ja, ist gut, danke.“
„Hier in Polen sind sie aber doch noch weit hinter uns zurück, wenn man sich so die Häuser am Straßenrand ansieht.“ Seine Frau hat die Gelegenheit genutzt, sich umzusehen.
„Ja, aber sie holen auf. Auch mit den EU-Geldern – obwohl sie ja eigentlich gegen Europa sind.“
„Vielleicht sollten sie auch mal ihre Kanalisation erneuern, irgendwie müffelt es hier manchmal so komisch. Riechst Du das auch?“
„Ja, aber nur in den Dörfern, wenn wir langsam fahren.“
-
In Przeźmierowo, einem Vorort von Posen, in der Nähe des Flugplatzes und der Rennstrecke, drängen sich die Autoverwerter. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Gebrauchtwagen, die hier gehandelt und umgeschlagen werden, nicht immer eine überprüfbare Herkunft haben. Ein wahres Eldorado ist Przeźmierowo allerdings für gebrauchte Autoersatzteile. Angelieferte Wagen, nicht nur Unfallfahrzeuge, werden in Windeseile zerlegt, die gängigsten und wertvollsten Teile fein säuberlich aufgelistet und gelagert und die Überbleibsel verschwinden in einer der hydraulischen Pressen, die sie in Sekunden zu einem Block aus zerknautschtem Blech verwandeln, der oft innerhalb Stunden in einem der Hochöfen im Süden Polens landet. Falls entgegen der gültigen EU-Vorschriften der Inhalt des Blechpäckchens zweifelhaft ist, ist das Stahlwerk in Schlobin in Weißrussland trotzdem ein dankbarer Abnehmer. Die Hochofenhitze lässt ohnehin alles in Rauch aufgehen. Aber auf das Mercedes Cabrio wartet schon sein neuer Besitzer in Minsk. Ein kleiner Umzugswagen steht bereit und wird das Auto über örtliche Sträßchen, vorbei an geschmierten Grenzern, direkt zum Kunden bringen.
„Hallo, guten Tag, hier sind wir. Sind Sie Marcin? Mein Name ist Gerd und ich bringe das Auto, das Dimitri besorgt hat. Alles in Ordnung, es fährt gut. Nur der Kofferraum und das Dach gehen nicht auf, ist wohl der Notschlüssel im Schloss abgebrochen und die Zentralverriegelung entsperrt auch nicht. Aber Dimitri weiß Bescheid, da liegt jedenfalls ein Zettel im Handschuhfach. Hier sind der Schlüssel und die Briefumschläge. Die Vollmacht können Sie jetzt vernichten.“
„Hallo, ja, ich bin Marcin. Das mit Dach kein Problem. Wir reparieren bevor laden auf LKW. Willst Du Kaffee, oder Essen?“
„Nein danke, vielleicht ein Glas Wasser, und wenn uns jemand zum Hotel nach Posen bringen könnte.“
„Das auch kein Problem. Warte hier, trink Wasser, ich rufe Kollege, heißt Pjotr, er dich bringen zu Hotel in halbe Stunde, ok?“
Marcin fährt das Cabrio in eine Garage um die Ecke und zwei Monteure laufen hinterher. Gerd und seine Frau sitzen auf der fleckigen Couch im Büro, trinken eiskaltes Wasser aus kleinen Plastikflaschen und schweigen. Er blättert in einem polnischen Auto-Tuning-Magazin, sie bewacht den Trolley und sucht nach einem Hinweis auf eine Toilette. Plötzlich wird es lauter, die drei Polen laufen hektisch herein und hinaus, mustern Gerd mit durchdringenden Blicken, flüstern miteinander. Dann fängt Marcin an zu telefonieren, er geht auf den Hof, damit man ihm nicht zuhören kann. Der eine Monteur fährt dem Mercedes wieder aus der Garage und in eine Halle in einer abgelegenen Ecke des Geländes, der andere läuft zu einem schwarzen BMW und fährt mit durchdrehenden Rädern vor das Büro.
„Komm, ich Pjotr. Ich dich bringen Hotel in Stadt. Du nix wissen und nix sehen hier, ok? Sonst Problem. Wir wissen wo du wohnen in Berlin. Komm, schnell, schnell!“
So flott es geht, steigen die beiden in den BMW. Pjotr fährt sie in die Altstadt und setzt sie ab.
„Das mit der Übernachtung hier lassen wir besser sein, meinst Du nicht? Das war ja doch sehr merkwürdig, Ich möchte so schnell wie möglich wieder nach Berlin.“
„Ja, Schatz, lass uns am besten die Bahn nehmen, die fährt öfter. Kannst Du das Hotel noch stornieren? Und wenn nicht, ist das auch egal.“
„Bis um sechs kann ich das online stornieren, das mache ich gleich mit dem Handy.“
Mit Glück bekommen sie am Bahnhof den Eurocity um halb fünf. Kurz vor acht steigen sie in Berlin aus.
-
Mandy Pietsch macht Pause. Nach zwei Stunden an der Kelle wird sie abgelöst. Sie sitzt hinten im Polizeibulli und beißt in ihr belegtes Brot, löffelt ihren Joghurt. Noch eine Stunde, dann hat sie frei. Sie setzt sich in die offene Schiebetür, zündet sich eine Zigarette an und ihre Gedanken streifen durch die letzten Stunden. Sie bleiben an dem blauen Mercedes Cabrio hängen. Das Auto hätte sie herauswinken müssen, sagt ihr das Bauchgefühl. Warum? War es nur der prominente Name des Fahrers? Warum waren so viele tote Mücken auf dem Auto, als wäre es lange nachts über die Autobahn gefahren? Warum lag ein Koffer auf der Rückbank, wo das Auto doch einen großen Kofferraum hat? Warum war das Verdeck geschlossen bei dem herrlichen Wetter? Kurioserweise stört sie im Nachhinein aber am meisten, dass die Farben der Garderobe der Insassen so gar nicht zu dem Auto passen. Das blaue Mercedes Cabrio geht ihr nicht aus dem Sinn.
Eins
Die schöne Helena macht den Master in Industrial Pharmacy, und dann will sie noch promovieren. Und leben will sie auch. Ohne reiche Eltern muss sie zusehen, wie das nötige Kleingeld hereinkommt. Sie hatte eine Zeit lang bei einem Chemiekonzern nachts in den Labors den blubbernden Kolben und Phiolen zugesehen und aufgepasst, dass die Digitalanzeigen so blinkten, wie sie sollten. Aber das bringt zu wenig Geld ein für die dort vertane Zeit. Eine Freundin hatte eine andere Idee, und nach ein paar Monaten des Zögerns, hat sie sich entschlossen in gehobenen Kreisen des Rheinlands die Kurtisane zu geben.
Sie empfängt am Wochenende Gäste, oft in der „Wonnemühle“. Diskret und etwas abgelegen ist das ehemalige Lokal für Familienausflüge in der alten Mühle in einem Bachtal im Bergischen Land seit ein paar Jahren ein Anziehungspunkt für ein zahlungskräftiges, meist männliches Publikum. Im Innenhof, wo früher Kinder spielten, ist jetzt ein nicht einsehbarer Parkplatz, im alten Haupthaus aus Bruchsteinen finden sich die hochwertige Gastronomie und ein paar Casinoräume, im ehemaligen Stall ist jetzt ein großes Schwimmbecken und eine moderne Saunalandschaft und im Wirtschaftstrakt hat eine führende Innenarchitektin fünf vornehme Gästezimmer eingerichtet.
Heute ist Helena mit Dimitri Todorov verabredet. Sie haben auf der sonnigen Terrasse ein leichtes, leckeres Mittagessen eingenommen.
„Meine Liebe, wir gehen jetzt auf Zimmer und machen kleines – wie sagt ihr – Fickerchen. Dann geh ich in Halle, Formel 1 gucken, und dann komm wieder und es geht zur Sache.“
„Ja, komm.“
Nach einer halben Stunde sitzt Dimitri wieder in der Halle vor der Beamerleinwand. Er trinkt zwei Espresso und ein Viertel süßen Rotwein, raucht – ohne Widerspruch der beiden anderen anwesenden Männer – eine Zigarre und nimmt noch eine Viagra. Dann geht er, verfolgt von aufmunternden, wissenden Blicken wieder in Richtung Gästetrakt.
Helena hat inzwischen das Zimmer und sich so zurechtgemacht, wie Dimitri es mag. Die Vorhänge halb zugezogen, ein paar rote Schleier über den Nachttischlampen, schwarze Seidenbettwäsche und Musik von Barry White. Dimitri liebt das klassische Bordellambiente. Entsprechend hat Helena eine rote Korsage angezogen, mit Strapsen und Strümpfen und sich und das Zimmer in eine Wolke „Dolce Vita“ von Dior gehüllt. Sie weiß, dass ihr Körper zurzeit ihr größtes Kapital ist, und setzt ihn möglichst gewinnbringend ein. Auch wenn es manchmal hart verdientes Brot ist, denn das, was jetzt folgen würde, könnte sehr langwierig und unerfreulich werden. Dimitri macht sich auf dem Bett bequem, streift die Schuhe ab, sieht, wie sich Helena zur Musik bewegt und genießt das Gebotene. Vorfreude steigt in ihm hoch und er knöpft schon mal sein Hemd auf. Da vibriert eins der beiden Telefone auf dem Nachttisch. Dimitri schaut hin, verärgert und enttäuscht.
„Oh, das ist rotes Telefon, muss ich drangehen.“
„Och nö, nicht jetzt, wo es gerade so gemütlich wird!“
„Doch, ist wichtig. Hör auf, Moment, still sein! Gleich geht weiter.“
Kaum hat Dimitri den grünen Button berührt, hört Helena ein slawisch klingendes Gebrüll aus dem Lautsprecher. Ihr Gast kümmert sich nur noch um sein Handy. Sie steht nun da wie bestellt und nicht abgeholt und sieht plötzlich gar nicht mehr so verführerisch aus. Sie angelt sich den Hotelbademantel. Ihre Mutter ist Russin und so bekommt sie ein paar Brocken mit. Dimitri weicht erst die Farbe aus dem Gesicht, dann wird er puterrot. Helena hört:
„Wieso Kofferraum zu? – Was stinkt Scheiße? – Keine Ahnung! Was weiß ich?“
Und nach einem weiteren gemischt polnisch-deutschem Wortschwall.
„Kein Problem, mach ich alles wieder gut. Bring ich in Ordnung. Bleib locker! Telefonieren morgen mit Ruhe.“
Die Stimmung ist im Eimer. Dimitri schenkt sich einen großen Cognac ein und würdigt Helena keines Blickes mehr. Er starrt aus dem Fenster in den Wald, während sie sich rasch anzieht, ihm ein Küsschen auf die Glatze gibt, den Fünfhunderter vom Sideboard nimmt und lautlos verschwindet.
-
Dimitri weiß, wann er verloren hat. Jetzt gilt es Ruhe zu bewahren. Wenn schon etwas schief gegangen ist, dann ist es umso wichtiger, nun keine Fehler mehr zu machen. Und vor allem kein Aufsehen zu erregen. Er lebt unauffällig, sozusagen unter dem Radar. Seine Wohnung hat er über seine bulgarische Firma gekauft, sein Name steht zwar am Briefkasten, aber gemeldet ist er nicht. Er reist als Tourist in seinem weißen Passat Kombi. Außer der bulgarischen Zulassung sammelt er auf Parkplätzen die Kennzeichen und schreibt die Adressen von gleich aussehenden Firmenautos ab. Mit den passend gefälschten Nummernschildern und Papieren ist er praktisch spurlos unterwegs. Er hat ein offizielles Handy von A1-Bulgaria, nutzt aber dauernd eine Handvoll verschiedener Telefone mit SIM-Karten von irgendwo. Sein Kontaktspeicher ist ziemlich klein. Die entscheidenden Nummern weiß nur er – auswendig. Gespeichert sind sie nirgendwo. Er kleidet sich bei einem großen, konservativen Kaufhaus ein, gepflegt aber nicht zu fein. Graumeliertes schütteres Haar und immer glatt rasiert würde man ihn eher für einen Regierungsamtmann oder Uhrmacher halten als für einen international agierenden Ganoven.
Dimitri kennt Gott und die Welt. Er besorgt alles, Nicht-Lieferbares, Altes, Rares, Teures billig, Verbotenes – für gute Kunden auch schon mal eine Waffe oder Drogen. Er übernimmt alles, vor allem alles, was in Deutschland keinen Markt hat oder vom Markt verschwinden muss. Er zahlt bar, hat kein Konto, keine Kreditkarte und nutzt erst recht keine Kryptowährungen. Er hinterlässt keine Spuren. Er lebt und arbeitet abseits von Vorschriften und Gesetzen. Aber auch sein Geschäft hat Regeln, er hat eine Ehre zu bewahren.
Bis zum Montagmorgen hat Dimitri viel telefoniert, wenig geschlafen. Manches ist ihm jetzt klar, insbesondere welchen Weg der blaue Mercedes genommen hat. Und er hat einen bösen Verdacht. Kurz nach acht Uhr wählt er die Nummer eines alten Kunden.
„Firma Tech Help, Guten Morgen, Sie sprechen mit Anja Klüttermann, wie kann ich helfen?“
„Anja, Dimitri hier. Ich muss Peter sprechen. Schnell!“
„Du, Dimitri, Peter ist nicht da. Ich hab auch schon versucht ihn zu kriegen – hier ist nämlich der Teufel los, eigentlich bin ich sogar krankgeschrieben – gestern war linksrheinisch ein Stromausfall. Alle Kunden drehen am Rad. Er geht nicht an sein Handy. Zu Hause ist er auch nicht. Sein Bulli steht nicht im Hof, nur sein Fahrrad. Im Terminkalender stehen drei Termine. Da hab‘ ich auch bereits angerufen. Ich brauch ihn dringend hier. Die Polizei hat auch schon wieder angerufen. Weißt Du was?“
„Anja, nein. Hat er doch noch mehr Telefonnummern, weißt Du noch welche?“
„Nein, Dimitri, sag ich doch!“
„Ist gut, Anja, kein Problem. Soll sofort anrufen, wenn da. Tschüss.“
-
Anja Klüttermanns Herz schlägt jetzt noch schneller, als ohnehin schon den ganzen Morgen. Hier ist etwas nicht in Ordnung, Hier droht Gefahr. Es klingt wie eine Plattitüde, aber eine Frau spürt so etwas. Insbesondere wenn es um einen Menschen geht, mit dem sie so lange zusammen ist. Sie ist machtlos. Sie greift zum Telefon und ruft Li-Ming nebenan in der Werkstatt an.
„Guten Morgen Anja, gut Dich hier zu sehen. Was ist mit dem Rechner?“
„Hi, dazu kommen wir später. Hör zu, ich mach mir Sorgen um Peter. Niemand weiß, wo er steckt. Ich brauch jetzt mal eine Pause, um den Kopf freizubekommen. Nimmst du bitte die Anrufe an?“
„Klar, mach ich. Meinst du nicht, dass Peter einfach irgendwo versackt ist? Vielleicht in diesem Nobelpuff. Der meldet sich bestimmt bald.“
Li-Ming merkt selbst, dass sie nicht sonderlich überzeugt und beruhigend wirkt. Ein wenig hat sie ein schlechtes Gewissen.
Anja geht in den Besprechungsraum. Sie macht sich einen Tee, zieht die Jalousie, die immer den Einblick in die Räume vom Hof her verhindert, nach oben und öffnet das Fenster. Sie steckt sich eine Zigarette an und blickt auf den Hof, auf das alte Wohnhaus am anderen Ende des Grundstücks, wo Peter Traxer jetzt alleine wohnt. Sie denkt an den Tag vor über zwanzig Jahren, als sie zum ersten Mal am Lieferanteneingang der Werkhalle der Firma Traxer Bürotechnik geklingelt hatte.
Zwei
Beim Arbeitsamt hatten sie ihr bei Traxer eine Lehrstelle im Büro angeboten. Lehrstellen waren damals knapp, sie war unsicher, und Schweißflecken zeigten sich unter ihren Achseln. Und auf Ihrer Bewerbungsmappe, die sie unter dem Arm eingeklemmt hatte. Bisher hatte sie schon ein Dutzend Mal Pech gehabt mit ihren Bewerbungen. An ihren Zeugnissen konnte es nicht liegen, auch nicht an ihrer Schulkarriere oder Herkunft. Blieben nur die dreißig Kilo Übergewicht, die Akne und die leicht fettenden Haare – all das hing irgendwie zusammen, war Ursache und Auswirkung zugleich, und gegen nichts von dem wusste sie ein Rezept.
Da war diese angestaubte Bude, die ihre besten Zeiten sicher lange hinter sich hatte, so etwas wie ihre letzte Chance. Als die Seniorchefin die Tür aufmachte, konnte niemand wissen, dass das der Anfang einer Bilderbuchgeschichte sein sollte.
Der alte Anton Traxer war immer mürrisch. Die Geschäfte gingen von Tag zu Tag schlechter, die Kunden wurden immer unverschämter, die Japaner mit ihren elektronischen Büromaschinen konnte er nicht verstehen. Und sein Sohn Peter machte ihm Sorgen. Der Junge war im Gegensatz zu seinem Vater ein Sonnenschein. Humorvoll, freundlich, aufgeschlossen, mit guten Manieren. Da musste er nicht einmal besonders gut aussehen, groß oder kräftig sein, um bei Frauen gut anzukommen. Und das nutze er aus bis zum Geht-nicht-mehr. Er hatte blaue Augen und braune Locken, eine etwas zu lange Nase, ziemlich gerade Zähne. Seine Hände waren schlank und gepflegt und auch bei der Kleidung legte er Wert auf Sauberkeit. Andere Söhne wurden Rowdies, Peter wurde Frauenheld. Nach seinem Motto „Intelligenz schlägt Fleiß“ segelte er durch die Schule zu einem leicht überdurchschnittlichen Abitur und fand seit der Pubertät genug Gelegenheit und Zeit, sich seinen Mitschülerinnen zu widmen.
Er war seit Kindestagen Mitglied im Tischtennisverein Borussia, wo er mit etwas Erfolg, aber ohne übertriebenen Ehrgeiz in den verschiedenen Mannschaften mitspielte. Als er achtzehn wurde und den Führerschein hatte, baute er sich einen der abgeschriebenen, grauen Firmen-Bullys zu einem Wohnmobil um. Das heißt, er baute ein breites Bett anstatt der Regale ein, installierte eine kleine Toilette und ein Waschbecken, dazu eine Kühlbox, eine aufwendige Musikanlage und ausgeklügelte Leuchten. Damit war er auf seinen Abenteuern weder auf das eigene Heim angewiesen, noch musste er etwaige Mitbewohner seiner Eroberungen beachten. Auch die Mitarbeiter und die Kunden mochten den Juniorchef. Sie glaubten ihm vieles und verziehen ihm fast alles. Warum sollte er also Tag für Tag acht Stunden arbeiten, wenn er auch anders Erfolg haben konnte?
Diese Erfahrung, mit seinem gewinnenden Wesen und seinem freundlichen Auftreten eigentlich alles erreichen zu können, erklärte auch seinen vielleicht einzigen Fehler. Er hatte es nicht gelernt zu scheitern. Beruflich und sportlich konnte er seine Erfolgsaussichten realistisch einschätzen, versuchte nichts, was von vorne herein unerreichbar schien. Nur wenn unvorhergesehene Umstände seine Pläne durchkreuzten, wenn ein Lehrer ihn gefühlt ungerecht benotete, wenn ein Schiedsrichter eine Fehlentscheidung gegen ihn traf oder später, wenn sich ihm plötzlich ein neuer Konkurrent in den Weg stellte, dann änderte sich sein Gemüt. Er fraß den Ärger in sich hinein, schwänzte den Unterricht, trat zum nächsten Match nicht an, zog sich komplett aus einem Geschäft zurück. Diese Phase konnte Stunden oder Tage andauern und während dieser Zeit war mit ihm nicht gut Kirschen essen. Er reagierte vollkommen unvorhersehbar und machte Sachen, die nicht mehr darauf zielten, wieder die Oberhand zu gewinnen, sondern die nur den Zweck hatten, Vergeltung zu üben. Deswegen galt er als verwöhntes Einzelkind.
Traxer Senior hatte hingegen eine sehr strenge Arbeitsmoral. Da war Anja für ihn genau die richtige Bürokraft. Fleißig, klug, gut erzogen, ja sogar dankbar – und vor allem weit ab vom Beuteschema des Juniors. Frau Traxer hatte geradezu einen Narren an der neuen Dicken gefressen. Sie richtete ihr einen Arbeitsplatz zwischen ihrem und dem Schreibtisch des Chefs ein. So bekam Anja von Anfang an alles mit, was in der Firma so lief. Und da es immer öfter Zeiten gab, wo eben nicht mehr so viel lief, fand die Chefin Zeit und Lust, dem Mädchen nicht nur das nötige Wissen und Können einer Bürokauffrau zu vermitteln, sondern ihr auch die ganze Erfahrung, alles, was sie im Lauf der Jahre an Steuerschummeleien, Kalkulationstricks, Buchhaltung, Büroorganisation und Personaleinsatz angesammelt hatte, weiter zu geben.
Anja wuchs mit ihren Aufgaben. Sie liebte ihre Arbeit, die Vielfalt und Abwechslung, das eigenverantwortliche Arbeiten, das nur ein kleiner Betrieb bieten kann. Ein paar Zentimeter legte sie auch noch an Länge zu und ohne den Frust lernte sie bewusster zu essen. Mit ein bisschen Make-up und regelmäßigen Besuchen beim Friseur lernte sie auch, selbstbewusster und fröhlicher aus den Augen zu schauen. Es ging richtig voran mit Anja Klüttermann.
Eigentlich hatte sie nur ein einziges Problem. Von dem Tag an, als der Junior zum ersten Mal seinen Lockenkopf durch die Tür gesteckt hatte und die dicke, pickelige Auszubildende mit einem freundlichen, aber unverbindlichen Lächeln begrüßt hatte, hatte sie ihr Herz an ihn verloren. Eine halbe Stunde später kam er sogar auf sie zu. Sie gab ihm ihre kleine feuchte Hand.
„Ciao, ich bin Peter. Also Peter Traxer, ich gehöre hier zur Familie – und zur Firma.“
„Guten Tag, ich bin Anja, Anja Klüttermann, ich bin der neue Lehrling.“
Er setzte sich neben sie.
„Und? Macht die Lehre Spaß?“
„Ich hab‘ ja gerade erst angefangen.“
„Wo wohnst Du denn?“
„Bei meinen Eltern. In Flingern.“
„So, so, also noch zu haben. Oder schon verlobt?“
Sie wurde sie puterrot – was ihn amüsierte. Mit der Röte kam ein Schweißausbruch, für den sie sich schämte. Und sie kicherte in einer Tonlage, für die sie sich heute noch in den Hintern beißen könnte.
Die Fixierung auf ihren Traummann hinderte Anja auf lange Jahre daran, überhaupt ein eigenes Liebesleben zu entwickeln. Nun standen die Verehrer nicht gerade Schlange vor ihrer Tür, aber die wenigen, die sich für sie interessierten, verglich sie mit Peter und zeigte ihnen die kalte Schulter. Ab und zu, wenn sie viel getrunken hatte, ließ sie sich mit dem Einen oder anderen ein. Bei Ihren Kumpels und in ihrer Nachbarschaft galt sie mal als kleine Schlampe, mal als fette Lesbe, je nach Standpunkt. Die anderen wussten ja nicht, warum sie so war, wie sie sich gab.
Als sie die dreißig hinter sich gelassen hatte, wurde sie eine stolze, starke Frau, die auch mit ihrer Größe 46 glücklich war. Nur dass Peter Traxer sie freundlich, vielleicht auch kameradschaftlich, behandelte - und nicht mehr – ließ sie langsam verzweifeln. So lange Peter jedem Rock hinterherlief und sich nie länger als ein paar Monate an eine Frau band, konnte sie damit leben. Irgendwann, so ihre Illusion, würde er ihre Zuneigung erkennen. Seit aber Christine in sein Leben getreten war, hatte sie damit zu kämpfen. Trotzdem war alles gut, wie es war, bis zu diesem undurchsichtigen Anruf an Weihnachten vor einem Jahr.
Drei
Peter Traxer verbrachte eigentlich seine ganze Kindheit und Jugend im Umfeld des Betriebs. Außer zum Gymnasium ging er nur noch regelmäßig zum Tischtennis. Am liebsten saß er am Arbeitstisch von Martin Kleinewevers, dem alterslosen Büromaschinenmechaniker alter Schule, einem freundlichen, aber schweigsamem Junggesellen, mit der Devise „was nicht passt, wird passend gemacht“. Von ihm lernte Peter alle traditionellen Handwerkstechniken. Er konnte bald drehen, bohren, fräsen, feilen, löten, kleben, schleifen, polieren, kurz: Er konnte alles selbst fertigen. Als er noch zur Grundschule ging, und seine Freunde sich meist mit Lego-Technik beschäftigten, baute er mit Martin die ersten Segelflugmodelle und bald auch sein erstes ferngesteuertes Auto. Anfangs noch aus vorgefertigten Bausätzen, aber im Teenageralter nach eigenen Vorstellungen. Vor allem die Funktechnik, elektronische Schaltungen und die Anwendung digitaler Steuerung faszinierte ihn. Ein kaputter iPod war für ihn ebenso wenig ein Problem wie ein Haartrockner, der zu heiß wird, oder ein Verstärker, der nicht genug verstärkt. Diese Fähigkeiten brachten ihm Anerkennung bei seinen Freunden und öffneten die Türen bei jungen Damen.
Beruflich verlief sein Leben in den vorgezeichneten Bahnen. Er hatte nie darüber nachgedacht, etwas anderes als Bürotechnik zu machen. Das war einfach das Naheliegendste. Als die Computer dann die Schreib- und Rechenmaschinen, die Registrierkassen, ja selbst die Kopierer und Faxgeräte verdrängten und Traxer Bürotechnik in die Insolvenz trieben, musste er gar nicht lange nachdenken. Seine Eltern zogen in ein Seniorenwohnprojekt an der holländischen Grenze und er kaufte aus der Insolvenzmasse den ganzen Maschinenpark und die Ersatzteile.
Ein paar Jahre später übernahm er auch die Gebäude von seinem Vater. In dem Mischgebiet mit Gewerbe und Wohnen nahm die alte Werkshalle mit der Ziegelfront die Straßenseite ein. Rechts daneben, an der Grenze zu einer Möbelspedition, war eine hohe und breite Toreinfahrt mit einem Stahltor. „Traxer Bürotechnik“ stand in altmodischen, eisernen Buchstaben darüber. Daran schloss sich die breite Zufahrt an, die hinter der Halle in einen großzügigen, asphaltierten Hof mündete. An der Hofseite stand auch der Anbau mit den Büroräumen. Wo der Anbau und die Halle einen Winkel bildeten, waren die Eingangstüren und eine kleine gemütliche Ecke mit ein paar Kübelpflanzen, drei Gartenstühlen, einem Tischchen mit einem Aschenbecher und einem Sonnenschirm.
Der Hof grenzte hinten an das Wohngebiet mit Einfamilienhäusern. Direkt im Anschluss, noch auf dem Traxerschen Grundstück, hatte Peters Vater ein kleines Einfamilienhaus gebaut und seine Mutter ein Gärtchen angelegt. So ergab sich eine Idylle, die von der Straße niemand vermutete. Peter befreite den Garten von allen pflegeaufwendigen Pflanzen und baute einen Carport für zwei Fahrzeuge an. Das Haus ließ er einmal durchrenovieren, mit zeitgemäßer Raumeinteilung, neuer Heizung, Fenstern, Sanitäranlagen und fühlte sich dann sehr wohl. Veränderungen, wie sie ein Umzug mitgebracht hätte, hasste er eigentlich, hauptsächlich wegen der Mühen.
Martin Kleinewevers blieb ebenso dabei wie natürlich Anja Klüttermann. Ohne sie wäre er aufgeschmissen gewesen, das wusste er nur zu genau. Sie hatte den Durch- und Überblick, wusste Details, Abläufe und Vorgänge, um die er sich nie gekümmert hatte. Sie war lieb und nett, sehr angenehm im täglichen Umgang. Er konnte mit ihr scherzen, sie nahmen sich gegenseitig auf den Arm. Sie begrüßten sich mit Küsschen rechts und links und fielen sich schon mal in die Arme, wenn etwas besonders gut gelungen war. Sie war seine engste Vertraute, sie lebten die meiste Zeit des Tages zusammen. Aber eine Brünette, die größer und schwerer war als er, nahm er nicht als weibliches Wesen war.
-
Die rettende Idee für den Familienbetrieb kam ihm bei seinen zahlreichen Kundenbesuchen, bei denen er mit kleiner werdendem Erfolg versuchte, wenigstens die Stammkundschaft von den Vorteilen analoger Bürotechnik zu überzeugen. Häufig fragten die Büroangestellten, ob er nicht jemanden wüsste, der alte Drucker – die doch so schön einfach waren – wieder in Gang bringen konnte, oder der herausfinden würde, warum sich ein Computerprogramm aufhängt, alltägliche Probleme, die vom Service der Konzerne nicht gelöst werden sollten, da die nächste Generation an Hard- und Software in den Markt gebracht werden musste. Aber auch zu Hause ging mal das eine oder andere kaputt, die Hi-Fi-Anlage gab ungewünschte Töne von sich, Küchenmaschinen, die nicht mehr rührten, Nähmaschinen, die neu programmiert werden mussten. Also machte er sich an die Neugestaltung. Er gründete Tech Help.
Im Anbau zum Hof richtete er sich ein großes Büro ein, in dem auch genug Platz für eine Werkbank war. Ein paar Rechner und Maschinen machten die Einrichtung komplett. Der Boden war weiß gefliest, die Wände weiß lackiert. Nichts Überflüssiges lag herum. Das war sein Reich und er empfand jeden Besuch als Eindringen. Selbst Anja vermied es, den Fuß über die Schwelle zu setzen, die anderen Mitarbeiter konnten sich nicht erinnern, jemals diesen Raum betreten zu haben. Als zukunftsträchtiges Betätigungsfeld hatte Peter sich die Sicherheitstechnik ausersehen. Dieses Spezialgebiet passte perfekt in das bisherige Angebot und einige Kunden hatten schon Interesse bekundet. Also versuchte er möglichst schnell und umfassend Informationen über Ultraschall- und Infrarotsender, Überwachungskameras, Funkanlagen, Fernsteuerung über das Mobilfunknetz und digitale Schlösser zusammenzutragen. In den Regalen und auf der Werkbank stapelten sich die bestellten Musteranlagen, mit denen er ausdauernd experimentierte.
Am anderen Ende des niedrigen Gebäudes residierte Anja Klüttermann. Ihr Büro war mit modernen, stilvollen Büroklassikern eingerichtet. In der Mitte ihr großer Schreibtisch mit dem jeweils neuesten und besten Monitor, zwei Eames-Chairs für Besucher und rundum Schränke in unterschiedlichen Höhen. Ein großer antiker Kelim, ausgesuchte Drucke an den Wänden und stets frische Blumen vollendeten diesen angenehmsten Raum des Betriebs.
In der Mitte des Anbaus gab es ein Besprechungszimmer, quasi als Pufferzone zwischen den beiden Büros und nur durch diese zu betreten. Auch hier spürte man Anjas sorgfältige Hand, wenn auch nicht die persönliche Wärme. In der Mitte stand der große Tisch mit acht Stühlen, unter dem Fenster eine gemütliche, etwas angestaubte Garnitur aus zwei Ledersesseln, niedrigem Tisch und einem Schlafsofa, das von allen schon mal genutzt wurde, wenn der Abend zuvor, privat oder im Betrieb, zu lange gedauert hatte.