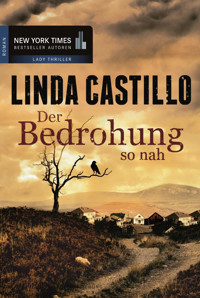9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Über die alte Scheune kursieren viele Geschichten. Die neunjährige Sally Ferman kennt sie alle. Sie weiß nicht, ob sie stimmen. Sie weiß nur, dass sie keinen unheimlicheren Ort kennt als dieses verfallene Gebäude mit seinem steinernen Fundament und den dunklen Fenstern. Als der Tornado über Painters Mill in Ohio hinwegfegt, legt er nicht nur die halbe Stadt in Schutt und Asche. Er bringt auch etwas zum Vorschein, was besser in der Erde geblieben wäre. Unter einer eingefallenen Scheune werden die Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden. Wer ist der Tote? Und warum lag er jahrelang hier vergraben? Als Doc Coblenz die Leiche obduziert, wird klar, dass diese Leiche keines natürlichen Todes gestorben ist. Und plötzlich muss Kate noch einmal in einem 30 Jahre zurückliegenden Fall ermitteln, der damals die kleine Amisch-Gemeinde von Painters Mill beschäftigte, zu der sie auch gehörte. Ein altes Familiengeheimnis und ein ungesühntes Verbrechen – Kate Burkholders siebter Fall führt sie an einen unheimlichen Ort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Linda Castillo
Grausame Nacht
Thriller
Über dieses Buch
Der siebte Fall für Polizeichefin Kate Burkholder von New-York-Times-Bestsellerautorin Linda Castillo
Als der Tornado über Painters Mill in Ohio hinwegfegt, legt er nicht nur die halbe Stadt in Schutt und Asche. Er bringt auch etwas zum Vorschein, das besser in der Erde geblieben wäre. Unter einer eingefallenen Scheune werden die Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden. Wer ist der Tote? Und warum lag er jahrelang hier vergraben? Ein altes Familiengeheimnis und ein ungesühntes Verbrechen – Kate Burkholders siebter Fall führt sie an einen unheimlichen Ort.
›Castillo ist eine Meisterin ihres Fachs…‹ People Magazine
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind ein internationaler Mega-Erfolg und stehen regelmäßig wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Dank
Dieses Buch widme ich allen Ersthelfern: Polizisten, Feuerwehrmännern und -frauen, Rettungssanitätern, Katastrophenhelfern und Freiwilligen. Ich danke euch für alles, was ihr tut, und dass ihr da seid, wenn ihr am meisten gebraucht werdet.
Suchet, dann werdet ihr finden; klopfet an, dann wird euch geöffnet.
Die BibelNeues Testament, Matthäus 7,7
Prolog
Über die alte Scheune kursierten viele Geschichten. Die neunjährige Sally Ferman kannte sie alle, und jede einzelne machte ihr Angst. Ihr Dad hatte erzählt, dass das Stück Land ursprünglich Hans Schneider gehört hatte, einem jungen deutschen Einwanderer. Hans baute eine Blockhütte darauf und heiratete Rebecca, eine Französin. Sie bekamen drei Söhne, und über die Jahre errichteten er und seine Söhne die Scheune, züchteten Rinder und Schafe und pflanzten Tabak und Mais an.
Dann, in einer verschneiten Nacht des Jahres 1763, überfiel eine Bande Delaware-Indianer die Farm. Hans, der mit seinem Vorderlader am Fenster stand, wurde erschossen, seine Frau aus dem Haus gezerrt und skalpiert. Die drei Jungen – alle bewaffnet und bereit für den Kampf auf Leben und Tod – verbrannten bei lebendigem Leib, als die Delawaren das Blockhaus in Brand setzten. Es hieß, dass man nachts noch immer die Schreie Rebeccas hören könne, wie damals, als man ihr die Kopfhaut vom Schädel zog.
Sally wusste nicht, ob die Geschichte stimmte; sie hatte hier immer nur das Gurren der Tauben und gelegentlich das Quieken der Schweine gehört. Doch eines wusste sie sicher, nämlich dass sie keinen unheimlicheren Ort kannte als die alte Scheune mit dem steinernen Fundament und den dunklen Fenstern.
Sie wohnte auf dem Nachbargrundstück, von wo aus die Scheune mit dem verblichenen roten Anstrich und dem rostigen Blechdach ganz normal wirkte. Doch wenn man näher heranging, war sie ziemlich verrottet und sah unheimlich aus, nicht zuletzt wegen des schulterhohen Grases und Unkrauts um das brüchige Fundament herum. Letzten Sommer waren sie und ihre beste Freundin, Lola, dort hingeschlichen. Doch gerade als sie allen Mut zusammengenommen hatten und in die Scheune reingehen wollten, kam ein amischer Mann heraus. Sie bekamen einen Riesenschreck und versteckten sich im hohen Gras, was aber auch ziemlich aufregend war. Der Mann hatte dann aber nur vor die Tür gepinkelt, und obwohl sie sich vor Angst fast in die Hose gemacht hatten, mussten sie auf dem ganzen Nachhauseweg lachen. Sally hatte einige Mühe gehabt, ihrer Mutter die Kletten in ihren Haaren zu erklären.
Bei der Erinnerung seufzte Sally. Lola und sie hatten immer viel Spaß zusammen gehabt, doch Lola war letzte Weihnachten wegen des blöden Jobs ihres Vaters weggezogen, und sie fehlte ihr sehr. In letzter Zeit traf sich Sally öfter mit Fayrene Ehrlich, die vor kurzem aus Columbus nach Painters Mill gezogen war. Fayrene war hübsch und beliebt (ihre Mom erlaubte ihr sogar, Lippenstift zu tragen und die Beine zu rasieren) und hatte auch schon einen Platz im Softball-Team und im Mädchenchor ergattert, was Sally bisher nicht gelungen war. Und das lag sicher nicht daran, dass sie es nicht eifrig genug versucht hätte. Alle hielten Fayrene für das Beste, was Painters Mill seit dem neuen Baseballfeld bei der Mittelschule passiert war. Sally hielt Fayrene für eine großmäulige Besserwisserin. Und sie wusste genau, dass Fayrene gar nicht so klug war, denn sie hatte schon zweimal die Hausaufgaben bei Sally abgeschrieben.
Aber durch Lolas Wegzug blieb ihr nur Fayrene als Freundin. Und Tatsache war, dass Sally sich anstrengen musste, um zu beweisen, dass sie mutig und reif genug für die fünfte Klasse war. Ihre Mom hatte gesagt, sie solle sich von den Amischen nebenan fernhalten, weil die nicht wollten, dass englische Kinder in ihrer Scheune rumschnüffelten. Aber genau das musste Sally jetzt tun, um allen zu zeigen, dass sie kühner und doppelt so interessant war wie Fayrene Ehrlich. Deshalb wollte sie in der Schulcafeteria eine coole Story zu bieten haben und am besten noch irgendeinen sichtbaren Beweis, dass sie sich das wirklich getraut hatte.
»Kinderleicht«, flüsterte sie, als sie die Böschung am Bach hochstieg. Was Fayrene wohl machen würde, wenn Sally mit Rebecca Schneiders Skalp zurückkäme? Das würde sie bestimmt für alle Zeiten zum Schweigen bringen.
Sally blickte sich um, ob die Luft rein war, und flitzte dann über den Fußpfad hinauf zur Scheune, die an einen Hang gebaut war. Die Vorderseite zeigte hangaufwärts, und die Rückseite, unter der sich niedrige Ställe und im Freien davor Schweinekoben befanden, ging zur Weide. Vorne war ein großes Schiebetor, wo die Amischen mit ihrem Fuhrwerk rückwärts reinfuhren, um Heu abzuladen. Aber durch das Tor konnte Sally nicht rein, da man sie von ihrem Haus aus sehen würde. Und da es keine Seitentür gab, musste sie durch die hinteren Ställe gehen.
Mit gespitzten Ohren und den Blick auf die Vorderseite gerichtet, schlich sie nach rechts. Hier konnte sie bereits die Schweine riechen, den beißenden Ammoniak-Gestank, über den sich ihre Eltern jedes Mal aufregten, wenn der Wind ihn zu ihrem Haus herübertrug. Sie presste den Rücken an die Wand und spähte um die Ecke. Die Ställe hatten einen Lehmboden, am hinteren Ende war ein etwa dreißig Zentimeter hoher Misthaufen, und überall hatten Murmeltiere Löcher für ihre Höhlen gegraben. Murmeltiere fand sie auch total gruselig, besonders die großen. Ihre Mom sagte, sie sähen aus wie riesige Ratten.
Sally wollte gar nicht erst groß darüber nachdenken, schlüpfte um die Ecke und schaute nach oben. Die Scheune hatte zwei Stockwerke, oder drei, wenn man die Ställe darunter mitzählte. Es gab nur eine Möglichkeit, nach oben zu gelangen, und zwar durch eine der Heuluken in der Decke über den Ställen. Sie musste nur die Klappe wegschieben und durchklettern.
Sie blickte ein letztes Mal um sich, dann lief sie geduckt in den Stall und weiter bis ans hintere Ende, wobei sie immer Ausschau nach Murmeltieren hielt. Die tiefhängende Decke war voller Spinnweben, die wie schmutzige Zuckerwatte herunterbaumelten. Sie hörte die Schweine draußen in den Koben grunzen und mit ihren gespaltenen Hufen über den Betonboden scharren. Sie kam zu einer Heuluke, checkte sie kurz nach Spinnen und drückte dann die schwere Holzabdeckung mit beiden Händen nach oben. Staub, Dreck und Heureste rieselten ihr auf Gesicht und Schultern. Mit einiger Anstrengung schob sie die Platte beiseite, stellte sich auf die Zehenspitzen und steckte den Kopf durch die Luke.
Ein übler Geruch schlug ihr aus dem Inneren der Scheune entgegen. Es war so dunkel, dass sie weiter vorn nur mit Mühe einen Heuhaufen erkennen konnte, einen einzelnen Ballen Alfalfagras und an der Wand ein paar Leinensäcke mit Maiskörnern. Sally zog sich durch die Luke nach oben, rappelte sich auf die Füße, schlug den Staub von ihrer Hose und sah sich um. Die Tür mit Blick auf die Schweinekoben lag zu ihrer Rechten, links waren das riesige Scheunentor, ein Fuhrwerk und ein Fenster zum Farmhaus. Sie konnte kaum glauben, dass sie es ganz allein bis hierher geschafft hatte. Jetzt musste sie nur noch etwas finden, als Beweis, dass sie hier gewesen war, und dann nix wie weg.
Lautlos schlich sie über den Holzboden nach rechts, kam an einem Stützbalken vorbei, an dem Zaumzeug an einem Nagel hing, das nach Pferdeschweiß und Leder roch, ging um eine Schubkarre mit Pferdeäpfeln und Stroh herum, erreichte die Tür und sah hinaus auf einen moosgrünen Teich und den Fluss weiter hinten. Etwa drei Meter fünfzig unter ihr liefen Dutzende Borstentiere – Hampshire-Schweine und große rosa Schweine mit schwarzen Flecken – in einem Koben herum, der mit einem Stahlrohrgeländer umzäunt war. Ein paar Tiere sahen mit Knopfaugen flehentlich zu ihr hoch, und sie schaute sich nach Heu oder Mais um, das sie ihnen runterwerfen könnte.
»Ihr habt bestimmt Hunger«, flüsterte sie.
Sally zog gerade ein Büschel Alfalfa aus dem Ballen, als sie Stimmen hörte. Sie wirbelte herum und sah, dass das große Scheunentor aufgeschoben wurde. Vor Schreck hielt sie die Luft an, dann schoss sie zurück zur Luke, setzte sich auf den Rand, schob die Füße durch und sprang runter, gerade als mehrere Männer die Scheune betraten. Sie landete auf den Füßen, stellte sich sofort auf die Zehenspitzen, steckte den Kopf durch die Öffnung, packte die Holzplatte und zog sie zurück an ihren Platz. Doch sie schloss die Luke nicht ganz, sondern hielt sie mit dem Kopf ein Stück auf und spähte durch den etwa fünf Zentimeter großen Spalt. Viel konnte sie nicht sehen, nur drei Paar Beine in Hosen und Männerarbeitsschuhe.
»Sis alles eigericht«, sagte einer der Männer.
Ihr Herz hämmerte vor Aufregung und Angst, doch sie rührte sich nicht, hielt die Luke so weit offen, wie sie sich traute. Wenn sie in Sallys Richtung sahen, konnten sie sie entdecken, doch die Gefahr war gering, denn sie unterhielten sich angeregt. Oder stritten sie sich sogar?
Sie wollte die Luke gerade ganz schließen und nach Hause laufen, als die drei Männer zu schreien anfingen. Sie verstand weder Pennsylvaniadeutsch, noch konnte sie ihre Gesichter sehen, doch das war auch gar nicht nötig, um zu wissen, dass sie wütend waren. Ihre Mom hatte immer gesagt, die Amischen seien religiöse, sanftmütige Menschen, die nie gewalttätig würden. Doch diese Unterhaltung hatte nichts Sanftmütiges. Sie traute ihren Augen kaum, als einer der Männer den anderen heftig stieß.
Um ein Haar hätte sie aufgeschrien, denn sie kamen ihrem Versteck immer näher, scharrten mit den Schuhen über den Boden und wirbelten Staub auf, waren kaum noch einen Meter von ihr entfernt. Eine Faust traf klatschend auf nacktes Fleisch, gefolgt von einem wütenden Schrei, wildem Stoßen und Schlagen, jetzt wieder in Richtung der offenen Tür. Einer der Männer stürzte sich auf den Mann nahe der Tür, knurrte dabei wie ein Tier. Sally sah Füße vom Boden abheben, und dann fiel der Mann in hohem Bogen rückwärts, drehte sich mitten in der Luft mit ausgestreckten Armen und schien sie direkt anzusehen, den Mund offen in einem lautlosen Schrei. Dann war er verschwunden.
Der Zaun schepperte beim Aufprall seines Körpers so laut, dass Sally ein Winseln entfuhr. Als er auf dem Betonboden aufschlug, drückte sie sich die Hand auf den Mund und duckte sich so schnell, dass die Luke zuknallte, sie das Gleichgewicht verlor und auf dem Po im Dreck landete.
Was sie gerade beobachtet hatte, machte sie fassungslos. »Omeingott«, flüsterte sie. »Omeingott. Omeingott.«
War der Mann tot?
Die Männer über ihr waren still geworden. Hatten sie sie gesehen?
Sie rannte zur Vorderseite des Stalls, warf einen Blick nach rechts zum Schweinekoben und sah trotz der vielen Schweine durch die Stahlrohre der Einzäunung den Mann auf dem Betonboden liegen. Er bewegte sich, hob den Kopf und blickte benommen um sich. Ihr fiel ein Stein vom Herzen, denn sie war sicher gewesen, dass er den Sturz nicht überlebt hatte.
Doch die Erleichterung währte nicht lange. Die Schweine rannten quiekend umher, ein paar größere Tiere scharten sich dicht um den Mann herum, eines stupste ihn sogar mit der Schnauze. Der Mann schrie etwas und schlug mit der Faust nach dem Schwein.
»Helft ihm«, flüsterte sie mit Blick zur Decke, wo die Männer über ihr sicher alles mit ansahen. Warum halfen sie ihm nicht?
Sally wurde übel. Jetzt brüllte ein großer weißer Eber, drängte sich nach vorn und rammte seine Stoßzähne in den Mann, der einen furchtbaren Laut von sich gab. Sally sah den aufgerissenen Hemdsärmel, das schockierende Rot von Blut, und klapperte mit den Zähnen.
Sie machte die Augen fest zu. »Helft ihm«, wimmerte sie. »Bitte.«
Auf einmal veränderten sich die Geräusche im Koben, irgendetwas passierte gerade. Sally machte die Augen wieder auf. Die Schweine rannten aufgeregt hin und her, dicht an den Mann heran und wieder weg. Und dann beobachtete sie entsetzt, wie sich eine große Sau in der Schulter des Mannes festbiss und ihn wild schüttelte, so wie ein Hund ein Eichhörnchen in seinem Maul schüttelte. Der Mann wand sich und versuchte wegzurollen, doch ein weiteres Schwein biss ihn in den Arm. Sally hielt sich die Hände vors Gesicht, doch die Geräusche und Schreie konnte sie nicht ausblenden.
»Omeingott! Omeingott!« Sie unterdrückte ihre Schluchzer und rannte so schnell sie konnte weg von der Scheune. Dass die Männer sie sehen würden, wenn sie in ihre Richtung blickten, war ihr egal. Ohne sich nur einmal umzudrehen, erreichte sie den Zaun, quetschte sich zwischen dem Draht durch, riss ihr Shirt an einem Stachel ein und ritzte sich den Arm auf. Doch sie fühlte keinen Schmerz, raste mit angewinkelten Armen und brennenden Beinen den Feldweg entlang, das Grauen im Nacken.
Ihre eigenen Schreie verfolgten sie auf dem ganzen Weg nach Hause.
Sie kam zwanzig Minuten zu früh an der überdachten Brücke an. Niemand wusste, wohin sie gegangen war. Ihre Nervosität trieb sie schier in den Wahnsinn. Aber freudig erregt war sie auch und froh, dass sie diesen Treffpunkt gewählt hatten. Die Tuskarawas-Brücke, an der sie sich im Sommer über ein Dutzend Mal getroffen hatten, war etwas ganz Besonderes. Hier hatten sich schon viele junge Verliebte zum ersten Mal geküsst, hatten sich Versprechen zugeflüstert, gelacht und von der Zukunft geträumt. Und wenn man alleine war, konnte man einfach hier sitzen und nachdenken.
An diesem Nachmittag war es so still hier, dass man die Rotschulterstärlinge hören konnte, die weiter unten beim angestauten Wasser von Baum zu Baum hüpften, und das Summen der Bienen, die um die gelben Spitzen der Goldruten entlang des schlammigen Ufers des Painters Creek schwirrten. Mit der Schulmappe in der Hand betrat sie die überdachte Brücke, auf der es wegen des Schattens ein wenig kühler war. Sie hob den Rock ihres Kleides – ihr schönstes, und auch die schwarze Kapp hatte sie sonst nur sonntags beim Gottesdienst auf – und setzte sich an das Fenster mit Blick auf den Fluss, der sich friedlich dahinschlängelte. Den gleichen Frieden wünschte sie sich für ihr Herz, doch den würde sie wohl so schnell nicht bekommen.
Nie zuvor hatte sie so viele widerstreitende Gefühle wie in dieser letzten Woche erlebt. Die Vorstellung, ein neues Leben mit ihm zu beginnen, machte sie überglücklich. Und doch war der Gedanke daran, ihre Familie verlassen zu müssen, unsäglich traurig. Sie würde ihre Mamm, ihren Datt und die jüngeren Geschwister furchtbar vermissen! Wie sollte sie den Alltag ohne die Weisheit ihrer Eltern bewältigen? Wie sollte sie abends ohne die Umarmungen und Küsse ihrer Brüder und Schwestern zu Bett gehen? Wussten die überhaupt, wie sehr sie sie liebte? Würden sie sich immer an ihre Schwester erinnern?
Die Alternative war, den Rest ihres Lebens ohne den Mann zu verbringen, den sie liebte – den sie bald heiraten wollte –, und das war ausgeschlossen. Es war nicht von Bedeutung, dass er ein Mennischt – Mennonit – war und obendrein der Neuen Ordnung angehörte. Er war ein guter Mann, freundlich und arbeitsam. Und das Wichtigste: Er liebte sie und wollte sie heiraten. Es war ihr egal, dass er Gott auf eine etwas andere Weise verehrte und dass sein Glaube es zuließ, modernen Komfort zu haben und ein Auto zu fahren.
Doch ihren Eltern war es nicht egal. Sie hatte versucht, ihnen zu erklären, dass er ein guter Ehemann sein würde, bestimmt hart arbeitete und für sie und ihre Kinder sorgte. Aber ihre Familie gehörte zu den Swartzentruber, den konservativsten aller amischen Gemeinden. Ihre Eltern waren demutig – unterwürfig und bescheiden – und hielten sich strikt an die Traditionen ihrer Vorfahren. Sie fuhren fensterlose Buggys mit stahlbereiften Holzrädern, lehnten die Nutzung von Strom ab und hatten im Haus weder ein Spülklosett noch Linoleumböden. Ihre Mamm trug eine Haube und ein Kleid, das bis fast zu den Knöcheln reichte. Ihr Datt hatte sich noch nie den Bart gestutzt.
Ihre Eltern glaubten daran, dass dieses Verhalten ihnen einen Platz im Himmel sicherte. Und deswegen würden sie ihr niemals Gehör schenken und sie auch niemals verstehen, geschweige denn ihre Wahl billigen. Am Ende hatten sie ihr keine andere Möglichkeit gelassen. Sie musste sich entscheiden zwischen ihrer Familie – deren striktem amischen Glauben – und der Zukunft mit einem Mann, den sie mehr liebte als ihr eigenes Leben.
Genau an diesem Ort hier hatten sie sich vor zwei Tagen das letzte Mal getroffen. Sie hatte lachen müssen, als er vor ihr auf die Knie fiel und ihr einen Heiratsantrag machte. Ringe wurden bei Amischen nicht getauscht, wenn sie sich verlobten. Aber sie hatte sich wie eine Prinzessin gefühlt, weil er einen hatte zurücklegen lassen – einen einfachen Goldring mit einem echten Diamanten –, den er abholen wollte, sobald er seinen Lohn bekam. Ihre und seine Freude wurde nur dadurch gedämpft, dass ihre Eltern ihnen niemals ihren Segen geben würden. Sie war erst siebzehn Jahre alt, aber schon getauft und würde unter Bann gestellt werden. Exkommuniziert. Niemand in der Gemeinde würde mit ihr sprechen oder gemeinsam mit ihr die Mahlzeiten einnehmen. Aber das Schlimmste war, dass sie ihre Geschwister nicht mehr sehen durfte. Allein diese Vorstellung tat ihr im Herzen weh!
Letzte Nacht, nachdem alle zu Bett gegangen waren, hatte sie ihre Schultasche hervorgeholt und gepackt. Unterwäsche, Socken, Kleider zum Wechseln, ein Stück Laugenseife von ihrer Mutter. Und ihre Ausgabe des »Märtyrerspiegel«, einem dicken Buch von eintausendzweihundert Seiten. Obwohl sie eigentlich keinen Platz dafür hatte, war es doch der eine Gegenstand, ohne den sie nicht leben konnte. Denn ganz egal, welche Seelenqualen sie gerade durchlebte, die Berichte in dem alten Wälzer über die Wiedertäufer, die für ihren Glauben gestorben waren, entsetzten sie zwar, inspirierten sie aber auch, Gott noch mehr zu lieben. In den nächsten Tagen würde sie all ihre Kraft und ihren Glauben brauchen, die sie aufbringen konnte.
Heute Morgen, nachdem ihr Datt das Haus verlassen hatte, war sie in die Zimmer ihrer Brüder und Schwestern geschlichen. Sie hatte sie zum Abschied geküsst, und am Ende waren deren zarte Wangen fast genauso tränennass wie ihre eigenen. »Ich liebe euch, meine Kleinen«, hatte sie geflüstert. »Seid schön brav.« Sie hoffte, dass ihre Eltern in ein paar Wochen oder Monaten merkten, wie sehr sie ihnen fehlte, und sie wieder in ihrem Haus willkommen heißen würden. Aber so recht glauben konnte sie es nicht. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass sie keinen von ihnen jemals wiedersehen würde, und sie weinte noch mehr.
Zwei Stunden hatte sie bis zur überdachten Brücke gebraucht und jedes Mal einen Schweißausbruch bekommen, wenn ein Auto oder ein Buggy an ihr vorüberfuhr. Sie hatte große Angst, jemand würde sie erkennen und ihren Eltern davon berichten. Im Grunde war es natürlich egal, weil sie es doch sowieso bald merken würden. Doch auch wenn sie versuchten, sie aufzuhalten, würde sie sich nicht anders entscheiden. Nichts konnte sie jetzt mehr aufhalten. Nichts.
Sie streifte ihre Schuhe ab und ging zu der Stelle, wo er ihre beiden Initialen ins Holz geritzt hatte. So albern es war, doch der Anblick trieb ihr wieder Tränen in die Augen. Denn erst nach vielen Monaten, in denen sie sich heimlich und voller Angst, entdeckt zu werden, davongestohlen hatten, waren sie zusammen gewesen wie Frau und Mann. Sie würden heiraten, ein Haus und Kinder haben. Vor lauter Liebe schwoll ihr die Brust, und nicht zum ersten Mal fragte sie Gott, wie etwas, das sich so richtig, rein und gut anfühlte, überhaupt schlecht sein konnte.
Emotional am Rande der Erschöpfung, ging sie schließlich zurück zu dem Platz, wo ihre Schultasche stand, und setzte sich. Er war zu spät, wie immer, und sie konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen. Sie stellte sich sein schönes Gesicht vor, die freundlichen Augen, das verborgene Lächeln, das er nur ihr schenkte. Gleich würde er in seinem alten Auto angebraust kommen, den Ellbogen aufs Fenster gestützt, das Radio aufgedreht, die Haare flatternd im Fahrtwind. Sie würde hier sitzen und warten, wenn es sein musste bis in alle Ewigkeit.
»Beeil dich, Liebster«, flüsterte sie. »Beeil dich.«
1. Kapitel
Im Alter von acht Jahren lernte ich, dass es Konsequenzen hatte, mit Englischen zu verkehren. Diese Konsequenzen waren ausnahmslos negativ und gründeten auf dem festen Vorsatz wohlmeinender amischer Eltern, die dreihundert Jahre alten Regeln ihrer Vorfahren – den Wiedertäufern – um jeden Preis zu befolgen. Meine Lektion erhielt ich bei einer Pferdeauktion nahe Millersburg, und involviert waren ein zwölfjähriger englischer Junge und ein Appaloosa-Wallach, den er verkaufen wollte. Mit mir als Dritter im Bunde ergab das eine gefährliche Konstellation, die damit endete, dass ich in Ungnade fiel und meinem Vater klarwurde, dass sich meine Sichtweise der Regeln von der seinen unterschied – und ich zudem eine tiefsitzende Unfähigkeit besaß, sie zu befolgen.
Die Lektion jenes Tages werde ich nie vergessen. Und auch nicht, wie sehr mein acht Jahre altes Herz schmerzte, das schon in diesem zarten Alter gegen die Ungerechtigkeiten der Ordnung rebellierte und gegen alle, die über meine Verfehlungen richteten. Doch sämtliche Lektionen hielten mich nicht davon ab, die Regeln immer wieder zu brechen und selbst gegen die fundamentalsten amischen Grundsätze aufzubegehren. Spätestens als ich dann im Teenageralter war, wurde allen klar, dass ich mich nicht fügen konnte, und schlimmer noch, dass ich nicht in die Gemeinschaft passte – beides Voraussetzungen, um ein Mitglied der amischen Gemeinde zu sein.
Jetzt bin ich dreiunddreißig Jahre alt und will immer noch all jenen gefallen, die mich niemals akzeptieren werden, weshalb ich auch jetzt noch genauso scheitere wie damals als unbeholfenes, unsicheres fünfzehnjähriges Mädchen.
»Hör auf, dir Sorgen zu machen.«
Ich sitze in John Tomasettis Tahoe auf dem Beifahrersitz und weiß nicht, ob ich mich von seiner Wahrnehmungsfähigkeit beeindrucken lassen oder aber mich ärgern soll, dass meine Gemütsverfassung so offensichtlich ist. Wir leben seit sieben Monaten zusammen auf seiner Farm, und obgleich es nicht immer nur harmonisch zugeht, muss ich gestehen, noch nie im Leben so glücklich und zufrieden gewesen zu sein.
Tomasetti war früher Detective bei der Polizei in Cleveland und ist jetzt Agent im Ohio Bureau of Criminal Identification and Investigation. Wie ich, hat auch er eine problematische Vergangenheit und wahrscheinlich mehr Geheimnisse, als ich ahne. Aber wir haben eine stillschweigende Übereinkunft, dass unsere Vergangenheit unser Glück nicht beeinflussen oder unsere Lebensweise bestimmen darf. Ehrlich gesagt, ist er das Beste, was mir jemals passiert ist, und ich wünsche mir natürlich, dass es ihm mit mir genauso geht.
»Wie kommst du darauf, dass ich mir Sorgen mache?«, frage ich herausfordernd.
»Du zappelst rum.«
»Ich zapple rum, weil ich nervös bin«, erwidere ich. »Das ist ein Unterschied.«
Er sieht mich kopfschüttelnd an, doch in dem Blick, mit dem er mich von Kopf bis Fuß mustert, liegt Anerkennung. »Du siehst schön aus.«
Ich schaue aus dem Fenster, damit er mein Lächeln nicht sieht. »Falls das ein Versuch ist, mich aufzuheitern, hat es nicht funktioniert.«
Ein vergnügtes Grinsen umspielt seinen Mund. »Es sieht dir nicht gerade ähnlich, dich viermal umzuziehen.«
»Es ist nicht einfach, sich für ein amisches Dinner zu kleiden.«
»Was offenbar besonders für ehemalige Amische gilt.«
»Vielleicht hätte ich mir eine Ausrede einfallen lassen sollen.« Ich blicke aus dem Fenster zum Horizont. »Laut Wetterbericht soll es regnen.«
»Sich zu drücken passt nicht zu dir.«
»Wenn es um meinen Bruder geht, schon.«
»Kate, er hat dich eingeladen. Er will, dass du zu ihnen kommst.« Er legt die Hand auf mein Bein oberhalb des Knies und drückt. Bestimmt hat er keine Vorstellung, wie beruhigend diese Geste ist. »Sei einfach du selbst und lass den Dingen ihren Lauf.«
Ich weise ihn nicht darauf hin, dass genau dieses »ich selbst sein« zu meiner Exkommunizierung und zum Rauswurf aus der amischen Glaubensgemeinde geführt hat.
Er biegt in die lange unbefestigte Straße ein, die zur Farm meines Bruders Jacob führt. Das Anwesen gehörte ursprünglich meinen Eltern und wurde nach ihrem Tod traditionell an den ältesten Sohn vererbt. Als links der kleine Apfelgarten in Sicht kommt, wappne ich mich gegen die Erinnerungen, die da kommen werden. Sie lassen auch nicht lange auf sich warten, und deutlich habe ich vor Augen, wie wir drei Kinder nach draußen geschickt wurden, um Äpfel für den Kuchen zu pflücken. Jacob, Sarah und ich waren damals unzertrennlich gewesen, und anstatt Äpfel zu pflücken, spielten wir oft so lange Verstecken, bis es zu dunkel war, um noch irgendetwas zu sehen. Wie üblich hatte ich sie dazu angestiftet. Kate, die druvvel-machah – Kate, die immer Ärger macht. So oder so ähnlich nannte mich Datt. Ein einziges Mal hatte ich zugegeben, meine Geschwister dazu überredet zu haben, und es hatte mich meine Lieblingsaufgabe gekostet: Ich durfte das drei Wochen alte elternlose Zicklein, das ich Sammy getauft hatte, nicht mehr mit der Flasche füttern. Alles Betteln, Schimpfen und auf ihn Einreden war nutzlos und führte am Ende nur dazu, dass ich ohne Abendessen und mit Bauchschmerzen von zu vielen grünen Äpfeln ins Bett geschickt wurde.
Das Haus meines Bruders ist weiß und schlicht. Es hat eine große vordere Veranda und hohe Fenster, die mich anstarren, als wir nach rechts auf den Hof biegen. Der Ahornbaum, den ich als Zwölfjährige mit meinem Vater gepflanzt habe, hat seine volle Größe erreicht und beschattet die Funkien entlang des Hauses. Im seitlichen Garten stehen zwei Tische, auf denen unterschiedlich gemusterte Decken im Wind flattern. Als ich das alte Hühnerhaus und die große Scheune zu meiner Linken erblicke, fällt mir auf, wie viel meiner eigenen Vergangenheit in diesem Ort wurzelt. Und wie viel für mich für immer verloren ist. Da Amische keine Fotos machen, gibt es keine kitschigen Fotoalben oder Schulaufnahmen oder peinlichen Videos. Meine Eltern sind schon lange tot, so dass alles, was hier einmal passiert ist, das Gute wie das Schlechte, nur noch in meiner Erinnerung und der meiner Geschwister existiert. Vielleicht komme ich deshalb noch her, denn ganz gleich, wie sehr mein Bruder mich verletzt, kehre ich wie ein getretenes Hündchen, das keinen anderen Ort kennt, keinen anderen Trost, immer wieder hierher zurück.
Ich möchte, dass Tomasetti diesen Teil meines Lebens kennenlernt. Er soll im Schatten des Ahornbaums stehen, während ich ihm von dem Tag erzähle, an dem mein Datt und ich ihn gepflanzt haben. Wie stolz ich war, als er bereits im ersten Frühjahr Knospen trug. Ich will mit ihm über die Felder spazieren und ihm den umgefallenen Baumstamm zeigen, über den ich im Alter von dreizehn Jahren mit unserem alten Ackergaul gesprungen bin. Ich will ihm den Teich zeigen, in dem ich meinen ersten Barsch gefangen habe und an dessen Ufern Jakob und ich einen Faustkampf wegen eines Hockeyspiels ausgetragen haben. Jacob war zwar älter und größer als ich, kämpfte aber ohne schmutzige Tricks, jedenfalls mit mir. Ich hingegen war mit dem Killerinstinkt geboren, der ihm fehlte, so dass er am Ende meist ein blaues Auge oder eine geplatzte Lippe davontrug. Er hat mich niemals verpetzt, aber ich werde den Blick nicht vergessen, mit dem er mich jedes Mal ansah, wenn er meine Eltern anlog, um mich zu schützen, und dann an meiner Stelle bestraft wurde. Und ich habe nie ein Wort gesagt.
Tomasetti parkt den Wagen auf dem sandigen Platz hinterm Haus und macht den Motor aus. Der Buggy meiner Schwester Sarah und meines Schwagers William steht vor der Scheune. Als ich aus dem Tahoe steige, tritt gerade meine Schwägerin, Irene, mit einem Brotkorb in einer und einem Plastikkrug in der anderen Hand aus der Hintertür.
Sie sieht mich und lächelt. »Nau is awwer bsil zert, Katie Burkholder!« Das wurde aber auch Zeit!
Ich begrüße sie auf Pennsylvaniadeutsch. »Guder nammidag.«
»Mir hen Englischer bsuch ghadde!«, ruft sie. Wir haben Besuch von Nicht-Amischen!
Die Fliegengittertür geht knallend auf. Ich sehe zum Haus, wo meine Schwester Sarah eine Platte Brathähnchen und eine volle Schüssel grüne Bohnen die Verandatreppe hinunter balanciert. Sie trägt ein blaues Kleid mit Schürze, eine Kapp, deren Bänder über den Rücken baumeln, und einfache schwarze Sneakers. »Hi, Katie!«, ruft sie etwas zu enthusiastisch »Die Männer sind im Haus. Sie scheie sich vun haddi arewat.« Sie scheuen sich vor schwerer Arbeit.
Irene stellt Krug und Korb auf den Picknicktisch, stemmt die Hände in die Taille und streckt den Rücken. Sie trägt fast die gleichen Sachen wie meine Schwester: ein etwas dunkleres blaues Kleid, Schürze, Kapp, ausgelatschte Sneakers. »Alle daag rumhersitze mach tem faul«, sagt sie in Bezug auf die Männer. Den ganzen Tag rumsitzen macht sie faul.
»Sell is nix as baeffzes.« Alles nur Geschwätz.
Als die Stimme meines Bruders ertönt, blicke ich zum Haus, wo er und sein Schwager, William, auf der Veranda stehen. Beide Männer tragen dunkle Hosen und weiße Hemden, Hosenträger und Strohhüte. Jacobs Bart reicht bis zur Brust und ist mehr grau als braun, Williams Bart ist rot und schütter. Beide Männer sehen von mir zu Tomasetti und wieder zu mir, als warteten sie auf eine Erklärung für seine Anwesenheit. Dass keiner von beiden anbietet, beim Tischdecken zu helfen, entgeht mir nicht.
»Katie.« Jacob nickt mir zu, während er die Verandatreppe herunterkommt. »Wie geth’s alleweil?« Wie geht es dir?
»Das ist John Tomasetti«, sage ich zu niemand Bestimmtem.
Tomasetti geht mit ausgestreckter Hand auf meinen Bruder zu. »Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen«, sagt er vollkommen entspannt.
Während Amische einem deutlich zeigen können, dass man ein Außenstehender ist – was gewöhnlich aus religiösen Gründen geschieht und nicht aus Gemeinheit –, können sie auch freundlich, herzlich und gastfreundlich sein. Es freut mich, all das in den Augen meines Bruders zu sehen, als er Tomasettis Hand nimmt. »Es ist schön, auch Sie kennenzulernen, John Tomasetti.«
»Kate hat mir viel von Ihnen erzählt«, sagt Tomasetti.
William streckt lächelnd die Hand aus. »Es waarken maulvoll gat.« Kein Grund zur Freude.
Sarah kichert. »Herzlich willkommen, John. Ich hoffe, Sie haben Hunger.«
»Den habe ich wirklich.«
Ich blicke zu Tomasetti. Er zwinkert mir zu, und die Anspannung in meinem Nacken lässt etwas nach.
Die beiden Frauen strecken nicht die Hand zur Begrüßung aus, sie nicken aber, als ich ihn vorstelle.
Als das eingetretene Schweigen etwas zu lange dauert, wende ich mich meiner Schwester zu. »Kann ich dir bei irgendwas helfen?«
»Setz der disch.« Deck den Tisch. Sarah sieht Tomasetti an und zeigt zum Picknicktisch. »Sitz dich anna un bleib e weil.« Machen Sie es sich bequem. »Dort steht Limonade, und ich bringe gleich Eistee raus.«
Tomasetti geht zum Tisch, wo sein Blick anerkennend über das Festessen wandert. »Und das soll ich alles essen?«
Jacob kichert.
»Es ist mehr als genug für alle da«, sagt Irene.
William streicht sich über den Bauch. »Sogar für mich?«
Eine Windbö zerrt am Tischtuch, und Jacob blickt nach Westen zum Horizont. »Wenn wir dem Sturm zuvorkommen wollen, sollten wir bald anfangen zu essen.«
Irene überkommt ein Schauder angesichts der Blitze und dunklen Wolken. »Wann der Hund sich off der buckle legt, gebt’s rene.« Wenn der Hund sich auf den Rücken legt, gib’s Regen.
Während Tomasetti und die beiden amischen Männer sich Limonade einschenken und über den angekündigten Sturm sprechen, folge ich den Frauen in die Küche. Ich hatte gezögert, die Einladung meines Bruders anzunehmen, weil ich nicht wusste, was mich erwarten würde. Wie sie darauf reagieren würden, dass ich mit Tomasetti zusammenlebe, ohne Hochzeitspläne zu haben. Doch zu meiner Erleichterung hat bisher keiner das Thema angesprochen, was meine Anspannung weiter vermindert.
In der Küche ist es trotz der Brise, die durch das Fenster über der Spüle weht, sehr warm. Sarah und ich tragen zunächst Pappteller und Plastikbesteck zusammen und probieren dann den Kartoffelsalat, während Irene etwa ein Dutzend dampfende Maiskolben aus dem Schmortopf auf dem Herd fischt und auf eine Platte häuft. Wir machen Smalltalk, und ich bin verblüfft, wie schnell mir der amische Lebensrhythmus wieder vertraut ist. Ich erkundige mich nach meiner Nichte und meinen Neffen und erfahre, dass sie auf die Weide gegangen sind, um der kleinen Hannah den Teich zu zeigen, und ich muss sofort an die Zeit denken, als dieser Teich in meinem eigenen Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich hatte darin schwimmen gelernt, und weder Schlamm noch Moos oder der fischige Geruch des Wassers hatten mich gestört. Damals kannte ich weder Schwimmbecken noch Chlor oder Sprungbretter und war zufrieden gewesen, mich in teefarbenem Wasser zu tummeln und auf dem verrotteten Steg zu sonnen, mir Schlammbäder zu gönnen und von all den Dingen zu träumen, die ich in meinem Leben noch vorhatte.
Ich nehme mir den Krug mit Eistee und einen Korb mit warmen Brötchen und folge den beiden Frauen hinaus zu den Tischen. Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass Jacob seine Pfeife hervorgeholt hat und raucht, eine Angewohnheit, die bei sehr konservativen Amischen Stirnrunzeln hervorruft. Aber so ist Jacob. Er ist auch einer der wenigen, die statt Zugpferden einen motorisierten Traktor benutzen, dessen Stahlräder allerdings keine Gummibereifung haben, weil das gegen die Ordnung wäre. Einige der Kirchenälteren haben sich beschwert, aber bis jetzt hat noch keiner etwas dagegen unternommen.
Innerhalb weniger Minuten sitzen wir alle am Tisch, wo auf der blauweißkarierten Tischdecke das Festessen aus Brathähnchen und Gartengemüse ausgebreitet ist. Am Tisch daneben laden sich meine Nichte und meine Neffen Hähnchen und grüne Bohnen auf ihre Teller. Ich blicke zu Tomasetti, dessen Grinsen bedeutet: »Ich hab dir doch gesagt, dass alles gutgeht«, und in dem Moment bin ich zufrieden.
»Wann der Disch voll is, well mir bede.« Wenn der Tisch reichlich gedeckt ist, lasst uns beten. Alle Köpfe senken sich, und die Kinder am Nachbartisch schweigen. Jacob erhebt die Stimme. »O Herr Gott, himmlischer Vater, segne uns und diese Deine Gaben, die wir von Deiner milden Güte zu uns nehmen warden, speise und tranke auch unsere Seelen zum ewigen Leben, und mach uns theilhaftig Deines himmlischen Tisches durch Jesus Christum. Amen.«
Als er geendet hat, blickt er in die Runde, und wie in stillschweigender Übereinkunft füllen die Erwachsenen ihre Teller.
»Die Kinder sind so groß geworden, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe«, sage ich und löffele grüne Bohnen auf meinen Teller.
»Es kommt mir vor wie gestern, dass klein Hannah noch ein Neugeborenes war«, sagt meine Schwester mit einem Seufzer. »Sie wachsen so schnell heran.«
Jacob streicht dick Butter auf seinen Maiskolben. »Letzte Woche hat Elam den Traktor gefahren.«
Sarah verdreht die Augen. »Und ist um ein Haar im Bach gelandet!«
»Wie der Vater, so der Sohn«, murmelt William.
»Katie, wollt ihr auch Kinder haben?«, fragt Irene, während sie sich Tee nachschenkt.
Doch jetzt hält sie mittendrin inne, und mir wird klar, dass sie gerade ihren Fauxpas bemerkt hat. Sie wirft mir einen Blick zu, eine stumme Entschuldigung in den Augen, dann sieht sie schnell weg und stellt den Krug auf den Tisch. »Hier ist Tee, falls jemand Durst hat.«
»Vielleicht sollten sie zuerst einmal heiraten«, sagt Jacob.
»Ich liebe Hochzeiten.« Sarah streut Pfeffer auf ihren Maiskolben.
»Schon Pläne?«, fragt Jacob.
In dem endlosen Schweigen, das nun folgt, gleicht die wachsende Anspannung einem lebendigen Etwas, das den Raum ausfüllt. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, doch eines weiß ich genau: Was immer es ist, man wird mich streng beurteilen.
»Sagen wir mal so, wir arbeiten noch daran.« Ich lächele zwar, komme mir aber verlogen vor, weil es nicht stimmt. Und da jetzt die Büchse der Pandora geöffnet ist, kann ich mich warm anziehen.
»Arbeiten?« Jacob bestreicht sein Brötchen dick mit Apfelbutter. »Ich finde nicht, dass Heiraten Arbeit ist.«
»Schon gar nicht für den Mann«, sagt Irene.
»Ein Mann wird härter arbeiten, um nicht zu viel zu Hause zu sein.« William sieht nicht von seinem Teller auf. »Wenn er klug ist.«
»Ich glaube, Kate will damit sagen, dass solche Entscheidungen nicht übers Knie gebrochen werden können«, sagt Tomasetti, wobei er Irene anlächelt. »Reichen Sie mir bitte den Mais?«
»In den Augen des Herrn lebt ihr zwei in Sünde«, sagt Jacob.
Ich wende mich an meinen Bruder. »In den Augen einiger Amischer offensichtlich auch.«
Er entgegnet ernst: »Ich verstehe nicht, warum zwei Menschen so leben wollen.«
Betretenheit, und kurz droht auch die vertraute alte Scham in mir aufzusteigen, doch ich lasse es nicht zu. »Jacob, hier ist weder die Zeit noch der Ort, um das zu diskutieren.«
»Hast du Angst, dass Gott es hört?«, fragt er. »Hast du Angst vor seiner Missbilligung?«
Tomasetti nimmt sich einen Maiskolben, legt die Gabel nieder und wendet sich meinem Bruder zu. »Wenn Sie an etwas Bestimmtes denken, Jacob, sagen Sie es doch einfach geradeheraus.«
»Die Ehe ist heilig.« Er hält Tomasettis Blick stand, einen nachdenklichen Ausdruck im Gesicht. »Ich verstehe nicht, warum Sie so leben. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben, sollten sie auch heiraten.«
Alle Blicke richten sich auf Tomasetti. Er weicht ihnen nicht aus, nimmt keine entschuldigende Haltung ein und lässt sich nicht verunsichern. »Bei allem Respekt, das geht nur Kate und mich etwas an. Mehr kann ich dazu nicht sagen, und ich hoffe, Sie und Ihre Familie können das respektieren.«
Mein Bruder senkt rücksichtsvoll den Blick. Doch ich weiß, dass er uns niemals seinen Segen geben oder unsere Ansicht teilen wird, auch wenn er sie jetzt toleriert. »Na gut.«
Ich sehe in die Runde. Alle starren auf ihre Teller, konzentrieren sich ein wenig zu sehr auf ihr Essen. Mir gegenüber schiebt Irene den Teller ihres Mannes etwas dichter an ihn heran. »Vielleicht solltest du lieber essen, anstatt wie ein altes Weib zu schwätzen.«
Sarah hält die Hand vor den Mund, um ihr Lachen hinter einem künstlichen Husten zu verbergen. »Es gibt Dattelpudding zum Nachtisch.«
»Das ist mein Lieblingspudding.« Irene lächelt ihre Schwägerin an. »Kommt gleich nach Pie mit getrockneten Äpfeln.«
»Den hab ich seit der Hochzeit von Big Joe Beiler und Edna Miller nicht mehr gegessen«, sagt William, den Mund voll Huhn.
Mein Puls schlägt so heftig, dass ich der Unterhaltung kaum mehr folgen kann. Es ist ja nicht so, dass ich meinen Bruder und meine Schwester nicht liebe, im Gegenteil. In meiner Kindheit waren sie meine besten Freunde und manchmal auch meine Komplizen. Vieles am amischen Leben hat mir sehr gefallen: Zu einer eng verbundenen Gemeinschaft zu gehören; mit dem Wissen aufzuwachsen, nicht nur von der eigenen Familie geliebt zu werden, sondern auch von den Glaubensbrüdern und -schwestern. Doch dieser Nachmittag erinnert mich an zwei Dinge, die ich gehasst habe: Engstirnigkeit und Intoleranz.
Als könnte er meine Gedanken lesen, legt Tomasetti die Hand auf meinen Arm und drückt ihn. »Lass es gut sein«, sagt er leise.
In dem Moment vibriert das Mobiltelefon an meiner Hüfte, was mir sehr gelegen kommt. »Ich muss da drangehen«, sage ich, stehe auf und nehme es aus der Tasche.
Ich entferne mich ein paar Meter vom Picknicktisch und melde mich wie üblich mit meinem Namen. »Burkholder.«
»Ich störe Sie ungern an Ihrem freien Nachmittag, Chief. Aber ich frage mich, ob Sie den Wetterbericht verfolgen.«
Es ist Rupert Maddox, den alle »Glock« nennen, weil er eine besondere Zuneigung zu seiner Glock-Pistole hegt. Als Kriegsveteran mit zwei Einsätzen in Afghanistan ist er mein zuverlässigster Officer und der erste Afroamerikaner bei der Polizei in Painters Mill.
»Ehrlich gesagt, nein«, sage ich. »Was ist denn los?«
»Der Wetterdienst hat soeben eine Tornadowarnung für die Bezirke Knox und Richland herausgegeben«, berichtet er. »Da kommt ein ziemlicher Mist auf uns zu. Ein Tornado ist gerade nördlich von Fredericktown durch.«
Augenblicklich rückt das Gespräch mit meiner Familie in den Hintergrund, und ich drücke das Handy fest ans Ohr. »Gibt es Tote?«, frage ich. »Schäden?«
»State Highway Patrol sagt, es sieht aus wie im Krieg. Ein Tornado in Bodennähe bewegt sich auf uns zu, und zwar rasend schnell. In fünfzehn Minuten wird’s hier brenzlig.«
»Rufen Sie den Bürgermeister an. Er soll die Sirenen einschalten.«
»Verstanden!«
Die Tornadosirenen sind zwar ein gutes Warnsystem für die Stadt, damit die Bewohner rechtzeitig die Keller oder Schutzräume aufsuchen, doch Holmes County ist überwiegend ländlich geprägt. Die Mehrheit der Menschen hier lebt außerhalb der Hörweite der Sirenen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Amischen weder Fernseher noch Radios besitzen und somit nicht wissen können, dass ein gefährlicher Sturm im Anmarsch ist.
»Rufen Sie die Telefonzentrale an und sagen Sie Lois, alle Mitarbeiter sollen sich in Bereitschaft halten. Wenn es im Revier zu riskant wird, sollen sie unten im Gefängnis Schutz suchen.«
»Mach ich.«
»Glock, haben Sie und LaShonda einen Keller?«
»Alles vorhanden, Chief. Mit Wetterradio und Spielekonsole für die Kids.«
»Gut.« Ich blicke zum Picknicktisch, wo Tomasetti aufgestanden ist und mich fragend anblickt. »Ich bin gerade auf der Farm meines Bruders, etwa neun Meilen östlich der Stadt. Können Sie mir helfen, die Nachricht zu verbreiten?«
»Ich übernehme den Westen und gehe von Tür zu Tür. Der Sheriff hat auch schon Deputys losgeschickt.«
»Danke. Und passen Sie auf sich auf, ja?«
»Und Sie auch.«
Ich lege auf und gehe zurück zum Tisch. »Im Westen wütet ein Tornado und kommt direkt auf uns zu.«
»Ich dachte schon, dass der Himmel komisch aussieht«, sagt Irene und steht auf.
Jacob erhebt sich ebenfalls. »Wie nahe ist er?«
»In fünfzehn Minuten müssen die Tiere im Freien sein und alle Leute im Keller.«
William verlässt den Tisch und geht zu seinem Buggy, an dem das Pferd angeschirrt ist. »Ich mache den Wallach auch los.«
»Ich helfe dir.« Jacob geht hinter ihm her. »Den Buggy bringst du am besten in die Scheune.«
Tomasetti beugt sich zu mir vor. »Vom Tornado gerettet«, murmelt er, greift aber schon nach seinem Smartphone, um das Wetterradar zu checken.
Sarah nimmt mehrere noch mit Essen beladene Teller und balanciert sie waghalsig auf dem Arm. Irene wirkt gestresst, als sie mit meinen Neffen zur hinteren Veranda eilt. Neben der Küche ist eine Tür, die hinunter in den Keller führt, ein feuchter, dunkler Raum, aber der beste Schutz vor umherfliegenden Trümmern, wenn der Sturm über ihr Haus fegt oder auch nur in der Nähe wütet.
»Lass alles stehen«, sage ich zu Sarah. »Kümmer dich um deine Tochter, in ein paar Minuten müsst ihr alle im Keller sein.«
»Zehn Minuten!«, rufe ich William und Jacob zu, die zwanzig Meter von mir entfernt gerade das Pferd abschirren.
Jacob gibt mir mit einem Winken zu verstehen, dass ihnen die Dringlichkeit der Situation bewusst ist.
In den wenigen Minuten, die seit dem Anruf vergangen sind, hat der Wind schon zugenommen. Der Himmel im Westen trübt sich mit seltsam grünlich-schwarzen Wolken ein. Die Tischdecke flattert heftig, eine Tüte Chips fliegt davon. Meine Schwester rennt mit ihrer Tochter auf dem Arm hinterher, doch ich rufe ihr zu, es sein zu lassen.
»Vergiss die Chips! Geh mit Hannah runter in den Keller. Sofort.« Ich blicke zur Scheune, wo Jacob und William gerade das Pferd zum Tor führen. »Ich muss los.«
Zu meiner Überraschung kommt Sarah zu mir und drückt ihre Wange an meine. »Sei vorsichtig, Schwester.«
Ich schenke ihr mein schönstes Lächeln. »Du auch.«
»Kate!«
Ich blicke nach rechts, wo Tomasetti im Tahoe sitzt, das Fenster offen. Er hat den Wagen bereits gedreht und wartet auf mich. »Wir müssen weg!«
Ich sprinte zum SUV, reiße die Tür auf und steige ein. »Wo ist er gerade?«, frage ich.
Als er anfährt, schleudern die Räder Schotter hoch. »Er hat gerade Spring Mountain plattgemacht.«
»Mist. Mist. Das heißt, er bewegt sich nach Nordosten.«
»Richtung Layland. Dann Clark.«
»Und dann Painters Mill.« Ich nehme mein Handy und drücke die Kurzwahltaste für Glock. »Wo sind Sie?«
»Eben auf der Stutz-Farm eingetroffen.«
»Er kommt genau in unsere Richtung.«
»Ich weiß.«
»Sirenen an?«
»Heulen wie Furien.«
Ich denke kurz nach. Der Motor jault, Tomasetti jagt ihn auf einhundertzehn Stundenkilometer hoch. Der Wind rüttelt am Wagen und zerrt an den oberirdischen Stromleitungen. »Ich wollte zur Wohnwagensiedlung im Südosten der Stadt.«
»Zu weit weg, Chief. Vergessen Sie’s.«
»Verdammt.« Frustriert blicke ich aus dem Fenster, wo der Wind die Bäume entlang der Straße schüttelt und die Blätter von den Ästen reißt. Es regnet nicht, aber die Sichtverhältnisse sind wegen des Staubs sehr schlecht. »Ich fahre hier noch einige Farmen ab und dann aufs Revier.«
»Wir sehen uns dort.«
Draußen lässt der Wind plötzlich nach. Die Blätter der Ahornbäume schimmern silbern vor dem schwarzen Himmel. Vereinzelter Müll, Schotter und Blätter, die teilweise noch an kleineren Ästen hängen, liegen über die Straße verstreut. Schwüle hängt in der Luft wie ein feuchtes Laken. Ich habe mein Funkgerät nicht dabei, aber Tomasetti hat seines auf die Frequenz des Holmes County Sheriffbüros eingestellt.
»Was ich hier sehe, gefällt mir gar nicht«, sagt er.
Ich zeige auf einen schmalen, hinter Bäumen verborgenen Schotterweg. »Da musst du rein.«
Er drosselt das Tempo, biegt ab, fährt viel zu schnell um die Kurve herum zur Rückseite des Hauses. Ich springe aus dem Wagen, noch bevor er zum Stehen gekommen ist, und mein Blick fällt sofort auf drei amische Kinder im seitlichen Garten, die mit einem großen, tapsigen jungen Hund spielen. Durch das offene Scheunentor erkenne ich im Inneren die Umrisse von Jonas Miller. Ich laufe zu ihm hin, während Tomasetti den Wagen wendet.
»Mr Miller!« Außer Atem trete ich durchs Scheunentor.
Der amische Mann lässt die Mistgabel fallen und kommt auf mich zugeeilt. »Was der schinner is letz?« Was ist denn los?
»Ein Tornado ist unterwegs«, sage ich auf Pennsylvaniadeutsch. »Bringen Sie Ihre Familie in den Keller. Nau.« Sofort.
Die Blitze um uns herum sind jetzt so nah, dass wir uns beide ducken. Der Wind hat wieder zugenommen, fegt ächzend um die Dachtraufen. Fette Regentropfen platschen auf den Schotter und an die Seitenwand der Scheune.
»Danki.« Er schlägt in die Hände: »Shtoahm!«, ruft er den Kindern zu. »Die Zeit fer in haus is nau!« Sturm! Alle ins Haus!
Ich sprinte zum Tahoe, reiße die Tür auf. »Gleich nebenan ist noch eine Farm.«
»Keine Zeit«, sagt er. »Wir müssen zum Revier.«
»Tomasetti, die Hälfte aller Einwohner dieser Stadt weiß nicht, dass ein Tornado im Anmarsch ist.«
»Tot werden wir ihnen auch keine Hilfe sein.«
Die Räder drehen durch, greifen, und dann rasen wir den Weg entlang. Zu schnell. Die Reifen suchen Halt auf dem losen Schotter. Die Bäume rechts und links wiegen sich wie Unterwasserpflanzen im Wildwasserstrudel. Ich blicke nach Westen. Eine wirbelnde schwarze Wolkenwand senkt sich vom Himmel wie ein riesiger Amboss, der alles, was sich ihm in den Weg stellt, zertrümmern wird.
Als wir das Ende des Schotterwegs erreichen, schlagen die ersten Hagelkörner auf die Windschutzscheibe und prallen von der Motorhaube ab. Tomasetti reißt das Lenkrad nach links, tritt aufs Gaspedal, der Tahoe schlingert, und dann rasen wir die Straße entlang, doppelt so schnell wie erlaubt.
Sein Handy liegt in der Mittelkonsole. Als ich es in die Hand nehme, leuchtet die Website der Nationalen Ozean- und Atmosphärenverwaltung auf dem winzigen Display auf, mit einer Echtzeit-Radardarstellung von Painters Mill und Umgebung. Der violett gekennzeichnete Sturm zieht über die Karte, während am unteren Rand das rote Wort TORNADOWARNUNG blinkt.
Ich lege das Telefon zurück und blicke nach draußen. »Er ist direkt über uns.«
»Hinter uns, aber ganz dicht.«
Ich drehe mich um, sehe durchs Rückfenster und traue meinen Augen kaum. Dicht hinter uns platscht Regen aus einem schwarzen Himmel. Er jagt uns, denke ich. Weiter hinten erkenne ich über dem Boden die Umrisse einer noch dunkleren Wolke, unvorstellbar groß, und Angst durchzuckt mich. Ich sehe Tomasetti an. »Ist unser Haus okay?«, frage ich.
»Ich denke schon.«
»Tomasetti, der macht die Wohnwagensiedlung platt.«
»Wahrscheinlich.« Er blickt mich finster an. »Keine Zeit, Kate.«
Ich will widersprechen, sagen, dass wir es schaffen, wenn wir uns beeilen, ich benutze das Megaphon, es dauert nur wenige Minuten. Aber er hat recht, es ist zu spät.
Und so schlage ich mit der Faust aufs Armaturenbrett. »Verdammt!«
Mit neunzig Stundenkilometern erreichen wir das Industriegebiet am Stadtrand von Painters Mill. Um uns herum heulen die Sirenen, ein Ton, bei dem sich mir unweigerlich die Nackenhaare aufstellen. Papier, Müll und Blätter flattern über Bürgersteige und Straßen, wie kleine Tiere auf der Suche nach Schutz. In der Main Street haben einige Ladenbesitzer die Markisen geschlossen, damit sie nicht in die Fenster knallen können. Angesichts der riesigen Wolkenwand glaube ich allerdings nicht, dass das viel hilft.
Als wir das Rathaus passieren, öffnet sich der Himmel. Durch die Regenwand hindurch sehe ich Stadtrat Stubblefield die Treppe hinauflaufen, immer zwei Stufen auf einmal, und die Tür aufreißen. Dann schüttet es wie aus Kübeln, wir sehen nichts mehr. Die Scheibenwischer laufen auf Höchststufe und sind trotzdem nutzlos. Es ist, als wären wir in einen reißenden Strom gefahren und sänken in düstere Tiefen.
»Da ist Lois’ Caddy.«
Der Cadillac steht auf seinem üblichen Platz, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht erkannt, so sehr schüttet es. »Der Polizeifunk läuft sicher auf Hochtouren.«
Der SUV kommt neben dem Caddy zum Stehen. »Hoffentlich ist sie inzwischen in den Keller umgezogen.« Tomasetti schiebt den Schalthebel auf Parken, zieht den Schlüssel ab und stößt die Tür auf.
Durch den Regenschleier auf der Windschutzscheibe hindurch sehe ich einen großen Plastikmülleimer über den Gehweg rollen. Ich drücke die Tür auf, die mir vom Wind sofort aus der Hand gerissen wird. Der Regen peitscht mir so stark ins Gesicht, dass es mir fast die Luft nimmt. Ich packe die Tür, werfe sie zu und sprinte zum Revier. Der Wind heult im bizarren Einklang mit den Sirenen. Die Hagelkörner prasseln so heftig auf mich nieder, dass ich bestimmt blaue Flecken kriege. Tomasetti wartet an der Tür und hält sie mir auf.
Ich bin nass bis auf die Haut, doch spüre ich weder Kälte noch Feuchtigkeit. Lois sitzt an der Empfangstheke, das Telefon-Headset schief auf dem Kopf und einen erschöpften Ausdruck im Gesicht. »Chief! Da draußen ist der Teufel los!«
»Mit Ihnen alles okay?«, frage ich.
»Ich mach mir vor Angst fast in die Hose. So was hab ich noch nie gesehen.«
Vor ihr auf dem Schreibtisch knistert das Funkgerät und brüllt nonstop Informationen hinaus. Die Telefone klingeln unaufhörlich. Aus dem Radio auf dem Regal hinter ihr tönen laufend die neuesten Warnungen des nationalen Wetterdienstes.
»Haben Sie irgendwo Radar?«, fragt Tomasetti sie schon von weitem.
Lois zeigt auf den Computerbildschirm auf ihrem Schreibtisch. »Ich beobachte das jetzt seit fünfzehn Minuten und schwöre, das ist das Furchterregendste, was mir je vor Augen gekommen ist.«
»Taschenlampen?«
»Da.« Sie zeigt auf die beiden MagLites auf dem Schreibtisch. »Und Batterien.«
Ich stelle mich neben Tomasetti und bin schier fassungslos beim Blick auf den Bildschirm. Ein breiter violetter Streifen mit verräterischem Hakenecho – was die Rotation anzeigt – befindet sich westlich von Painters Mill und nähert sich mit jedem Echoimpuls.
»Er ist fast genau über uns«, sage ich.
»Die weiter südlich von hier kriegen das meiste ab«, entgegnet er.
»Eine Menge Notrufe kommen aus der Wohnwagensiedlung dort.« Lois drückt eine Taste auf der Telefonanlage, nimmt den nächsten Anruf entgegen. »Ja, Ma’am. Das wissen wir. Es ist ein Tornado. Sie müssen sofort in einem Schutzraum oder Ihrem Keller Schutz suchen.« Sie hält inne. »Dann legen Sie sich in Ihre Badewanne und decken Sie sich mit Sofakissen, einer Matratze oder mit Decken zu.« Pause. »Nehmen Sie Ihren Sohn mit. Ich weiß, es macht Angst. Legen Sie sich in die Wanne. Jetzt sofort.« Weitere Anrufe kommen, doch sie zeigt keinerlei Ungeduld.
Die Wohnwagensiedlung geht mir nicht aus dem Kopf. Viele junge Familien wohnen dort, viele Kinder. Es gibt keine Keller, keine Schutzräume. Nichts, wo man hinflüchten kann.
Vor ein paar Jahren habe ich als freiwillige Helferin bei den Aufräumarbeiten in Perrysburg, Ohio, geholfen, etwa zwei Autostunden nordwestlich von Painters Mill. Ein Tornado der Stärke F2, also ein wirklich heftiger, war durch die Stadt gefegt. Zwar gab es keine Toten, aber viele Verletzte, und am schlimmsten hatte es all jene erwischt, die versucht hatten, den Sturm in ihrem Mobilheim zu überstehen.
»Bleiben Sie vom Fenster weg«, instruiert Lois die Anruferin gerade. »Die älteren Kinder müssen in den begehbaren Wandschrank, decken Sie sie mit Matratzen zu. Und Sie legen sich mit dem Baby in die Badewanne. Alles Gute.«
Tomasetti reißt den Blick vom Monitor los. »Kann man die Notrufe in den Keller umleiten?«
»Ich kann alle Anrufe auf das Telefon dort weiterleiten.« Lois drückt ein paar Tasten. »Schon passiert.«
»Wir müssen runter.« Tomasetti schnipst mit den Fingern Richtung Lois. »Headset abnehmen.« Als sie seine Anweisung nicht umgehend befolgt, streift er es ihr sanft vom Kopf und zeigt zum Flur. »Geh –«
In dem Moment implodiert das Fenster bei der Eingangstür. Lois schreit auf. Etwas Großes bleibt in der Jalousie hängen. Der Wind brüllt wie ein Jet-Motor, und der Boden ist in Sekundenschnelle pitschnass.
»Los, auf!«, ruft Tomasetti und packt das Wetterradio.
Lois schießt vom Stuhl hoch und läuft zum Flur. Ich bin keinen halben Meter hinter ihr, Tomasetti ist rechts von mir. Um uns herum ächzt und wackelt das Gebäude, hinter mir geht noch mehr Glas zu Bruch. Die Jalousien flattern im Wind. Wir haben fast die Kellertür erreicht, als es schlagartig dunkel wird. Einen Moment lang sehe ich nichts, das schwache Licht von draußen kann die Schatten des Flurs nicht durchdringen. Tomasetti knipst seine Taschenlampe an, drückt mir die andere in die Hand. Ich mache sie an, reiße die Tür auf, und wir rennen die Treppe hinunter, die Schritte vom Teppichboden gedämpft.
Der Keller ist ein feuchtkalter, dunkler Raum mit einer Gefängniszelle, einem Schreibtisch für den wachhabenden Polizisten und ein paar altmodischen Aktenschränken. Ich leuchte zum Schreibtisch, Lois geht hin und nimmt das Telefon ab. »Tot«, lässt sie verlauten.
Ich nehme mein Handy aus der Tasche und rufe Sheriff Mike Rasmussen auf seiner Privatnummer an. Er nimmt nach dem ersten Klingeln ab.
»Bei Ihnen alles okay?«, beginne ich.
»Ist südlich an uns vorbei«, sagt er. »Und bei Ihnen?«
»Schwer zu sagen. Wir sind im Keller, aber ich fürchte, es wird uns voll erwischen.«
»Haben Sie Funkverbindung?«
»Ja.«
»Der Schaden wird beträchtlich sein, Kate. Das verdammte Ding ist circa achthundert Meter breit und macht alles nieder, was ihm im Weg steht.«
Ich erzähle ihm von der Wohnwagensiedlung. »Ich hab’s nicht mehr dorthin geschafft, Mike. Wenn er durch die Siedlung fegt, gibt’s Tote.«
»Pomerene und Wooster sind in Alarmbereitschaft«, sagt er und meint die Krankenhäuser in der Nähe. »Elektrizitätswerk und Gasversorger bereiten sich auf Stromausfälle und Probleme mit Gasleitungen vor.« Er stößt einen Seufzer aus. »Sobald es bei uns vorbei ist, schicke ich meine Leute zur Wohnwagensiedlung.«
»Danke, Mike. In ein paar Minuten wissen wir, ob wir das Schlimmste hinter uns haben.«
»Rufen Sie an, wenn Sie etwas brauchen.«
Ich lege auf und sehe Tomasetti an, der ein paar Meter weit weg steht, den Blick abwechselnd auf das Wetterradar seines Smartphones und auf mich gerichtet.
Die Decke über uns knarrt und ächzt. Meine Ohren dröhnen wie vom heillosen Donnern eines Zuges, der über wacklige Schienen rast. Im Schein der Taschenlampe fliegen Staubpartikel, aufgewirbelt von der Erschütterung über uns, und ich hoffe inständig, dass das Gebäude dem Sturm standhält.
Jetzt sieht er mich an, und sein Gesichtsausdruck besagt nichts Gutes. »Der Wetterdienst meint, der im Westen war vielleicht ein F3-Tornado.«
Ich erinnere mich noch gut an die Schäden, die der F2 in Perrysburg angerichtet hatte, und die Beklemmung in meiner Brust wächst spürbar.
Mit düsterem Blick kommt er zu mir. »Habt ihr einen Notfallplan?«, fragt er.
»Natürlich«, blaffe ich ihn an, was mir sofort leidtut, denn er will ja nur helfen. Ich atme tief durch. »Ich hätte selber daran denken müssen.« Ich trete ein paar Schritte zur Seite, hole mein Handy aus der Tasche. »Ich rufe den Bürgermeister an.«
Auggie hebt nach dem ersten Klingeln ab. »Kate. Gott sei Dank. Wo sind Sie?«
»Im Polizeirevier.«
»Alle okay?«
»Ja. Und bei Ihnen?«
»Abgesehen von dem Ahornbaum in unserer Küche ist alles toll.«
Auggie und seine Frau wohnen in einem hübschen Viertel mit historischen Häusern und alten Bäumen im Norden der Stadt. »Auggie, wie groß sind die Schäden? Hat der Tornado Ihr Viertel erwischt?«
»Bis auf den umgefallenen Baum ist wohl nicht so viel passiert, glaube ich. Aber der Wind war … unglaublich.«
»Hören Sie, ich glaube, wir sollten den Notfallplan in Kraft setzen.«
Der Bürgermeister schweigt, als versuche er, sich zu erinnern, was der vorsah. Tatsache ist, dass wir ihn vor zwei Jahren aufgestellt haben und noch nie anwenden mussten.
»Sie haben eine Kopie des Plans, richtig?«, frage ich.
»Ja, sicher. Hier irgendwo unter meinen Akten, glaube ich.« Doch er klingt nicht gerade zuversichtlich, und mich beschleicht das Gefühl, dass er nicht weiß, was jetzt zu tun ist.
Ich habe eine Kopie hier im Revier, aber Bürgermeister Auggie ist der offizielle Koordinator. »Wahrscheinlich sollten Sie als Erstes das Rote Kreuz informieren«, sage ich. »Ich fürchte, dass es Tote geben wird, kaputte Gas- und Stromleitungen. Und Einwohner, die Lebensmittel und Wasser und ein Dach über dem Kopf brauchen.«
»Richtig.«
»Wir hatten die Halle der Kriegsveteranen zum Schutzraum bestimmt«, teile ich ihm mit. »Vielleicht rufen Sie Rusty an, damit er alles vorbereitet. Soviel ich weiß, gibt es in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Feldbetten, Decken und Wasserflaschen.«
»Ja, sicher, ich rufe ihn an.«
»Gut. Ich fahre jetzt zur Wohnwagensiedlung. Meinen Mitarbeitern sage ich Bescheid, dass sie alle mit anpacken sollen. Die Telefone im Revier sind tot, wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich auf dem Handy an.«
Ich lege auf und sehe Tomasetti an. »Ich hab keine Zeit, um zur Farm zu fahren und meinen Explorer zu holen, weshalb ich hiermit deinen Wagen beschlagnahme«, sage ich nur halb im Scherz.
Er hat den Schlüssel schon in der Hand. »Und einen Fahrer kriegst du auch gleich mitgeliefert, wenn du willst.«
»Gern.« Ich sehe zu Lois. »Rufen Sie alle Mitarbeiter an, und finden Sie heraus, ob sie den Sturm heil überstanden haben. Wenn ja, sollen sie alle zum Dienst erscheinen, auch Pickles und Mona. Es sei denn, sie müssen sich um einen eigenen Notfall kümmern. Oberste Priorität haben die Verletzten, allen voran die Schwerverletzten. Wir richten eine Notunterkunft in der Halle der Kriegsveteranen ein.«
»Verstanden.«
»Rufen Sie einen der Männer an, T.J. oder Skid, er soll unseren Generator hier anwerfen. Es kann eine Weile dauern, bis wir wieder Strom haben, und die Telefone hier müssen funktionieren.«
»Okay.«