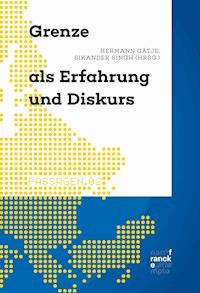
Grenze als Erfahrung und Diskurs E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Passagen
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach der Dynamik von Grenzziehungs- und Grenzverschiebungsprozessen sowie die Wechselbeziehung von Grenzen und Ordnungen werden seit einiger Zeit von der geistes- wie der sozialwissenschaftlichen Forschung in den Blick genommen: Einerseits konstituieren Grenzen Ordnungen und Sinnstrukturen. Andererseits produzieren Ordnungen Grenzen. Der Umstand, dass Grenzen seit dem Einsetzen der Moderne im 19. Jahrhundert in eine beschleunigte Bewegung geraten sind, schlägt sich zudem in einer Vielzahl aktueller Debatten nieder. Die geschichts- und literaturwissenschaftlichen Beiträge des interdisziplinär ausgerichteten Bandes nehmen aktuelle politische Entwicklungen wie neuere Forschungsbewegungen gleichermaßen auf. Das Phänomen des Exils wird dabei in empirischer wie in methodischer Hinsicht nicht von seinen Zentren, sondern von den Grenzen aus in den Blick genommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grenze als Erfahrung und Diskurs
Literatur- und geschichtswissenschaftliche Perspektivierungen
Hermann Gätje / Sikander Singh
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-7720-0065-2
Inhalt
Vorwort
Die Frage nach der Dynamik von Grenzziehungs- und Grenzverschiebungsprozessen wird seit einiger Zeit von der geistes- wie der sozialwissenschaftlichen Forschung fokussiert. Diese gehen davon aus, dass es eine folgenreiche Perspektivenverschiebung und damit verbunden einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ermöglicht, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Phänomene von den Prozessen der Grenzziehung aus zu betrachten.
Zugleich rückt die Wechselbeziehung von Grenzen und Ordnungen ins Zentrum wissenschaftlicher Überlegungen: Einerseits konstituieren Grenzen Ordnungen und Sinnstrukturen. Andererseits produzieren Ordnungen Grenzen. Die Tatsache, dass Grenzen mit dem Einsetzen der Moderne im 19. Jahrhundert in eine beschleunigte Bewegung geraten sind, schlägt sich heute in einer Vielzahl von aktuellen Terminologien nieder. Die Frage danach, welche Auswirkungen von derartigen Veränderungen für die Ordnungen ausgehen, in denen wir leben, beschreibt dabei einen wesentlichen Punkt des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses des vorliegenden Bandes. Im Zuge der momentanen Flüchtlingsbewegungen hat das Thema der Grenze – in seiner historischen Dimension – zudem an politischer Brisanz gewonnen. Menschen harren wartend vor den Grenzen Europas aus. Die Politik und Gesellschaft diskutieren Maßnahmen der „Grenzsicherung“ bzw. die Frage nach der „Durchlässigkeit“ von Grenzen.
Die geschichts- und literaturwissenschaftlichen Beiträge dieses interdisziplinär ausgerichteten Bandes nehmen diese aktuellen politischen Entwicklungen wie neueren Forschungsbewegungen gleichermaßen auf. Das Phänomen des Exils wird dabei in empirischer wie in methodischer Hinsicht nicht von seinen Zentren, sondern von den Grenzen aus in den Blick genommen.
Ausgehend von einem regionalen Schwerpunkt auf das Saargebiet (Territoire du Bassin de la Sarre), den das Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass als Archiv der Großregion Saar-Lor-Lux wissenschaftlich aufarbeitet, diskutieren die hier versammelten Aufsätze Darstellungen von und über den Gang in das Exil, seien es Landwege nach Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, die Schweiz, die skandinavischen Länder, in die Sowjetunion, die Tschechoslowakei oder Überseereisen nach Großbritannien, Mittel- und Lateinamerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika.
Mit seinen Grenzen zu Deutschland und Frankreich war das Saargebiet, das seit 1920 als Mandatsgebiet vom Völkerbund verwaltet wurde, für zahlreiche Verfolgte des Nationalsozialismus bis zum Jahr 1935 ein erstes Ziel ihres Exils und diente oftmals als Durchgangsstation. Zudem fungierte die Region in dieser Zeit als eine Schnittstelle für die Organisation des illegalen Widerstands gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Reich und war dabei – wie auch andere Grenzregionen – selbst ein Ort des Exils: Die geringe Entfernung zur deutschen Grenze evozierte – charakteristisch für grenznahe Exilräume – eine ambivalente Gefühlslage. Die Nähe zur verlassenen Heimat kontrastierte mit der Bedrohung, die von derselben ausging.
Die hier versammelten Aufsätze sind Ergebnis einer Tagung, zu der das Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass der Universität des Saarlandes gemeinsam mit der Gesellschaft für Exilforschung e.V. im März 2017 nach Saarbrücken eingeladen hat. Die Herausgeber danken der Gesellschaft für Exilforschung e.V., insbesondere ihrem Vorstand, für die ebenso vertrauensvolle wie in jeder Hinsicht konstruktive Zusammenarbeit.
Das Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes hat die Ausrichtung der Tagung und die Drucklegung dieses Bandes durch sein großzügiges Engagement finanziell unterstützt. Das Gustav-Regler-Archiv Merzig, Frau Annemay Regler-Repplinger, hat die Durchführung der Tagung ebenfalls finanziell gefördert. Ihnen gilt der besondere Dank der Herausgeber.
Ferner danken wir den Referentinnen und Referenten für ihre engagierten Diskussionsbeiträge und – nicht zuletzt – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Literaturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass für ihre hilfreiche Mitarbeit bei der Durchsicht und Einrichtung der Manuskripte für den Satz.
Saarbrücken, im Januar 2018
Hermann Gätje und Sikander Singh
Literarische Perspektivierungen
Von der (konkreten) Wahrheit der Grenze
Bertolt Brechts Grenzbetrachtungen im Exil
ANDIEDÄNISCHEZUFLUCHTSSTÄTTE
Sag, Haus, das zwischen Sund und Birnbaum steht:
Hat, den der Flüchtling einst dir eingemauert
Der alte Satz DIEWAHRHEITISTKONKRET
Der Bombenpläne Anfall überdauert?
I.Überlegungen zum Grundmotiv der Grenze
Ich aber ging über die Grenze lautet der Titel eines frühen Gedichts von Stefan Heym. „Über die Berge, da noch der Schnee lag, / auf den die Sonne brannte durch die dünne Luft. / Und der Schnee drang ein in meine Schuhe“.1 Das Gedicht, in dem Heym (geboren Helmut Flieg) seine Flucht aus Nazideutschland in die Tschechoslowakei verdichtet, hält paradigmatisch fest, wie tief Exil und Grenze miteinander verbunden sind. Der eigentliche Beginn des Exils geht mit dem Moment der Grenzüberschreitung einher, welche die Gleichzeitigkeit von Ende und Anfang, Ausstieg und Einstieg konkretisiert. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Grenze eines der wichtigsten und bedeutungsträchtigsten Grundmotive der Exilliteratur ist. In Mythos und Sachlichkeit – Beobachtungen zur Grenze in der Exilliteratur stellt Markus Bauer fest:
Vor dem Exil liegt die Grenze. Sie trennt und verbindet auf vielfältige Weisen. Für die Literatur wirkt dieses oft grausame Leben jenseits der Grenze beflügelnd, zieht es doch von den ‚Tumulten der Welt‘ ab (oder gerade in sie hinein), gibt der Klage Form, macht das Gesicht der Gewalt kenntlich.2
An dieser trennend-verbindenden Grenze führt kein Weg vorbei: sie ist nicht neutral, man muss sich ihr stellen, mit ihrer konkreten Sperrkraft ringen und ihrer Einladung zur Kontemplation Gehör leisten. Sie zwingt den Grenzüberschreitenden zu einer Gegenüberstellung von hier und dort, gestern und heute. Mag dies für Reisende eine philosophische Übung sein, für Flüchtlinge ist es eine existentielle Herausforderung, eine Krise, die radikaler nicht sein könnte.
In seinem Lob der Grenze stellt der Philosoph Konrad Paul Liessmann eine Verbindung zwischen „Grenze“ und „Krise“ her, indem er Letztere auf das griechische Verb krínein zurückführt, das er mit „trennen“ oder „unterscheiden“ übersetzt und auf dessen etymologische Verwandtschaft mit „Kritik“ er hinweist. Grenzen wie Krisen haben somit gemein, dass sie Unterschiede bloßlegen und Distanz ermöglichen.
Kritik und Krise stammen aus derselben sprachlichen Wurzel, und sie markieren Grenzen. Nur während wir in der Kritik Unterscheidungen vornehmen, werden wir in der Krise von Unterscheidungen getroffen. Krise ist vorab ein Synonym für Differenzerfahrungen. Es ändert sich etwas, und es steht zu erwarten, dass nachher nichts mehr so sein wird wie vorher.3
Exil, Grenze und Krise erweisen sich als Teil eines Bedeutungs- und Erfahrungsspektrums, in dem die Trennung vom Vorherigen und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Neuverortung und -gewichtung im Mittelpunkt stehen.
Diese Erfahrung der exilbedingten Grenzüberschreitung als existentieller Krise findet in einem der ersten Exilgedichte Bertolt Brechts ihren besonders prägnanten Ausdruck. Kurz nach seiner Flucht ins dänische Exil 1933 schreibt Brecht: „Der du zu fliehen glaubtest das Unertragbare / Ein Geretteter trittst du / In das Nichts“.4 Diese erste Gedichtstrophe hält den Augenblick einer multiplen Grenzüberschreitung fest: aus der Gefahrenzone in die vermeintliche Freiheit; aus einer vertrauten Sphäre in eine für den Fliehenden noch nicht existente Welt; und aus der Fiktion der lebensverheißenden Rettung in eine wohl möglich existenzbedrohende neue Wirklichkeit, die es nun aus dem Nichts aufzubauen gilt. Die Grenzüberschreitung ist zudem performativ, indem sie sich als „Tritt“ in einen neuen Raum gestaltet, gleichzeitig aber ist auch die Grenze selber handlungstragend: die Trennlinie zwischen Flucht und Rettung ist messerscharf und hat eine bleibende, trennende Kraft inne. Beim Überschreiten der Grenze wird die Flucht – als Bewegung – zum Exil in der Fremde. Hinzu kommt, dass es sich auch um eine territoriale Grenze handelt, eine staatlich festgelegte Linie, die sich kartografisch markieren lässt.
In ihrem Sammelband Cartographies of Exile versteht Karen Elizabeth Bishop das Exil deshalb grundsätzlich als eine Krise, deren geografische Koordinaten sich festlegen lassen, die sich in ihrer Entortung an erster Stelle räumlich gestaltet, von der neuen Umgebung betroffen ist und diese gleichzeitig auch ganz konkret prägt: „Exile is fundamentally a cartographical condition, concerned with space and place, how they are ordered and what they order or, perhaps, disorder in the process“.5 Durch das Exil, als staatlich erzwungene Ausgrenzung sowie auch als existentielle Schicksalserfahrung, entstehen Trennlinien, Markierungen, Schwellen und Schranken, Schmugglerrouten und Passagen, asylverheißende und -verneinende Orte: eine Topografie des Exils, die sowohl behördliche Maßnahmen als auch individuelle Entscheidungen widerspiegelt. Das Exil tritt als geografisches Liniennetzwerk in Erscheinung: „Exile drafts these lines – the scrapes and scratches we use to describe our earth – as tools of exclusion and punishment, markers of dislocations and longing, and means of moving nations and reshaping territories that limit who belongs and who does not“.6 Das Exil schreibt sich in die Landschaft ein, was Bishop als Wesenszug des Lebens in der Verbannung betrachtet: „The cartographic imperative inherent in the exilic condition“.7
Die zweifellos bedeutungsträchtigste Linie in der Exiltopografie ist die Staatsgrenze: mit ihrer Überschreitung wird das bis dahin nur gedankliche Konstrukt des – vielleicht noch abwendbaren – Exils zur Wirklichkeit, in der man sich nun einzurichten hat. In ihrer aus Sperrvorrichtungen, Mauern, Stacheldraht und Grenzschranken bestehenden Formsprache macht die Grenze das Exil sichtbar. Sie ist das letzte Hindernis, das es zu überwinden gilt. Erst der gelungene Grenzübertritt erlaubt den Rückblick auf das Überstandene und eine erste Bestandsaufnahme des Bevorstehenden, des Brecht’schen „Nichts“. Die Biografie vieler deutschsprachiger Exilanten zeigt jedoch, dass für die meisten nach der ersten Grenzüberschreitung – vom Dritten Reich ins benachbarte Dänemark, Holland, Frankreich, Österreich, Polen, in die Schweiz oder Tschechoslowakei – noch weitere, mitunter noch gefahrvollere, folgen sollten. Somit setzt das Exil das Überwinden neuer Grenzen voraus und macht den Exilanten zum permanenten Grenzgänger, ständig auf der Suche nach benötigten Papieren, Reisepässen, Aufenthaltsgenehmigungen, Visen, sauf conduits, Immigrantenbürgschaften. Markus Bauers Feststellung, vor dem Exil liege die Grenze, ist gewiss zutreffend, doch müsste man erweiternd sagen, dass die Grenze auch im Exil schicksalsträchtig bleibt. Insbesondere bei den deutschsprachigen Exilschriftstellern, deren Biografie vom mehrfachen Grenzübergang gekennzeichnet ist, zeigt sich das Grenzmotiv in erstaunlich differenzierter Ausprägung. Dies soll im Folgenden exemplarisch am Beispiel von Bertolt Brechts Gedichten, Korrespondenz und Tagebucheinträgen dargelegt werden.
II.Der den Backstein mit sich trug
Das wohl bekannteste exilbezogene Gedicht von Brecht Über die Bezeichnung Emigranten spiegelt die zentrale Bedeutung der Grenze nicht nur in ihrer Überschreitung, sondern vorrangig als kollektive Positionsbestimmung des „wir“ im Exil wider: „möglichst nahe den Grenzen / Wartend des Tags der Rückkehr, jede kleinste / Veränderung / Jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling / Eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend“.1 Es gilt, die Grenze scharf im Auge zu behalten, da sie dem Exilanten als Seismograf dient, dessen akribische Aufzeichnungen aufschlussreich sowohl für die Lage in der Heimat als auch für die Dauer des eigenen Verbleibs im Exil sind. Die Grenze wird somit zum erkenntniserweiternden Instrument, in dem jeder Grenzgänger zum Datenträger wird, dessen Informationen sofort eingeholt und sorgfältig ausgelotet werden. Doch bereits der Grenzgang selbst, als exilinitiierende Handlung, ist bedeutungsschwer und lässt sich in die Semiotik des Exils einfügen: „Sind wir doch selber / Fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen / Über die Grenzen. Jeder von uns / Der mit zerrissenen Schuhn durch die Menge geht / Zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt“.2
Im „Nichts“, das den Exilanten nach der Flucht über die Grenze erwartet, lässt es sich nicht leben, doch ist die Grenze nicht an erster Stelle eine Trennlinie zwischen „sein“ oder „nicht sein“, sondern vielmehr zwischen „haben“ und „nicht haben“, wobei das „nicht länger haben“, der materielle Verlust, für die Missstände im eigenen Lande steht. Das materielle Besitztum ist bei Brecht jedoch nicht neutral, sondern weist über das Dingliche hinaus auf die ökonomischen und politischen Zustände im Land. Auf das „Haben“ hatte er ein Recht, es stand ihm zu. Das Exil bedeutet materielle Entbehrung durch Diebstahl, was dem Verlust des Materiellen eine moralische Dimension verleiht. Die Dinge, die einem im Exil abhanden gekommen sind, zeugen auf beiden Seiten der Grenze von Verbrechen: in ihrem enteigneten kontinuierlichen Dasein wie auch in ihrer Abwesenheit. So auch in Brechts Gedicht Ich habe lange die Wahrheit gesucht:
Als ich über die Grenze fuhr, dachte ich:
Mehr als mein Haus brauche ich die Wahrheit.
Aber ich brauche auch mein Haus. Und seitdem
Ist die Wahrheit für mich wie ein Haus und ein Wagen.
Und man hat sie genommen.3
Die Wahrheit ist in den Dingen: in ihrer Brauchbarkeit und im Besitzverhältnis zu ihnen. „Die Wahrheit ist konkret“, heißt es auch im Gedicht An die dänische Zufluchtsstätte.4 Umso schwerwiegender ist der Akt des „Nehmens“, der Enteignung, die paradigmatisch für Rechtsverstoß, Verlust, Ausgrenzung und Exil steht. Im Exil werden die Dinge in ein neues Licht gerückt und das Verlorengegangene, dessen Fortbestehen jenseits der Grenze umso mehr schmerzt, wird wahrheitsstiftend. „Dem gleich ich“, schreibt Brecht 1938 im Motto zur Steffinischen Sammlung, „der den Backstein mit sich trug / Der Welt zu zeigen, wie sein Haus aussah“.5 Dieses Haus findet sich immer wieder in den Exilgedichten zurück und gestaltet sich mitunter als ein paradiesischer Ort, aus dem man verstoßen wurde. Brechts Gedicht Zeit meines Reichtums schildert das Haus in bewusst idyllischen Tönen, insbesondere den umringenden Garten mit Teich, weißen Rhododendrenbüschen und alten Bäumen. „Wir sahen uns um: von keiner Stelle aus / Sah man dieses Gartens Grenzen alle“.6 Das Gedicht ist eine Elegie auf das verlorene Paradies, wobei auch hier das Besitzverhältnis hervorgehoben wird: „Vom Ertrag eines Stückes erwarb ich / Ein Haus in einem großen Garten“.7 Doch ihm sind nur sieben Wochen in diesem Paradies gegeben: Eine runde, biblische Zahl, die gleichzeitig die Zeit unmittelbar vor dem Exil festhält. Der Vertreibung aus dem Paradies und der Trennung von Hab und Gut folgt der Eintritt in das – materielle – „Nichts“. Der Kontrast zwischen „haben“ und „nicht (mehr) haben“ könnte stärker nicht sein: „Nach sieben Wochen echten Reichtums verließen wir das / Besitztum, bald / Flohen wir über die Grenze“.8 Die Schlusszeile des Gedichts, insbesondere die Verwendung des Verbs „fliehen“, betont das jähe Ende der paradiesischen Zustände und die Unabdingbarkeit des bevorstehenden Exils. Haften dem „Tritt“ des Geretteten ins Exil und der „Fahrt“ über die Grenze noch eine gewisse Autonomie an, deuten „Flucht“ und „Entkommen“ auf den Zwang, dem der Exilant zur Rettung der eigenen Haut nachgeben muss.
III. Vom Fliehen über die Grenzen
Die Flucht lässt kein sorgfältiges Planen zu: auf der Flucht überkommt einen das Exil, das nun agiert und mit dessen Unberechenbarkeit sich der Exilant abzufinden hat.
Dieser Flucht über die Grenze lässt sich jedoch auch Gutes abgewinnen, wie auch das Gedicht 1940 zeigt, das Brecht kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Dänemark schrieb: „Auf der Flucht vor meinen Landsleuten / Bin ich nun nach Finnland gelangt. Freunde / Die ich gestern nicht kannte, stellten ein paar Betten / In saubere Zimmer“.1 Die Flucht schafft Abhängigkeit, macht aus dem Exilanten einen Schutzbedürftigen, doch dieses Ausgesetztsein bietet gleichzeitig auch neue Möglichkeiten menschlichen Kontakts. Die – hier finnischen – Freunde gibt es bereits, doch erst die Not der Flucht fördert ihre Freundschaft zu Tage. Sie eröffnet eine Topografie menschlicher Wohlgesinnung und Hilfsbereitschaft weit über die eigenen Landesgrenzen hinweg, unbekannte Orte erweisen sich als schutzbringend, und die zur Verfügung gestellten sauberen Zimmer ergeben eine Art „underground railroad“ von Stadt zu Stadt, von Land zu Land.
Allmählich entsteht eine geografische Karte des Exils, die Fluchtwege verzeichnet, Hilfsnetzwerke markiert, und auf der das scharfe Auge des Fliehenden auch die letztmöglichen und unwahrscheinlichsten Schlupflöcher erahnt: „Neugierig / Betrachte ich die Landkarte des Erdteils. Hoch oben in / Lappland / Nach dem Nördlichen Eismeer zu / Sehe ich noch eine kleine Tür“.2 Die Verlässlichkeit dieser Karte beruht nicht zuletzt auf die dem Exilanten zur Verfügung stehenden Informationen: Über Friedensbeteuerungen, Kriegsvorbereitungen und -erklärungen, Gebietsgewinne oder -verluste, Kapitulationen und Besatzungen. Brecht trug auf seiner Flucht ein Radiogerät mit sich, das ihm erlaubte, mit Nazideutschland in Funkkontakt zu bleiben und so nicht zuletzt die eigenen Fluchtentscheidungen auf die Berichterstattung abzustimmen. Die Stimme des Rundfunksprechers begleitet ihn, und die Bedeutung seiner Worte – ironischerweise die Worte des Feindes – erleichtert das Gewicht des mitzutragenden Radios. Brecht widmet dem Gerät das vierzeilige Gedicht Auf den kleinen Radioapparat: „Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug / Daß seine Lampen mir auch nicht zerbrächen / Besorgt von Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug / Daß meine Feinde weiter zu mir sprächen“.3
Was braucht der Flüchtling, dem das Überschreiten der Grenze – vielleicht sogar Grenzen – bevorsteht? Die Exilgedichte Brechts ergeben insgesamt eine Art Inventur: mag der „Backstein“ in seiner ganzen Konkretheit nur metaphorisch zu verstehen sein, das Radiogerät trug Brecht tatsächlich mit sich. In seinem Gedicht Die Pfeifen, in dem er festhält, dass er „die Bücher, nach der Grenze hetzend / den Freunden ließ“,4 formuliert Brecht eine Art Fluchtmaxime, die er aber mit dem Mitbringen seines Rauchzeugs sofort verletzt: „Des Flüchtlings dritte Regel: Habe nichts!“5 Die ersten zwei Regeln lassen sich nur erraten, doch Leichtigkeit ist auf der Flucht das Gebot der Stunde. „Habe nichts“ fungiert weiter auch als Kontrastposition zum vorexilischen Leben, das sich nicht zuletzt auch in den Besitztümern – im Wagen, Haus und Garten – manifestierte. Nun wird im Exil das Nichthaben zum kategorischen Imperativ erhoben.
So wie die Wahrheit, die sich in den Dingen zeigt, ist auch die Flucht über die Grenze konkret. In Brechts Flüchtlingsgespräche heißt es zynisch, der Pass sei „der edelste Teil des Menschen“, denn er werde anerkannt „wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird“.6 Diese wertschöpfende Anerkennung trifft natürlich auch auf Devisen zu, weshalb zu des Flüchtlings drei Regeln neben der Beschaffung von gültigen Papieren wohl auch das Mitbringen von Geld zählen mag. In seinem Reisejournal erinnert sich Brecht an seine in einem Moskauer Krankenhaus gestorbene Mitarbeiterin und Geliebte Margarethe Steffin, kurz Grete, die in ihrem Hang zu schönen Dingen immer wieder gegen die Brecht’sche Flüchtlingsmaxime verstößt. Doch auch sie, so erfährt er erst später, hat sich die Grenze – als Erfahrungsbereich, als Praxis – zu eigen gemacht, hat von den zurückliegenden Grenzüberschreitungen gelernt und will auf den nächsten Grenzgang vorbereitet sein.
Ich sehe häufig Grete mit ihren Sachen, die sie immer wieder in die Koffer packte. Das seidene Tuch mit dem Porträt, von Cas gemalt; die hölzernen und elfenbeinernen kleinen Elefanten aus den verschiedenen Städten, in denen ich war; den chinesischen Schlafmantel; die Manuskripte; das Leninfoto; die Wörterbücher. Sie verstand schöne Dinge, wie sie sprachliche Schönheiten verstand. Als ich sie in Moskau aus dem Hotel in die Klinik brachte, lag sie mit dem Sauerstoffkissen; aber sie regte sich auf, daß ich ihren braunen finnischen Kapuzenmantel mitnähme, und war erst ruhig, als ich ihn ihr zeigte. In diesem Mantel, erfuhr ich später, hatte sie 15 englische Pfund, seit Jahren gespart und versteckt, über die Grenzen geschmuggelt: das sollte ihr Freiheit verleihen. Ich liebte sie sehr, als ich das erfuhr.7
Für den Exilanten ist die Grenze eine existentielle Bedrohung, doch die Bemühungen, sie zu überwinden und den ihr innewohnenden Gefahren zu entkommen, machen auch schlau. Gretes Mantel versinnbildlicht die praktische Klugheit, die ein routinierter Grenzüberschreitender – der Schmuggler – an den Tag legt, um die Grenze zu überlisten, so wie ein Schriftsteller beim geschickten Täuschen der Zensurbehörde, braucht er für das Schreiben der Wahrheit doch die List sie zu verbreiten. Brecht mag in Gretes Sorgen um ihren Mantel auch eine Parallele zu seiner 1939 – auch in Moskau – erschienenen Kurzgeschichte Der Mantel des Nolaners gesehen haben,8 in der sich Giordano Bruno trotz Einkerkerung und bevorstehender Todesstrafe um die Rückgabe seines Mantels bemüht, den er von einer Schneiderin hatte anfertigen lassen, doch für den er zu bezahlen nicht mehr in der Lage ist. Wie in der Geschichte Brunos zeigt sich auch bei Grete die wahre Größe in der Tat, im konkreten Handeln und im Verantwortungsbewusstsein über das eigene Schicksal hinweg. Gretes über Jahre herangesammelte und sorgfältig im Mantelsaum eingenähte Pfund deuten zudem auf ihre handfeste, pragmatische Einschätzung der bevorstehenden Bewährungsprobe im Exil. Auch hier ist die Wahrheit konkret.
IV.Grenzüberschreitende Briefe
Wahr ist, dass der Flüchtende Geld braucht und sich nun in der Fremde neue Einkommensquellen schaffen muss. Dementsprechend steht die von Exilanten geführte Korrespondenz in nicht unerheblichem Maße im Zeichen der finanziellen Not und zeigt die Entstehung und Pflege eines regen, länderübergreifenden schriftlichen Verkehrs, in dessen Mittelpunkt immer wieder die Erkundung potentieller Arbeitsmöglichkeiten rückt. Das Grenzschicksal des Exils wird auch hier erwartungsgemäß zum Thema, wie Brechts Briefwechsel im Frühjahr 1939 mit dem schwedischen Schriftsteller und Übersetzer Henry Peter Matthis zeigt. Der seit 1933 im dänischen Exil lebende Brecht, den Matthis zu einer Vortragsreise durch Schweden eingeladen hat, weist auf das Faktum Grenze hin – dessen Aktualität aufgrund drohender Kriegsgefahr ständig wächst – und erhofft sich von Matthis die benötigte Hilfe bei der behördlichen Abhandlung seiner Überquerung der dänisch-schwedischen Staatsgrenze. Datiert 4. März 1939 schreibt er aus Svendborg, unter seinem „dänischen Dach“, an Matthis:
Wenn wir auch den Zeitpunkt für den Beginn der Vorträge im Augenblick noch nicht bestimmen wollen, so wäre es doch richtig, meiner Frau und mir die Möglichkeit, die Grenze zu übertreten, sogleich zu verschaffen, so daß dann nicht daran alles scheitern kann. Wie ich höre, benötigen wir dazu Grenzempfehlungen, am besten von im öffentlichen Leben stehenden Persönlichkeiten. Ich glaube, wir bekämen die Erlaubnis, wenn Sie dem schwedischen Konsulat in Kopenhagen mitteilen könnten, welche Leute mich in Schweden haben wollen.1
Mag ihm an der Vortragsreise viel gelegen sein, Brechts Hauptanliegen ist ohne Zweifel die gesicherte Fahrt nach Schweden, die Matthis mittels seiner „Grenzempfehlungen“ in die Wege leiten soll. Auch nach sechsjährigem Aufenthalt im benachbarten Dänemark und trotz seines Rufs in Schweden ist Brecht auf die Hilfe Wohlgesinnter angewiesen.
In seinem Brief bezieht er sich auf das Vorhaben prominenter Schweden, ein „Nationalkomitee Freies Deutschland“ zu gründen, das jedoch am Beharren der schwedischen Regierung auf ihrer politischen Neutralität im Zweiten Weltkrieg scheitern sollte. Brecht betont das grenzübersteigende Potenzial einer solchen Hilfsorganisation in einer Zeit, die von immer größer werdenden Einschränkungen der Bewegungs- und Gedankenfreiheit gekennzeichnet ist: „Darf ich Ihnen sagen, daß ich Ihre und Herrn Brantings Idee, dieses Komitee zu gründen, jetzt in dieser Zeit, wo jedem freien geistigen Austausch immer mehr ganz mittelalterliche Schranken gesetzt werden, außerordentlich finde?“2 Diesen unzeitgemäßen Einschränkungen, dem Aufwerfen von Grenzen müsse man entschlossen entgegentreten, so Brecht: die Grenze fordert den Menschen heraus und gebietet praktisches Handeln, damit sie überwindbar bleibt. Die Zeit wird kommen, schreibt Brecht in Gedanken über die Dauer des Exils, dann „Wird der Zaun der Gewalt zermorschen / Der an der Grenze aufgerichtet ist / Gegen die Gerechtigkeit“.3
Gegen die Tyrannei der Grenze, die den Ausgestoßenen von Land und Leuten abtrennt, stemmt sich das Briefeschreiben, das im Exil eine Hochkonjunktur erfährt. Brecht selber ist unermüdlicher Briefeschreiber, dessen Briefe in der Regel mit einer Bitte um schnelle Rückmeldung enden. Im Gedicht Zufluchtsstätte, das sein Haus am Skovsbostrand beschreibt, heißt es: „Die Post kommt zweimal hin / Wo die Briefe willkommen wären“.4 Auf über 2000 Seiten erschließen Hermann Haarmann und Christoph Hesse in Briefe an Bertolt Brecht im Exil, 1933–1949 die Korrespondenzflut, die in den Exiljahren auf Brecht zukam und insgesamt etwa 1600 Briefe betrug.5 Durch die häufig undurchsichtige Lage im Exil, die sich auf der Flucht ständig ändernden Postadressen, Störungen im internationalen Postverkehr und die daraus resultierende Drohung der Unzustellbarkeit von Briefen gewinnt das Briefeschreiben im Exil an Bedeutung. Briefe sind außerdem handfest, mitunter sogar intim, in der Handschrift des Senders und gedanklich auf den Empfänger hin verfasst. Somit wohnt Briefen nicht selten eine stellvertretende Kraft inne: Im Briefwechsel sind Schreiber und Empfänger präsent. Bei seiner Ankunft im finnischen Helsinki Anfang Mai 1940 erwarten Brecht zwei Briefe seines Freundes Hans Tombrock, wofür Brecht sich umgehend bedankt und gleichzeitig den hohen Stellenwert des freien Briefverkehrs betont, den er kausal zwingend als gefährdet sieht:
Lieber Tombrock,
besten Dank für die Briefe und Fotos. Deine Briefe waren die ersten und einzigen, die wir hier erhielten, und das gab ihnen etwas Festliches. Ich fürchte, etwas, was bei der ‚Neuordnung Europas‘ abgeschafft werden wird, ist die Post. Ohne ihre Abschaffung bleiben alle Versuche, die Kultur endgültig zu beseitigen, nur halbe Maßnahmen.6
Solange die Möglichkeit zur Korrespondenz besteht, bleiben auch die Grenzen der Barbarei porös, denn im schriftlichen Austausch tauscht sich die Kultur selbst aus. Die „ganz mittelalterlichen Schranken“ zeigen sich somit nicht zuletzt in der modernen Postüberwachung, die mit der europäischen Machtausdehnung des Dritten Reiches einhergeht: die Dichte seiner Außengrenzen manifestiert sich im Abreißen des Briefverkehrs bis hin zur vollständigen Briefstille.
V.Grenzwässer
In Ein Zeitalter wird besichtigt schildert Heinrich Mann rückblickend seine Reise per Zug von Frankfurt am Main nach „Straßburg, geschrieben Strasbourg“,1 mit der sein eigentliches Exil beginnt. Die Reise hätte unscheinbarer nicht sein können, mit Regenschirm, in Begleitung seiner Ehefrau und mit den Gepäckstücken im Netz, doch von der Rheinüberquerung ins benachbarte Frankreich geht erhebliche Symbolkraft aus: „So sieht, will es scheinen, der Rubikon aus. Hinter dem verhängnisvollen Fluß, den ich wähle, liegt das Exil“.2 Der Rhein ist ein Grenzfluss, wie der Rubikon, den Cäsar auf dem Feldzug nach Rom überquerte und von dem es kein Zurück mehr geben sollte: „alea iacta est“.
Während für Mann die Verbannung permanent ist – „Wer Emigrant ist, muß Emigrant bleiben“3 –, betrachtet Brecht das Exil als Provisorium, ein Strohdach, das dem Flüchtling nur kurzzeitig eine Bleibe sein soll. Doch auch ihn trennt das Wasser von der Heimat, der dänische Øresund, dem er in den Exilgedichten große Bedeutung beimisst. Seine Grenze ist eine Wassergrenze, seine Exilstätte ein Haus am Strand einer Insel, wie er auch in seiner Korrespondenz immer wieder erwähnt. So schreibt er 1934 an den Maler George Grosz: „Seit einigen Monaten haust Dein Freund in einem strohgedeckten, länglichen Hause auf einer Insel mit einem alten Radiokasten. Wie so manchen andern hat auch ihn der Zorn des Volkes hinweggespült.“4 Von der braunen Flut vertrieben, bietet ihm der Sund sowohl Schutz vor als auch Nähe zu den Feinden daheim. „Auf, betritt das Schiff“, so lädt er Grosz ein, „Nirgends sitzest Du näher an Deiner Heimat!“5 Das umringende, trennend-verbindende Wasser wird zur tragenden Metapher exilischen Seins, und die Exilinsel bietet dem „Gestrandeten“ Schutz.6 Nun gilt es zu lernen, auch von den Schicksalsgenossen; Schiffbrüchigen, die das Exil auf die Insel verschlagen hat. So auch im Gedicht Bericht über einen Gescheiterten, das schildert, wie der Havarie des Exils Lehrreiches abzugewinnen sei:
Als der Gescheiterte unsere Insel betrat
Kam er wie einer, der sein Ziel erreicht hat
[…]
Aus den Erfahrungen seines Schiffbruchs
Lehrte er uns das Segeln. Selbst Mut
Brachte er uns bei. Von den stürmischen Gewässern
Sprach er mit großer Achtung, wohl
Da sie einen Mann wie ihn besiegt hatten. Freilich
Hatten sie dabei viel von ihren Tricks verraten. Diese
Kenntnis würde aus uns, seinen Schülern
Bessere Männer machen.7
Die Insel erweist sich somit als Ort des Lernens, dessen erkenntniserweiternde Lage von der Nähe zur Grenze bestimmt wird. Wenn nicht sichtbar, so ist sie doch hörbar und stellt eine auditive Verbindung zum Terrorregime in der Heimat her. „Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht!“ heißt es in Über die Bezeichnung Emigranten. „Wir hören die Schreie / Aus ihren Lagern bis hierher“.8 Der Lernende weiß, dass die idyllische Ruhe trügt und sich über den Wässern eine Klanglandschaft des bevorstehenden Krieges ausbreitet: Gedanken über die Dauer des Exils verleiht dieser Klangbühne besonders bildhaft Ausdruck:
Über das gekräuselte Sundwasser
Läuft ein kleines Boot mit geflicktem Segel.
In das Gezwitscher der Stare
Mischt sich der ferne Donner
Der manövrierenden Schiffsgeschütze
Des Dritten Reiches.9
Brecht entflieht den „Schlachtflotten des Anstreichers“10 auf dem Seeweg, über blaue Grenzen hinweg von Dänemark über Schweden und Finnland nach Russland, währenddessen er zurückblickend – wie der Engel der Geschichte seines Freundes Walter Benjamin – die Opfer des Dritten Reiches verzeichnet: „Flüchtend vom sinkenden Schiff, besteigend ein sinkendes – / noch ist in Sicht kein neues –, notiere ich / Auf einen kleinen Zettel die Namen derer / die nicht mehr um mich sind“.11 Unter den Gegangenen ist auch Benjamin, dessen Todesnachricht Brecht kurz zuvor erreicht hatte und dessen Resignation die existenzgefährdende Bedrohung der Grenze betont: „An der unübertretbaren Grenze / Müde der Verfolgung, legte er sich nieder / Nicht mehr aus dem Schlaf erwachte er“.12
VI.Laotses Grenzgang
Brechts wohl bedeutendste literarische Auseinandersetzung mit dem Motiv des Grenzübertritts ins Exil ist die knappe, auf dreizehn Strophen belaufende Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration.1 Brecht hatte bereits 1920 den taoistischen Philosophen kennengelernt, „und der stimmt mit mir so sehr überein, daß er immerfort staunt“.2 Fast zwanzig Jahre später und nun seit über fünf Jahren im dänischen Exil widmet er dem pazifistischen Lehrmeister ein Gedicht, dessen unmittelbarer Gegenwartsbezug hervorsticht, das aber gleichzeitig die Verbannung im „wieder einmal“ als transhistorisches Schicksal darstellt: der Siebzigjährige sieht sich gezwungen, seine Heimat zu verlassen, „Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich / Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu“.3 Das Brecht’sche Exilgebot „Habe nichts“ spiegelt sich in Laotses Grenzgang wider, dessen „Pfeife, die er immer abends rauchte“ stilisierend den Bezug zur eigenen Flucht ins Exil herstellt. Auch hier erweist sich die Grenzüberquerung als Schwellenereignis, das den Grenzgänger herausfordert und ihn zur Stellungnahme auffordert.
Den Dialog mit der Grenze ermöglicht der Zöllner, dessen Aufgabe es ist, in Erfahrung zu bringen, ob „Kostbarkeiten zu verzollen“sind.4 Die Weisheit des Alten, wenn auch kostbar, lässt sich nicht ohne weiteres verdinglichen, doch die Frage des Zöllners gebietet eine Antwort, und so steigt Laotse von seinem Ochsen und erstellt in sieben Tagen, zusammen mit seinem Knaben, die einundachtzig Sprüche, aus denen das Tao Te King, das Buch vom Sinn und Leben, besteht. Wäre da nicht der Zöllner gewesen, hätte es die Grenze nicht gegeben, so hätte der Anreiz zum Niederschreiben der Weisheit gefehlt. Die Grenzüberschreitung hat eine auslösende Kraft und fungiert gleichsam als geburtshelferisches Instrument, dem Rechnung zu tragen ist und Achtung gebührt:
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.5
Die Grenze fordert das Gedankliche an den Tag, macht das Abstrakte konkret und übt im Entreißen und Abverlangen eine produktive Gewalt aus. Die Grenze bewegt, stimmt zur Besinnung und verleiht dieser auch eine Form. „Schreib mirʼs auf!“, ruft der Zöllner. „So was nimmt man doch nicht mit sich fort“.6
Der Exilant ist letztendlich der ultimative Grenzgänger, dessen Grenzerfahrungen lebendig bleiben und immer wieder nach Ausdruck verlangen. Die Grenze reizt zur dauerhaften kritischen Auseinandersetzung, zur krisenbewussten Kritik im Sinne Liessmanns, und wird so zum Wesensmerkmal des Exils. Vor dem Exil liegt die Grenze, doch trägt der Exilant die Grenze auch mit sich in die Verbannung. „Die Grenzpfähle“, so lautet ein 1938 entstandenes Gedichtfragment von Brecht, „Sind zum Herumtragen. / Die da schweigen zu den Schreien der Gequälten / Werden selber schreien und nicht gehört werden“.7
Der „Grenzübertritt“ im Werk Heinrich Manns
Polysemantik und Deutungsperspektiven
Heinrich Mann gilt als Schriftsteller der Widersprüche und Spannungen, die Meinungen über ihn klaffen auseinander. Kaum ein Autor der deutschen Literatur polarisiert in dieser Weise. Das Spektrum der Urteile über sein Werk ruft das Bild eines Grenzgängers zwischen Kunst und Kitsch hervor. Einige Romane von ihm gelten als Meisterwerke, andere werden als Kolportage abgetan. In der Summe seiner politischen Aktivitäten und Positionierungen lassen sich einerseits humane Überzeugungen, frühe und kluge Einsicht in manche fatale Entwicklungen und andererseits verblendete Fehleinschätzungen sowie irrationales Wunschdenken pointiert gegenüberstellen. Heinrich Mann hat persönlich und in seinen Werken Grenzen zwischen den Nationen und Kulturen, zwischen den sozialen Klassen überschritten und thematisiert. Schon daher liegt es nahe, sein Schaffen und Wirken mit dem Begriff des „Grenzübertritts“ sinnbildlich zu charakterisieren. Zugleich hat er als Autor des Exils zahlreiche tatsächliche Grenzübertritte vollziehen müssen, die für ihn existenzielle Bedeutung hatten und die er in seinen Texten reflektiert hat.
Es überrascht daher kaum, dass vom Begriff „Grenze“ abgeleitete Topoi in der Literatur zu Heinrich Mann häufig auftauchen. Die Charakterisierung als Grenzgänger findet sich in Bezug auf zahlreiche Aspekte seiner Persönlichkeit. Doerte Bischoff sieht ihn und seinen Bruder Thomas als „Grenz-Gänger eines Europa-Diskurses“,1 Marcel Reich-Ranicki formuliert, dass Gottfried Benn Heinrich Manns Romantrilogie Die Göttinnen „als etwas gänzlich Neuartiges“ ansah, „einen Vorstoß, der weit über die Grenzen der am Anfang des Jahrhunderts dominierenden erzählenden Prosa (etwa vom ‚Stechlin‘ bis zu den ‚Buddenbrooks‘ von Paul Heyse bis zu Ricarda Huch und Eduard von Keyserling, Emil Strauss und Hermann Hesse) führe und somit den Bereich der Literatur kühn und kraftvoll ausdehne.“2 Reich-Ranicki selbst hingegen attestiert den Göttinnen Nähe zur Trivialliteratur, und da er nur ein paar Zeilen nach der eben zitierten Stelle in seinen Ausführungen schreibt, Heinrich Mann „haperte“ es an „Geschmack“,3 evoziert er unweigerlich die Wortassoziation, dass Heinrich Mann die Grenzen des guten Geschmacks häufig überschritten habe.
Gemäß der Thematik „Grenze als Erfahrung und Diskurs“ möchte ich im Folgenden die persönliche Erfahrung des Grenzübertritts bei Heinrich Mann mit dem Topos der „Grenze“ in seinem literarischen Schaffen im Hinblick auf seine zahlreichen Bedeutungsimplikationen in Beziehung setzen. Anhand von Textstellen aus verschiedenen Schaffensphasen soll exemplifiziert werden, dass in seinem Werk die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Grenze“ in den unterschiedlichsten Facetten auftauchen und sich dabei strukturelle Zusammenhänge aufzeigen lassen.
Inspiration und Ausgangspunkt meiner Ausführungen ist die Schilderung der Flucht über die Pyrenäen in seiner Autobiografie Ein Zeitalter wird besichtigt, die 1946 erstmals erschien. Die Textpassage ist eine Schlüsselszene in seiner Lebensbeschreibung und lässt sich sinnbildlich für seinen Lebensweg und seine Persönlichkeit deuten.
Mann beschreibt ausführlich den wagemutigen Fußweg über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien im Jahr 1940. Im autobiografischen Rückblick rekurriert er auf seine Kindheit, parallelisiert das Geschehen sinnbildlich einerseits als wiederkehrendes Muster seines Lebensnarrativs, als neuen Aufbruch, andererseits stellt er das Bedrohliche, Abweichende dieses Ereignisses heraus, indem er diese Flucht mit Bergwanderungen der Jugend kontrastiert:
Den frischen Wind dieses Morgens fühle ich noch. So kann ich die Luft verschiedener, sehr verschiedener Morgenstunden zurückrufen, wenn ich einst aufbrach und hatte vor Freude nicht geschlafen, oder vor Unruhe nicht, vor Sehnsucht. Oder ich war wundervoll ausgeruht, weil nur das Vertrauenswürdige bevorstand, ein grüner Berg, zweitausend Meter hoch. […] Der kalte Hauch meines Aufbruchs von Marseille befremdete eigentümlich. Ohne weiter zu insistieren, brachte er Nachricht aus künftigen Tagen, die nichts mehr von Belang zu melden hatten.4
Der mehrdeutige Kapiteltitel Über den Berg versinnbildlicht den Berg als Grenze und wirft die Frage auf, ob es im Werk Heinrich Manns raumsemantische Konstanten gibt, also Textstellen, in denen geografische Entitäten wie Berge oder auch Gewässer wie Meere, Flüsse, Seen Grenzen darstellen bzw. symbolisieren und Analogien zu der Textpassage aus seiner Autobiografie aufweisen. Die Rolle des Meeres in seinem Werk wurde von der Forschung bereits hervorgehoben, auch in dieser Passage erscheint es: „Wir ergingen uns am Meeresstrand, zehn Uhr vormittags, in der Meinung bis übermorgen hierzubleiben.“5
Die Erzählung des mühevollen Fußmarsches zur Grenze wird zur Reflexion über Alter und Jugend. Heinrich Mann kann diesen Weg nur mit Hilfe seiner Frau und seines Neffen Golo bewältigen. In der Reflexion über diesen nimmt er Bezug auf das Verhältnis der älteren zur jüngeren Generation und verknüpft den Grenzübertritt mit lebensphilosophischen Überlegungen. Die „Dornen“ auf den Pfaden verweisen nicht nur auf das unwirtliche Gelände, sie stehen in ihrer christlichen Symbolik für den Lebens- und Leidensweg des Exilanten.
Ich erging mich auf meinem Dornenweg noch immer wie Gott in Frankreich. Ob ich die Grenze des anderen Landes in zwei Stunden oder nie mehr überschritt, ich durfte es dem Lauf der Welt anvertrauen.6
In dieser Szene lässt sich die Polysemantik der Grenze im Chronotopos der Flucht über den Berg fassen. Einerseits schildert Mann einen tatsächlichen Grenzübertritt, andererseits verweist er auf die Aufbrüche seiner Jugend. Letztere versinnbildlichen im autobiografischen Kontext die eigenen Anfänge und Lebensziele als Mensch, Schriftsteller und Politiker, den Ausbruch aus bürgerlichen Konventionen, den Einsatz für die Republik, den Kampf gegen den Nationalsozialismus. So liegt es nahe, auch das Lebensmotto Manns als permanenten Aufbruch zu Grenzüberschreitungen zu begreifen. Doch die geschilderte Grenzüberschreitung von 1940 gelingt ihm nur noch mit letzter Kraft. Die Flucht aus Europa vor Hitler wird angesichts der militärischen Erfolge des Deutschen Reichs in einem resignativen Gestus erzählt, der durch die Reflexion über die Gebrechlichkeit des Alters unterstrichen wird.
Analogien zu dieser Textstelle finden sich in der frühen Romantrilogie Die Göttinnen, die Ende 1902 erschien. Die Protagonistin, die dalmatinische Herzogin von Assy, drängt wie der junge Heinrich Mann nach Taten und politischer Umwälzung. Sie zettelt eine politische Revolte an und muss über das Meer nach Italien fliehen:
Noch in der Nacht sollte der Staatsstreich geschehen; stattdessen fand die Nacht sie, mit Mühe der Verhaftung entgangen, weit draußen im Meer.
Ihr Tag hatte im Harem begonnen und in einer Volksrede gegipfelt; sie beschloß ihn auf dem Hinterdeck einer schwerfälligen Segelbarke, allein und flüchtig.7
Die Beschreibung der Fahrt übers Meer weist Ähnlichkeiten mit der Überwindung des Berges in der Autobiografie auf. Einerseits eröffnet das Meer den Weg der Flucht, andererseits birgt es Gefahren, die bewältigt werden müssen. Während der Überfahrt geht der Sohn des Begleiters der Herzogin Pavic spurlos über Bord. Die Bedrohlichkeit der See wird bildlich veranschaulicht:
Einmal, als sie die Augen öffnete, hatte das Meer die Finsternis durchbrochen, von der es gebannt gehalten war. Eine graue Schlange, krümmte es sich um sie her und wollte sie ersticken.8
Wie Heinrich Mann in der Autobiografie ruft die Herzogin während der Überfahrt das Vergangene zurück und zieht die Bilanz ihrer politischen Aktivitäten:
‚Wo die Sonne aufgeht, liegt das Land, das ich verlassen habe. […]‘9
‚Gestern abend beim Einsteigen habe ich noch gelacht. […] Ich weiß nicht einmal, ob ich Feste gab, um eine Revolution anzuzetteln, oder ob ich durch Verschwörung und Umsturz meine Geselligkeit beleben wollte. […]‘10
„Über Schönheit und Stärke ein Reich der Freiheit aufzurichten: welch ein Traum!“11
Die Überfahrt glückt schließlich:
In der Dunkelheit begegneten sie heimkehrenden Fischerbooten. Und endlich landeten sie.
„[…] in die Stadt dürfen wir uns nicht getrauen.“
„Warum nicht?“ meinte sie.
„Hoheit, wir sind politische Flüchtlinge.“
Sie standen ratlos am Strande. […]
Sie wanderten an einer Dorfmauer hin; es war ein Passionsweg darauf gemalt.12
Die Erwähnung des Passionswegs kann hier ähnlich interpretiert werden wie die Dornen in der Schilderung der Überquerung des Berges in der Autobiografie.
Die Flucht übers Meer und der symbolistische Schluss der Roman-Trilogie Die Göttinnen sind sinnhaft miteinander verknüpft. Das Sterben der Herzogin wird unterlegt von einem Bild, mit dem der Maler Jakobus ihren Tod antizipiert und künstlerisch stilisiert, eindeutig eine Anspielung auf Arnold Böcklins Gemälde Die Toteninsel:
Und in der weißen Helle, sah die Herzogin in das plötzlich entschleierte Bild ihrer letzten Verwandlung.
Sie stand im hohen Kahn auf dem Nebelmeer, die Brust flach unter dem fahl gleißenden Panzer, schwarzes Haar am Rande des Helmes, der matt herausschien aus Wolken, und die müde, blasse Hand auf den Schwertknauf gestreckt. Sie war die Jungfrau, die, von allen Gewalten des heißen Lebens verwüstet, im Glanze einer anderen, unangreifbaren Reinheit von dannen fuhr.
Ihr Maler hatte mehr gemalt als ihr Sein und ihr Vergehen. Aus diesem weißen Gesicht, das kühl erhoben über das Leben hinwegsah, grüßten im Verscheiden die großen Träume von Jahrhunderten.13
Die Überschreitung der Grenze zwischen Leben und Tod spielt auch in der 1905 entstandenen Novelle Heldin aus der Sammlung Stürmische Morgen eine zentrale Rolle. Der Text greift wie viele andere Werke des Schriftstellers den kulturellen Gegensatz zwischen nördlich-germanischem und südlich-romanischem Temperament auf. Die Handlung spielt in einer Stadt an einem See in Italien, der unmittelbar die Grenze zum Norden bildet. Der Ort bleibt ungenannt und ist daher als typologische Stilisierung, als Sinnbild der Grenze zu verstehen. Es wird auf die Nähe des Sees zur anderen Seite verwiesen:
„Sehen Sie, Fräulein Lina, am Ende dieser engen, wimmelnden Gasse den Turm, den stillen grauen Wachtturm am Hafen? Seit tausend Jahren steht er dort: hinter sich die Stadt, vor sich den See in seinen blauen Luftschleiern, worin der Umriß des Gebirges sich verstrickt, aus denen sonst, wie aus der Ewigkeit, Feinde auftauchten, und in die sie, abgeschlagen, zurücksanken. Wie viele Geschlechter haben dem alten Wachtturm ihr Heil verdankt. […]“14
Die Novelle unterlegt eine tragisch endende Dreiecksgeschichte zwischen den einheimischen Mädchen Grete und Lina, die unterschiedliche Frauentypen verkörpern, und dem deutschen Studenten Roland. Am Schluss steht der Selbstmord der sensiblen Lina. Der Handlungsort ist von seiner Grenznähe geprägt, „Lastträger, Zolleute, Schiffer“ bestimmen das Stadtbild, „die Finanzwache zerrte einen Schmuggler aus seiner Kajüte hervor“.15 Das hier im Zusammenhang mit der Grenze angesprochene Gebirge weist motivische Ähnlichkeiten zu den Pyrenäen in Ein Zeitalter wird besichtigt auf. Auch ein Gewässer, hier der See, stellt eine Grenze dar. Die Kulisse des Ortes, seine Grenznähe ist in der Komposition nicht zufällig:
Der Scheinwerfer, der die Ufer des Sees nach Schmugglern durchsuchte, schoß von Zeit zu Zeit sein grellweißes Licht durch den Garten. Einmal verweilte es auf Lina; und sie legte die Augen in die Hand und fühlte ihr Gesicht noch heißer werden.
[…]
Wie sie sich geborgen fühlte in der dunklen Flut, unter dem dunklen Himmel.
[…]
Da machte der Strahl des Scheinwerfers eine jähe Wendung und traf grell die Badehütte.16
Das Licht enthüllt ein Stelldichein von Grete und Roland, was auslösendes Moment für Linas Freitod wird.
Ein wesentliches Thema in Heinrich Manns Werk ist die Frage der Grenzüberschreitung im Hinblick auf soziale Klassen und Normen. Cheng Hui-Chun überträgt Lotmanns Raummodell und seinen Grenzbegriff auf den Aufsteigerroman Im Schlaraffenland von 1900:
Im Sinne von Lotmans Raummodell bei der Erzählanalyse wird Andreas Zumsee durch seinen unkonventionellen Charakter zu einer „bewegten Figur“ in dieser sujethaften Erzählung, welche klassifikatorische Barrieren leicht überschreiten kann. Er ist Grenzgänger zwischen der „feinen Gesellschaft“ des Romans und seiner eigenen sozialen Situation. Andreas Zumsee ändert seinen Stand – zuerst infolge der Regie von Köpf und danach auf Anweisung von anderen Schlaraffianern – und steigt von einem besitzlosen Studenten zu einem Mitglied des Schlaraffenlands auf.17
In Professor Unrat (1904) finden sich einige explizite Erwähnungen des Begriffs Grenze, die das Exzessive des Romans als „Grenzübertritte“ in mehrfacher Bedeutung signalisieren:
Da ging Unrat unter in der schwindelnden Panik des Tyrannen, der den Pöbel im Palast und alles verloren sieht. In diesem Augenblick war ihm jede Gewalttat recht, er kannte kaum noch Grenzen.18
Aber er konnte sie [die Schüler] nicht zwingen, schön zu finden, was nach seinem Ermessen und Gebot schön war. Hier war vielleicht die letzte Zuflucht ihrer Widersetzlichkeit. Unrats despotischer Trieb stieß hier auf die äußerste Grenze menschlicher Beugungsfähigkeit … Er ertrug es kaum.19
Die Furcht vor ihrem Treiben [der Schüler] ließ ihm allmählich das Äußerste tunlich und alle zwischen den Menschen gesetzten Grenzen überschreitbar erscheinen.20
Die Frage nach der Überschreitung der „Grenzen des moralisch Zulässigen“ steht im Zentrum einer Gerichtsverhandlung.21
In dem Roman Ein ernstes Leben von 1932, der in Teilen auf die Biografie seiner Freundin und späteren Frau Nelly Kröger zurückgreift, schwingt die soziale Mobilität und der Wunsch nach dem Ausbruch aus bescheidenen Verhältnissen mit; ebenso impliziert die Kriminalhandlung die Überschreitung von sozialen Normen. Der oben skizzierte Bedeutungskontext des Meeres als Grenze lässt sich hier mit der Bedeutung der Grenze im Hinblick auf soziale Klassen und Normen in Beziehung setzen. Die Hauptfigur Marie wächst unter einfachsten Verhältnissen in einem Ort an der Ostsee auf, das Meer symbolisiert in dem Roman Begrenzung, Bedrohung durch die Flut (das Elternhaus wird zerstört) und zugleich den Wunsch nach Flucht und Ausbruch aus den Verhältnissen. Als Marie durch ein wohlhabendes Haus, in dem sie arbeiten soll, geführt wird, heißt es: „Dort aber hing eine Erdkarte, mit allen Meeren – einzig ihretwegen blieb Marie stehen. ‚Was machen Sie denn?‘ fragte Lissie ausnahmsweise verwundert. ‚Ich zeige Ihnen eine ganz große Klasse nach der andern, und hier kieken Sie!‘“22 Der sinnbildliche Charakter dieser Stelle ergibt sich in der Romanhandlung daraus, dass Maries Freund Mingo auf See ist, um vor Strafverfolgung zu fliehen. Als Marie das Haus endgültig verlässt, denkt sie: „Ich gehe noch einmal in das Pingpongzimmer, zu der Karte mit den Weltmeeren.“23 Der Roman zeigt die verschiedenen Bedeutungen des Meeres als Grenze auf: es kann Begrenzung, Bedrohung und zugleich Flucht- und Rettungsweg sein.
Auch wenn der Roman auf Nelly Krögers Herkommen aus einem Ort an der Ostsee Bezug nimmt, ist es im Kontext der Bedeutung des Meeres als Grenze wichtig, auf Heinrich Manns Herkunft aus der Seestadt Lübeck zu verweisen, die gewiss nicht ohne Einfluss auf diese Bildlichkeit gewesen ist.
Die Affinität des Schriftstellers zu Italien und Frankreich verleiht seinem Werk eine weitere Nuance der Grenzüberschreitung. Bereits seine frühen Texte kontrastieren südliche Lebensart und Temperament mit dem nördlichen, deutschen Wesen und Charakter. Dieses Moment wurde in den Ausführungen zur Novelle Heldin bereits erwähnt und trägt konzeptionell den Italien-Roman Zwischen den Rassen (1907), in dem sich eindeutige Bezüge zu seinen brasilianischen Wurzeln mütterlicherseits finden. Mit der französischen Literatur hat er sich in zahlreichen Essays beschäftigt. Die Texte der 1931 erschienenen Sammlung Geist und Tat sind von dem Ideal getragen, die Grenze zwischen Denken und sozialer bzw. politischer Wirkmächtigkeit aufzulösen. In französischen Autoren wie Zola, Flaubert oder Anatole France, ihrem Engagement und ihrer Rezeption, sah Mann diese Synthese nahezu idealtypisch verwirklicht.
Dieser zentrale Ansatz sowie seine Liebe zu Frankreich und südlicher Lebensart finden Ausdruck in seinem opus magnum, den beiden voluminösen Romanen (Die Jugend des Königs Henri Quatre, 1935; Die Vollendung des Königs Henri Quatre, 1938) um den französischen König Heinrich IV. Das im Exil entstandene, vielschichtige historische Epos beschwört am Beispiel des guten Königs das Ideal von „Geist und Tat“, zugleich zeigt es die Grenzen seiner Verwirklichung auf. Der Text verweist auf die Historie und spiegelt zugleich die Gegenwart, stellt fundamentale herrschaftstheoretische und -soziologische Fragen, lässt auch Lebensgefühl, Autobiografisches und Wunschdenken des Autors einfließen. Sein Bruder Thomas schrieb in einem Brief vom 2. März 1939: „Résumé Deines Lebens und Deiner Persönlichkeit.“24 Schauplatz ist das Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts im Zeitalter der Glaubenskriege, das Züge einer Heterotopie in der Vergangenheit trägt. In diesem Erzähl-Chronotopos wird das Leben Heinrichs IV. geschildert. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit Grenzen in der räumlichen Strukturierung des Romans signifikant sind und welche übertragenen Bedeutungen der Begriff der Grenze im Roman annimmt.
Als Summe des Lebens und Werks seines Autors finden sich in den beiden Romanen zahlreiche Anknüpfungspunkte und Verbindungslinien zu den hier aufgezeigten Aspekten, die in der Komplexität der Texte unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten eröffnen. Auffallend ist, dass der Begriff der Grenze in den beiden Romanen an zentralen Textstellen wörtlich erscheint.
Als Sohn des katholischen Königs von Navarra Anton von Bourbon und der protestantischen Jeanne d’Abret personifiziert Heinrich IV. das heikle Verhältnis der Konfessionen im damaligen Frankreich. Sein Leben ist von zahlreichen Wechseln zwischen katholischem und protestantischem Bekenntnis gezeichnet. Im Roman symbolisiert eine Szene aus der Kindheit Heinrichs antizipierend, wie er schon sehr früh in dieses Spannungsfeld gerät:
[E]inige protestantische Herren erschienen darin und verkündeten, der Admiral Coligny sei im Hause, […]. Der König von Navarra sogar neigte den Kopf vor diesem alten Mann und damit auch vor der Partei, die er führte. […]
Der zweite der Pastoren stimmte einen Choral an. […] Denn wo sangen sie so laut, wo behaupteten sie dreist ihre Sache? Im eigenen Hause der Könige von Frankreich! Sie konnten es wagen, sie wagten es!
Coligny erhob mit beiden Armen den Prinzen von Navarra [Henri] über alle Köpfe, er ließ ihn dort einatmen für sein Leben, was vorging, was diese alle waren. […]
Dies alles waren recht gefährliche Überschreitungen der erlaubten Grenzen, Jeanne sah es nachher von selbst ein, ihr Gatte brauchte sie nicht lange zu warnen.25
Ein merkwürdiger Besucher, der sich am Schluss der Szene als der legendäre Astrologe Nostradamus entpuppt, sieht Heinrich visionär als kommenden König und Einheitsstifter:





























