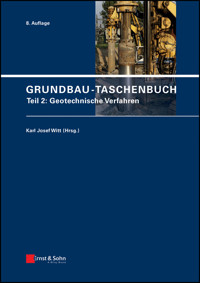
Grundbau-Taschenbuch E-Book
160,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Grundbau-Taschenbuch ist das bekannteste und umfangreichste deutschsprachige Kompendium auf dem Gebiet der Geotechnik und hat seit über 60 Jahren zum Ziel, Entwicklungen, neue Erfahrungen und Erkenntnisse, aktuelle und neue Berechnungs- und Nachweismethoden für die Belange der Baupraxis umfassend zusammenzutragen und transparent zu vermitteln. Für die 8. Auflage wurde es umfassend überarbeitet und aktualisiert. Der zweite Teil des Grundbau-Taschenbuches behandelt die geotechnischen Verfahren mit ihren Berechnungs- und Nachweismethoden: Erdbau, Baugrundverbesserung, Injektions- und Ankertechnik, Bodenvereisung, Horizontalbohrungen und Rohrvortrieb, Rammen und Bohren, Grundwasserhaltung, geotechnisches Erdbebeningenieurwesen sowie Geokunststoffe im Erd- und Grundbau. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel über hydraulisch bedingte Grenzzustände.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Vorwort
Autoren-Kurzbiografien
Verzeichnis der Autoren
2.1 Erdbau
1 Einleitung
2 Regelwerke – Normen und Richtlinien
3 Begriffe
4 Einschnitte
5 Erd- und Steinschüttdämme
6 Erd- und Dammbaustoffe
7 Erdarbeiten
8 Bodenbehandlung mit Bindemitteln
9 Qualitätssicherung und Prüfungen
10 Literatur
11 Anhang: Erläuterung der Kurzzeichen für die Bodenklassifizierung
2.2 Baugrundverbesserung und Injektionen
1 Einleitung und Überblick
2 Statische Verdichtung und Entwässerungsverfahren
3 Dynamische Verdichtung
4 Bewehrung des Baugrunds ohne verdrängende Wirkung
5 Bewehren des Baugrunds mit verdrängender Wirkung
6 Literatur
2.3 Verstärkung von Gründungsstrukturen
1 Einleitung
2 Grundsätzliche Überlegungen
3 Unterfangung und Nachgründung
4 Verstärkung von Gründungsstrukturen
5 Schlussbemerkungen
6 Literatur
7 Zitierte Regelwerke
2.4 Bodenvereisung
1 Verfahrensprinzip und Anwendungen
2 Vereisungsverfahren
3 Frostausbreitung
4 Mechanisches Verhalten gefrorener Böden
5 Eigenschaften von Eis
6 Frostwirkungen
7 Hinweise zur Berechnung von Frostkörpern
8 Verwendete Zeichen und Symbole
9 Literatur
2.5 Verpressanker, Bodennägel und Zugpfähle
1 Verpressanker
2 Bodenvernagelungen
3 Anker und Nägel im Tunnel- und Bergbau
4 Zugpfähle
5 Literatur
2.6 Bohrtechnik
1 Einführung
2 Trockenbohrverfahren
3 Spülbohrverfahren
4 Kernbohren
5 Geothermiebohrungen
6 Bohrverfahren für den Baugrundaufschluss
7 Sonderbohrverfahren
8 Literatur
2.7 Horizontalbohrungen und Rohrvortrieb
1 Einleitung
2 Horizontalbohrungen
3 Rohrvortrieb
4 Grabenlose Erneuerung von Leitungen
5 Literatur
2.8 Einbringverfahren für Pfähle und Spundbohlen: Rammen, Vibrieren, Pressen
1 Anwendung von Ramm- und Ziehverfahren
2 Einbringgut
3 Geräte
4 Einbringtechnik
5 Einbringen von Spundbohlen
6 Ziehen
7 Geotechnische Aspekte
8 Literatur
2.9 Grundwasserströmung – Grundwasserhaltung
1 Grundwasserhydraulik
2 Ermittlung geohydraulischer Parameter
3 Grundwasserhaltung
4 Literatur
2.10 Hydraulisch bedingte Grenzzustände
1 Einleitung
2 Geohydraulische Grundlagen
3 Hydraulische bedingte Grenzzustände
4 Schlussbemerkung
5 Literatur
2.11 Geotechnisches Erdbebeningenieurwesen
1 Einleitung
2 Seismologische Grundlagen
3 Parameter der seismischen Bodenbewegung
4 Erdbebengefährdung und Erdbebenkarten
5 Einfluss der Standortverhältnisse
6 Berechnung der seismischen Bodenantwort
7 Böschungen und Erddämme
8 Verflüssigung
9 Erddruck auf Stützbauwerke
10 Literatur
2.12 Geokunststoffe in der Geotechnik und im Wasserbau
1 Allgemeines
2 Grundlagen und Begriffe
3 Einsatzbereiche
4 Vertragsgestaltung
5 Schlussbemerkung
6 Literatur
Stichwortverzeichnis
Inserentenverzeichnis
Wiley Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
List of Tables
2.1 Erdbau
Tabelle 1 Anforderungen an Erdbauwerke in Abhängigkeit vom Bauwerkstyp (nach [29])
Tabelle 2 Maximal möglicher Böschungswinkel β in Abhängigkeit vom Reibungswinkel φ′ und der Standsicherheitszahl N
1
(Grenzgleichgewicht) (nach [56])
Tabelle 3 Böschungsneigungen für Entwurfsböschungen in Lockergesteinen bei verschiedenen Böschungshöhen (nach [14])
Tabelle 4 Empfehlungen für Böschungsneigungen in Abhängigkeit von der Bodenart und der Böschungshöhe h (nach [22])
Tabelle 5 Böschungsneigungen in nichtbindigen Böden von mindestens mitteldichter Lagerung (nach [49])
Tabelle 6 Böschungsneigungen bei Einschnitten in gewachsenen bindigen Böden und bei Dämmen aus verdichteten bindigen Böden von mindestens steifer Konsistenz (nach [49])
Tabelle 7 Böschungsneigungen für Einschnitte in natürlich gewachsenen grobkörnigen, gemischtkörnigen und feinkörnigen Böden für homogene Untergrundverhältnisse, ohne Wasserdruck und ohne äußere Einwirkungen (Richtwerte nach [8])
Tabelle 8 Regelneigungen in Lockergesteinsböschungen an Eisenbahnstrecken (Dämme, Einschnitte) (nach [119])
Tabelle 9 Übersicht über gängige Sicherungsmethoden von Böschungen (nach [96])
Tabelle 10 Anforderungen an die Korngrößenverteilung grobkörniger Böden (nach [124])
Tabelle 11 Anforderungen an die Korngrößenverteilung gemischtkörniger Böden (nach [124])
Tabelle 12 Anforderungen an die Korngrößenverteilung und an die plastischen Eigenschaften von feinkörnigen Böden (nach [124])
Tabelle 13 Anwendungsmöglichkeiten von Boden bzw. Bodenmaterial
1)
ohne und mit Fremdbestandteilen (nach [98])
Tabelle 14 Klassifikation von Bodengruppen nach der Frostempfindlichkeit (nach [130])
Tabelle 15 Bewertung der Lockergesteine als Dammbaustoffe (nach [50])
Tabelle 16 Zustandsformen in Abhängigkeit von der Konsistenzzahl I
C
bzw. der Liquiditätszahl I
L
(nach [62])
Tabelle 17 Beziehung zwischen D
Pr
und I
D
(nach [22])
Tabelle 18 Näherungsweise Zuordnung der Verformungsmoduln E
v2
und E
vd
[MN/m
2
] in Abhängigkeit vom Verdichtungsgrad grobkörniger Böden (nach [130])
Tabelle 19 Beispiel für einen Ausschreibungstext nach der DIN 18300 für einen Homogenbereich „Schluffige Sande“ (nach [31])
Tabelle 20 Phasen der Beschreibung und Klassifizierung gemäß DIN EN 16907-2 (nach [90])
Tabelle 21 Merkmale zur Einstufung eines Erddamms in eine Geotechnische Kategorie (nach [61])
Tabelle 22 Aufschlussarbeiten zur Erkundung des Baugrunds eines Staudamms (nach [35])
Tabelle 23 Eigenschaften von Böden in Abhängigkeit von der Bodengruppe (nach [41])
Tabelle 24 Anforderungen an den Verdichtungsgrad D
Pr
nach ZTV E-StB 09 für den Unterbau von Dämmen und Untergrund von Einschnitten (nach [47])
Tabelle 25 Anforderungen an das 10%-Mindestquantil des E
v2
-Werts auf dem Planum bei frostsicherem Untergrund bzw. Unterbau (nach [95] und [130])
Tabelle 26 Anforderungen an das 10%-Mindestquantil des E
vd
-Werts auf dem Planum bei frostsicherem Untergrund bzw. Unterbau (nach [130])
Tabelle 27 Anforderungen an die Verdichtung für Erdbauwerke von Eisenbahnen (nach [119])
Tabelle 28 Anforderungen an den Verformungsmodul für Erdbauwerke von Eisenbahnen (nach [119])
Tabelle 29 Mindestanforderung an die Verdichtung in Österreich (nach [120])
Tabelle 30 Übersicht über für verschiedene Materialarten geeignete Verdichtungsgeräte (nach [91])
Tabelle 31 Anhaltswerte für den Einsatz von Verdichtungsgeräten (nach [95])
Tabelle 32 Betriebszustände einer Vibrationswalze (nach [5])
Tabelle 33 Reaktionszeiten von Bindemitteln in Stunden (nach TP BF-StB – B 11.1 [127])
Tabelle 34 Erfahrungswerte zur Stabilisierung mit Mischbindern (nach
Witt
, aus [59])
Tabelle 35 Erfahrungswerte für Bindemittelmengen für Bodenverfestigungen (nach TP BF-StB – B 11.1 [127])
Tabelle 36 Maximal Zulässige Verarbeitungszeiten von Bindemittel in Stunden (nach [103])
Tabelle 37 Erfahrungswerte von Bindemittelmengen für Bodenverfestigungen (TP BF-StB – B 11.1 [127])
Tabelle 38 Erfahrungswerte von Bindemittelmengen für Bodenverbesserungen (TP BF-StB – B 11.3 [128])
Tabelle 39 Übersicht über Prüfverfahren gemäß der RVS 08.03.01 [120]
Tabelle A-1 Gegenüberstellung der Kurzzeichen auf deutscher und europäischer Ebene
Tabelle A-2 Kurzzeichen für die Bodenklassifizierung gemäß DIN EN 16907-2 [90] in deutscher Sprache
Tabelle A-3 Kurzzeichen für die Bodenklassifizierung gemäß DIN EN 16907-2 [90] in englischer Sprache
Tabelle A-4 Angabe der Haupt- und Nebenbestandteile gemäß DIN EN ISO 14688-2 [75]
2.2 Baugrundverbesserung und Injektionen
Tabelle 1 Methoden der Baugrundverbesserung
Tabelle 2 Übersicht über Vertikaldrän-Typen
Tabelle 3 Richtwerte für die Festigkeitseigenschaften von Sand (nach [83])
Tabelle 4 Erfahrungswerte K
3
, K
4
(nach [68])
Tabelle 5 Tiefeneinmischverfahren, unterschieden nach dem Mischungsprozess (aus [89], modifiziert)
Tabelle 6 Richtwerte für die verschiedenen europäischen Tiefeneinmischverfahren (nach DIN EN 14679, modifiziert)
Tabelle 7 Charakteristische Entscheidungskriterien für die Verfahrensauswahl „trocken“ oder „nass“ (nach [164], teilweise modifiziert)
Tabelle 8 Typische mit dem Nassverfahren erzielbare Festigkeiten und Durchlässigkeiten für unterschiedliche Böden und Zementgehalte (aus [164])
Tabelle 9 Anhaltswerte für Durchmesser von Säulen in Sand und Ton, die nach dem 3-Phasen-System hergestellt wurden (nach [23])
Tabelle 10 Anhaltswerte für Durchmesser von Säulen in Sand und Ton, die nach der Super-Jet-Methode hergestellt wurden [23]
2.4 Bodenvereisung
Tabelle 1 Technische Daten von Stickstoff
Tabelle 2 Eingangswerte zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit nach [33]
Tabelle 3 Thermische Kennwerte (Anhaltswerte)
Tabelle 4 Versuchsergebnisse aus einaxialen Kriechversuchen an gesättigtem Mittelsand [51]
Tabelle 5 σ
α
-Werte für alle Temperaturen
Tabelle 6 Klassifikation der Frostempfindlichkeit von Bodengruppen [74]
2.5 Verpressanker, Bodennägel und Zugpfähle
Tabelle 1 Gebräuchliche Zugglieder für Einstab-Verpressanker
Tabelle 2 Gebräuchliche Zugglieder für Litzenanker
Tabelle 3 Korrosionsschutz bei Kurzzeit- und Dauerankern
Tabelle 4 Übliche Ankerbohrverfahren
Tabelle 5 Bauarten von Ankern
Tabelle 6 Anhaltswerte für die Gebrauchsmantelreibung cal τ
M
von Felsankern in MN/m
2
für verschiedene Felsarten (nach
Ostermayer
[24])
Tabelle 7 Prüfungen an Ankern
Tabelle 8 Tragfähigkeitsnachweise durch Eignungs- und Abnahmeprüfung
Tabelle 9 Laststufen und Mindestbeobachtungszeiten für Eignungsprüfungen nach DIN SPEC 18537:2012-02 (Tabelle G.2)
Tabelle 10 Beobachtungszeiten, zulässige Verschiebungen und Kriechmaße bei der Prüfkraft P
P
von Eignungsprüfungen
Tabelle 11 Laststufen und Mindestbeobachtungszeiten für Abnahmeprüfungen
Tabelle 12 Einwirkungen und Widerstände
Tabelle 13 Liste der Zugglieder aus Stahl B500B GEWI und S 555/700 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Tabelle 14 Daten von Zuggliedern System DYWI DRILL
Tabelle 15 Tragfähigkeitsnachweise für vernagelte Stützkonstruktionen
Tabelle 16 Gebräuchliche Stahltragglieder für GEWI-Verpresspfähle
Tabelle 17 Mindestmaße der Betondeckung des Stahltragglieds (in Anlehnung an Tabelle 1 DIN 4128)
Tabelle 18 Pfahlkräfte und Mindestbohrlochdurchmesser
Tabelle 19 Tragglieder Ischebeck TITAN
2.6 Bohrtechnik
Tabelle 1 Drehbohrgeräte von Bauer (Auszug)
Tabelle 2 Drehbohrgeräte von Liebherr (Auszug)
Tabelle 3 Anwendbarkeit verschiedener Bohrverfahren
Tabelle 4 Beherrschbarkeit besonderer Vorkommnisse [3]
2.7 Horizontalbohrungen und Rohrvortrieb
Tabelle 1 Liste der Eigenschaften und Kennwerte für Homogenbereiche in Boden
Tabelle 2 Liste der Eigenschaften und Kennwerte für Homogenbereiche in Fels
2.8 Einbringverfahren für Pfähle und Spundbohlen: Rammen, Vibrieren, Pressen
Tabelle 1 Schlossformen warmgewalzter Spundbohlen [58]
Tabelle 2 Herstellparameterempfehlung für das Vibrationsrammen in Abhängigkeit des anstehenden Bodens [51]
Tabelle 3 Einfluss verschiedener Herstellparameter während des Vibrationsrammens auf den Mantel- und Fußwiderstand in granularen und kohäsiven Böden [66]
Tabelle 4 Feldversuch Altenwalde: Angaben zur Installation der sechs Testpfähle
Tabelle 5 Regressionsparameter für die Bestimmung der Boden- und Fundamentschwinggeschwindigkeit beim Rammen [75]
Tabelle 6 Regressionsparameter für die Bestimmung der Boden- und Fundamentschwinggeschwindigkeit beim Vibrieren [75]
Tabelle 7 Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit v
i
zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Schütterungen auf Bauwerke nach DIN 4150-3 [17]
2.9 Grundwasserströmung – Grundwasserhaltung
Tabelle 1 Kapillare Steighöhen (nach [3])
Tabelle 2 Gesamtporosität und effektive Porosität für Lockergesteine (nach [4])
Tabelle 3 Abhängigkeit der Dichte und der Zähigkeit reinen Wassers von der Temperatur (nach [3])
Tabelle 4 Brunnenfunktion W(u) für 0,01 ≤ u < 10
Tabelle 5 Typische Durchlässigkeitsbeiwerte k für verschiedene Bodenarten
Tabelle 6 Ansätze zur Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwerts aus der Kornverteilung
Tabelle 7 Korrekturfaktor unter Einrechnung der Ungleichförmigkeit U = d
60
/ d
10
(nach
Beyer
)
Tabelle 8 Korrekturfaktoren χ
10
bzw. χ
25
nach
Seiler
für 5 ≤ U ≤ 100
Tabelle 9 Diagnose von hydraulischen Randbedingungen und Aquifertypen anhand des typischen Verlaufs der Bourdet-Ableitung (Beispiele)
Tabelle 10 Formfaktoren und Bestimmungsgleichungen für den Durchlässigkeitsbeiwert k für gebräuchliche Versuchsanordnungen und Aquiferverhältnisse (verändert, nach
Thompson
[61])
Tabelle 11 Bodenarten, Körnungen, Durchlässigkeitsbeiwerte, Entwässerungsmöglichkeiten, anfallende Wassermengen (nach [71])
Tabelle 12 Filtersande und -kiese nach DIN 4924 [86]
Tabelle 13 Reibungsverluste in Formstücken (nach [12])
Tabelle 14 Ermittlung der anfallenden Wassermenge [m
3
/ h] in Abhängigkeit der Durchlässigkeit und der Absenktiefe [89]
Tabelle 15 Ermittlung der erforderlichen Filterüberdeckung [89]
2.10 Hydraulisch bedingte Grenzzustände
Tabelle 1 Filterkriterien für fein- und gemischtkörnige Basiserdstoffe [74]
Tabelle 2 Klassifizierung von Bodenarten hinsichtlich des Erosionswiderstands nach dem ICOLD Bulletin 164 (Entwurf) [36]
Tabelle 3 Untergrenzen des Kriechfaktors C nach
Bligh
[5] und
Lane
[46]
2.11 Geotechnisches Erdbebeningenieurwesen
Tabelle 1 Werte der Parameter zur Beschreibung des elastischen horizontalen Antwortspektrums, Tabelle NA.4 [20]
2.12 Geokunststoffe in der Geotechnik und im Wasserbau
Tabelle 1 Empfohlene Dicke einer geotextilen Schutzschicht in Abhängigkeit vom beanspruchenden Boden für Kunststoffdichtungsbahnen mit einer Dicke von mindestens 2 mm nach [110].
Tabelle 2 Anwendungsmöglichkeiten von Geotextilien im Staudammbau [64]
Tabelle 3 Mindestanforderungen an geosynthetische Tondichtungsbahnen nach [69] bzw. [85]
Tabelle 4 Beurteilung von Eigenschaften für die Auswahl geeigneter Produkte (nach [109], aus [160])
Tabelle 5 Beurteilung von Eigenschaften für die Auswahl geeigneter Produkte (nach [109], aus [160])
List of Illustrations
2.1 Erdbau
Bild 1 Anwendungsbereiche und Abgrenzung des Erdbaus (nach [29])
Bild 2 Begriffe im Erdbau nach ZTV E-StB 09 [130]
Bild 3 Begriffe im Erdbau gemäß RVS 08.03.01 [120]
Bild 4 Gliederung des Oberbaus im Eisenbahnwesen in Deutschland (nach [23])
Bild 5 Ermittlung des maximal möglichen Böschungswinkels β (nach [52] gemäß Tabelle 2 [56])
Bild 6 Diagramm der Böschungsneigungen für Lockergesteine in Abhängigkeit der Bodengruppe und der Böschungshöhe (nach [14]) (maximal: I″, II″,…; minimal: I″, II″,… -Neigungen)
Bild 7 Böschungsgleiten bzw. hangparalleles Gleiten (kohäsionsloser Boden, keine hangparallele Durchströmung) – Böschungsneigung in Abhängigkeit vom wirksamen Reibungswinkel unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte gemäß ÖNORM B 1997-1-1 [104] (nach [8])
Bild 8 Böschungsgleiten bzw. hangparalleles Gleiten (kohäsionsloser Boden, hangparallele Durchströmung) – Böschungsneigung in Abhängigkeit vom wirksamen Reibungswinkel unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte gemäß ÖNORM B 1997-1-1 [104] (nach [8])
Bild 9 Rechenmodell – beliebiger Boden (Kohäsion c′ ≠ 0 und Reibungswinkel φ′ ≠ 0), geneigtes Gelände (Geländeneigung β) und ebene, nicht böschungsparallele Gleitfläche (Neigung der Gleitfläche ϑ) (nach [8])
Bild 10 Freie Standhöhe (kohäsiver Boden, kein Wasser) – Bezogene Kohäsion c/(γ · h) in Abhängigkeit von der Geländeneigung β für einen Reibungswinkel φ von 18° bis 42° (in 2°-Stufen) (nach [8])
Bild 11 Beispiele für a) einen Kompaktlader, b) einen Kleinlader auf Rädern und c) einen Großlader auf Rädern (adaptiert nach [34])
Bild 12 Beispiel für a) eine Planierraupe und b) einen Doppelmotor-Scraper mit Push-Pull-Einrichtung (adaptiert nach [34])
Bild 13 Erdbaumaschinen zum Lösen, Laden, Transportieren und Planieren (nach [47]);
Bild 14 Einaxiale Druckfestigkeit eines Tonschiefers in Abhängigkeit von der Belastungsrichtung zur Schieferung (nach [45])
Bild 15 Standsicherheitsnachweis eines Gleitkörpers auf einer ebenen Gleitfläche (nach [4])
Bild 16 Ausbildung von Felsböschungen in Abhängigkeit von Böschungshöhe und Felsgruppenzugehörigkeit nach
Brandecker
(nach [14])
Bild 17 Böschungsgestaltung und Sicherung in Anpassung an das bestehende Felsgefüge (nach [14]); a) Einfallen der Haupttrennflächen mit 0 – 15°, keine Anpassung; b) 15 – 30°, keine Anpassung, jedoch Sicherung des Trennflächenhangs; c) 30 – 45°, Anpassung der Böschung an das Felsgefüge oder umfangreiche Sicherung des Trennflächenhangs; d) 45 – 60°, Anpassung der Böschung an das Felsgefüge, nur in Sonderfällen Sicherung des Trennflächenhangs; e) 45 – 75°, Anpassung der Böschung an das Felsgefüge, Sicherung des Trennflächenhangs; f) 75 – 90°, Anpassung der Böschung an das Felsgefüge und beidseitige Sicherung der Hänge
Bild 18 Gefügebedingte Felsböschungen (nach [14]); a) geneigtes Einfallen mit der Möglichkeit einer hängenden Abtreppung, b) steiles Einfallen mit Abtreppung oder Berme, c) steiles Schichtfallen mit zwei Varianten für die mögliche Abtreppung – hängende Abtreppung ist erst nach einer Standsicherheitsuntersuchung zulässig, d) Varianten für eine Treppenböschung
Bild 19 Liebherr Planierraupe mit Parallelogrammaufreißer (nach [36])
Bild 20 Liebherr Planierraupe mit Schwenkaufreißer (nach [36])
Bild 21 Anordnung der Bohrlöcher beim Abspalten (nach [49], gemäß [94])
Bild 22 Anordnung der Bohrlöcher beim Abkerben (nach [49], gemäß [94])
Bild 23 Sprengen eines Felseinschnitts mit senkrechten oder böschungsparallelen Bohrlöchern (nach [58])
Bild 24 Beispiel für die Oberflächen- und Grundentwässerung bei einem halb eingeschnittenen/halb aufgeschütteten Profil (nach [89])
Bild 25 Beispiele für die Ausführung einer Oberflächenentwässerung bzw. oberflächennahe Entwässerung (nach [22]); a) Filterschicht auf der Böschung aus Sand oder Kies bei starkem Wasserandrang, b) Sickerschlitze bzw. Sickerstützscheiben
Bild 26 Beispiele ingenieurbiologischer Sicherungsmaßnahmen: Hangfaschinen, Hangbepflanzung, Rautengeflecht und Lagenbau (nach [21]); a) Hangfaschinen, b) Hangbepflanzung, c) Rautengeflecht mit Weidenflechtzaun, d) Lagenbau (lebend bewehrte Erde)
Bild 27 Beispiele ingenieurbiologischer Sicherungsmaßnahmen: Pilotenwand, Hangrost und Holzkrainerwand (nach [21]); a) bepflanzte Pilotenwand, b) lebender Hangrost an steilen Hängen, c) doppelwandige, bepflanzte Holzkrainerwand als Stützverbauung
Bild 28 Beispiele gebräuchlicher Sicherungsmaßnahmen bei Felsböschungen (nach [14])
Bild 29 Anwendungsgebiete des Dammbaus (ergänzt und adaptiert nach [50])
Bild 30 Charakteristische Dammquerschnitte (nach [50]); a) Eisenbahndamm, b) Straßendamm, c) Staudamm, d) Kanaldamm, e) Deich, f) Deponiedamm
Bild 31 Deponietypen (nach
Striegler
[50]);
Bild 32 Anforderungen an Verkehrswege (nach [3])
Bild 33 Innerhalb eines Instandhaltungszyklus hinnehmbare Setzungsdifferenzen bei Schottergleisen (nach [119])
Bild 34 Beispiele von Regelausbildungen des Unterbaus P300 – Damm; a) Schotteroberbau, b) Feste Fahrbahn (nach [46])
Bild 35 Typische Kornverteilungskurven geeigneter (durchgehende und gestrichelte Linien) und bedingt geeigneter Dammbaustoffe (punktierte Linien) (adaptiert nach [3])
Bild 36 Prinzipskizzen verschiedener
Bild 37 Beispiel für einen Steinschüttdamm mit Oberflächendichtung auf einer Filterschicht (nach [29])
Bild 38 Grenzkornverteilungskurven von Dammbaustoffen (nach [38])
Bild 39 Beispiel für einen Hochwasserschutzdamm (nach [7])
Bild 40 Mögliche Versagensmechanismen bei Hochwasserschutzdämmen (nach [7]), a) Überströmen des Dammes (Erosionsbruch), b) Böschungsbruch infolge Sickerwasser, c) Hydraulischer Grundbruch infolge Auftrieb (Aufschwimmen), d) Hydraulischer Grundbruch infolge Erosion/Suffosion
Bild 41 Möglichkeiten zur Sanierung von bestehenden Hochwasserschutzdämmen (nach [6])
Bild 42 Prinzipskizzen mit Konstruktionsvarianten von Hochwasserdeichen (nach [39])
Bild 43 Prinzipieller Aufbau eines mit Geokunststoffen bewehrten Damms (nach [2])
Bild 44 Beispiel für einen Schutzdamm mit den maßgebenden Einwirkungen, sowie Versagensmechanismen (nach
Hofmann
aus [48])
Bild 45 Konstruktive Maßnahmen für neue Abfalldeponien (nach [28])
Bild 46 Beispiel eines Basisabdichtungssystems mit einer Kombinationsdichtung (nach [16])
Bild 47 Beispiele für das Versagen durch Böschungsbruchmechanismen (nach [29]); a) gleitkreisförmige Versagensflächen, b) hangparallele Gleitflächen, c) ebene Gleitflächen, d) Bruchmechanismen aus mehreren Gleitblöcken
Bild 48 Beispiele für das Versagen durch mechanischen Grundbruch (nach [29]); a) gleitkreisförmige Versagensflächen mit Grundbruch, b) Grundbruch am Dammfuß
Bild 49 Beispiel des Ansatzes einer zusammengesetzten Gleitfläche (nach
Terzaghi
[53])
Bild 50 Beispiele für das Versagen durch Gleiten auf der Aufstandsfläche (nach [29]); a) Abgleiten des Damms, b) Dammfußgleiten durch Spreizdruck
Bild 51 Einheitswürfel (nach [6])
Bild 52 Kurven gleichen Sättigungsgrads S
r
und gleichen Luftporengehalts n
a
(nach [6])
Bild 53 Auswertung des Proctorversuchs, Standard-Proctorversuch und modifizierter Proctorversuch (nach [6])
Bild 54 Typische Proctorkurve mit Darstellung der Verteilung von Feststoff und Porenraum mit entsprechendem Wasser- und Luftporenanteil anhand des Einheitswürfels (nach [29])
Bild 55 Typische Proctorkurven für grobkörnige, gemischtkörnige, feinkörnige Böden (nach [29])
Bild 56 Typische Proctorkurven für verschiedene Bodenarten (nach [22])
Bild 57 Typische Proctorkurven für einen bindigen Boden mit unterschiedlichen Bindemittelgehalten (nach [29])
Bild 58 Proctorkurve und Verformungsmodul (nach
Göbel
et al. [23])
Bild 59 Zusammenhänge bei der Verdichtung (aus [27], nach
Lang
et al. (2011) adaptiert)
Bild 60 Beispiel zur Bildung von Homogenbereichen (nach [43])
Bild 61 Vorgehensweise zu Bodenklassifikation gemäß ÖNORM B 2205 (nach [105])
Bild 62 Übersicht der Regelwerke für Böden mit Fremdbestandteilen (nach [98])
Bild 63 Definition der Untersuchungstiefe z
a
und der Bauwerkshöhe h gemäß Eurocode 7 [78];
Bild 64 Anforderungen an die 10%-Mindest- bzw. Höchstquantile der Verdichtungskennwerte mit und ohne Verbesserung oder Verfestigung des Untergrunds oder Unterbaus (nach [95])
Bild 65 a) Glattmantelbandage [26], b) Stampffußbandage [26], c) Polygonbandage [13] (nach [6])
Bild 66 Anregung der Bandage einer Vibrationswalze. Die in der Achse angeordnete Unwuchtmasse erzeugt eine kreisförmig translatorische Schwingung (nach [5])
Bild 67 Vario-Bandage mit manuell oder automatisch verdrehbarer Richtschwingereinheit, vertikal (große Amplitude), schräg (kleine Amplituden), horizontal [33]
Bild 68 Anregung der Bandage einer Oszillationswalze. Zwei punktsymmetrisch angeordnete Unwuchtmassen erzeugen durch gleichsinnige Rotation eine Momentenwirkung um die Achse und damit eine rotatorische Schwingung der Bandage (nach [5]).
Bild 69 Hinterfüllung bei Aushub im gewachsenen Boden bzw. bestehenden Damm ohne Schleppplatte (gemäß der RVS 08.03.01 [120])
Bild 70 Regelquerschnitt für einen Lärmschutzwall (nach [22])
Bild 71 Anwendungsgrenzen von Bindemitteln zur Bodenstabilisierung in Abhängigkeit von der Korngrößenverteilung (aus [6], nach
Brandl
(2006) adaptiert)
Bild 72 Einfluss der Kalkstabilisierung auf die Verdichtbarkeit, a) Trockendichte und optimaler Wassergehalt (Proctorkurven) sowie b) Änderung des Reibungswinkels durch Zugabe von Kalk (nach [15])
Bild 73 Bodenreaktion;
Bild 74 Modell für synergetische Wirkungsweise von Mischbindern; a) Anfangsphase und b) Stabilisierungsphase (aus [59])
Bild 75 Übersicht über punktuelle Verdichtungsmethoden (nach [6])
Bild 76 Komponenten des Leichten Fallgewichtsgeräts (nach [1])
Bild 77 Bodenkontaktspannung, Verschiebung und Arbeitsdiagramm der Lastplatte des Leichten Fallgewichtsgeräts (nach [1])
Bild 78 Komponenten eines FDVK-Messsystems (links oben), gemessene Beschleunigung (links unten) und Visualisierung der FDVK-Werte am Beispiel der zweiten und fünften Überfahrt (nach [9])
Bild 79 Definition und Darstellung der Messwerte unterschiedlicher FDVK-Systeme (nach [6])
Bild 80 Verlauf der vier gängigen FDVK-Werte für Vibrationswalzen (CMV, OMEGA, E
vib
, k
B
) in Abhängigkeit von der Bodensteifigkeit und den Betriebszuständen (nach [9])
Bild 81 a) Prinzip des FDVK-Systems für Oszillationswalzen,
Bild 82 Korrelationsbildung zwischen E
v1
-Werten und FDVK-Werten mittels linearer Regression (nach RVS 08.03.02 [121])
2.2 Baugrundverbesserung und Injektionen
Bild 1 Wirkungsweise der Vorbelastung zur Baugrundverbesserung
Bild 2 Bemessungsdiagramm Vorbelastung (nach [70])
Bild 3 Charakteristische Bezeichnungen zur Drän-Bemessung
Bild 4 Prinzip der Vakuumkonsolidierung (nach [135])
Bild 5 Ergebnisse aus einem Vakuumkonsolidierungstest (nach [122])
Bild 6 Anwendungsgrenzen des Rütteldruckverfahrens (nach [36])
Bild 7 Arbeitsphasen des Rütteldruckverfahrens
Bild 8 Tiefenrüttler und Prinzip des Rüttelvorgangs
Bild 9 MRC-Tiefenverdichtung
Bild 10 Fallplattenverdichtung mit Trägergerät, Gewicht und Schlagtrichter
Bild 11 Wirktiefe einer Fallplattenverdichtung (nach [143])
Bild 12 Schwingungsauswirkung bei Fallplattenverdichtung (nach [168])
Bild 13 Einpunkt-Sprengung
Bild 14 Porenwasserdruckausbreitung in wassergesättigtem Sand (nach [92])
Bild 15 Porenwasserüberdruck als Funktion a) der Ladungsgröße und b) der Konsolidierungszeit
Bild 16 Setzungsmulde und Konsolidierungszone des Bodens (C-Sprengladung) (nach [144])
Bild 17 Grundrissanordnung der Sprengladungen bei Ansatz von vier Serien (nach [144])
Bild 18 Geräteaufbau für die Airgun-Technik (nach [165])
Bild 19 Mass mixing (aus [31], modifiziert)
Bild 20 Arbeitsweise des Tiefeneinmischverfahrens
Bild 21 Erzielbare Festigkeiten – Trockenverfahren (nach [63])
Bild 22 Verschiedene geometrische Anwendungen des Tiefeneinmischverfahrens; a) Block, b) Mauer, c) Gitter, d) Säulengruppen
Bild 23 Dynamisches Druckverhältnis p/p
0
entlang des Strahlzentrums bei unterschiedlichen Luftgeschwindigkeiten (aus [23])
Bild 24 Varianten des Düsenstrahlverfahrens
Bild 25 a) Prüfstand; Prüfbilder von Schneidstrahlen, b) fokussierter Strahl und c) durch Verwirbelung aufgeweiteter Strahl
Bild 26 Schematische Darstellung des Cross-Jet-Verfahrens (aus [23])
Bild 27 Festigkeit q
u
des Düsenstrahlkörpers in Abhängigkeit des Zementgehalts in unterschiedlichen Böden (aus [23])
Bild 28 Kombination von mechanischer und hydraulischer Tiefeneinmischung (nach [141])
Bild 29 Herstellungsreihenfolge (nach [71]); a) Bohren, b) Ausfahren Wing, c) Bohren bis vergr. Durchmesser, d) Injektion und Mischen, e) Einfahren Wing und Ausbau
Bild 30 Herstellung einer Weichgelsohle
Bild 31 Anwendungsbereiche von Injektionsmitteln (nach [64])
Bild 32 Viskosität und Sedimentationsgeschwindigkeit von Zementsuspensionen (nach [16])
Bild 33 Aufbau des Schleusenrüttlers
Bild 34 Trägergerät mit Schleusenrüttler
Bild 35 Stopfrüttler mit pneumatischer Beschickungsvorrichtung
Bild 36 Interaktionen Last–Säule–Boden (aus [80])
Bild 37 Abschätzung der Säulentragkraft aus Stützkraftwirkungen
Bild 38 Versagensmechanismus von Rüttelstopfsäulen bei Gruppenwirkung (aus [80])
Bild 39 Versagensmechanismen von Rüttelstopfsäulen bei vertikaler Belastung (aus [83]); a) bulging, b) shearing, c) sinking, d) bulging in soft deeper layer
Bild 40 Bemessungsdiagramm für Baugrundverbesserung durch Rüttelstopfsäulen (nach [120])
Bild 41 Verfahrensweise bei Sand-Verdichtungspfählen (nach [160])
Bild 42 Verbesserungswerte bei Sand-Verdichtungspfählen (nach [13])
Bild 43 Tragverhalten von Stabilisierungssäulen [113]
Bild 44 Wirkbreiten von Kalkpfählen (nach [157])
Bild 45 Verfahrensablauf zur Herstellung von Stabilisierungssäulen (nach [132])
Bild 46 Arbeitsweise der Pulverlanze (nach [53])
Bild 47 Manschettenrohrinjektion und fortschreitende Rissbildung im Untergrund
Bild 48 Bohrgerät mit Hebebühne in Bohrschacht von 5 m Durchmesser aus [79]
Bild 49 Ventilrohrfächer aus einem Schacht
Bild 50 Körnungsbereiche und Eignung für Verdichtungsinjektionen
Bild 51 Verdichtungsinjektionen zur Gründungsertüchtigung
Bild 52 Sondierung vor und nach einer Verdichtungsinjektion
2.3 Verstärkung von Gründungsstrukturen
Bild 1 Prinzipskizze zur Herstellung einer Unterfangung nach DIN 4123, Reihenfolge der Abschnitte
Bild 2 Grenzen des Bodenaushubs nach DIN 4123
Bild 3 Bauabschnitte und Abmessungen einer Unterfangung nach DIN 4123
Bild 4 Begrenzung der Unterfangung am Anschluss einer Querwand
Bild 5 Unterfangung durch Verfestigung eines Bodenkörpers als a) Gewichtsmauer und b) verankerte Wand
Bild 6 Belastung und statisch wirksamer Querschnitt eines Verfestigungskörpers
Bild 7 Beispiel des Fächers und der Ventilanordnung für eine Poreninjektion (nach [32]); a) Regelquerschnitt, b) Grundriss, Schnitt A–A
Bild 8 Beispiel einer Anordnung von Voll- und Halbsäulen zur Unterfangung eines Wohngebäudes (nach [26])
Bild 9 Beispiel zur Unterfangung eines Wohngebäudes mit dem Düsenstrahlverfahren (Quelle: Keller Grundbau GmbH)
Bild 10 Herstellungsphasen einer Unterfangung und Umlastung mit beidseitigen Vertikalpfählen und Joch; a) Herstellung der Mikropfähle, b) Abfangung, Umlastung, Rückbau des Fundaments, Herstellung der Decke/Platte, c) Herstellung einer neuen Tragstruktur, Umlastung auf Decke, Rückbau der Abfangung
Bild 11 Unterfangung und Verstärkung mit beidseitigen Vertikalpfählen und Streichbalken
Bild 12 Unterfangung und Verstärkung mit beidseitigen Schrägpfählen, Pfahlraster und Systemschnitt
Bild 13 Einseitige Unterfangung und Verstärkung mit Pfahlbock und kurzem Abfangbalken, Pfahlraster und Systemschnitt
Bild 14 Einseitige Unterfangung und Verstärkung mit Kniehebeljoch, Zug- und Druckpfählen, Pfahlraster und Systemschnitt
Bild 15 Prinzip eines Presspfahls, System Franki
Bild 16 Prinzip eines Segmentpfahls, System Erka; a) Herstellung, b) fertiger Pfahlkopf
Bild 17 Unterfangung mit geneigter Bohrpfahlwand (nach [29])
Bild 18 Kombinierte Unterfangung mit Mikropfählen, Verpressankern und Bodennägel (nach [4])
Bild 19 Prinzipskizze zur Verbreiterung eines Fundaments
Bild 20 Prinzipskizze zum Stopfen eines weichen Bodens mit trockenem Granulat (nach [20])
Bild 21 Prinzipskizze zur Sanierung einer schadhaften Holzpfahlgründung (nach [35])
Bild 22 Verstärkung einer schadhaften Holzpfahlgründung; a) Nachgründung einer Langpfahlgründung mit Streckträgern und Mikropfählen, b) Nachgründung einer Spickpfahlgründung mit Streichbalken auf Bohrpfählen (nach [51])
Bild 23 Beispiele für Tragstrukturen bei einer Teilunterfahrung in offener Bauweise; a) Kragkonstruktion; von Neubau getrennt, b) Portalkonstruktion, in Neubau integriert, c) temporäre Abfangung und Umlastung auf Neubau
Bild 24 Nachträgliche Unterkellerung eines historischen Gebäudes, nach [21]; a) temporäre Abfangung, Teilaushub, b) Herstellung der obersten Decke und der Stützen, Restaushub und Herstellung weiterer Decken
2.4 Bodenvereisung
Bild 1 Gefrorene Schwergewichtsmauer
Bild 2 Baugrube durch horizontales Frostgewölbe gestützt (Grundriss) [47]
Bild 3 Frostkörper [27]; a) durch Steifen gestützt, b) verankert
Bild 4 Querschnitt Frostkörper mit Lastabtrag auf Pfählen [46]
Bild 5 Auf Biegung beanspruchte Frostplatte [60]
Bild 6 Frostschale mit tunnelparallelen Gefrierrohren [7]; a) hinter Bohrpfahlwand, b) Endbereich
Bild 7 Frostkörper von Pilotstollen aus hergestellt [45]
Bild 8 Tunnelparallele Gefrierrohre in Pilotstollen verlegt [12]
Bild 9 Gefrorene Bodenprobe an Gefrierlanze
Bild 10 Gefrierrohr im Boden
Bild 11 Baustelleneinrichtung für eine Stickstoffvereisung
Bild 12 Gefrierrohrkopf
Bild 13 Gefrieranlage für Solevereisung (schematisch)
Bild 14 Wärmekapazität in Abhängigkeit von der Temperatur [32]
Bild 15 Temperaturverlauf um ein Gefrierrohr zu verschiedenen Zeiten (nach [67])
Bild 16 Frostausbreitung a) bei ruhendem Grundwasser und b) um eine Rohrreihe
Bild 17 Nomogramm zur Bestimmung des Frostfortschritts am Einzelrohr (t
l
= konst.) [67]
Bild 18 Nomogramm zur Bestimmung des Proportionalitätsfaktors p für die Frostausbreitung im ebenen Fall [67]
Bild 19 Verhältnis E(L) der mittleren Temperatur auf der Rohrebene zur Rohrwandtemperatur in Abhängigkeit von der Frostdicke L [67]
Bild 20 Frostkörperwachstum bei strömendem Grundwasser
Bild 21 Grafische Integration der Gl. (37) [70]
Bild 22 Korrekturfaktor K
B
in der verbesserten Berggren-Formel [2]
Bild 23 Frosteindringung durch Beton in körnige Böden und Geschiebe [2]
Bild 24 Berechnete Grenztemperaturen und Messergebnisse in einem Frostkörper
Bild 25 Kriechkurven verschiedener Böden [71]
Bild 26 Maximalspannung in weggesteuerten Versuchen abhängig vom Wassergehalt, Feinsand [6]
Bild 27 Einaxiale Druckfestigkeiten von Proben des Kies-Sand-Bereichs (T = −10 °C) in Abhängigkeit vom Sättigungsgrad [8]
Bild 28 Einfluss von Temperatur und Salinität auf die einaxiale Druckfestigkeit von gefrorenem Boden [32]
Bild 29 Arbeitslinien aus weggesteuerten Einaxialversuchen [51]; a) verschiedene , b) verschiedene θ
Bild 30 Einaxiale Kriechversuche an gesättigtem Mittelsand bei −10 °C [51]; a) Dehnung ε
1
, b) Dehnungsgeschwindigkeit über der Zeit
Bild 31 Festlegung von t
m
und in Kriechversuchen [51]
Bild 32 Axialspannung über der maximalen Kriechgeschwindigkeit (Einaxialversuche an gesättigtem Mittelsand) [51]
Bild 33 Kriechgeschwindigkeitskurven mit t
m
und normiert [51]
Bild 34 Kriechkurven von Einaxialversuchen mit t
m
und normiert [51]
Bild 35 Berechnete σ
α
(θ) und geeignete Approximationsfunktion [51]
Bild 36 σ
1
über , Messwerte und Berechnung nach Gl. (50) mit zugehörigen Eingangsversuchen [51]
Bild 37 t
m
über σ
1
, Messwerte und Berechnung [51]
Bild 38 Geschwindigkeitsverläufe aus Versuchen und Approximation [51]
Bild 39 Deformationsmodul E aus elastischer und viskoser Verformunga) für 10 Tage Standzeit und b) für −10 °C (Karlsruher Mittelsand)
Bild 40 Arbeitslinien aus weggesteuerten Triaxialversuchen mit jeweils konstanter Spannungssumme [51]
Bild 41 Dehnungsgeschwindigkeit über Spannungssumme I
σ
, Messwerte (triaxiale Kriechversuche bei σ
1
− σ
3
= 10 MPa) und Rechenwerte nach Gl. (56) [25]
Bild 42 a) Deviatorspannung σ
1
− σ
3
über Dehnungsgeschwindigkeit , Rechenwerte nach Gl. (56) für verschiedene Spannungssummen I
σ
bei θ = −10 °C, b) Standzeit t
m
über Deviatorspannung σ
1
− σ
3
, Rechenwerte nach Gl. (56) für verschiedene Spannungssummen I
σ
bei θ = −10 °C [25]
Bild 43 Kriechkurven aus einaxialen Druck- und Zugversuchen, Material: Mittelsand [20]
Bild 44 Ergebnisse von einaxialen Kriechversuchen an reinem Eis; a) Spannung σ über der minimalen Kriechgeschwindigkeit , b) Standzeit t
m
über Spannung σ [42]
Bild 45 Segregationspotenzial in Abhängigkeit von der Auflastspannung [38]
2.5 Verpressanker, Bodennägel und Zugpfähle
Bild 1 Verankerte Stützmauer mit Zusatzankern
Bild 2 Ankereinbau zur Standsicherheitserhöhung einer Gewichtsstaumauer
Bild 3 Hangsicherung mit Verpressankern
Bild 4 Baugrubenverbau mit Ankern
Bild 5 Kopf eines Einstabankers
Bild 6 Kopf eines Litzenankers
Bild 7 Kopf eines Bündelankers (links)
Bild 8 Kopfausbildung bei Verpressankern
Bild 9 Prinzip der Ankerbohrverfahren im Lockergestein
Bild 10 Modernes Ankerbohrgerät mit Gestängemagazin
Bild 11 Herstellungsprinzip eines selbstbohrenden Ankers
Bild 12 Einbau eines langen Litzenankers
Bild 13 Herstellung eines Ankers „über Kopf“
Bild 14 Technische Möglichkeiten zur Nachverpressung
Bild 15 Wirkung der Nachverpressung auf den Verpresskörper
Bild 16 Konstruktionsprinzip eines Kurzzeit-Verbundankers
Bild 17 Kurzzeit-Verbundanker vor dem Einbau
Bild 18 Konstruktionsprinzip eines Einstab-Druckrohrankers
Bild 19 Druckrohranker vor dem Einbau
Bild 20 Konstruktionsprinzip eines Ankers mit aufweitbarem Verpresskörper
Bild 21 Aufweitbarer Ankerbalg vor dem Einbau
Bild 22 Aufbrechkörper bei rückbaubaren Litzenankern
Bild 23 Kopf eines Litzenankers mit Reguliermutter (Stellschraube)
Bild 24 Kopf eines Ankers zur Hangsicherung mit Reguliermöglichkeit
Bild 25 Rissbildung im Verpresskörper bei Gewindestählen
Bild 26 Erdstatischer Ansatz zur Ermittlung der Ankertragfähigkeit
Bild 27 Schematische Darstellung der Radialverschiebung und Radialspannung beim Verpressvorgang
Bild 28 Modell für die Verspannung eines Verpresskörpers infolge Dilatanz in der Scherfuge nach
Wernick
[31]
Bild 29 Verteilung der Mantelreibung bei einem Anker in kiesigem Sand nach
Scheele
[27]
Bild 30 Verbundspannung (Stahl/Mörtel) bei einem Einstabanker in Sandstein nach
Jirovec
[20]
Bild 31 Scherkraft-Scherverschiebungslinien von direkten Scherversuchen mit Sand und Schubspannungsverteilung entlang eines Verpresskörpers (schematisch)
Bild 32 Kraftabtragung an einem kombinierten Druckrohr-/Verbundanker
Bild 33 Lastabtragung an einem hoch belasteten Felsanker
Bild 34 Grenzlast von Ankern in nichtbindigen Böden (nach
Ostermayer
[24])
Bild 35 Grenzlast von Ankern in bindigen Böden mit Nachverpressung (nach
Ostermayer
[24])
Bild 36 Grenzlast von Ankern in bindigen Böden ohne Nachverpressung (nach
Ostermayer
[24])
Bild 37 Einfluss verschiedener Nachverpresssysteme auf die erzielbare Mantelreibung bei mittel- bis hochplastischen Tonen
Bild 38 Einfluss der Nachverpressung auf die Ankertragfähigkeit in einem schluffigen Ton
Bild 39 Schematische Darstellung eines Zugversuchs an einem Einstabanker
Bild 40 Hydraulische Hohlkolbenpressen (rechte Presse mit Stahlmantel, linke drei Pressen Leichtbauzylinder mit CFK-Mantel)
Bild 41 Eignungsprüfung an drei Verpressankern
Bild 42 Versuchsablauf einer Eignungsprüfung an einem Daueranker
Bild 43 Zeit-Verschiebungs-Kurven und Ermittlung des Kriechmaßes bei einer Eignungsprüfung
Bild 44 Ermittlung der Grenzlast aus dem Kriechmaß
Bild 45 Versuchsablauf bei einer Abnahmeprüfung (oben: Temporäranker; unten: Daueranker)
Bild 46 Kraft-Verschiebungs-Linie am Beispiel einer Eignungsprüfung an einem Daueranker
Bild 47 Zeit-Verschiebungs-Linien zur Ermittlung der Kriechmaße k
s
= (s
b
− s
a
)/log (t
b
/t
a
) am Beispiel eines Dauerankers in nichtbindigem Boden
Bild 48 Darstellung des Kriechmaßes als Funktion der Ankerkraft
Bild 49 Prinzip einer Ankerkraftnachprüfung durch Abhebeversuch
Bild 50 Abhebeversuch an einem Einstabanker (mit spezieller Spannbrücke, erforderlich wegen zu geringen Zuggliedüberstands)
Bild 51 Aufschraubbare Abhebepresse für Litzen- oder Bündelanker
Bild 52 Prinzip der Ankerüberwachung mit Lichtwellenleitersensoren
Bild 53 Prinzip eines elektrischen Kraftmessrings
Bild 54 Elektrische Kraftmessringe und Anzeigegerät (DMD 20)
Bild 55 Prinzip eines hydraulischen Kraftmessgebers
Bild 56 Hydraulischer Kraftmessgeber
Bild 57 Prinzip eines Stangenextensometers
Bild 58 Messtechnische Überwachung einer mit Ankern gesicherten Böschung
Bild 59 Daueranker mit Isolationsplatte
Bild 60 Prüfung des Widerstands zwischen Stahlzugglied und Baugrund [22]
Bild 61 Prüfung des Widerstands zwischen Ankerkopf und Bauteil [22]
Bild 62 Verfahrensschritte bei einer Baugrubenwandvernagelung
Bild 63 Vernagelte Baugrubenböschung im Löss
Bild 64 Sicherung eines rutschgefährdeten Hangs mit langen Bodennägeln
Bild 65 Vernagelung einer steilen Felsböschung
Bild 66 Ertüchtigung einer Stützmauer mit Bodennägeln
Bild 67 Vernagelung eines rechnerisch nicht ausreichend standsicheren Bahndamms
Bild 68 Temporärbodennagel mit einfachem Korrosionsschutz
Bild 69 Dauerbodennagel mit doppeltem Korrosionsschutz
Bild 70 Temporärbodennägel
Bild 71 Dauerbodennägel
Bild 72 Prinzip einer Nagelprobebelastung
Bild 73 Nagelkraft-Kopfverschiebungsdiagramm bei einer Nagelprobebelastung und Prüfkriterien
Bild 74 Prinzip der Einbringung eines Kunstharzklebeankers
Bild 75 Ausbildung von Spreizankern
Bild 76 Zementmörtelanker (SN-Anker, Injektionsanker, Perfoanker)
Bild 77 SN-Anker für den Tunnelbau
Bild 78 Kopf eines Glasfaserankers (bei einem Zugversuch)
Bild 79 Glasfaseranker vor dem Einbau
Bild 80 Prüfregime einer Zugprüfung an einem Gebirgsanker
Bild 81 Freigelegte Zugpfähle im Kies
Bild 82 Freigelegte Zugpfähle im Ton
2.6 Bohrtechnik
Bild 1 Kugelgreifer am Seilbagger mit Verrohrungsanlage [6]
Bild 2 Vierschaliger Greifer für Greiferbohrungen [12]
Bild 3 Ventilbohrer [12]; a) Schlammbüchse, b) Kiespumpe
Bild 4 Wirkungsweise eines Ventilbohrers [12]; a) Beginn des Hubs, b) Ende des Hubs (Sogwirkung), c) freier Fall (Bodeneintrieb)
Bild 5 Kastenbohreimer mit geöffnetem Drehboden [6]
Bild 6 Felskastenbohrer mit Rundschaftmeißel
Bild 7 Kastenbohrer bestückt mit Flachzähnen, geeignet für Ton
Bild 8 Schneckenbohrwerkzeug gefüllt mit schluffigem Sand [17]
Bild 9 Abschleudern durch schnelles Hin- und Herdrehen der Bohrschnecke [17]
Bild 10 Zweischneidige Schnecke mit Rundschaftmeißel und kleiner Hohlseele
Bild 11 „Cross-cutter“ mit Rundschaftmeißel für Felsanwendungen
Bild 12 Progressivschnecke mit Rundschaftmeißel für Felsbohrarbeiten [13]
Bild 13 Rollenmeißelkernrohr für Felsbohrarbeiten [6]
Bild 14 Teleskopierbare Kellystange [6]
Bild 15 Großdrehbohrgerät mit Bohrwerkzeug und Kellystange im Rüstzustand
Bild 16 Kellystange, Drehgetriebe, Bohrwerkzeug, Verrohrungsrohre (von oben nach unten) [17]
Bild 17 Großdrehbohrgerät mit Kastenbohrer und angebauter Verrohrungsanlage
Bild 18 Großdrehbohrgerät beim Herstellen geneigter Pfähle mit Verrohrungsanlage [17]
Bild 19 Endlosschnecken mit Kellyverlängerung [6]
Bild 20 „Low headroom“ Endlosschneckenbohrgeräte mit 7,5 m Masthöhe. Bohrtiefen bis 28 m erzielt durch Aufsetzen einzelner Schneckenschüsse (Länge 2,5 m) [6]
Bild 21 Großdrehbohrgerät mit Endlosschnecken und 8 m Kellyverlängerung [6]
Bild 22 Endlosschnecken mit am Gittermast geführter 13 m Kellyverlängerung, max. Bohrtiefe 30 m [6]
Bild 23 Abschütteln der Endlosschnecken durch schockierende Hin- und Herbewegung
Bild 24 Rollenschneckenputzer für bindige Böden [6]
Bild 25 Effekt des zu großen Förderns von Boden (nach
Fleming
[7])
Bild 26 Schneckenpfahlherstellung [6]
Bild 27 Schneckenbohrwerkzeug mit großer Hohlseele
Bild 28 Ablauf zum Herstellen von verrohrten Schneckenbohrpfählen [6]
Bild 29 Überschnittene Bohrpfahlwand hergestellt im CCFA-Verfahren, ∅ 750 mm: hervorragende Wandvertikalität [6]
Bild 30 Dieselbe Baustelle wie in Bild 29, Pfähle im CFA-Verfahren hergestellt, ∅ 750 mm; große Abweichungen im Fußbereich der Wand [6]
Bild 31 Bohrwerkzeug – Bohrschnecke innen und Bohrrohr außen
Bild 32 Großdrehbohrgerät beim Herstellen einer überschnittenen Pfahlwand, ∅ 750 mm verrohrte Schneckenpfählen bis 15,5 m Länge [6]
Bild 33 Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird die induktive Übertragung von Bohr- und Betondruckdaten aus dem Bohrloch genutzt [27]
Bild 34 Qualitätskontrolle bei der Pfahlherstellung [27]
Bild 35 VdW-Getriebe zum Herstellen von verrohrten Schneckenpfählen [8]
Bild 36 Verdrängerbohrwerkzeug mit gegenläufiger Wendel [6]
Bild 37 Am Gittermast geführte Kellyverlängerung
Bild 38 Verdrängerbohrgerät der Firma FRANKI Südafrika mit 480 kNm Drehmoment
Bild 39 Verdrängerbohrwerkzeug mit gegenläufiger Wendel und verlorener Bohrspitze [6]
Bild 40 Bewehrungskorbeinbau durch die Hohlseele unter Verwendung der Gerätehilfswinde
Bild 41 Qualitätskontrolle am Bildschirm, Bild von der Kamera mit Blick in den Betoniertrichter unten rechts
Bild 42 Betoniertrichter mit angebauter Farbkamera zur Überwachung des Füllstands
Bild 43 Typische Bestandteile eines Kellybohrgeräts [17]
Bild 44 Durchdrehende Verrohrungsanlage für Durchmesser bis 3 m [6]
Bild 45 Oszillierende Verrohrungsanlage
Bild 46 Funktionsweise der H-W-Schwinge, Blick von oben
Bild 47 Einsatz der H-W-Schwinge bei der Herstellung eines Ortbetonpfahls
Bild 48 Rotarybohren mit direktem Spülstrom [5]
Bild 49 Schema des Rotary-Bohrverfahrens [10]
Bild 50 Universalbohrgerät RB 25 von PRAKLA, Hakenlast 150 kN geeignet für Bohrdurchmesser von 4″ bis 30″ und Bohrtiefen bis zu 400 m [5]
Bild 51 Vollhydraulisches Drehbohrgerät DSB 0 von Nordmeyer [4]
Bild 52 Bestandteile und prinzipielle Anordnung des Gesamtsystems einer Rotary-Bohranlage mit ihren Beistellaggregaten [5]
Bild 53 Schema des indirekten (inversen) Spülbohrverfahrens links [10], rechts [5]
Bild 54 Prinzip des Lufthebebohrverfahrens
Bild 55 Geräteanordnung beim Lufthebebohren
Bild 56 Kernbohren [3]
Bild 57 Diamantimprägnierte Kernbohrkrone [4]
Bild 58 Meißelbesatz für Großlochbohrungen [4]
Bild 59 Bohrwerkzeuge für Imlochhämmer [10]
Bild 60 Bohrwerkzeug für Rotationsspülbohrungen; a) Flügelmeißel, b) Rollenmeißel
Bild 61 Baustellenübersicht [5]
Bild 62 Kolloidalmischer für Verpressmaterial [14]
Bild 63 Einbau des Bohrgestänges [5]
Bild 64 Geothermiebohrgerät DSB 1 von Nordmeyer [3]
Bild 65 Bohrverfahren für den Baugrundaufschluss [4]; a) Trockendrehbohrungen mit Verrohrung, b) Kernbohren (Einfach-, Doppel- oder Seilkernrohr), c) Rammkernbohren
Bild 66 Sonic-Drilling-Bohrgerät [16]
Bild 67 Kerngewinnung, bis zu 4 m lange Kernmärsche werden vom Kernrohr direkt in eine Plastikfolie ausgerüttelt
Bild 68 In Plastikfolie umhüllte Bodenprobe
Bild 69 Gewonnener Bohrkern
Bild 70 Entleeren des Bohreimers [7]
Bild 71 Aufsetzen des Fly Drill auf das Bohrrohr, Kastenbohrerdurchmesser von 3 bis 4,4 m [9]
2.7 Horizontalbohrungen und Rohrvortrieb
Bild 1 Gliederung der Verfahren nach DIN EN 12889
Bild 2 Wesentliche Elemente der Vortriebsmaschinen für den Mikrotunnelbaua) Teilschnittmaschine (DA: 1,5 m bis 4,2 m)b) Vollschnittmaschine mit Flüssigkeitsstützung (DA: 0,4 m bis 3,0 m)c) Vollschnittmaschine mit pneumatisch geregelter Flüssigkeitsstützung (DA: 2,0 m bis 4,2 m)d) Vollschnittmaschine mit Erddruckschild (DA: 1,5 m bis 4,5 m)e) Vollschnittmaschine für Fels (TBM (DA: 1,5 m bis 4,5 m)
Bild 3 Anwendungsgrenzen der Vortriebsmaschinen in Abhängigkeit von der Kornverteilung [29]
Bild 4 Beispiel einer typischen HDD-Dükerbohrung [43]
Bild 5 Asymmetrischer Bohrkopf
Bild 6 Beispiele für die Reichweiten von HDD-Bohrungen [43]
Bild 7 Erreichbare Längen in Abhängigkeit vom Maschinentyp [29]
Bild 8 Aufweiten der Pilotbohrung [43]
Bild 9 Rohreinzug beim Endaufweiten oder Glätten des Bohrlochs (zusammengestellt aus [43])
Bild 10 Die 3 Schritte des HDD-Verfahrens (zusammengestellt aus [33])
Bild 11 Innerstädtische Längsverlegung
Bild 12 Prinzipskizze zur Altlastensanierung
Bild 13 Fotos von einer Maßnahme zur Deichentwässerung [42];
Bild 14 Anordnung von Dränleitungen zur Böschungsstabilisierung
Bild 15 Felsbohrköpfe für Schachtgeräte; a) Pilotbohrung mit druckluftbetriebener Hammerbohrlanze für Kleinbohranlagen (z. B. Grundopit), Ø 80 mm, b) Aufweitkopf (Hole Opener) zum Vergrößern von Bohrlöchern im Fels
Bild 16 Mudmotor/Bohrlochmotor (Grundorock, Typ Low-Flow)
Bild 17 a) Zahnmeißel, b) Warzenmeißel
Bild 18 Aufweitköpfe für das Felsbohren [43]
Bild 19 Bohrungen im harten Kalkstein von Postojna;
Bild 20 Unterbohrung eines Flusses im Geröll- und Blockmaterial
Bild 21 Felsbohrung im Schweizer Jura
Bild 22 Felsbohrung in den Glarner Alpen
Bild 23 Herstellung langer Anker an einem Bahndamm
Bild 24 Einsatz eines ungesteuerten Verdrängungshammers (Erdrakete, Zusammenstellung aus [43]);
Bild 25 Steuerbarer Verdrängungshammer
Bild 26 Rammen und Entleeren der Rohre [42]; a) Vortrieb mit Horizontalramme, b) Rohrentleerung
Bild 27 Einrammen von Rohren zur Unterfahrung eines Bahndamms [42]
Bild 28 Herstellung einer Sacklochbohrung mit dem Pressbohrverfahren [10];
Bild 29 Kompakt- und Langrahmenmaschine für das Pressbohrverfahren [10];
Bild 30 Pressbohrverfahren mit Pilotbohrung
Bild 31 Steuer- bzw. Korrekturmöglichkeiten beim Pressbohrverfahren;
Bild 32 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren (DWA-A 125 [2] modifiziert)
Bild 33 Schema eines bemannten Rohrvortriebs mit offenem Schild [39]
Bild 34 Mindestlichtmaße bei ständigem Personaleinsatz in Rohrvortrieben (ausgenommen Rohrvortriebe unter Druckluftbedingungen) [2]
Bild 35 Schematische Darstellung eines Stoßes bei Vortriebsrohren (Beispiel: Rohrverbindung mit fest verbundenem Stahlführungsring)
Bild 36 Rohrverbindung bei beidseitig frei aufliegendem Stahlführungsring mit Kompressionsinnendichtung
Bild 37 Mindestüberdeckung beim Druckluftvortrieb in Grundwasser führenden Schichten
Bild 38 Statisches Berstlining
Bild 39 Dynamisches Berstlining
Bild 40 Berst-Press-Verfahren
Bild 41 Bohrkopf für das Pipe-Eating-Verfahren
Bild 42 Press-Zieh-Verfahren
Bild 43 Hilfsrohrverfahren
Bild 44 Rückbau von Kabeln durch Ausschälen mit einer HDD-Maschine; a) Detail, b) Querschnitt
2.8 Einbringverfahren für Pfähle und Spundbohlen: Rammen, Vibrieren, Pressen
Bild 1 Hydraulikbagger als Geräteträger (Müller) mit Vibrationsramme; Betätigung durch Bordhydraulik des Baggers; Teleskopmäklertyp MS-M 10000 T
Bild 2 Seilbagger als Geräteträger
Bild 3 Verwendungsfähigkeit eines Anbaumäklers (DELMAG [11]); a) Mäkler angehoben, b) Mäkler abgesenkt, c), d) Mäkler geneigt
Bild 4 Aufsteckmäkler für Pfähle und Spundbohlen (DELMAG [11])
Bild 5 Schwingmäkler (DELMAG [11])
Bild 6 Prinzip der Schlagzerstäubung (DELMAG [11])
Bild 7 Müller Vibrationsanlage mit eigener Kraftstation (ThyssenKrupp [57])
Bild 8 Gerätewahl eines Vibratoren-Herstellers (ThyssenKrupp [57])
Bild 9 Selbstschreitende Spundwandpresse (Giken Europe BV [22])
Bild 10 Anschlagklaue (Profilarbed [49])
Bild 11 Sicherheitsschäkel (Profilarbed [49])
Bild 12 Fortlaufendes Einbringen von Spundbohlen
Bild 13 Staffelweises Einbringen von Doppelprofilen (Profilarbed [49])
Bild 14 Fachweises Einbringen von Doppelbohlen (Profilarbed [49])
Bild 15 Kombinierte Wände mit Rammgerüst (Profilarbed [49])
Bild 16 Vor- und Nacheilen von Spundbohlen
Bild 17 Führungszange (Profilarbed [49])
Bild 18 Einflussbereiche beim Einpressen von am Fuß geschlossenen Pfählen in dichtem Sand; hier s < D, Phase 2, nach
Linder
[37]
Bild 19 Schematische Darstellung des Schadensbilds einer Tondichtung infolge a) Verschleppung und b) seitlicher Auslenkung eines Spundwandprofils [32]
Bild 20 Einfluss der Sättigung des Sandes auf die Änderung der horizontalen Spannung (HS) infolge Pfahlrammung; a) erdfeuchter Sand, b) wassergesättigter Sand [55]
Bild 21 Einfluss des Pfahldurchmessers auf die Änderung der horizontalen Spannung (HS) infolge Pfahlrammung; a) D = 0,36 m, b) D = 0,51 m [55]
Bild 22 Bodenaufbau der Baumaßnahme „Hamburger Hafen“ [26]
Bild 23 Gemessene und berechnete Horizontalspannungen am Pfahlfuß zwischen −7 und −11 mNN [26]
Bild 24 Veränderung der vertikalen Spannung σ′
v
unter der Pfahlfußebene infolge des Rammvorgangs [71]
Bild 25 Vertikale Spannungsänderung Δσ′
v
in Abhängigkeit des Abstands von der Pfahlachse und der Rammarbeit ΣW [71]
Bild 26 Änderung von K
0
= σ′
h
/ σ′
v
neben dem Pfahl infolge des Rammvorgangs [71]
Bild 27 Mechanisches System der freireitenden Vibrationsrammung [35]
Bild 28 Kavitatives Vibrationsrammen: idealisierter Verlauf der Spitzendruckkraf F
s
[14, 52]
Bild 29 Vereinfachte Unterscheidung zwischen schnellem und langsamem Vibrationsrammen [51]
Bild 30 Verlauf der Pfahlpenetrationskurven für die von
Vogelsang
et al. [63] durchgeführten Versuche
Bild 31 Pfahlfußwiderstand während der zyklischen Pfahlinstallation mit a) großer und b) kleiner Verschiebungsamplitude im Abgleich mit monotonem Eindrücken des Pfahls (Sand mit mitteldichter Lagerung) [63]
Bild 32 Änderung der a) Horizontal- (HEP) und b) Vertikalspannung (VEP) während der Vibrationsrammung [55]
Bild 33 Feldversuche: Vergleich des axialen Widerstands von vibrierten und gerammten Pfählen [43]
Bild 34 Altenwalde: Ergebnisse der Drucksondierungen vor und 30 Tage nach Installation der Stahlrohrpfähle; a) gerammt, b) vibriert [43]
Bild 35 Altenwalde: horizontale Probebelastung eines vibrierten und eines gerammten Pfahls [43]
Bild 36 Altenwalde: Biegelinien der vibrierten und gerammten Testpfähle während der horizontalen Probebelastung [43]
Bild 37 Altenwalde: Vergleich der Pfahlkopfverschiebungen eines vibrierten und eines gerammten Stahlrohrpfahls [43]
Bild 38 In verschiedenen Abständen gemessene Schwinggeschwindigkeit im Boden bei der Schlagrammung mit Diesel- und Freifallrammen [75]
Bild 39 In verschiedenen Abständen gemessene Schwinggeschwindigkeit im Boden bei der Schlagrammung mit Hydraulikrammen [75]
Bild 40 In verschiedenen Abständen gemessene Schwinggeschwindigkeit im Boden bei der Vibrationsrammung mit Frequenzen < 30 Hz [75]
Bild 41 In verschiedenen Abständen gemessene Schwinggeschwindigkeit im Boden bei der Vibrationsrammung mit Frequenzen > 30 Hz [75]
Bild 42 Feldversuche von
Zerrenthin
[73]: Setzungsverlauf in Abhängigkeit von der Schwingungseinwirkung auf der GOK bei Proberammungen am gleichen Standort
2.9 Grundwasserströmung – Grundwasserhaltung
Bild 1 Schematische Darstellung von Gesteinen mit a) Poren-, b) Kluft- und c) Karsthohlräumen nach [2]
Bild 2 Erscheinungsformen des Wassers in der gesättigten und der ungesättigten Bodenzone (nach [2])
Bild 3 Definition des Grundwasserpotenzials
Bild 4 Schematische Darstellung von Grundwasserstockwerken
Bild 5 Spezifischer Speicherkoeffizient S
s
in Abhängigkeit des Porenwasserdrucks u und des Porenluftgehalts
Bild 6 Qualitative Darstellung eines Darcy-Versuchs (nach [8])
Bild 7 Zu- und Abflüsse am Kontrollvolumen
Bild 8 Grabenströmung im gespannten Grundwasserleiter
Bild 9 Dränagegraben im gespannten Grundwasserleiter
Bild 10 Grabenströmung im gespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 11 Dränagegraben im gespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 12 Grabenströmung im halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 13 Einflusslänge der Druckentspannung im halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 14 Dränagegraben im halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 15 Unterströmung eines Deiches in einem halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 16 Grundwasserpotenziallinien für die Unterströmung einer Spundwand
Bild 17 Vertikal-ebene Modellierung der Spundwandunterströmung
Bild 18 Unvollkommener Dränagegraben bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 19 Erhöhungsfaktor α für die Zuströmung zu einem unvollkommenen Dränagegraben bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 20 Strom- und Potenzialliniennetz für die Unterströmung einer Spundwand
Bild 21 a) Geschwindigkeitsvektoren bei Grundwasserströmung mit freier Oberfläche und b) vereinfacht entsprechend den Dupuit-Annahmen
Bild 22 Grabenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 23 Dränagegraben im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 24 Grabenströmung im ungespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 25 Dränagegraben im ungespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 26 Grabenströmung mit Übergang vom gespannten zum ungespannten Grundwasserleiter
Bild 27 Infiltration aus einem kolmatierten Graben in einen ungespannten Grundwasserleiter
Bild 28 Randbedingungen für die Modellierung der wassergesättigten Dammdurchströmung
Bild 29 Funktionaler Zusammenhang zwischen Sättigungsgrad (S
r
) und Saugspannung (−u) für verschiedene Bodenarten (qualitativ)
Bild 30 Funktionaler Zusammenhang zwischen relativer Durchlässigkeit (k
r
) und Saugspannung (−u) für verschiedene Bodenarten (qualitativ)
Bild 31 Berechnete Grundwasserpotenziale sowie Sickerlinie und Sickerstrecke für durchströmten Damm mit homogener, isotroper Durchlässigkeit auf undurchlässiger Aufstandsfläche
Bild 32 Grundwassermodell zur Ermittlung der Sickerstrecke bei der Grabenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 33 Austrittshöhe der Sickerlinie h
S
bei Grabenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 34 Grabenzufluss aus ungespanntem Grundwasserleiter
Bild 35 Funktion f
0
(u)
Bild 36 Modell für instationäre Grabenströmung aus gespanntem Grundwasserleiter
Bild 37 Grundwasserpotenzial für plötzliche Absenkung am linken Modellrand bei gespannter Grundwasserströmung
Bild 38 Funktion f
1
(u)
Bild 39 Grundwasserpotenzial für konstante Entnahmerate am linken Modellrand bei gespannter Grundwasserströmung
Bild 40 Modell für instationäre Grabenströmung aus ungespanntem Grundwasserleiter
Bild 41 Grundwasserpotenzial für plötzliche Absenkung am linken Modellrand bei ungespannter Grundwasserströmung
Bild 42 Grundwasserpotenzial für konstante Entnahmerate am linken Modellrand bei ungespannter Grundwasserströmung
Bild 43 Brunnenströmung im gespannten Grundwasserleiter
Bild 44 Brunnenströmung im gespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 45 Brunnenströmung im halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 46 Modifizierte Besselfunktionen I
0
, K
0
, I
1
und K
1
Bild 47 Einflussradius der Druckentspannung im halbgespannten Grundwasserleiter
Bild 48 Berechnungsbeispiel mit zwei Brunnen
Bild 49 Grundwasserpotenzial entlang x- und y-Achse für Berechnungsbeispiel mit zwei Brunnen
Bild 50 Brunnenabstände zum betrachteten Punkt P
Bild 51 Berechnungsbeispiel für Mehrbrunnenanlage im gespannten Grundwasserleiter, Draufsicht (oben) und Schnitt (unten)
Bild 52 Brunnenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 53 Brunnenströmung im ungespannten Grundwasserleiter mit Grundwasserneubildung
Bild 54 Berechnungsbeispiel für Mehrbrunnenanlage im ungespannten Grundwasserleiter; a) Draufsicht und b) Schnitt (unten)
Bild 55 Unvollkommener Brunnen bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 56 Erhöhungsfaktor a für die Zuströmung zu einem unvollkommenen (Einzel-) Brunnen bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 57 Erhöhungsfaktor a für die Zuströmung zu einem unvollkommenen (Ersatz-) Brunnen bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 58 Brunnenzuströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 59 Grundwassermodell zur Ermittlung der Sickerstrecke bei der Brunnenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 60 Austrittshöhe der Sickerlinie bei Brunnenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 61 Brunnenzufluss im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 62 Unvollkommener Brunnen bei gespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 63 Erhöhungsfaktor a für die Zuströmung zu einem unvollkommenen Brunnen bei ungespannten Grundwasserverhältnissen
Bild 64 Brunnenfunktion W(u) und Approximation W′(u)
Bild 65 Modell für instationäre Brunnenströmung im gespannten Grundwasserleiter
Bild 66 Grundwasserpotenzial h für konstante Brunnenentnahmerate bei gespannter Grundwasserströmung für verschiedene Zeitpunkte t in a) linearer und b) logarithmischer Darstellung
Bild 67 Grundwasserpotenzial h im brunnennahen Bereich für konstante Brunnenentnahmerate bei gespannter Grundwasserströmung in a) linearer und b) logarithmischer Darstellung
Bild 68 Modell für instationäre Brunnenströmung im ungespannten Grundwasserleiter
Bild 69 Grundwasserpotenzial h bzw. quadriertes Grundwasserpotenzial h
2
für konstante Brunnenentnahmerate bei ungespannter Grundwasserströmung für verschiedene Zeitpunkte t in a) linearer und b) logarithmischer Darstellung
Bild 70 Grundwasserpotenzial h bzw. quadriertes Grundwasserpotenzial h
2
im brunnennahen Bereich für konstante Brunnenentnahmerate bei ungespannter Grundwasserströmung in a) linearer und b) logarithmischer Darstellung
Bild 71 Korrektur zur Berücksichtigung von Ausfallkörnungen im Grobkornbereich
Bild 72 Pumpversuch bei gespanntem Grundwasserspiegel
Bild 73 Pumpversuch bei freiem Grundwasserspiegel
Bild 74 Theis-Typkurve mit Bourdet-Ableitung (gestrichelt)
Bild 75 Beispiel für die Absenkung des Wasserspiegels in einer Grundwassermessstelle während eines Pumpversuchs
Bild 76 Doppeltlogarithmische Aufragung der Absenkung mit Bourdet-Ableitung
Bild 77 Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts k durch Anpassung der doppeltlogarithmischen Aufragung mit der Theis-Typkurve. Hier sind z. B. W(u) = 1 und s = 0,015 m
Bild 78 Auswertung der Absenkung mit dem Geradlinienverfahren nach
Cooper/Jacob
[56]
Bild 79 Typkurven nach
Gringarten
et al. [57] mit Ableitungen nach
Bourdet
et al. [58]
Bild 80 Beispiel eines Pumpversuchs, Absenkung und Wiederanstieg im Brunnen
Bild 81 Doppeltlogarithmische Auftragung der Absenkung mit Bourdet-Ableitung
Bild 82 Bestimmung der Transmissivität T durch Anpassung der doppeltlogarithmischen Auftragung mit der passenden Typkurve. Hier sind z. B. s
D
= 1 und s = 0,18 m.
Bild 83 Auswertung des Wiederanstiegs im Brunnen mit dem Geradlinienverfahren nach
Theis
Bild 84 Versuchsgeometrie bei Auffüll-/Absenkversuchen mit veränderlicher Druckhöhe nach
Freeze/Cherry
[11]
Bild 85 Auswertediagramm nach
Hvorslev
[60]
Bild 86 Typkurven zur Auswertung von Slug&Bail-Tests nach
Cooper
et al. [62]
Bild 87 Doppelpackertesteinrichtung für Slug-, Drill-Stem- und Pulse-Tests
Bild 88 Wasserhaltungsverfahren; a) offene Wasserhaltung, b) Brunnenabsenkung, c) Horizontalabsenkung (nach [70, 71])
Bild 89 Absenkungsverfahren für verschiedene Körnungslinien (nach [70])
Bild 90 Beispiel Geotechnischer Schnitt (Brunnenbau Conrad GmbH)
Bild 91 Kleiner Pumpensumpf
Bild 92 Horizontaldrän (Tiefensicker) bei der Strecke Hannover–Würzburg [79]
Bild 93 Zweistaffelige Absenkungsanlage mit Flachbrunnen
Bild 94 Flachbrunnen mit Saugschenkel und Saugrohr [80]
Bild 95 Einspülen mit a) gesondert geführter Spüllanze (bei gröberen Böden erforderlich) [80] und b) selbstspülender Spüllanze
Bild 96 Flachwasserhaltung bei fortschreitendem Baugrubenaushub
Bild 97 Einbauvarianten einer Wellpointanlage am Beispiel einer Grabenbaustelle bei unterschiedlichen Randbedingungen [81].
Bild 98 Tiefbrunnen mit eingehängter Tauchpumpe
Bild 99 Strömungswiderstände in glatten Rohren bei Förderung von kaltem Wasser [12]
Bild 100 Wassermessung beim Ausfluss aus Rohren
Bild 101 Pumpenkennlinien (Beispiel ITT Lowara Deutschland GmbH, Großostheim)
Bild 102 Vergleich der Absenkkurven bei Schwerkraft- und Vakuumverfahren
Bild 103 Strömungs- und Druckverhältnisse an einem Vakuumbrunnen
Bild 104 Absenkkurven in Abhängigkeit von verschiedenen Durchlässigkeitsbeiwerten [89]
Bild 105 Vakuumtiefbrunnen
Bild 106 Sickerbrunnen mit 2 Messpegeln und Oberflächenabdichtung [91]
2.10 Hydraulisch bedingte Grenzzustände
Bild 1 Auf ein Bauwerk im Grundwasser wirkende Kräfte
Bild 2 Versagensformen der Bodenüberlagerung; a) Scheibe/Zylinder, b) Trapez/Kegelstumpf, c) gekrümmte Form/Rotationskörper (nach [71])
Bild 3 Auftriebsnachweis einer Dichtsohle
Bild 4 Aufschwimmen einer Bodenschicht
Bild 5 Aufbrechen einer bindigen Deckschicht
Bild 6 Hydraulischer Grundbruch, Gleichgewicht am Volumenelement [85]
Bild 7 Form des Prismas, EAU [25] und Vorschlag
Terzaghi
und
Peck
[73]
Bild 8 Gleichgewichtsbedingungen und Vertikaldruck bei einer zusätzlichen Auflast
Bild 9 Hjulström-Diagramm, Fließgeschwindigkeit und Partikeltransport [81]
Bild 10 Filter- und Dränagekriterium nach
Terzaghi
[73]
Bild 11 Struktur eines weitgestuften Sedimentbodens. Skelett aus einem Kies > 2 mm, in die Poren lose eingelagerter Sand; a) Foto eines Vergusses, b) Computertomografie
Bild 12 Suffosionskriterium von
Kenney
und
Lau
[41]
Bild 13 Nachweis der Suffosionsstabilität mit dem Selbstfiltrationsindex [82]
Bild 14 Phasen einer rückschreitenden Erosion (Piping) unter einem Damm oder Deich (nach [75])
Bild 15 Beispiel zur Definition des Kriechfaktors C nach
Bligh
[5] und
Lane
[46]
2.11 Geotechnisches Erdbebeningenieurwesen
Bild 1 Magnituden-Häufigkeitskurven; a) aus der weltweiten Datenbank [6] und b) für die Quellregion Hohenzollernalb [17]
Bild 2 Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung typischer Erdbeben
Bild 3 Antwortspektren
Bild 4 Bestimmung der Starkbebendauer D
5–95
Bild 5 a) Eingangszeitverlauf, b) generierter Zeitverlauf sowie c) Gegenüberstellung von Zielspektrum und Spektrum des generierten Zeitverlaufs
Bild 6 Synthetische Zeitverläufe für drei Szenarien an einem Standort [50];
Bild 7 Ergebnis einer probabilistischen Gefährdungsstudie für T
R
= 475 Jahre
Bild 8 Variation der PGA-Werte mit der Überschreitungswahrscheinlich innerhalb von 50 Jahren an vier Standorten [54]
Bild 9 Vergleich der bezogenen Antwortspektren für zwei Standorte in Abhängigkeit von der Wiederkehrperiode T
R
Bild 10 Karte der Spitzenbodenbeschleunigungen PGA (Felsuntergrund) nach DIN 19700 für mittlere Wiederkehrperioden von a) 500 und b) 2500 Jahren (aus [62])
Bild 11 System „Bodenschicht auf Fels“ mit den Beobachtungspunkten A, B und C
Bild 12 Aufzeichnungen aus dem Erdbeben in Mexiko-Stadt 1985 (nach [75])
Bild 13 Beziehung zwischen Spitzenbeschleunigungen an Fels und weichen Böden [83]
Bild 14 Elastisches Antwortspektrum nach DIN EN 1998-1/NA
Bild 15 Erdbebenzonen und Untergrundklassen der DIN 4149:2005 bzw. DIN EN 1998-1/NA [82]
Bild 16 Auswirkung einer Erhöhung von Periode und Dämpfung am Bespiel eines typischen Antwortspektrums (nach [85])
Bild 17 Auf den PGA-Wert bezogene, spektrale Beschleunigungen einiger starker Erdbeben mit signifikanten Anteilen an hohen Perioden, verglichen mit einem typischen Normenspektrum für weiche Böden (nach [87])
Bild 18 System, Bodenkennwerte für die zwei Böden und berechnete Antwortspektren
Bild 19 Vorgehensweise bei 2-D-Berechnungen der seismischen Bodenantwort mit vorgegebenem Spektrum an der Bodenoberfläche eines sehr tiefen Sediments [113]
Bild 20 Blockgleitverfahren nach
Newmark
Bild 21 a) Prinzip des pseudostatischen Verfahrens und b) Bewegung der Böschung bei niedrigen und höheren Frequenzen
Bild 22 Standsicherheit von Dammböschungen nach dem entkoppelten Verfahren: Geometrie, seismische Beanspruchung und Bodenkennwerte [132]
Bild 23 Standsicherheit von Dammböschungen: Bemessungskurven nach [133]
Bild 24 Verflüssigungsgrenzkurve für die CPT-basierte Methode für M = 7,5 [147]
Bild 25 Aktiver und passiver seismischer Erddruck auf eine Stützwand
Bild 26 Kräfte auf eine Wand bei seismischer Beanspruchung
2.12 Geokunststoffe in der Geotechnik und im Wasserbau
Bild 1 a) Einteilung der Geokunststoffe, b) Beispiele
Bild 2 Für Gewebe bevorzugt verwendete Garnarten und Rohstoffe [63]
Bild 3 Bindungspatronen von Geweben [130]; a) Leinenbindung, b) dreibindiger Köper, c) vierbindiger Köper
Bild 4 Verfestigung von Vliesstoffen [130]
Bild 5 Einsatzgebiete und zu berücksichtigende Funktionen (nach [157])
Bild 6 Überblick über Anwendungen von Geotextilien im Küstenschutz (Prinzipskizzen) [64]
Bild 7 Beispiele für mit Geotextilien ausgeführte Deichund Vorlanddeckwerke [63]
Bild 8 Uferlängswerk mit flexibler Fußsicherung, Port Kembla/Australien [95]
Bild 9 Verlegen der flexiblen Fußsicherungsmatte, Port Kembla/Australien [166]
Bild 10 Flexible Fußsicherung an einem Seedeich-Deckwerk [166]
Bild 11 Sicherung einer Strombuhne an der Unterweser [63]
Bild 12 Für mittlere Strömungsbelastung ausgelegte Buhne mit geotextilen Containern und Sandmatten [140]
Bild 13 Buhnenerhöhung auf der Insel Borkum [63]
Bild 14 Einbau der Sohlensicherung am Eidersperrwerk [166]
Bild 15 Beispiel eines Sinkstücks aus Gewebe mit aufgebundenen Faschinen [166]
Bild 16 Regelprofil der neuen Sohlensicherung an der seewärtigen Böschung [139]
Bild 17 Geotextile Vliesstoff-Container sind robust und verformbar
Bild 18 Temporärer Erosionsschutz auf Sri Lanka; a) Befülleinrichtung, b) fertiggestellte Baumaßnahme
Bild 19 20 m langer Mega-Sandcontainer [134]
Bild 20 Künstliches Riff, Narrowneck (Australien), fotografiert aus einem Hubschrauber [142]
Bild 21 Geotextilwall aus geotextilen Containern im landseitigen Teil einer Düne [129] (Zeichnung: Frank Göricke)
Bild 22 Sandgefüllter Schlauch
Bild 23 Prinzipskizze einer mehrlagigen Schlauchbuhne [99]
Bild 24 Objektschutz Haus Kliffende, Querprofil der künstlichen Düne aus Geotextilien [98] (nach [121])
Bild 25 Objektschutz Haus Kliffende, Dezember 1999, 10 Jahre nach dem Bau freigelegt [98}, vgl. auch [121], (Foto: Sylt-Picture, V. Frenzel)
Bild 26 Kriterien für die Auswahl einer dichten oder einer durchlässigen Deckwerksbauweise [115]
Bild 27 Regeldeckwerk am Mittellandkanal mit verklammerter Schüttsteinlage auf geotextilem Filter unter Schifffahrtsbelastung [166]
Bild 28 Schematische Darstellung einer durchlässigen Deckschicht aus losen Wasserbausteinen im Querschnitt [115]
Bild 29 Konstruktive Ausbildung einer Fußsicherung [115]
Bild 30 Geotextiler Filter freigelegt durch abgetragene Deckschicht, Bereich Olfen [143]
Bild 31 Alternativlösung zur Dichtung einer Dammstrecke [140]
Bild 32 Alternativlösung zur Dichtung einer begrenzt hohen Dammstrecke
Bild 33 Unterwassereinbau, Schiffsausweichstelle Eberswalde
Bild 34 Baumaßnahme Dortmund-Ems-Kanal
Bild 35 Sanierungslösung für einen Elbedeichquerschnitt in Sachsen-Anhalt [96]
Bild 36 Triebwasserkanal Alzkanal; a) Troggerinne, b) Trapezgerinne (Fotos: Martin Rau)
Bild 37 Baggergutentwässerung mit geotextilen Schläuchen in a) England und b) Husum (Fotos: Markus Wilke)
Bild 38 a) Erosionen an Böschungen der A 20 in Groß Sarau (2011), b) Erosionsschutz- und Begrünungshilfe aus natürlichen Werkstoffen an der A1 in Billstedt (2012) [136]
Bild 39 Anwendungsmöglichkeiten von Geotextilien in Stauhaltungsdämmen [64]
Bild 40 Anwendungsmöglichkeiten von Geotextilien im Staudammbau [64] a, b, … Lagebezeichnung, siehe Tabelle 2
Bild 41 Trinkwassertalsperre Frauenau, 1981 [107]
Bild 42 Hochwasserrückhaltebecken Schönstädt, 1985 [63]
Bild 43 Böschungsdichtungen mit Betonverbundsteinen am Beispiel des Stausees Bitburg, 1977–1979 [63]
Bild 44 Basisdichtungssystem Deponieklasse II nach TA Siedlungsabfall [147] und Deponieverordnung [26]
Bild 45 Oberflächendichtungssystem Deponieklasse II nach TA Siedlungsabfall [147] und Deponieverordnung [26]
Bild 46 Beispiel eines alternativen Oberflächendichtungssystems für Deponieklasse II, hier steile Böschung
Bild 47 Aufbau der Deponie Grabow
Bild 48 Aufbau der Deponie Eckendorfer Straße
Bild 49 Aufbau der Deponie Neu Wulmstorf
Bild 50 Deponie Neu Wulmstorf; a) Einbau der Bentonitmatte, b) Einbau der PEHD-Kunststoffdichtungsbahn
Bild 51 Deponie Furth im Wald
Bild 52 Fließdiagramm Geotextilrobustheitsklasse
Bild 53 Geotextile Trennschicht unter einem Damm nach [110]
Bild 54 Sickerstrang mit geotextilem Filter nach [110]
Bild 55 Schutz gegen Ausspülen und Ausfließen von Böschungen
Bild 56 Anwendungsbeispiele
Bild 57 Anordnung von Geogittern in Tragschichten von Logistikflächen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit [154] (Fotos: Dr. L. Vollmert)
Bild 58 Bewehrungs-Geogitter mit zusätzlicher Trenn- und Filterwirkung, AFA Hannover
Bild 59 Bewehrtes Gründungspolster mit Fundament und Überschüttung
Bild 60 Bewehrter Erdkörper über pfahlähnlichen Traggliedern [74]
Bild 61 Tragsystem und Berechnungsmodell für geokunststoffummantelte Säulen [74]
Bild 62 Vor Ort oft anzutreffende Verhältnisse vor der Überbauung von Schlammteichen
Bild 63 Mögliche Gleitlinien durch eine Stützkonstruktion
Bild 64 Mögliche Gleitlinien um eine Stützkonstruktion
Bild 65 Standsicherheitsnachweise, mögliche Bruchmechanismen
Bild 66 Typische Frontausbildungen von bewehrten Stützkonstruktionen
Bild 67 Ummantelte Geokunststoffsäulen (Foto: Josef Möbius Baugesellschaft mbH Hamburg)
Bild 68 Geogitterbewehrte Stützkonstruktion A9 Hienberg
Bild 69 Geokunststoffbewehrte Böschung Idstein; Blick von oben mit Kopfbalken
Bild 70 Geokunststoffbewehrte Böschung Idstein; oberer Querschnitt im Bereich der Natursteinmauer
Bild 71 Bewehrte Stützkonstruktion A4 Thieschitzer Berg; a) Querschnitt, b) Bauphase
Bild 72 Bewehrte Stützkonstruktion Senftenberger See; a) Querschnitt, b) Bauphase
Bild 73 Gabionenwand und aufgesetzte Steilböschung, Aalen Bahnhofstraße
Bild 74 BAB A3 Haseltal; a) während der Bauausführung und b) vor Fertigstellung
Bild 75 Ausbaustrecke 29/1 Augsburg-Olching
Bild 76 Bundesautobahn A 26 in der Nähe von Stade [12]
Bild 77 Einbau auf Seekreide, Bundesautobahn A7 in der Nähe von Füssen
Bild 78 Baumaßnahme A96 im Bereich Leutkirch (Foto: R. Schmidt)
Bild 79 Regelquerschnitt in der Wasserschutzzone II [145]
Bild 80 Hallandsås Tunnel, Schweden, nach Fertigstellung der Dichtungsarbeiten
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
C1
III
IV
V
VII
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
e1





























