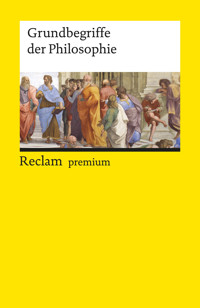
Grundbegriffe der Philosophie E-Book
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Nachschlagewerk für Einsteiger und Profis – unentbehrliche Grundlage für philosophisches Arbeiten In der Philosophie gehören die zentralen Begriffe nicht nur zum theoretischen Rüstzeug, sondern markieren jeweils Dreh- und Angelpunkte philosophischer Diskussionen. Doch wie soll man einen Einstieg, einen Überblick bekommen? Klassische Lexikoneinträge sind meist zu kurz. Fachaufsätze sind zu voraussetzungsreich. Die Grundbegriffe der Philosophie informieren daher in kurzen Essays umfassend, fundiert und allgemeinverständlich über die Bedeutung von 104 zentralen philosophischen Begriffen, von »Altruismus« über »Ästhetik«, »Idee«, »Logik« und »Wahrheit« bis hin zu »Willensfreiheit« und »Zeit«. Der Band wurde für diese Auflage vollständig überarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Grundbegriffe der Philosophie
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
11., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage 2025
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962394
2009, 2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Ausschnitt aus dem Gemälde »La Scuola di Atene« (»Die Schule von Athen«) von Raffael (1483–1520)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962394-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014672-9
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Einleitung
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Grundbegriffe der Philosophie
Altruismus/Egoismus
analytisch/synthetisch
Analytische Philosophie
a priori / a posteriori
Argument
Aristotelismus
Ästhetik
Aufklärung
Autonomie
Bedeutung
Begriffe
Bewusstsein/Selbstbewusstsein
Bild
Definition
Deontologie
Determinismus
Dialektik
Eigenschaften/Relationen
Emotionen
Empirismus
Erklärung
Ethik
Evolution
Existenz/Existenzialismus
Feministische Philosophie
Fiktion
Freiheit
Frieden
Funktion/Zweck
Geist und Seele
Gerechtigkeit
Geschichte
Gesellschaft
Glück
Gott
Grund/Gründe
Handeln
Humanismus
Idealismus
Ideen
Identität
Induktion
Intentionalität
Intuition
Kategorien
Kategorischer Imperativ
Kausalität
Kritische Theorie
Kultur
Liberalismus
Logik
Materialismus
Mensch
Metaphysik
Natur
Naturalismus
Naturgesetz
Naturrecht
Normativität
Notwendigkeit/Möglichkeit
Paradoxie
Person
Phänomenologie
Philosophie
Platonismus
Politik
Positivismus
Pragmatismus
Rationalismus
Raum
Realismus
Recht
Rechtfertigung
Reduktion
Relativismus
Religion
Scholastik
Sein
Sinn des Lebens
Skeptizismus
Sprache
Sprechakt
Substanz/Akzidens
Teil/Ganzes
Tod
Toleranz
Transzendentalphilosophie
Tugend
Universalien
Ursache/Prinzip
Utilitarismus
Utopie
Vernunft
Verstehen
Wahrheit
Wahrnehmung
Welt
Werte
Wesen
Willensfreiheit
Wissen
Wissenschaft
Zahl
Zeit
Kommentierte Literaturauswahl
Einführungen in die Philosophie
Einführungen zu Bereichen der Philosophie
Handbuchreihen
Nachschlagewerke und Wörterbücher
Philosophiegeschichte: Textsammlungen und Darstellungen
Personenregister
Sachregister
Register
Einleitung
Der vorliegende Band ist die durchgesehene und schonend ergänzte Neuauflage des Lexikons Philosophie. Hundert Grundbegriffe, das 2009 zum ersten Mal im Reclam Verlag erschien. Neben dem Titel wurde auch die Ausstattung leicht geändert: Der gelbe Papiereinband der Taschenbuchausgabe hat nun einen robusteren Umschlag, der den Erhalt dieses Arbeitsbandes auch bei intensiverer Lektüre gewährleistet. Die vergangene Zeit ist am Verzeichnis unserer Autorinnen und Autoren ablesbar: Die meisten der damals jüngeren Autorinnen und Autoren gehören mittlerweile zum akademischen Establishment; viele der damals älteren Autoren sind inzwischen emeritiert, einige mittlerweile verstorben.
Wichtigstes Argument des Verlags und der Herausgeber für die Neuauflage ist der Umstand, dass sich der Band in der philosophischen Lehr- und Lernpraxis bewährt hat, sei es als Einstiegsbuch für den philosophisch Interessierten, als Lektüre für fachphilosophische Veranstaltungen oder als allgemeiner Studienbegleiter. Um der Entwicklung in der philosophischen Debatte der letzten Jahre Rechnung zu tragen, wurde den Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gegeben, die Auswahlliteratur zu ihren jeweiligen Artikeln zu ergänzen und zu aktualisieren. Auch in die kommentierte Bibliographie mit weiterführender Literatur am Ende des Bandes haben wir ausgewählte neuere Publikationen eingearbeitet. Die Liste der Stichworte wurde gegenüber dem Vorgängerband nicht verändert. Sie basiert weiterhin auf der Auswertung der Stichwortlisten anderer wichtiger Nachschlagewerke und einschlägiger Fachdiskussionen sowie auf den Debatten, die wir seinerzeit mit unseren Autorinnen und Autoren sowie anderen uns mit Rat zur Seite stehenden Philosophinnen und Philosophen geführt haben.
Bei alledem ist die dreifache Zielsetzung der Grundbegriffe Philosophie gleich geblieben. Viele der in der philosophischen Fachdebatte zentralen Begriffe kommen im Gewand alltäglicher Ausdrücke daher, denen man ihre theoretisch aufgeladene, fachphilosophische Bedeutung nicht ohne weiteres ansieht. Hier soll unser Band als kompaktes Nachschlagewerk Abhilfe schaffen und die interessierte Leserin verlässlich, klar und prägnant über 101 debattenprägende philosophische Begriffe informieren – und dies umfassender als ein reines Wörterbuch.
Nun kann man philosophische Grundbegriffe nicht überzeugend erläutern, ohne auf die philosophischen Debatten einzugehen, deren Dreh- und Angelpunkte die Begriffe markieren. Es lässt sich beispielsweise nicht sagen, was unter ›Willensfreiheit‹ zu verstehen ist, ohne dass man philosophische Theorien des freien Willens erörtert. Wer wirklich Aufschluss über den philosophischen Begriff des ›Naturrechts‹ gewinnen will, der muss sich auf den Austausch von Gründen und Argumenten einlassen; ein bloßes Verzeichnen berühmter Meinungen greift in jedem Fall zu kurz. Entsprechend bietet Grundbegriffe der Philosophie einen – auf die Bedürfnisse des Einsteigers oder der fortgeschrittenen Anfängerin zugeschnittenen – Überblick über zentrale Debatten der Philosophie, ihre Protagonisten, die wichtigsten Positionen und die wirkungsmächtigsten Argumente.
Die vorgestellten Grundbegriffe können auf eine illustre Geschichte zurückblicken. Zugleich spielen sie nach wie vor eine wichtige Rolle in der gegenwärtigen Fachphilosophie. So erfüllt Grundbegriffe der Philosophie noch eine dritte Funktion: Es ist ein kompaktes und verständliches Einführungsbuch in das aktuelle philosophische Geschehen, gleichsam kollektiv verfasst von 73 Autorinnen und Autoren aus ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten der Philosophie und anderen Disziplinen, alle mit je eigenem akademischen Hintergrund und unterschiedlichen philosophischen Überzeugungen. Man kann Grundbegriffe der Philosophie in die Hand nehmen, an einer beliebigen Stelle in die aktuelle Debatte hineinspringen und – je nachdem, welchen Verweisen man folgt – auf unterschiedlichem Kurs durch die philosophische Gegenwartsdiskussion navigieren.
Damit die Grundbegriffe der Philosophie ihren Aufgaben als Nachschlagewerk, Debattenüberblick und Einführungsbuch möglichst gut nachkommen können, haben sich die Autorinnen und Autoren bemüht, einem vorgegebenen Artikelschema zu folgen: Die Artikel beginnen mit einer hinführenden Erläuterung des Grundbegriffs. Diese geht nur dann auf die Herkunft des Ausdrucks ein, wenn diese für dessen fachphilosophische Bedeutung hilfreich ist. (In vielen Fällen würde die Etymologie sachlich in die Irre führen.) An die hinführende Erläuterung schließt sich ein zumeist sowohl historischer als auch systematischer Darstellungsteil an. Die Artikel enden mit einer kurzen Liste möglichst aktueller Überblicksliteratur, welche die im Text genannten Titel ergänzt. Angeführt werden also nicht die benutzten Quellen, sondern von unseren Autoren zusammengetragene Empfehlungen für die weiterführende Lektüre. Um die weiterführende Lektüre zu erleichtern, haben wir dazu im Anhang eine kommentierte Auswahl an philosophischen Nachschlagewerken und Einführungsbüchern zusammengestellt.
Querverweise auf andere Stichworte sind in den Artikeln mit einem Pfeil (→) gekennzeichnet. Die Abkürzung der Stichworte kann sich auf Singular oder Plural beziehen; so kann ›B.‹ im betreffenden Artikel sowohl ›Begriff‹ als auch ›Begriffe‹ bedeuten. Genus, Numerus und Kasus bleiben in der Abkürzung ebenfalls unberücksichtigt. Weitere Abkürzungen folgen der Standardisierung des Grammatik-DUDEN. Wichtig ist uns der Hinweis, dass mit Blick auf den knapp bemessenen Raum die Nennung beider Geschlechter nicht möglich war, aber immer mitgedacht werden sollte.
Bielefeld/München, im Sommer 2019
Christian Nimtz und Stefan Jordan
Die Neuauflage der Grundbegriffe der Philosophie wurde um die Artikel »Deontologie«, »Feministische Philosophie« und »Grund/Gründe« erweitert. Die Autorinnen und Autoren haben ihre Texte durchgesehen und formale Fehler behoben. Außerdem haben sie die Auswahlbibliographien am Ende ihrer Artikel aktualisiert. Ebenfalls aktualisiert wurden die Angaben im Verzeichnis der Autorinnen und Autoren sowie die am Ende des Bandes vorgestellte kommentierte Literaturauswahl.
Bielefeld/München, im Frühjahr 2025
Christian Nimtz und Stefan Jordan
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Ruhestand bei Professorinnen und Professoren zeigen wir einheitlich durch ein »em.« an.
EMIL ANGEHRN
,
Jg.
1946,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Basel.
ANSGAR BECKERMANN
,
Jg.
1945,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Bielefeld.
SINGA BEHRENS
,
Jg.
1992,
Dr.
phil., Wiss. Mitarbeiterin im Bereich Praktische Philosophie an der Universität Bielefeld.
EIKE BOHLKEN
,
Jg.
1967,
Dr.
phil., Professor für Ethik an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
NRW
, Abteilung Köln.
CHRISTINE BRATU
,
Jg.
1981,
Dr.
phil., Professorin für Philosophie mit einem Schwerpunkt in der Genderforschung an der Georg-August-Universität Göttingen.
ELKE BRENDEL
,
Jg.
1962,
Dr.
phil., Professorin für Philosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
MARTIN CARRIER
,
Jg.
1955,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Bielefeld.
ALBERT CASULLO
,
Jg.
1949, Ph. D., Professor für Philosophie an der University of Nebraska, Lincoln,
USA
.
JONATHAN DANCY
,
Jg.
1946, B. Phil., Professor für Philosophie an der University of Texas, Austin,
USA
, und Forschungsprofessor der University of Reading.
SABINE A. DÖRING
,
Dr.
phil., Professorin für Praktische Philosophie an der Eberhard Karls Universität Tübingen.
GERHARD ERNST
,
Jg.
1971,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
VOLKER GERHARDT
,
Jg.
1944,
Dr.
phil.,
Dr.
h. c.
, Professor (em.) für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
BERNWARD GESANG
,
Jg.
1968,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Mannheim.
HANS-JOHANN GLOCK
,
Jg.
1960,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Zürich.
FRIEDRICH WILHELM GRAF
,
Jg.
1948,
Dr.
theol., Professor (em.) für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
VOLKER HALBACH
,
Jg.
1965,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Oxford University, Fellow von New College, Oxford.
MICHAEL HEIDELBERGER
,
Jg.
1947,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie mit Schwerpunkt Logik und Philosophie der Naturwissenschaften an der Eberhard Karls Universität Tübingen.
NORBERT HOERSTER
,
Jg.
1937,
Dr.
iur.,
Dr.
phil., Professor (em.) für Rechts- und Sozialphilosophie am Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
HANS HEINZ HOLZ
, 1927–2011,
Dr.
phil.,
Dr.
h. c.
, Professor (em.) für Philosophie an der Rijksuniversiteit Groningen.
DETLEF HORSTER
,
Jg.
1942,
Dr.
phil., Professor (em.) für Sozialphilosophie an der Leibniz Universität Hannover.
JOHANNES HÜBNER
,
Jg.
1968,
Dr.
phil., Professor für Theoretische Philosophie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
ANDREAS HÜTTEMANN
,
Jg.
1964,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität zu Köln.
FRIEDRICH JAEGER
,
Jg.
1956,
Prof.
Dr.
phil., Permanent Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.
LUDGER JANSEN
,
Jg.
1969,
Dr.
phil., Cusanus-Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen (Italien) und außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der Universität Rostock.
STEFAN JORDAN
,
Jg.
1967,
Dr.
phil., Wiss. Angestellter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München.
GEERT KEIL
,
Jg.
1963,
Dr.
phil., Professor für Philosophische Anthropologie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
ANDREAS KEMMERLING
,
Jg.
1950,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie am Philosophischen Seminar der Ru-precht-Karls-Universität Heidelberg.
HARTMUT KLIEMT
,
Jg.
1949,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.
NIKOLA KOMPA
,
Jg.
1970,
Dr.
phil., Professorin für Theoretische Philosophie an der Universität Osnabrück.
ULRICH KROHS
,
Jg.
1961,
Dr.
rer. nat., Professor für Philosophie an der Universität Münster.
CHRISTOPH LUMER
,
Jg.
1956,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Siena.
HOLGER LYRE
,
Jg.
1965,
Dr.
phil., Dipl.-Physiker, Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Magdeburg.
THOMAS MACHO
,
Jg.
1952,
Dr.
phil., Professor (em.) für Kulturgeschichte am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.
GEORG MEGGLE
,
Jg.
1944,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Leipzig. Ehrenpräsident der Gesellschaft für Analytische Philosophie (
GAP
).
UWE MEIXNER
,
Jg.
1956,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Augsburg.
CATRIN MISSELHORN
,
Dr.
phil., Professorin für Philosophie mit einem Schwerpunkt in der Theoretischen Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen.
BURKHARD MOJSISCH
, 1944–2015,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
CHRISTIAN NIMTZ
,
Jg.
1968,
Dr.
phil., Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Bielefeld.
ULRICH NORTMANN
,
Jg.
1956,
Dr.
phil., Professor (em.) für Theoretische Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.
DAVID PAPINEAU
,
Jg.
1947, Ph. D., Professor für Philosophie am King’s College, London, und am City University New York Graduate Center.
MICHAEL PAUEN
,
Jg.
1956,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Sprecher der »Berlin School of Mind and Brain«.
MICHAEL QUANTE
,
Jg.
1962,
Dr.
phil., Professor für Philosophie am Philosophischen Seminar der Universität Münster.
GEORGES REY
,
Jg.
1945, Ph. D., Professor für Philosophie an der University of Maryland at College Park,
USA
.
ROBERT C. RICHARDSON
,
Jg.
1949, Ph. D., Charles Phelps Taft Professor für Philosophie an der University of Cincinnati, Ohio,
USA
.
FRIEDO RICKEN
, 1934–2021,
Dr.
phil.,
Dr.
theol., Professor (em.) für Geschichte der Philosophie und Ethik an der Hochschule für Philosophie
S.
J. München.
WOLFGANG RÖD
, 1926–2014,
Dr.
phil.,
Dr.
phil.
h. c.
, Professor (em.) für Philosophie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
TOBIAS ROSEFELDT
,
Jg.
1970,
Dr.
phil., Professor für Klassische Deutsche Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
SVEN ROSENKRANZ
,
Jg.
1969,
Dr.
phil., Forschungsprofessor am »Catalan Institute for Research and Advanced Studies« (
ICREA
), Barcelona (Spanien).
JÖRN RÜSEN
,
Jg.
1938,
Dr.
phil., Professor (em.) für Allgemeine Geschichte und Geschichtskultur an der Universität Witten/Herdecke und Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen.
KATIA SAPORITI
,
Jg.
1964,
Dr.
phil., Professorin für Philosophie an der Universität Zürich.
RICHARD SCHANTZ
,
Jg.
1950,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Siegen.
REINOLD SCHMÜCKER
,
Jg.
1964,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Münster.
HERBERT SCHNÄDELBACH
, 1936–2024,
Dr.
phil., Professor (em.) für Theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
BENJAMIN SCHNIEDER
,
Jg.
1974,
Dr.
phil., Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Wien.
OLIVER R. SCHOLZ
,
Jg.
1960,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Münster.
MICHAEL SCHÜTTE
,
Jg.
1970,
Dr.
phil., Nürnberg.
PETER SCHULTHESS
,
Jg.
1953,
Dr.
phil., Professor (em.) für Theoretische Philosophie an der Universität Zürich.
WOLFGANG SCHWARZ
,
Jg.
1975,
Dr.
phil., Lecturer an der University of Edinburgh (Schottland).
GERHARD SCHWEPPENHÄUSER
,
Jg.
1960,
Dr.
phil., Professor für Design- und Medientheorie an der Fakultät Gestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg und Privatdozent für Philosophie an der Universität Kassel.
PETER SIMONS
,
Jg.
1950,
Dr.
phil., F. B. A., M. Acad. Eur., M. R. I. A., M. Pol. Acad. Sci., Professor (em.) für Philosophie am Trinity College Dublin (Irland).
THOMAS SPITZLEY
,
Jg.
1957,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.
WOLFGANG SPOHN
,
Jg.
1950,
Dr.
phil.,
Dr.
h. c.
, Professor (em.) für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Konstanz und Seniorprofessor an der Eberhard Karls Universität Tübingen.
JAKOB STEINBRENNER
,
Jg.
1959,
Dr.
phil., außerplanmäßiger Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart.
MARKUS STEPANIANS
,
Jg.
1959,
Dr.
phil., Professor für Politische Philosophie an der Universität Bern.
ACHIM STEPHAN
,
Jg.
1955,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie der Kognition am Institut für Kognitionswissenschaft der Universität Osnabrück.
RALF STOECKER
,
Jg.
1956,
Dr.
phil., Professor (em.) für Praktische Philosophie an der Universität Bielefeld.
JÜRGEN STOLZENBERG
,
Jg.
1948,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Universität Halle-Wittenberg.
NIKO STROBACH
,
Jg.
1969,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Münster.
HOLM TETENS
,
Jg.
1948,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Freien Universität Berlin.
CHRISTIAN THIES
,
Jg.
1959,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Universität Passau.
WILHELM VOSSENKUHL
,
Jg.
1945,
Dr.
phil., Professor (em.) für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
BERNHARD WALDENFELS
,
Jg.
1934,
Dr.
phil.,
Dr.
h. c.
, Professor (em.) für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
HEINRICH WANSING
,
Jg.
1963,
Dr.
phil., Professor für Logik und Erkenntnistheorie an der Ruhr-Universität Bochum.
TORSTEN WILHOLT
,
Jg.
1973,
Dr.
phil., Professor für Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover.
MARCUS WILLASCHEK
,
Jg.
1962,
Dr.
phil., Professor für Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Grundbegriffe der Philosophie
Altruismus/Egoismus
Ein Ziel einer Person ist altruistisch, wenn es darin besteht, das Wohl eines anderen Lebewesens zu befördern. Jemand handelt (u. a.) aus einem altruistischen Motiv, (a) wenn er annimmt, wenigstens eine der Folgen seiner Handlung sei die Beförderung des Wohls anderer Lebewesen, und (b) wenn er diese Beförderung des Wohls in entscheidungsbeeinflussender Weise als an sich gut bewertet. Man kann ein altruistisches Ziel verfolgen, ohne altruistische Motive zu haben – ein Verkäufer mag z. B. einem Kunden durch Beratung helfen wollen und dabei nur an der Kundenbindung, seinem Einkommen und letztlich den Genüssen, die er sich damit leisten kann, interessiert sein.
›Egoistisches Ziel‹ bzw. ›egoistisches Motiv‹ lassen sich nicht analog als Beförderung des eigenen Wohls definieren, da nach gängiger Nutzentheorie gilt: Wenn eine Person eine Handlungsfolge p der Folge q vorzieht (und kohärent ist), dann hat p für diese Person einen höheren Nutzen als q – völlig unabhängig vom Inhalt von p oder q, also selbst dann, wenn es bei p um das Wohl anderer (›Mein Kind ist zufrieden‹) und bei q um das eigene Wohl (›Ich genieße meine Ruhe‹) geht. Demnach wäre jedes kohärente Entscheiden egoistisch (Christoph Lumer, Rationaler Altruismus, 2009). Ein Ziel einer Person ist vielmehr egoistisch, wenn es subjektzentrisch ist, d. h. die Gefühle des Subjekts selbst oder sein Ansehen bei anderen oder seine Macht usw. betrifft; jemand handelt aus einem egoistischen Motiv, wenn der in diesem Motiv als an sich gut oder schlecht bewertete Sachverhalt subjektzentrisch ist.
Die Ausdrücke ›E.‹ und ›A.‹ bezeichnen einerseits Einstellungen, andererseits bestimmte Theorien. Jemand handelt im starken Sinn altruistisch, wenn die Motive seines Handelns überwiegend (nach der Stärke, nicht nach der Anzahl) altruistisch sind; und er handelt im schwachen Sinn altruistisch, wenn die Ziele seines Handelns überwiegend altruistisch sind. Man sagt in diesem Fall auch, der Betreffende handele ›aus A.‹, also aus einer altruistischen Einstellung. ›Egoistisches Handeln‹, ›egoistische Einstellung‹ und ›Handeln aus E.‹ sind in der Philosophie analog definiert. Alltagssprachlich wird ›E.‹ allerdings enger verstanden, nämlich als rücksichtsloses Verfolgen egoistischer Ziele.
Der psychologische A. ist die empirische Theorie, dass normal entwickelte erwachsene Menschen altruistische Motive haben und gelegentlich aus diesen handeln. Einen psychologischen A., der neben egoistischen Motiven ein genuin altruistisches Wohlwollen oder in altruistischem Handeln mündendes Mitgefühl annimmt, vertraten Francis Hutcheson, Shaftesbury, Samuel Butler, David Hume, Adam Smith und Arthur Schopenhauer. Der Psychologe Daniel Batson hat in einer Serie von ingeniösen Versuchen gezeigt, dass viele Menschen vermittelt über Empathie mit anderen, die der Hilfe bedürfen oder für die Hilfe vorteilhaft ist, aus altruistischen Motiven handeln, und er hat für viele solcher Handlungen egoistische Erklärungen widerlegt. Dem u. a. von Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Bernard Mandeville und Sigmund Freud vertretenen psychologischen E. zufolge handeln Menschen dagegen immer aus egoistischen Motiven. Der psychologische E. nimmt insbesondere an, dass durch Mitgefühl induziertes Wohlwollen ein egoistisch begründetes Motiv ist: Da das unangenehme Gefühl des Mitleids durch die Verbesserung der Lage des anderen verschwindet, wird dem Mitfühlenden unterstellt, dieser wolle letztlich nur seinen eigenen Gefühlszustand verbessern. Was wir für A. halten, ist demnach immer versteckter E. Diese Unterstellung wird aber durch den sozialpsychologischen Befund widerlegt, dass Personen auch dann aus Mitleid helfen, wenn sie nicht hoffen können, aus der Hilfe hedonischen Nutzen zu ziehen (Heinz Heckhausen, Motivation und Handeln, 21989, Kap. 9). Evolutionsbiologen haben eine Reihe von Erklärungen entwickelt, warum – trotz des für das Überleben scheinbar zwingend erforderlichen E. – altruistische Motive und weit verbreitetes altruistisches Handeln evolutionär selektiert werden konnten (biologischer A.; →Evolution).
Ethischer A. (→Ethik) ist jede normativ-ethische Theorie, nach der in bestimmten Situationen das Verfolgen altruistischer Ziele geboten ist oder es zum moralischen Ideal gehört, altruistische Motive oder Ziele zu haben. Der ethische E. hingegen fordert, immer nur egoistische Ziele und Motive zu haben. Die meisten Ethiker sind ethische Altruisten; Friedrich Nietzsche hingegen war ethischer Egoist. Eine rein rational begründete Vertragstheorie der gegenseitigen Kooperation (Hobbes, David Gauthier) steht dem ethischen E. zumindest nahe.
Rationaler oder prudentieller A. ist eine Theorie, nach der es rational oder klug ist, altruistische Ziele zu verfolgen (→Vernunft). Der rationale oder prudentielle E. hingegen hält allein die Verfolgung egoistischer Ziele für rational oder klug. Der rationale A. ist eine starke und verbreitete Form der Moralbegründung, zu der es mehrere Ansätze gibt: (1) Wohlwollens- oder Mitgefühlsethiken setzen auf die vom psychologischen A. festgestellten altruistischen Motive (Richard Brandt). Da diese relativ schwach sind, bleiben zur Durchsetzung einer stärkeren Moral normative Ergänzungen erforderlich (Schopenhauer, Christoph Lumer). (2) Humanistische Psychologen betonen, dass Altruisten glücklicher sind als Egoisten (hedonisches Paradox) und dass echte Selbstakzeptanz sowie tiefe zwischenmenschliche Beziehungen automatisch ein erhebliches Maß an A. einschließen (Erich Fromm). (3) Einigen Theorien praktischer Gründe zufolge stehen uns die eigenen künftigen Präferenzen nicht näher als die Präferenzen anderer. Wenn es rational ist, Erstere zu berücksichtigen, dann gilt dies auch für Letztere (Henry Sidgwick, Thomas Nagel, Derek Parfit, John Broome).
Christoph Lumer
C. Daniel Batson: Altruism in Humans. Oxford 2011.
Christoph Lumer: Altruismus. Probleme und Fragestellungen in der philosophischen Debatte. In: Dagmar Kiesel / Thomas Smettan / Sebastian Schmidt (
Hrsg.
): Altruismus. Interdisziplinäre Perspektiven. Berlin 2024.
S.
1–23.
Georg Mohr: [
Art.
] Altruismus/Egoismus. In: Hans Jörg Sandkühler (
Hrsg.
): Enzyklopädie Philosophie. Hamburg 2010.
Bd.
1.
S.
60–67.
Samir Okasha: [
Art.
] Biological Altruism. In: Edward N. Zalta (
Hrsg.
): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition). Online: https://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/altruism-biological/
Niall Scott / Jonathan Seglow: Altruism. Milton Keynes 2007.
analytisch/synthetisch
Ein Satz ist a., wenn seine →Wahrheit oder Falschheit durch die Bedeutungen der in ihm enthaltenen Ausdrücke festgelegt ist. Um den Wahrheitswert eines a. Satzes wie z. B. ›Alle Junggesellen sind unverheiratet‹ einzusehen, genügt es, ihn zu verstehen. Ein Satz ist s., wenn seine Wahrheit oder Falschheit davon abhängt, was in der Welt der Fall ist. S. Sätze wie z. B. ›Alle Menschen sind sterblich‹ müssen wir wohl stets empirisch überprüfen. Wenige zeitgenössische Philosophen folgen Immanuel Kant in der Annahme, es gäbe s.Wahrheiten →a priori (→Transzendentalphilosophie).
In seinem Treatise of Human Nature (1739) unterschied David Hume Bedeutungs- von Tatsachenwahrheiten. Ähnlich grenzte Kant in der Kritik der reinen Vernunft (1781, 21787) Sätze, bei denen das Prädikat schon im Subjekt enthalten ist, von Sätzen ab, bei denen dies nicht der Fall ist. Erste nannte er »analytisch«, Letztere »synthetisch«. Da diese Erklärung auf Subjekt-Prädikat-Sätze eingeschränkt ist, war seit Kant umstritten, wie eine allgemeine Definition lauten muss. Gottlob Freges (Grundlagen der Arithmetik, 1884) einflussreichem Vorschlag zufolge ist ein Satz genau dann a., wenn er sich durch Austausch synonymer Ausdrücke in eine logische Wahrheit (→Logik) umwandeln lässt. So lässt sich der Satz ›Alle Junggesellen sind Männer‹ durch Austausch von ›Junggeselle‹ durch ›unverheirateter Mann‹ in die logische Wahrheit ›Alle unverheirateten Männer sind Männer‹ überführen.
Für den logischen Empirismus (→Empirismus, Positivismus) war die Unterscheidung zwischen a. und s. Sätzen fundamental. Die logischen Empiristen führten die →Notwendigkeit und den →A-priori-Charakter der Sätze der Logik, Mathematik und Philosophie auf deren Analytizität zurück (Alfred Ayer, Language, Truth and Logic, 1936, dt. 1970). Sie hielten →Metaphysik für sinnlos, da metaphysische Sätze weder s. noch a. seien (Rudolf Carnap, »Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache«, in: Erkenntnis 2, 1931). Dazu erklärten sie die besondere Stellung der Philosophie dadurch, dass Philosophen anders als Naturwissenschaftler durch Begriffsanalyse a. Wahrheiten ermitteln. Verwandte Ansichten finden sich bei Ludwig Wittgenstein (Friedrich Waismann, The Principles of Linguistic Philosophy, 1965; →Analytische Philosophie).
Willard V. O. Quines »Two Dogmas of Empiricism« (in: The Philosophical Review 60, 1951) stellte diese Ideen radikal und einflussreich in Frage. Quine argumentierte, dass sich der Begriff der Analytizität nicht empirisch informativ erklären lasse und kein Satz gegen empirische Widerlegung gefeit sei. Er folgerte, dass die Unterscheidung zwischen a. und s. Sätzen unhaltbar und das logisch-empiristische Bild von Bedeutung, Wissen und Erfahrung falsch sei. In der Folge Quines lehnen viele Philosophen die Unterscheidung ab, weisen jede Form der Begriffsanalyse als philosophische Methode zurück und verstehen Philosophie als analog zu den Naturwissenschaften (→Naturalismus).
Heutige Philosophen betrachten Quines Argumente zumeist als wenig überzeugend und akzeptieren a. Sätze ebenso wie philosophische Begriffsanalyse (David Lewis, Frank Jackson). Allerdings wird a. Sätzen selten ausdrücklich eine theoretische Schlüsselrolle zugewiesen. Anders als die logischen Empiristen denkt gegenwärtig kaum jemand, dass Notwendigkeit und Apriorität generell auf Analytizität beruhen oder dass die Sätze der Mathematik a. sind.
Christian Nimtz
Joachim Horvarth: [
Art.
] Analytizität. In: Nikola Kompa (
Hrsg.
): Handbuch Sprachphilosophie. Stuttgart 2015.
S.
309–317.
Cory Juhl / Eric Loomis: [
Art.
] Analytic Truth. In: Gillian Russell / Delia Graff Fara (
Hrsg.
): Routledge Companion to Philosophy of Language. New York 2012.
S.
231–241.
Brian Weatherson: [
Art.
] Analytic–Synthetic and A Priori–A Posteriori. In Herman Cappelen / Tamar Gendler / John Hawthorne (
Hrsg.
): The Oxford Handbook of Philosophical Methodology. Oxford 2016,
S.
231–248.
Analytische Philosophie
Die A. P. ist eine der einflussreichsten Richtungen der Gegenwartsphilosophie. Entgegen verbreiteten Annahmen ist sie keine durch thematische, doktrinäre oder methodologische Ideen zusammengehaltene Schule, sondern eine lose und weitverzweigte philosophische Strömung, welche die zeitgenössische philosophische Diskussion insbesondere im angelsächs. Sprachraum prägt.
Die A. P. hat zwei Wurzeln, die in das 19. Jh. zurückreichen: (1) Bei der logischen Analyse im Anschluss an Gottlob Frege und Bertrand Russell werden Sätze mittels formaler Kunstsprachen (→Logik) so paraphrasiert, dass ihre logischen Beziehungen deutlich zutage treten. Die logische Analyse zielt darauf, die von der grammatischen Oberflächenstruktur verdeckte ›logische Form‹ der zu analysierenden Sätze aufzudecken und durch ›Weganalysieren‹ problematischer Ausdrücke im Satzkontext – paradigmatisch ausgeführt in Russells Theorie der Kennzeichnungen (»On Denoting«, in: Mind 14, 1905) – unnötige Existenzannahmen zu vermeiden (→Ontologie). (2) Die Begriffsanalyse, wie sie beispielhaft George Edward Moore (Principia Ethica, 1903) betrieb, beruht auf der Annahme, philosophische Fragen ließen sich nicht unmittelbar beantworten, sondern müssten zunächst dadurch hinterfragt und geklärt werden, dass man die in ihnen auftauchenden →Begriffe in ihre Bestandteile zerlegt und analysiert und so definiert. Sowohl logische als auch begriffliche Analyse dienen nicht nur propädeutischen Zwecken, sondern sollen zur Lösung traditioneller philosophischer Probleme beitragen.
Mit Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus (1921) begann die oft mit der A. P. assoziierte Wende zur →Sprache (linguistic turn). Künstliche Zeichensysteme decken, so Wittgenstein, Strukturen auf, die jede Sprache besitzen muss, um die Wirklichkeit abbilden zu können. Legitime Philosophie ist laut Wittgenstein »Sprachkritik«. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften stellt sie selbst keine Sätze über die Wirklichkeit auf, sondern klärt durch logische und begriffliche Analyse den Sinn nichtphilosophischer Sätze. Dabei soll sich zugleich herausstellen, dass die →Metaphysik nur Pseudofragen durch ›Scheinsätze‹ beantwortet.
Diese Idee beeinflusste die logischen Empiristen (→Positivismus). Für sie sind metaphysische Sätze unsinnig, da diese im Gegensatz zu Logik und Mathematik nicht analytisch sind und sich im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Sätzen durch Erfahrung nicht überprüfen lassen. Die Philosophie wird zur ›Logik der Wissenschaften‹ (Rudolf Carnap, Logische Syntax der Sprache, 1934); sie reduziert alle sinnvollen Sätze auf solche, die sich ausschließlich auf private Sinnesdaten bzw. physikalische Phänomene beziehen.
Die logischen Empiristen prägten Stil und Interessen der A. P. entscheidend mit, gaben aber ihre Metaphysikkritik schrittweise auf. Das Projekt der reduktiven Analyse wurde zudem vom späten Wittgenstein (Philosophische Untersuchungen, 1953) und der von ihm beeinflussten ›Philosophie der Normalen Sprache‹ (Gilbert Ryle, John L. Austin, Peter Strawson) in Frage gestellt. Gemäß dieser begriffsanalytischen Strömung gibt es weder eine philosophisch ›ideale Sprache‹ noch logische Strukturen, die sich durch Analyse natürlicher Sprachen entdecken lassen. Stattdessen werden philosophische Probleme durch die Beschreibung des Gebrauchs und der begrifflichen Zusammenhänge der in natürlichen Sprachen auftretenden Ausdrücke geklärt.
Im Gegensatz sowohl zum logischen Empirismus als auch zur Begriffsanalyse bezweifelte Willard V. O. Quine, dass man überhaupt zwischen analytischen Sätzen der Philosophie und synthetischen Sätzen der Naturwissenschaften unterscheiden kann (→analytisch/synthetisch). Im Gefolge Quines hängen viele zeitgenössische Analytiker einem →Naturalismus an und vertreten die Auffassung, die Philosophie sei lediglich ein Teil bzw. Anhängsel der empirischen Wissenschaften. Andere glauben, auf der Grundlage von Saul Kripkes (Naming and Necessity, 1980) essenzialistischer Metaphysik könne die A. P. autonome Einsichten in das →Wesen der Welt liefern. Die Wende zur Sprache ist durch zwei jüngere Entwicklungen noch weiter rückgängig gemacht worden: Vertreter der ›kognitiven Revolution‹, wie z. B. Jerry Fodor (Psychosemantics, 1987), suchen den Schlüssel zum Verständnis von Sprache und →Geist nicht mehr in intersubjektiv zugänglichem Verhalten, sondern im Geist bzw. Gehirn von Individuen. Schließlich wurde die Beschränkung der Moralphilosophie (→Moral) auf die ›meta-ethische‹ Analyse moralischer Begriffe und Aussagen aufgehoben, so dass normative und angewandte Ethik sowie politische Theorie blühende Zweige der A. P. sind.
Angesichts dieser thematischen, doktrinären und selbst methodologischen Vielfalt ziehen sich manche zeitgenössischen Analytiker auf ein stilistisches Selbstverständnis zurück. Im Gegensatz besonders zur ›kontinentalen‹ Philosophie soll die A. P. drei Bedingungen erfüllen: Sie strebt (1) die Lösung oder Auflösung inhaltlicher Probleme an, statt sich auf Philosophiegeschichte bzw. die Interpretation philosophischer Texte zu beschränken; sie verfährt (2) rational, d. h., weist ihre Fragen und Antworten argumentativ aus, anstatt sich auf Autoritäten oder Eingebungen zu berufen; und sie drückt sich (3) auf klare und eindeutige Weise aus. Diese weite, unhistorische Auffassung impliziert allerdings, dass die Mehrheit aller Philosophen analytisch ist, zeichnet doch der Anspruch, fundamentale Probleme auf rational nachvollziehbare Weise zu lösen, das Fach seit Sokrates aus. Es ist angemessener, die A. P. als historisch gewachsene Tradition zu verstehen, deren Vertreter durch wechselseitige Beeinflussung und überlappende ›Familienähnlichkeiten‹ zusammengehalten werden.
Hans-Johann Glock
Mike Beaney (
Hrsg.
): The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford 2009.
Hans-Johann Glock: What is Analytic Philosophy? Cambridge 2008.
Edward Kanterian: Analytische Philosophie. Frankfurt
a. M.
/ New York 2004.
Albert Newen: Analytische Philosophie zur Einführung. Hamburg 2005.
2
2007.
Peter Prechtl (
Hrsg.
): Grundbegriffe der Analytischen Philosophie. Stuttgart/Weimar 2004.
a priori / a posteriori
In der Erkenntnistheorie grenzt man erfahrungsunabhängiges Wissen als A-priori-Wissen von empirischem Wissen als A-posteriori-Wissen ab. Nach traditioneller Auffassung liefern die Naturwissenschaften (→Wissenschaft) A-posteriori-Wissen, während →Logik und Mathematik (→Zahl) A-priori-Wissen erzeugen. →Rationalisten und →Empiristen sind uneins über die Natur und den Umfang des A-priori-Wissens.
Die traditionelle Definition von A-priori-Wissen geht auf Immanuel Kant (Kritik der reinen Vernunft, 1781, 21787) zurück. Kant bestimmte A-priori-Wissen als »absolut unabhängig von aller Erfahrung« und kontrastierte es mit Wissen, das seine »Quellen« in der Erfahrung hat und das er als »a posteriori« (oder »empirisch«) beschrieb. Aber Kants Definition ist problematisch. Einerseits lässt sie zu, dass A-priori-Wissen doch von Erfahrung abhängt. So räumte Kant z. B. ein, zum Erwerb der →Begriffe, die in einer a priori gewussten Proposition (d. i. der Inhalt, der ausgesagt oder gewusst wird) vorkommen, benötige man oftmals Erfahrung. Andererseits arbeitete Kant nicht heraus, in welcher Hinsicht A-priori-Wissen unabhängig von Erfahrung sein soll. Man kann Kants Definition von A-priori-Wissen und A-priori-Rechtfertigung daher präziser so fassen: Eine Person S weiß genau dann a priori, dass p (wobei p eine Proposition ist), wenn S Überzeugung, dass p, a priori gerechtfertigt ist und die anderen Anforderungen an Wissen erfüllt sind; und S Überzeugung, dass p, ist genau dann gerechtfertigt, wenn S Rechtfertigung für die Überzeugung, dass p, nicht von Erfahrung abhängt.
Zeitgenössische Philosophen bringen zwei Einwände gegen Kants Definition vor. Einige Kritiker betrachten diese als nicht hinreichend informativ, da sie rein negativ ist: Kants Definition verrät uns nur, dass die Quelle von A-priori-Rechtfertigung nichtErfahrung ist, aber sie sagt uns nicht, was hier als Quelle in Frage kommt. Anhänger dieses Einwands ziehen eine positive Charakterisierung von A-priori-Rechtfertigung vor: S Überzeugung, dass p, ist genau dann a priori gerechtfertigt, wenn S Überzeugung, dass p, durch eine Quelle Φ gerechtfertigt ist, wobei Φ auf eine spezifische Quelle erfahrungsunabhängiger Rechtfertigung Bezug nimmt. Verschiedene Theoretiker geben verschiedene Beschreibungen der betreffenden Quelle; diese enthalten typischerweise den Begriff der notwendigen Wahrheit. So behauptet Laurence BonJour, eine A-priori-Rechtfertigung der Überzeugung, dass p, schließe ein intuitives Erfassen davon ein, dass p notwendig wahr ist (→Intuitionen, Notwendigkeit).
Den zweiten Einwand formulieren Philosophen, die Kants negative Charakterisierung von A-priori-Rechtfertigung akzeptieren. Unter ihnen ist umstritten, in welcher Hinsicht A-priori-Rechtfertigung von Erfahrung »unabhängig« sein muss. Albert Casullo hält sich an Kant, dem allein an der Quelle der Rechtfertigung gelegen ist, und verlangt deren Erfahrungsunabhängigkeit. Demnach ist SRechtfertigung für die Überzeugung, dass p, genau dann unabhängig von Erfahrung, wenn S Überzeugung durch eine erfahrungsunabhängige Quelle gerechtfertigt ist. Philip Kitcher (The Nature of Mathematical Knowledge, 1983) und Hilary Putnam (»›Two Dogmas‹ Revisited«, in: Contemporary Aspects of Philosophy, hrsg. von Gilbert Ryle, 1976) formulieren stärkere Ansprüche an eine erfahrungsunabhängige Rechtfertigung. Ihnen zufolge muss eine A-priori-Quelle von Rechtfertigung nicht nur unabhängig von Erfahrung sein; sie muss zusätzlich auch gegen jede Widerlegung durch Erfahrung gefeit sein: SRechtfertigung für die Überzeugung, dass p, ist genau dann unabhängig von Erfahrung, wenn S Überzeugung, dass p, durch eine erfahrungsunabhängige Quelle gerechtfertigt und durch Erfahrung nicht zu widerlegen ist.
Albert Casullo
Paul Boghossian / Christopher Peacocke (
Hrsg.
): New Essays on the A priori
.
Oxford [
u. a.
] 2000.
Laurence BonJour: In Defense of Pure Reason. Cambridge [
u. a.
] 1998. Nachdr. 2002.
Albert Casullo: A Priori Justification. Oxford / New York 2003.
– Essays on A Priori Knowledge and Justification. New York [
u. a.
] 2012.
– / Joshua C. Thurow (
Hrsg.
): The A Priori in Philosophy. Oxford 2013.
Brian Weatherson: [
Art.
] Analytic–Synthetic and A Priori–A Posteriori. In: Herman Cappelen / Tamar Gendler / John Hawthorne (
Hrsg.
): The Oxford Handbook of Philosophical Methodology. Oxford 2016.
S.
231–248.
Aristotelismus
Der A. im engen Sinn ist die Gesamtheit der Lehren des antiken Philosophen Aristoteles. Im weiteren Sinn versteht man unter ›A.‹ ein Bündel philosophischer Auffassungen, die mehr oder weniger eng an Aristoteles anschließen und sich im Lauf der Überlieferung mit anderen Lehren gemischt haben.
Die Geschichte des A. ist unstetig. Nur für zwei Generationen setzte die Peripatos genannte Schule des Aristoteles die begonnene Arbeit produktiv fort. Mit der Edition der Schriften des Aristoteles im 1. Jh. v. Chr. und der einsetzenden griech. Kommentierung erhielt der A. den Charakter einer Rückwendung. Die philosophische Ausbildung und Forschung im lat. Mittelalter wurde dann durch die Lektüre und Kommentierung von Schriften des Aristoteles beherrscht. Den Kern bildeten zunächst Texte, an denen die logische Argumentation geschult wurde. Seit 1200 wurde, vermittelt durch die Rezeption arab. Aristoteliker wie Averroes, das Textspektrum erheblich erweitert. Die Lehren des Aristoteles eröffneten begrifflichen Bewegungsspielraum jenseits religiöser Vorgaben (→Scholastik). So wurde der aristotelische Naturbegriff zur Emanzipation des politischen Denkens von der christlichen Theologie genutzt. Zugleich stellten die Schriften des Aristoteles Interpreten wie Thomas von Aquin vor die Aufgabe, christliche Theologie und heidnische Lehre auszusöhnen.
In der Renaissance (etwa 1350–1600) nahm die Aristoteles-Kommentierung bis dahin ungekannte Ausmaße an. Der vorläufige, von Polemik begleitete Abschied vom A. wurde im 17. Jh. im Gefolge von René Descartes vollzogen. Vermehrte Rückgriffe auf Aristoteles lassen sich dann wieder seit dem 19. Jh. im Zuge der philologisch-kritischen Erschließung des Aristoteles und des antiken A. beobachten. Von nun an sucht die Rückwendung zu Aristoteles gerne Heilmittel für das, was als neuzeitliche Fehlentwicklung gilt. Diese Wiederbelebung aristotelischer Positionen wird auch als ›Neoaristotelismus‹ bezeichnet.
Die Methode des A. folgt dem Aristoteles typischerweise in folgenden Hinsichten: Überzeugung von der Erkennbarkeit des Wirklichen, Drang zur Erkenntnis aller Bereiche der Wirklichkeit, Einteilung von →Wissenschaft und →Philosophie in getrennte Disziplinen, Unterscheidung von theoretischer und praktischer →Vernunft, Interesse an empirischen Forschungen, Respekt vor anerkannten Meinungen aus dem Alltag und der Tradition und Verpflichtung der Wissenschaften auf rigorose Standards des Argumentierens.
In der Ontologie (→Metaphysik), d. h. der Lehre von dem, was es gibt, teilt der A. das Existierende in verschiedene allgemeinste Arten ein, nämlich in die →Kategorien, unter denen →Substanzen als fundamental ausgezeichnet werden. Im Gegensatz zum →Platonismus werden im A. →Universalien nicht als den Dingen der Erfahrungswelt vorgeordnet angesehen (ante rem). Vielmehr gilt: Allgemeine Eigenschaften existieren, aber nur, wenn es Substanzen mit solchen Eigenschaften tatsächlich gibt (in rebus). Zeitgenössische Vertreter des A. in der Ontologie sind Peter Strawson und David Wiggins. Strawson (Individuals, 1956, dt. 1972) argumentierte, dass Körper in der Ontologie eine ausgezeichnete Stellung einnehmen, weil es ohne sie nicht möglich wäre, überhaupt auf etwas Bezug zu nehmen. Wiggins bekräftigte, zuletzt in Sameness and Substance Renewed (2001), die Sonderrolle von wesentlichen →Eigenschaften.
Das →Wesen natürlicher Dinge ist ihre →Natur. Der Naturbegriff des A. ist normativ, weil er beschreibt, wie Dinge sind, und ausdrückt, wie sie sein sollen. Wenn ein Löwe von Natur aus vier Beine hat, so sollte er vier Beine haben, andernfalls ist er ein Krüppel. Der Begriff der Natur prägt zum einen die Physik des A. So wird dafür, dass Erde zu Boden fällt, die Natur von Erde verantwortlich gemacht und nicht ein →Naturgesetz. Die Naturen der natürlichen Dinge bilden einen harmonischen Kosmos, an dessen Spitze eine ewige göttliche Substanz steht (→Gott). Zum anderen bestimmt der Begriff der menschlichen Natur den A. in →Ethik und politischer Philosophie (→Politik). Die Ethik des A. fragt, was für einen Charakter man haben muss, um ein glückliches Leben zu führen bzw. um im Diesseits die Grundlage für ein glückliches Leben im Jenseits zu schaffen (→Glück). Da der →Mensch seiner Natur nach vernünftig ist, muss er vernünftig tätig sein, um Glück zu erlangen. Der Mensch gilt als von Natur aus politisch, weil er von Natur aus in Gruppen lebt und die für soziales Leben nötige Ausstattung hat, insbesondere die Sprache. Die Bildung von Staaten und die Begründung der Herrschaft einiger über andere werden mit Bezug auf die Natur des Menschen erklärt.
Heute erfolgt eine explizite Berufung auf Aristoteles besonders in der praktischen Philosophie (Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum). Attraktiv erscheint die unterschiedliche Gewichtung der ethischen Zentralbegriffe im Vergleich zu neuzeitlichen Konzeptionen: Nicht die Frage nach Pflicht und Moralgesetz, sondern die nach dem Glück und den erforderlichen charakterlichen Eigenschaften steht im Vordergrund (→Tugend). Gegenüber der Ausrichtung auf individuelle Freiheitsrechte (→Freiheit) betont man die Notwendigkeit der in einer Gemeinschaft geteilten Vorstellung vom Guten (→Liberalismus).
Johannes Hübner
Jonathan Barnes: Aristotle. Oxford 1981. – Dt.: Aristoteles. Eine Einführung. Stuttgart 1992. Nachdr. 2003.
Paul Moraux: Der Aristotelismus bei den Griechen. 3
Bde.
Berlin / New York 1973–2001.
Cary J. Nederman: The Meaning of ›Aristotelianism‹ in Medieval Moral and Political Thought. In: Journal of the History of Ideas 57 (1996).
S.
563–585.
Riccardo Pozzo: The Impact of Aristotelianism on Modern Philosophy. Washington 2004.
John R. Wallach: Contemporary Aristotelianism. In: Political Theory 20 (1992).
S.
613–641.
Aufklärung
Der Begriff ›A.‹ bedeutet primär ein Programm: Der →Mensch (Individuum und Gattung) soll sich mittels des richtigen Gebrauchs des Vernunftvermögens selbst befreien und intellektuell, besonders aber moralisch vervollkommnen (→Vernunft, Freiheit). Als Voraussetzungen für die Realisierung werden die allgemeine Menschenvernunft als Naturanlage und die Gewährung von Grundfreiheiten (wie Denk-, Rede- und Publikationsfreiheit) als äußere Bedingung betrachtet. Abgeleitet können eine Bewegung, die versucht, dieses Programm zu realisieren, und eine Epoche, die durch dieses Programm geprägt ist, ›A.‹ genannt werden. Wie andere Ausdrücke, die auf ›-ung‹ enden, dient A. sowohl zur Bezeichnung von Prozessen als auch von deren Resultaten.
In dem Programm der A. kann man Kampf-, Programm- und Basisideen sowie abgeleitete Ideen unterscheiden. Alle diese Ideen sind philosophischen Ursprungs. Den Kampf angesagt hat die A. den Vorurteilen, dem Aberglauben, der Schwärmerei und dem Fanatismus. Seit Francis Bacons Vorurteilskritik (sog. Idolenlehre) und René Descartes’ Zweifelsmethode steht die Befreiung von Vorurteilen auf der philosophischen Agenda. John Locke und Immanuel Kant erkannten, dass Vorurteile nicht irrige Einzelurteile, sondern schwer abzulegende irrationale Urteilsmaximen sind; in der kritiklosen Übernahme von voreingenommenen und abergläubischen Meinungen zeige sich ein Hang zur Heteronomie und zum Mechanismus der Vernunft (Kant), den jeder Einzelne gegen äußere und innere Widerstände überwinden müsse. Um Aberglauben und Schwärmerei zu vermeiden, gelte es, Reichweite und Grenzen der menschlichen Vernunft zu bestimmen (Kritik der reinen Vernunft, 1781, 21787).
Positiv vertraut die A. auf die Möglichkeit der Vervollkommnung des Menschen (Jean-Jacques Rousseau) und tritt für Selbstbestimmung, Selbstdenken und Mündigkeit ein. A. ist laut Kant geradezu »die Maxime, jederzeit selbst zu denken«, wobei Selbstdenken bedeutet, »den Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vernunft) [zu] suchen« (Was heißt: sich im Denken orientieren?, 1786). Da Unmündigkeit »das Unvermögen« ist, »sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«, kann A. laut Kant folgerichtig auch als »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« charakterisiert werden (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784). Zu den Aufgaben von Lehrern gehört es, Hindernisse, die dem Selbstdenken entgegenstehen, aus dem Weg zu räumen; sie dürfen die ihnen Anvertrauten aber nicht wiederum in Abhängigkeiten führen.
Zu den Basisideen der A. gehören die Idee der Bestimmung des Menschen (u. a. Johann Joachim Spalding, Moses Mendelssohn, Johann Gottfried Herder) und die Annahme einer allgemeinen Menschenvernunft, »worin ein jeder seine Stimme hat« (Kant). Das anthropologische Verständnis der A. geht von der wesentlichen Gleichheit der menschlichen Natur und ihrer Bestimmung aus: Jeder Mensch ist mit den gleichen Seelenvermögen ausgestattet, v. a. mit einer Vernunft, die er dazu gebrauchen soll, zu verstehen, was man sein muss, um ein Mensch zu sein und sich so des Menschseins würdig zu erweisen. Unter den abgeleiteten Ideen sind die Ideen der Unparteilichkeit, der Liberalität bzw. →Toleranz, des Kosmopolitismus, der Öffentlichkeit und Publikationsfreiheit hervorzuheben. Hauptmedium der A. ist der öffentliche Diskurs. Alles, selbst →Religion und Gesetzgebung (→Recht), muss sich im Zeitalter der Kritik der freien und öffentlichen Prüfung unterwerfen.
Im Sinne einer Epoche ist die A. in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden ab der Mitte des 17. Jh. hervorgetreten, in Deutschland kann man den Beginn der Früh-A., wenn man sie an der Wirksamkeit von Christian Thomasius in Halle festmacht, um 1687 ansetzen. Einflussreiche Selbstbeschreibungen der Epoche sind: siècle philosophique (Jean d’Alembert u. a.), »Zeitalter der Kritik« (Kant) und Age of Reason (Thomas Paine). Kant verstand seine Zeit als »Zeitalter der A.«, aber noch nicht als »aufgeklärtes Zeitalter«. Sofern Teile des A.-Programms vor oder nach dem 18. Jh. realisiert wurden, findet der Begriff auch auf diese Zeiten Anwendung; so spricht man etwa mit Bezug auf Sokrates und die Sophisten von einer ›griech. A.‹.
Die Bewegung der A. erfasste große Teile Europas und strahlte auf Nord- und Lateinamerika aus. Vielerorts entwickelte sie sich von einer philosophisch-literarischen Strömung zu einer sozialen Reformbewegung oder sogar zur politischen Revolution. Die Bewegung wurde beflügelt durch die großen Erfindungen der Neuzeit (Buchdruck, Seekompass, Fernrohr, Mikroskop, Blitzableiter) und den Aufschwung der Wissenschaften, insbesondere die wissenschaftliche Revolution des 17. Jh. (→Wissenschaft). Neue Formen von Öffentlichkeit entstanden: Zahlreiche Zeitungen, politische und gelehrte Zeitschriften, Lesegesellschaften, Salons und Clubs, Schulen, Universitäten, Akademien und gelehrte Sozietäten wurden gegründet, Bibliotheken und Museen für breitere Kreise geöffnet. Da die A. sich wesentlich als Erziehungs- und Bildungsprogramm verstand, entwickelte sie eine praxisorientierte Pädagogik. In Recht und Verwaltung, im Schul- und Unterrichtswesen sowie in allen anderen Lebensbereichen wurden bedeutende Reformen durchgesetzt (v. a. Kodifizierung der Grundrechte und der Verfassung; vielerorts Abschaffung des Hexereidelikts, der Folter und der Leibeigenschaft). Die amerik. Unabhängigkeitsbewegung mit der Declaration of Independence 1776, der Bill of Rights of Virginia 1776 und der amerik. Verfassung 1787, durch die sich die erste moderne Demokratie konstituierte, sowie die Französische Revolution mit ihrer Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte) 1789 waren konkrete politische Folgen der europäischen A.
Die A. hat als Programm, Bewegung und Epoche unterschiedliche Bewertungen und Reaktionen erfahren. Legitim ist die Forderung, die A. solle sich selbst aufklären, was ganz im Sinne des A.-Programms ist. A. stieß jedoch auch auf Ablehnung. Sturm und Drang und Romantik brandmarkten sie als einseitige Vergötzung von Verstand und Nützlichkeit und setzten ihr Gefühl, Glauben und Genie entgegen (u. a. Johann Georg Hamann, Friedrich Heinrich Jacobi). Konservative wie Edmund Burke verabscheuten die Französische Revolution und verteidigten die Orientierung an Tradition und Autoritäten, ja selbst an Vorurteilen. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (Dialektik der Aufklärung, 1947; →Kritische Theorie) machten die A. pauschal für eine Verabsolutierung der »instrumentellen Vernunft« zum Zwecke totaler Natur- und Menschenbeherrschung verantwortlich; als solche müsse sie in Mythos und Barbarei »umschlagen«.
Es bleibt im Einzelfall zu prüfen, welche Bedenken und Vorwürfe die A. tatsächlich treffen. Unbestreitbar ist, dass die Epoche der A. hinter ihren eigenen Forderungen zurückblieb. Die Frage, in welchen Punkten das Programm der A. wünschenswert und realisierbar ist, stellt sich dagegen auch heute mit unverminderter Dringlichkeit.
Oliver R. Scholz
Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen 1932. Neudr. 2007.
Raffaele Ciafardone: L’illuminismo tedesco. Turin 1983. – Dt.: Die Philosophie der deutschen Aufklärung. Texte und Darstellung. Bearb. von Norbert Hinske und Rainer Specht. Stuttgart 1990.
James Schmidt (
Hrsg.
): What is Enligthenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions. Berkeley/London 1996.
Werner Schneiders (
Hrsg.
): Lexikon der Aufklärung. München 1995. Verb.
Ausg.
2001.
Horst Stuke: [
Art.
] Aufklärung. In: Otto Brunner [
u. a.
] (
Hrsg.
): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland.
Bd.
1. Stuttgart 1972.
S.
243–342.





























