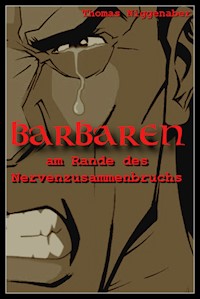Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tolkien meets Leone, High-Fantasy im Wilden Westen. Ein abgedrehter, ungewöhnlicher und actionreicher Genre-Mix. Kiffende Elfen, Sombrero tragende Orks und arrogante Yankee-Magier das ist die Welt von Gungo Large, dem versoffenen, zu groß geratenen Zwerg, der für eine handvoll Mithril-Dollar jeden noch so dreckigen Job übernimmt. In dieser aberwitzigen Symbiose aus Fantasy und Western, in der blaue Bohnen ebenso aus der Hüfte abgefeuert werden wie unzählige Referenzen und Seitenhiebe auf alle Bereiche der Popkultur, muss sich der eigensinnige Revolverheld durch unzählige Abenteuer und Gefahren schießen, prügeln und lamentieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gungo Large - Spiel mir das Lied vom Troll
Titel1234567891011121314151617181920212223242526Thomas Niggenaber
Gungo Large Spiel mir das Lied vom Troll
Impressum
Texte: © Thomas Niggenaber
Cover: © breakermaximus / Adobe Stock
Verantwortlich für den Inhalt:
Thomas Niggenaber
Stockumer Str.12
44225 Dortmund
Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
1
»Blöde Prärie!«, knurrte der Ork. »Öde, blöde Prärie!«
Merluzo Fuerte de la Raqueta – so der Name des grobschlächtigen, grünhäutigen Burschen – saß auf dem Gatter, welches die südlichen Weideflächen der Tolemak-Ranch begrenzte. Übellaunig und gelangweilt beobachtete er, wie langsam die Sonne hinter den Bergen weit im Westen unterging.
Die Schönheit dieses Naturschauspiels – die wundervollen Farben, die das Abendrot in den Himmel malte und die glutrot leuchtenden Berggipfel – beeindruckte den Ork allerdings herzlich wenig. Auch die faszinierenden, vielförmigen Schatten, welche sich ganz gemächlich über die endlos weiten Grasflächen ausbreiteten, waren ihm völlig schnuppe.
Er war halt, so wie die meisten Angehörigen seiner Rasse, weit davon entfernt, ein Schöngeist zu sein. Sein Interesse galt eher den einfachen Dingen des Lebens: Essen, Trinken, Schlafen und in besonderem Maße der exzessive Konsum von Kautabak. Nahezu ständig kaute er mit leidenschaftlichem Eifer auf dem schwarzen, in harte Riegel gepressten Kraut herum. Wenn er sich im Freien befand, war er meist schon nach wenigen Minuten von schwarzen, klebrigen Speichelflecken umgeben, die er achtlos in die Gegend gespuckt hatte. Meistens blieb dabei ein Großteil der nikotinhaltigen Masse an einem seiner beiden Hauer hängen. Wie bei all seinen männlichen Artgenossen ragten diese aus seinem weit vorgeschobenen Unterkiefer über seine Oberlippe hinaus und waren daher beim Spucken oftmals im Weg. Üblicherweise Stolz und Zierde eines jeden männlichen Orks waren seine Hauer deshalb auch eher unansehnliche, fleckige und kariöse Zahnruinen.
Doch das störte Merluzo Fuerte nicht. Er war ohnehin nicht das attraktivste Mitglied seiner Gattung. Obendrein gehörte Zahnpflege zu den unendlich vielen Dingen, an die er in seinem Leben noch nie einen Gedanken verschwendet hatte. Nachdenken gehörte generell nicht zu seinen bevorzugten Tätigkeiten. Es strengte ihn viel zu sehr an und nach einer Weile bereitete es ihm meist üble Kopfschmerzen.
An diesem Abend jedoch, welcher sich nun schwül-warm über das Land legte und bald schon von einem vollen, tief stehenden Mond erhellt wurde, verlangte Merluzo sich diese große Mühsal ab.
Warum er hier Wache schieben musste, das begriff er nämlich ganz und gar nicht. Wieso durfte er nicht wie die anderen Cowboys in den Unterkünften um seinen spärlichen Lohn pokern oder sich mit billigem Whisky betrinken? Noch nie hatte es eine Nachtwache auf der Tolemak-Ranch gegeben, weshalb war sie jetzt vonnöten? Wilde Tiere, die den Rindern hätten gefährlich werden können, gab es in diesem Teil des Landes kaum und wer sonst hätte es wagen sollen, sich am Eigentum von Colonel Don Athuro zu vergreifen? Einen der vermögendsten, einflussreichsten und mächtigsten Zwerge der verbündeten Reiche zu bestehlen, auf die Idee wäre wohl kein Viehdieb gekommen, der auch nur das geringste Interesse an seinem Weiterleben hegte.
Es gab also keinerlei Veranlassung für diese Vorsichtsmaßnahme – zumindest keine, die Merluzo mit seinen bescheidenen geistigen Fähigkeiten hätte erkennen können. Auch sein Vorarbeiter hatte ihm keine triftigen Gründe genannt, als er ihm diesen Auftrag erteilt hatte.
»Dieser Job ist wie geschaffen für so eine hässliche Hohlbirne wie dich«, hatte er stattdessen in seiner gewohnt freundlichen Art erklärt. »Also schieb deinen grünen, runzligen Hintern hinaus und halt die Augen offen.«
Merluzo tat fast immer, was man ihm sagte – Befehle befolgen ersparte ihm die unnötig anstrengende Denkarbeit. Deshalb saß er nun hier, ohne zu wissen warum und in Gesellschaft unzähliger Longhorn-Rinder, die hinter ihm auf der Koppel friedlich grasten, schliefen und hin und wieder ein leises Muhen von sich gaben.
»Blöde Rinder«, knurrte der Ork. »Öde, blöde Rinder.« Beinahe schon liebevoll tätschelte er dabei seine doppelläufige Schrotflinte, die in seinem Schoß ruhte. Diese Waffe bedeutete dem Ork sehr viel, wesentlich mehr als eine Waffe seinem Besitzer normalerweise bedeutet. Schon seit Generationen befand sich diese Flinte im Besitz der de la Raquetas. Sein Urgroßvater – seinerzeit einer der besten Büchsenmacher Enchicos – hatte sie einst aus Zwergenstahl gefertigt. Er hatte sie mit einem Kolben aus weißem, echtem Drachenknochen versehen und mit zahlreichen Ornamenten verziert, die sich über die zwei Läufe bis hin zum Schaft erstreckten.
Ein ebenso durchschlagskräftiges wie schönes Meisterstück hatte er so erschaffen, das die meisten anderen Waffen vergleichbarer Art in allen Belangen übertraf. Nach seinem Ableben hatte sein Sohn, Merluzos Großvater, die Flinte geerbt. Dieser wiederum hatte sie dann kurz vor seinem Tod Merluzos Vater vermacht.
Merluzo letztendlich hatte sie seinem Vater schlichtweg gestohlen. Die Angst vor der Vergeltung seines Vaters hatte ihn im Anschluss an diese Tat dazu bewogen, sein Heimatland Enchico zu verlassen und ein neues Leben in den verbündeten Reichen von Avaritia zu beginnen. Dass er sich seitdem für einen kargen Lohn als Hilfsarbeiter auf einer Ranch verdingen musste, das schien ihm ein angemessener Preis für den Besitz dieser Waffe zu sein. Denn sie verlieh ihm jene Selbstsicherheit, an der es ihm aufgrund seines Aussehens und seines arg begrenzten Denkvermögens oftmals mangelte. Außerdem konnte man mit ihr so wunderbar Dinge wegballern.
Merluzo grinste. Wegballern – dieses Wort gefiel ihm außerordentlich gut und er benutzte es bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Er spuckte einen weiteren Klumpen rabenschwarzen Speichels in das Präriegras. Dann erhob er seine Schrotflinte und tat so, als würde er irgendwelche Dinge wegballern. Die Schussgeräusche imitierte er dabei so voller Inbrunst, dass er das seltsame Geräusch glatt überhörte, welches sich wie das Rauschen des Windes in den Bäumen anhörte. Es gab hier im Umkreis von vielen Meilen jedoch keinen einzigen Baum. Den Schatten, der kurz darauf über ihn hinwegglitt, bemerkte er hingegen schon. Zu groß für einen Vogel und mit hoher Geschwindigkeit streifte dieser den Ork nur für den Bruchteil einer Sekunde. Das reichte jedoch schon aus, um dessen Argwohn zu erwecken.
Verwundert legte er seine wulstige Stirn in Falten und sah nach oben. Er stellte fest, dass der bunte Sombrero auf seinem Kopf seine Sicht in diese Richtung stark einschränkte, schob selbigen deshalb in den Nacken und blickte erneut in den Himmel. Natürlich gab es dort mittlerweile nur noch die unzähligen Sterne zu sehen, die friedlich auf ihn herabschienen. Der Schatten war schon längst nach Norden in Richtung Ranchgebäude entschwunden.
Merluzo stieg vom Zaun herab, wobei seine ledernen Chaps, die er über seiner alten, speckigen Jeans trug, ein lautes Knirschen und seine Sporen ein leises Klingeln verursachten. Ansonsten war es plötzlich völlig Still.
Selbst die Rinder gaben keinerlei Laute mehr von sich. Sie standen wie versteinert herum, zeigten keinerlei Regung mehr und glotzten allesamt mit starrem Blick in Richtung Ranch.
Solch ein Verhalten kannte der Ork von den Longhorns nicht. Sie schienen in eine Art Angststarre verfallen zu sein, so wie das Meerschweinchen, dem Merluzo als Kind eine Freude hatte machen wollen. Da sein kleiner, pelziger Freund einen etwas einsam Eindruck gemacht hatte, war er auf die Idee gekommen, ihm eine Schlange als Spielgefährten in den Käfig zu legen. Anstatt mit seinem neuen Freund zu spielen, hatte das undankbare Nagetier allerdings ein ähnlich merkwürdiges Gebaren gezeigt wie die Rinder. Das anschließende Verschwinden des Nagers – am nächsten Tag hatte nur noch eine träge und übersättigt wirkende Schlange im Käfig gelegen – war für Merluzo stets ein Rätsel geblieben.
Der Ork dachte kurz darüber nach, ob seine derzeitige Aufgabe auch das Untersuchen seltsamer Schatten beinhaltete. Er verspürte nämlich keinerlei Motivation, selbiges zu tun. Doch so sehr er auch in den selten genutzten Windungen seines Gehirns danach suchte, er fand keine Ausrede dafür, diesen ungewöhnlichen Vorkommnissen nicht nachgehen zu müssen.
Also setzte er sich widerwillig und langsam in Bewegung, in Richtung Herrenhaus, dem größten und nächstgelegenen Gebäude der Tolemak-Ranch. Er wählte dabei den kürzesten Weg nach Norden, quer über die Koppel hinweg und zwischen den erstarrten Rindern hindurch. Diese schenkten ihm keinerlei Beachtung. Selbst als er einem der Tiere kräftig am Schwanz zog, zeigte es keinerlei Reaktion.
Merluzo Fuerte de la Raqueta war kein Feigling. Wie alle Orks verfügte auch er über ein hohes Maß an körperlicher Kraft. Außerdem fehlte es ihm schlicht an der nötigen Fantasie, sich unbekannte Gefahren ausmalen zu können. Allmählich jedoch erwachte die Furcht in ihm.
Zu dieser gesellte sich die Verärgerung darüber, dass sich dieser Vorfall ausgerechnet während seiner Wache ereignen musste – einer Wache, die zudem niemand außer ihm jemals hatte halten müssen. Lediglich die Aussicht auf eine mögliche Gelegenheit, vielleicht mal wieder irgendwas wegballern zu können, beschwichtigte ihn etwas.
Kurz bevor er die Ranch erreichte, drangen Stimmen, Lachen und andere Geräusche aus den nordöstlich gelegenen Unterkünften der Bediensteten zu ihm. Seine Kollegen genossen offensichtlich ihren Feierabend. Anstatt den Neid in ihm zu wecken, beruhigten ihn diese vertrauten Töne. Sie brachten etwas Normalität zurück in diesen etwas außergewöhnlichen Abend.
Auch Don Athuros Herrenhaus, ein dreistöckiges Gebäude aus weiß gestrichenem Holz mit zwei Kaminen und einem Sockel aus roten Backsteinen, lag nun friedlich und ruhig vor ihm. Die ihm zugewandte Rückseite des beeindruckenden Hauses wirkte vergleichsweise schlicht im Gegensatz zur Front, welche von einer ausladenden, prachtvollen Veranda geschmückt wurde. Doch die hohen Sprossenfenster und das mit grauen Schindeln gedeckte Dach versprühten auch nach hinten eine Eleganz, welche offensichtlich Einfluss und Status des Hausbesitzers widerspiegeln sollte.
Oft schon hatte Merluzo sich gewünscht, einmal das Innere dieses vornehmen Gebäudes besichtigen zu dürfen. Doch das war neben den Bewohnern nur den Hausangestellten und dem Vorarbeiter gestattet. Einem kleinen Hilfsarbeiter wie ihm, der es noch nicht einmal bis zum Viehtreiber gebracht hatte, würde diese Ehre niemals zuteil werden. Er hätte wohl auch gar nicht gewusst, wie er sich in solch einer Umgebung hätte benehmen müssen. Bei dem Gedanken daran, mit schmutzigen Stiefeln über den bestimmt überall ausliegenden, teuren Teppich zu latschen und dabei dicke Kautabakflecken auf dem erlesenen Mobiliar zu hinterlassen, musste Merluzo unwillkürlich Grinsen.
Dieses Grinsen erstarb jedoch schnell, als ein ihm unbekanntes Geräusch an seine spitzen, ungewaschenen Ohren drang. Irgendetwas Großes hatte sich bewegt, zu seiner Linken, hinter der westlichen Ecke des Hauses.
So leise es ihm seine grobe Motorik und die Sporen an seinen Stiefeln gestatteten, bewegte Merluzo sich dorthin. Im Westen lagen die Pferdeställe, doch dieses Geräusch hatte eindeutig nicht so geklungen, als hätte ein Pferd es verursacht. Es hatte den Ork an das Rascheln von Gefieder erinnert. Er konnte sich jedoch beim besten Willen nicht vorstellen, wie groß das Federvieh sein musste, das ein Rascheln dieser Lautstärke erzeugen konnte.
War es etwa ein Monsterhuhn, dass hinter der Ecke lauerte? Ein Pollo Diablo, jenes Wesen aus den Ammenmärchen, mit dem man in seinem Heimatland die Kinder erschreckte und ihnen drohte, wenn sie nicht artig waren?
Seine Hände verkrampften sich um seine Schrotflinte, so dass die Gelenke seiner Finger ein leises Knacken von sich gaben. Dann spannte er die beiden Hähne seiner Waffe mit dem Daumen, so leise und behutsam, wie es ihm möglich war. Nur noch ein Schritt trennte ihn davon, um die Hausecke spähen zu können. Er nahm all seinen Mut zusammen, atmete tief ein und wagte diesen Schritt.
Was er dann zu sehen bekam, jagte einen kalten Schauer über seine grüne Haut. Der Schreck stimulierte spontan seinen Schluckreflex, sodass sich der Rest Kautabak, welcher noch in seinem Mund verblieben war, heftig brennend seinen Weg durch die Speiseröhre in den Magen bahnte. Dieses Ungemach registrierte er jedoch gar nicht aufgrund des Anblicks, der sich ihm bot.
Das erste Mal in seinem Leben erblickte Merluzo einen leibhaftigen Greif. Größer als ein ausgewachsener Bisonbulle lag das Wesen da, den weiß gefiederten Kopf, der dem eines Adlers stark ähnelte, auf den Vorderpfoten ruhend. Die gewaltigen, ebenfalls weißen Schwingen hatte es angelegt. Hin und wieder zuckte einer der Flügel leicht und verursachte so eben jenes Rascheln, das Merluzo vor Kurzem vernommen hatte. Ansonsten zeigte der massige, raubkatzenartige Körper keinerlei Regung.
Die geschlossenen Augen und das leise Schnarchen, das aus dem gebogenen, leicht geöffneten Schnabel drang, ließen Merluzo dann endlich begreifen, dass der Greif dort ein Nickerchen machte. Von der Anwesenheit des Orks hatte das beeindruckende Tier noch keinerlei Notiz genommen.
»Wegballern!«, war natürlich das erste, was Merluzo in den Sinn kam. Er verspürte nicht das Bedürfnis, herausfinden zu wollen, was dieses Wesen mit ihm anstellen würde, sollte es ihn bemerken. Dem Greifen zwei Ladungen aus seiner Flinte in den Leib zu jagen, würde der Gesundheit des Orks wohl wesentlich zuträglicher sein. Doch dann bemerkte er das Zaumzeug und den Sattel, was den Greifen eindeutig als Reittier kenntlich machte. Dieses Vieh hatte jemanden hierher gebracht. Doch wo war dieser jemand jetzt?
Von weiteren Überlegungen oder Handlungen hielt ihn der heftige Schlag ab, der ihn plötzlich von hinten traf. Irgendetwas knallte an seinen Hinterkopf, riss ihm den Sombrero herab und schickte ihn augenblicklich zu Boden. Vor seinen Augen erschienen Millionen schwarzer Flecken, die sich immer mehr zu einer Schwarzen Fläche verdichteten und ein dumpfer Schmerz machte sich in seinem Schädel breit. Einen so heftigen Schmerz hatte das Denken dann doch noch nie in ihm verursacht.
Noch nicht ganz ins Land der Träume entschwunden, spürte er, wie ihm jemand seine geliebte Schrotflinte aus den Händen nahm. Es gab nichts, was er dagegen hätte unternehmen können. Dann hörte er gedämpft, so als hätte er Watte in den Ohren, Stimmen und Schritte, die sich von ihm entfernten und in Richtung des Greifen bewegten.
Einen starken Luftzug und das Schlagen riesiger Flügel vernahm er noch, dann schwanden ihm endgültig die Sinne.
2
Es gibt vieles, was ich nach einer durchzechten Nacht im Saloon so ganz und gar nicht gebrauchen kann – lautes Klopfen an meiner Tür rangiert auf dieser Liste ganz weit oben.
Ich ignorierte deshalb diese dreiste Störung meines Deliriums an jenem Morgen und zog mir meine Decke über den Kopf. Dabei versuchte ich, jede überflüssige Bewegung zu vermeiden, damit sich das Rindvieh in meinem Kopf weiterhin einigermaßen ruhig verhielt.
Diese Kuh – ich hatte sie Elsa getauft – war in diesen alkoholreichen Tagen oft zu Gast in meinem Schädel. Sie vollzog dort meist irgendwelche wilden Tänze, deren Schritte äußerst schmerzhaft und dröhnend in meiner Hirnschale widerhallten. Nur enorm viel Schlaf und körperliche Inaktivität vermochten es, ihr Einhalt zu gebieten.
Das zweite Klopfen weckte darum den aufrichtigen Hass gegen den Verursacher dieses Geräusches in mir. Doch Elsas erste Tanzschritte hielten mich davon ab, mich mit seinem Ableben zu beschäftigen.
Erst das dritte Klopfen, das mir beinahe heftig genug erschien, die Tür aus den Angeln zu heben, ließ meinen Zorn über Elsa triumphieren und mich aus meinem Bett hochfahren. Jeglichen Schmerz unter meiner Schädeldecke ignorierend und lauthals fluchend stürmte ich zur Tür meines kleinen Zimmers. An den genauen Wortlaut meiner Flüche kann ich mich nicht mehr erinnern, die Worte verrecke, Arschloch und Kopf abreißen kamen aber bestimmt darin vor.
Mit dem festen Vorsatz also, dem Störenfried unendliche Schmerzen zu bereiten, riss ich die Tür auf. Doch der Anblick meines unerwünschten Besuchs ließ mich dieses Vorhaben schnell wieder vergessen. Es wäre wohl nicht besonders ratsam gewesen, dem örtlichen Arm des Gesetzes selbigen zu brechen. Denn es war Beinir McHardy der vor mir stand, der Sheriff unserer kleinen Zwergensiedlung Copperhole.
McHardy war offensichtlich darum bemüht, mir gegenüber sofort Autorität und Respekt auszustrahlen. Der Umstand, dass er gut einen Kopf kleiner war als ich, machte ihm dies allerdings nicht gerade einfach. Nur das Gewehr in seiner Hand und der Stern auf seiner Brust glichen dieses Manko zum Teil wieder aus.
Natürlich hatte er auch seinen Deputy dabei, einen widerlichen Schleimbeutel von einem Zwerg namens Laurel Ombringer. Dieser bewegte sich ständig im Fahrwasser des Sheriffs und versuchte so, sein mickriges Ego aufzupolieren. Warum McHardy gerade diesen rückgratlosen Nichtskönner zum Hilfssheriff gemacht hatte, war allen Einwohnern Copperholes ein Rätsel. Physisch waren ihm nämlich viele, psychisch fast alle überlegen. Er stand ein Stück hinter McHardy und grinste dümmlich, was er eigentlich immer tat und in mir – auch immer – das dringende Bedürfnis weckte, ihm dieses Grinsen aus der Visage zu dengeln.
»Zieh dich an, Large«, forderte McHardy mich mit Blick auf meine Unterhose, dem einzigen Kleidungsstück das ich trug, auf. »Du bist verhaftet!«
Ich stöhnte genervt auf. »Och nöööö, nicht schon wieder. Das ist doch Ogerkacke!«
Elsa begann diese frohe Botschaft mit einem Freudentanz in meinem Schädel zu feiern. Wieder einmal wünschte ich mir, dass irgendwann mal ein Kräuterweib, Apotheker oder Alchemist ein Mittel gegen Kopfschmerzen erfinden würde
»Stell dich doch nicht so an«, mischte sich Ombringer ein. »Die Zelle ist doch schon so etwas wie ein zweites Zuhause für dich.«
Ich ignorierte diesen Kriecher und begann stattdessen, mein Zimmer behäbig nach brauchbaren Kleidungsstücken zu durchsuchen. Jede Bewegung meines Kopfes quittierte Elsa dabei mit einem schwungvollen Polkaschritt. Die Gesetzeshüter folgten mir.
»Bei allen Göttern, Large!« McHardy sah sich um und rümpfte demonstrativ die Nase. »Hier sieht es ja aus wie bei einem Kobold unter dem Sofa! Du solltest hier unbedingt mal Ordnung schaffen.«
»Hab ich doch erst vor Kurzem«, erwiderte ich. Meiner Meinung nach sah es hier, abgesehen von ein paar Dutzend leerer Flaschen und einigen nur leicht angeschimmelten Essensresten, ganz manierlich aus. Die Kakerlaken fühlten sich hier zumindest sehr wohl und meine Vermieterin, die gute, alte Witwe Latro, hatte sich auch noch nie beschwert. Letzteres lag aber wohl daran, dass ich sie seit meinem Einzug in ihre kleine Pension erfolgreich davon abgehalten hatte, mein Zimmer zu betreten.
»Was habe ich denn überhaupt verbrochen?«, wollte ich wissen und und angelte meine Hose unter dem Bett hervor.
Das Grinsen inmitten Ombringers fuchsrotem Bart wurde noch breiter. »Hast dein Erinnerungsvermögen wohl auch schon versoffen, was? Du hast dich mal wieder geprügelt und dabei den halben Coppercoin-Saloon in Trümmer gelegt.«
Ich wankte zu meinem Waschtisch und benetzte mein Gesicht mit etwas von dem Wasser, welches sich noch vom Vortag oder dem Tag davor in der Schüssel befand. Ganz langsam kehrte meine Erinnerung an die letzte Nacht zurück, wenn auch nur in Bruchstücken.
»Stimmt, irgend so ein Arsch hat mich Halbmensch genannt.« Ich entdeckte mein Hemd, das statt eines Handtuches am Handtuchhalter hing und zog es an, nachdem ich mich damit abgetrocknet hatte. »Hab ich irgendein Möbelstück auf ihm zertrümmert?«
»Das hast du«, antwortete McHardy. »Und nicht nur eins. Wir mussten ihn unter einem ganzen Berg aus Tischen und Stühlen hervorholen. Der Doc hatte gar nicht genug Schienen, um all seine Brüche zu versorgen.«
Ombringer wäre nicht Ombringer gewesen, wenn er diese Gelegenheit, mich zu provozieren, ungenutzt gelassen hätte. »Dabei hatte der Typ doch nicht ganz unrecht«, spottete er. »Du bist mehr als einen Meter siebzig groß, viel zu dürr für einen Zwerg und die paar Flusen an deinem Kinn kann man wohl kaum einen Bart nennen. Würde mich nicht wundern, wenn es wirklich ein Mensch war, der da mal kurz über deine Mutter gestiegen ist.«
Ich hatte gerade einen meiner Stiefel unter meinem Kopfkissen hervorgeholt und ihn leider schon angezogen, sodass ich ihn dem Deputy nicht mehr an den Schädel werfen konnte. Mein Vater, den ich niemals kennengelernt hatte, war ein ganz heikles Thema für mich, sozusagen mein wunder Punkt. Zwar hatte mir meine Mutter nie etwas über ihn erzählt und sowohl das Wissen über seine Herkunft als auch über seine Rasse mit ins Grab genommen, doch die Möglichkeit, dass er ein Mensch war, hatte ich seit frühester Kindheit ausgeschlossen. Welches vernunftbegabte Wesen will schon mit einem Menschen verwandt sein?
»Dünnes Eis, Ombringer!« Ich trat nahe an den Deputy heran, sah auf ihn herab und hoffte, dass mein Blick eine gehörige Portion Verachtung ausstrahlte. »Ganz dünnes Eis, auf dem du dich da bewegst! Vor allem für jemanden, dessen Vater sämtliche Esel im Ort begattet hat.«
Selbst jetzt erstarb das dümmliche Grinsen im Gesicht des Hilfssheriffs nicht. »Hältst du es für schlau, in deiner Situation eine solch dicke Lippe zu riskieren?«
Noch während er diese Frage stellte, rammte er mir den Kolben seines Gewehres in den Magen. Ich klappte augenblicklich zusammen und konnte nur noch ein kurzes »Uff« von mir geben. Obendrein lief Elsa jetzt zur Höchstform auf. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, ob nun das Hämmern unter meiner Schädeldecke oder meine schmerzende Körpermitte den Höhepunkt dieses wundervollen Morgens darstellte.
»Lass den Scheiß!«, fuhr der Sheriff seinen Gehilfen an. »Du weißt, dass ich es nicht leiden kann, wenn man so mit unseren Kunden umgeht.«
Er half mir auf die Beine und reichte mir meinen zweiten Stiefel. Keine Ahnung, wo er selbigen gefunden hatte. Meinen Revolvergurt, der an einem Haken an der Wand hing und als einziger Gegenstand in diesem Raum seinen festen Platz hatte, durfte ich natürlich nicht anlegen.
Ohne diesen fühlte ich mich noch immer irgendwie nackt, als wir die Pension verließen, obwohl ich mittlerweile vollständig bekleidet war. Nur mein schöner, schwarzer Hut blieb unauffindbar und eben diesen vermisste ich schmerzhaft, als wir auf die staubige Hauptstraße Copperholes hinaustraten.
Die Morgensonne brannte nämlich erbarmungslos auf mein noch immer vom Alkohol vernebeltes Gehirn und das helle Tageslicht stach mir in die Augen. All meine übrigen Sinne befanden sich zu dieser ungewohnt frühen Stunde noch in einer Art Dämmerzustand.
Dennoch bemerkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte.
Die sonst so belebten Straßen der kleinen Bergarbeitersiedlung schienen beinahe wie leergefegt. Nur hier und da konnte man einen Einwohner entdecken, der durch den Ort spazierte oder vor einem der schlichten Holzhäuser auf der Veranda saß.
Doch wo waren all die Zwerge, die ihrem Tagewerk nachgingen? Wo waren all die Kutschen, Pferde und Reiter, die sich sonst ihren Weg über die unebenen, holprigen Straßen bahnten, über die jetzt nur ein paar Büschel vertrockneter Steppengräser rollten?
Ich sondierte die Umgebung mit zusammengekniffenen Augen. Der Gemischtwarenhandel auf der gegenüberliegenden Straßenseite war geschlossen, ebenso Russels Drugstore und Littles Lebensmittelgeschäft daneben. Die unnatürliche Ruhe ließ mich vermuten, dass dies bei den anderen Geschäften der Stadt auch der Fall war. Selbst das laute, metallische Hämmern, mit dem der hiesige Hufschmied an normalen Tagen die Ortschaft beschallte, war nicht zu hören.
Dass meine zwei Begleiter all dem keinerlei Beachtung schenkten, stimmte mich zusätzlich misstrauisch. Ich entschloss mich deshalb spontan dazu, diesem Mysterium auf den Grund zu gehen. Selbst unbewaffnet wollte ich mich den unbekannten Herausforderungen stellen.
»Was ist hier los?«, wollte ich wissen. »Warum ist das Kaff wie ausgestorben?«
»Weil es Sonntagmorgen ist, du Trottel«, enträtselte Ombringer dieses Geheimnis unerwartet schnell. »Wahrscheinlich der erste, den du nicht verpennst.«
Mit einem Stoß in den Rücken machte er mir klar, dass ich mich endlich in Bewegung setzen sollte und so marschierten wir drei nach Norden, in Richtung Sheriffbüro, los.
Die wenigen braven Bürger, denen wir unterwegs begegneten, bedachten mich mit abwertenden Blicken und dem Schütteln ihrer biederen, rechtschaffenen Häupter, in denen es, meiner Meinung nach, schrecklich tugendhaft und öde zugehen musste. Vermutlich erweckte mein wenig adretter Kleidungsstil und der augenscheinliche Umstand, dass ich gerade abgeführt wurde, ihre Missbilligung. Ähnliche Reaktionen auf meinen Anblick war ich allerdings schon gewohnt. Wie immer erwiderte ich diese mit einem freundlichen Ihr-könnt-mich-mal-Lächeln, das von Herzen kam.
»Hast du schon meine neue Knarre gesehen?«, fragte der Sheriff nach einer Weile, in der wir schweigend nebeneinander hergegangen waren. Mit stolzgeschwellter Brust hielt er mir sein Gewehr unter die Nase. »Ist ein echtes iRifle von Peach – war verflucht teuer und ich musste eine Ewigkeit beim Waffenhändler dafür anstehen.«
Mit einem kurzen Schulterzucken tat ich mein Desinteresse kund. »Muss ich nicht haben. Da bezahlt man doch nur den Namen. Andere, preiswertere Gewehre haben die gleichen Funktionen und seltener Ladehemmungen.«
Meine Meinung enttäuschte McHardy offensichtlich.
»Du hast doch keine Ahnung, Large!« Schmollend ließ er sein Gewehr wieder sinken. »Du warst zwar in der Army, hast aber trotzdem keine Ahnung! Ein Revolverheld der keine Ahnung von guten Gewehren hat – unglaublich!«
Sein Deputy stieß ein verächtliches Schnaufen aus »Revolverheld? Der Suffkopp? Der hat seine Kanone doch das letzte mal im Krieg benutzt und das ist Jahre her.«
Zu meinem großen Bedauern musste ich dem Widerling in diesem Punkt Recht geben. Seit ich aus der Army zurück in meine Heimatstadt gekommen war, hatten sich keinerlei Gelegenheiten ergeben, mir meinen Lebensunterhalt mit dem Revolver zu verdienen. In ganz Copperhole gab es keinen Bedarf an professionellen, mietbaren Schützen. Bewaffnete Auseinandersetzungen gab es kaum und weder die Kupferminen noch die Wagentrecks, welche das Kupfer aus der Stadt brachten, waren hochwertig oder bedeutend genug, um bewacht werden zu müssen.
Meine außergewöhnliche Begabung im Umgang mit Schusswaffen blieb daher völlig ungenutzt an diesem viel zu friedvollen Ort. Dabei machte mich dieses einzigartige Talent – ohne Übertreibung – zu dem wohl besten Schützen in ganz Avaritia. Entdeckt hatte ich diese Fähigkeit erst nach meinem Eintritt in die Army, da ich nie zuvor eine Waffe in den Händen gehalten hatte. Sie ermöglichte es mir, egal mit welcher Schusswaffe, immer mein Ziel zu treffen, egal ob ich nüchtern war oder volltrunken und egal unter welchen Umständen. Mühe musste ich mir dabei keine geben, konzentrieren musste ich mich auch nicht und geübt hatte ich es erst recht noch nie. Ich musste einfach nur daran denken, etwas oder jemanden zu treffen. Fast zeitgleich mit dem Beenden dieses Gedankens war es dann auch schon passiert. All dies geschah automatisch, ohne mein Zutun und oft schon hatte ich hinterher verwundert auf meine Waffe geblickt, ohne mich daran erinnern zu können, wie ich sie gezogen und abgefeuert hatte.
Im Krieg war mir dieses Talent natürlich sehr gelegen gekommen und es hatte mir viel Anerkennung und Bewunderung eingebracht. Aufgrund meines ausgeprägten Problems mit Autoritäten – wahrscheinlich bedingt durch das Fehlen einer Vaterfigur während meiner Kindheit...Bla Bla Bla – und meinem Unvermögen, auch mal die große Klappe zu halten, hatte ich es in der militärischen Hierarchie dennoch nicht sehr weit gebracht. Als mittelloser Ex-Private war ich bei Kriegsende nach Copperhole zurückgekehrt, mit wenig Glanz und ganz ohne Gloria.
Meine finanzielle Situation konnte man deshalb getrost als katastrophal bezeichnen, zumal ich die paar Dollars, welche ich mir borgte, erschnorrte oder mit irgendwelchen Handlangerjobs erarbeitete, umgehend wieder in die lokale Wirtschaft oder besser gesagt den örtlichen Saloon investierte.
»So kann es mit dir nicht weitergehen«, bemerkte McHardy, so als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich glaubte sogar, eine gewisse Besorgnis aus seiner Stimme heraushören zu können. »Du brauchst endlich einen vernünftigen Job. Warum arbeitest du nicht in den Minen, so wie die meisten anderen Zwerge auch?«
Eigentlich verspürte ich überhaupt keine Lust, solch eine Diskussion zu führen. Ich war voll und ganz damit beschäftigt, Elsas Tanzwut zu zügeln.
Dennoch antwortete ich wahrheitsgemäß. »Die Stollen sind viel zu niedrig für mich. Außerdem habe ich keinen Schimmer vom Bergbau. Schnell ziehen und immer treffen – das ist es, was ich kann.«
Der Sheriff nickte. »Und das kannst du verdammt gut. Wahrscheinlich bist du der beste Schütze, den ich je gesehen habe, doch hier wirst du damit keinen lausigen Cent verdienen. In den größeren Städten im Osten oder Süden könntest du dir mit deinen Fähigkeiten echt einen Namen als Revolverheld machen, so wie Basilisk Bill oder Doc Gargoyle. Hast du schon mal darüber nachgedacht, von hier fortzugehen?«
Natürlich hatte ich das. Fast jeden Tag war mir dieser Gedanke mindestens fünf Mal durch den Kopf geschossen wie eine Gewehrkugel, während ich meine Zeit mit Saufen und Herumlungern verschwendet hatte. Doch zum einen fühlte ich mich in diesem Kaff trotz allem recht wohl, zum anderen hatten mir der Müßiggang und der regelmäßige Alkoholkonsum einen Großteil meiner Abenteuerlust und Entscheidungsfreudigkeit geraubt. Ich hatte ja noch nicht einmal ein Pferd und ohne die entsprechende Barschaft in die Welt hinauszuziehen, erschien mir ebenfalls nur wenig verlockend.
Ombringer hingegen war von dieser Idee natürlich sehr angetan. »Es wäre das Beste, was dieser Stadt passieren könnte, wenn sich dieser Penner endlich verpissen würde. Zu den verkommenen Menschen im Osten würde dieses lange Elend auch hervorragend passen.«
Ich lächelte ihn an. »Dabei würde ich dich doch so sehr vermissen! Vielleicht ist es sogar dein dämliches, debiles Grinsen, was mich hier hält.«
An dieser Stelle mussten wir unser freundschaftliches Gespräch leider beenden, da wir unser Ziel erreicht hatten, was mir wohl einen weiteren Hieb mit dem Gewehrkolben oder eine andere Aufmerksamkeit des Deputys ersparte.
Das Büro des Sheriffs war eines der wenigen Gebäude in Copperhole, dessen Wände aus massiven Backsteinen bestand. Angesichts der Tatsache, dass sich in ihm auch Arrestzellen befanden, war das auch durchaus sinnvoll. Ansonsten war der Flachbau völlig schmucklos, mal abgesehen von dem uralten Holzschild über der Tür, auf dem in verblichenen Buchstaben Sheriffs Office geschrieben stand.
»Du kennst dich ja hier aus«, bemerkte McHardy, als wir seine Amtsstube betraten. Deren Einrichtung bestand lediglich aus zwei Schreibtischen mit Stühlen, ein paar Regalen und einem üppig gefüllten Waffenschrank. »Also geh schon mal vor, ich schließe gleich hinter dir ab.«
Er entledigte sich seines Hutes und suchte in der Schublade seines Schreibtisches nach den Zellenschlüsseln. Ombringer parkte seinen dicken Hintern indes mit einem zufriedenen Seufzer auf seinem Stuhl.
Ich schlenderte derweil quer durch das Büro in den hinteren Teil des Gebäudes, betrat die mir sehr vertraute Zelle und ließ mich auf die ebenso vertraute Pritsche darin fallen. Wie angekündigt folgte mir McHardy kurz darauf und schloss die Zellentür hinter mir ab.
»Wie lange?«, wollte ich wissen und irgendwie ahnte ich schon, dass mir die Antwort darauf nicht gefallen würde.
»Lange genug um deine Sucht nach Fusel vollständig zu kurieren«, lautete dann auch die erschreckende Prognose des Sheriffs. »Der Friedensrichter kommt in drei Wochen und wird dann entscheiden, was mit dir passieren soll. So lange bist du auf jeden Fall unser Gast.«
Bei dem Gedanken daran, mindestens drei Wochen auf dem Trockenen zu sitzen, befiel mich ein leichtes Gefühl der Panik. Auch die Aussicht auf regelmäßige, kostenlose Mahlzeiten konnte dieses Gefühl nicht schmälern. Zwar ließ Sheriff McHardy manchmal mit sich reden – ganz im Gegensatz zu seinem fiesen Deputy –, doch es würde einiges an Überzeugungskraft kosten, ihm den ein oder anderen Schluck Whisky abzuschwatzen.
Trübe Aussichten also, mit denen ich mich auf die Pritsche niederlegte, um mir und Elsa die dringend benötigte Ruhe zu gönnen. Unter gleichmäßig abnehmendem Pochen in meinen Schläfen gelang es mir dennoch, langsam in den Schlaf zu gleiten.
Dass die seltsame, super spannende und unbedingt lesenswerte Geschichte, welche ich hier erzählen möchte, bereits in weit entfernten Teilen des Landes ihren Anfang genommen hatte, davon ahnte ich natürlich nichts.
Um jeglicher Klugscheißerei vorzubeugen sei erwähnt, dass ich mir von den meisten Geschehnissen, bei denen ich nicht zugegen war, bis ins kleinste Detail berichten ließ, um sie hier niederschreiben zu können. Den Rest habe ich mir irgendwie zusammengereimt – der geneigte Leser wird damit schon klarkommen.
3
Während ich in Copperhole schnarchend und verkatert auf einer harten Pritsche lag, lag weit im Osten ein Elf auf noch wesentlich härterem Felsgestein.
Seit Stunden schon verharrte er bäuchlings liegend am Rand eines hoch gelegenen, ausladenden Felsvorsprunges. Von hier aus beobachtete er aufmerksam das Geschehen unter sich, welches in solch großer Entfernung stattfand, dass nur die enorm scharfen Augen eines Elfen Einzelheiten und Details erspähen konnten.
Ungeachtet der Hitze und seiner unbequemen Position würde er noch länger hier ausharren, solange bis ein anderer Elf aus seinem Dorf kommen und seinen Platz als Späher einnehmen würde. So hatte es der Häuptling befohlen und so wurde es auch gemacht.
Die Gebirgskette inmitten der Prärie war ideal für dieses Unterfangen, denn von hier konnte man fast das ganze Gebiet des Moonytoad-Stammes überblicken. Selbiges bestand fast nur aus spärlich bewachsener, ebener Graslandschaft und erstreckte sich fast bis zum Seven-Hills-Gebirge, weit im Westen.
Viele Generationen lang hatte es hier, außer den Moonytoads, nur Bisons, Koyoten und irgendwelche Reptilien gegeben. Doch seit einigen Wochen tummelten sich hier Wesen, die seit jeher das Misstrauen und Argwohn eines jeden Elfen weckten. Menschen und Zwerge waren es, die das Land zu Tausenden mit ihrer Anwesenheit besudelten. Mit Pferdewagen waren sie gekommen, so schwer mit Holz, Metall und Werkzeug beladen, dass ihre Räder tiefe Narben in der Erde hinterlassen hatten. Dann hatten sie ihre Lager aufgeschlagen, Unterkünfte für Arbeiter sowie Stauräume für Unmengen an Material gebaut. Um die Versorgung mit ausreichend Wasser zu gewährleisten, hatten sie tiefe Brunnen in den Boden getrieben. So war das Camp schon bald zu einer kleinen Siedlung aus Zelten, Hütten und anderen Holzkonstruktionen herangewachsen.
Doch das war nur der Anfang ihrer Verbrechen gewesen, die sie in den Augen der Elfen an der Natur begingen. Sie malträtierten den Boden mit Spitzhacken und Schaufeln, sprengten Felsen, die ihnen im Weg waren und formten das Land rücksichtslos nach ihren Bedürfnissen. Über viele hundert Meilen hinweg verunstalteten Sie das Antlitz der Steppe mit dem, was Sie Bahnschienen nannten und all das geschah nur, damit das metallene Monstrum namens Eisenbahn in naher Zukunft durch die Prärie würde fahren und sich regelmäßig würde verspäten können.
Dass dies ungestört im Land der Elfen geschehen durfte, war Inhalt des Friedensvertrages, welchen man den Elfen nach ihrer Niederlage im großen Krieg aufgezwungen hatte. Neben weiten Teilen ihres Landes hatte man allen Stämmen das Einverständnis abgepresst, die Eisenbahnlinie unbehelligt durch das ihnen noch verbliebene Land bauen zu dürfen. Ansonsten hätte es keinen Frieden zwischen den Elfen und der Allianz aus Zwergen und Menschen gegeben.
Dass sich diese Wesen unbeobachtet in ihrem Gebiet bewegen durften, davon stand allerdings nichts in dem Vertrag und deshalb sandten die Moonytoads regelmäßig ihre Späher aus. Diese sollten die Bauarbeiten an den Gleisen beobachten und darüber wachen, dass die unerwünschten Eindringlinge eben jenem Gebirgszug nicht zu nahe kamen, in dessen Höhen die Späher ihren Posten bezogen hatten.
Tief unter diesen Bergen nämlich – die Elfen nannten sie die Säulen der Unvergänglichkeit – befand sich das bedeutsamste Heiligtum der gesamten elfischen Rasse. Hinter einem magisch versiegelten Tor, in einem gigantischen Labyrinth aus Höhlen, Gängen und Tunneln, lagen hier die Grabstätten der Ältesten verborgen, den Urahnen und Gründern aller Stämme Avaritias. So was von dermaßen total uneingeschränkt absolut heilig und unantastbar waren diese Gräber, dass kein lebendes Wesen ihrer je ansichtig werden durfte. Nicht einmal den einflussreichsten Häuptlingen oder Schamanen der Elfen war es gestattet, diese Höhlen zu betreten.
Von den mannigfaltigen Mysterien, Wundern und Gefahren dieses in finsteren Tiefen schlummernden Heiligtums wurde in den alten Schriftrollen berichtet. Doch auch diese wurden von uralten, weisen Männern gehütet, als seien sie ein Teil ihrer selbst. Wer diese Männer waren und wo sie die Schriftrollen verborgen hielten, das war – wer hätte das gedacht – ein total uneingeschränkt absolut geheimes Geheimnis.
Über die Säulen der Unvergänglichkeit zu wachen, dazu waren deshalb nur die angesehensten und besten Krieger des Moonytoad-Stammes auserkoren.
Und das waren die Greifenreiter.
Der Elf zog sich, immer noch auf dem Bauch liegend, ein Stück vom Rand des Felsvorsprunges zurück. Dann warf er einen Blick über die Schulter nach hinten. Dort saß sein Greif. Offensichtlich gelangweilt, doch artig dem Befehl seines Herren folgend, verhielt er sich ruhig und regte sich kaum. Nur hin und wieder gähnte er ausgiebig und fuhr sich mit einer seiner Vorderpfoten über Augen und Schnabel, was trotz seiner enormen Größe beinahe possierlich wirkte.
Der Elf lächelte. Er liebte dieses prächtige Tier von ganzem Herzen. Eine tiefgehende, nahezu mystische Verbindung mit dem Greifen hatte der Elf bereits empfunden, noch bevor dieser das Licht dieser Welt erblickt hatte. Schon als er das Griffogotchi – so die Bezeichnung der Elfen für Greifeneier – vor langer Zeit das erste mal in Händen gehalten hatte, waren in ihm diese Gefühle erwacht. Den Greifen großzuziehen und aus ihm ein folgsames Reittier zu machen, war ihm aufgrund dessen auch ungewöhnlich leicht gefallen und mithilfe seines gefiederten Gefährten hatte er vor einigen Jahren den Rang des Greifenreiters erlangt. Ein strenges, langwieriges Auswahlverfahren hatten sie gemeinsam überstehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn nicht jeder Elf, der einen Greif besaß, durfte diesen Titel tragen.
Der Stamm der Moonytoads sucht den nächsten Greifenreiter – so lautete die traditionelle Bezeichnung dieses althergebrachten Verfahrens, in dem alle Anwärter eine Vielzahl schwieriger Aufgaben zu bewältigen hatten. Vier Stammesältere beurteilten anschließend die Leistungen eines jeden Prüflings. Sie entschieden darüber, wer qualifiziert genug war, um in die Endrunde zu kommen. In dieser wählten sämtliche Stammesmitglieder, Männer, Frauen und auch Kinder, schließlich den fähigsten Elfenkrieger unter den Bewerbern aus. Natürlich spielte bei dieser Wahl auch die Beliebtheit des Kandidaten eine Rolle - vor allem die jungen Squaws ließen sich eher vom Aussehen als von den Fähigkeiten selbiger beeinflussen.
Mit Bravour hatte der Elf all diese Hürden genommen und war mit einer überragenden Mehrheit zum neuen Greifenreiter gewählt worden. Nicht zuletzt hatte er das der hohen Lernfähigkeit und Begabung seines Reittieres sowie der tiefen Verbundenheit mit ihm zu verdanken.
Doch nicht nur der außergewöhnliche Intellekt seines Greifen und seine überdurchschnittliche Größe waren es, die ihn deutlich von seinen Artgenossen unterschieden. Auch nicht die ungewöhnliche, samtschwarze Färbung seines Gefieders, welches Kopf und Flügel bedeckte, oder das ebenso schwarze Körperfell war sein ungewöhnlichstes Merkmal. Dieser Greif besaß eine Fähigkeit, die absolut einzigartig war unter den Wesen seiner Gattung: Er konnte sprechen.
Leider hatte er dies bislang ausschließlich im Beisein seines Besitzers getan und niemand glaubte dessen Erzählungen darüber – meist verursachten diese nur Schmunzeln oder gar schallendes Gelächter. Der Elf selbst hätte es wohl nicht geglaubt, hätte er es nicht schon oftmals miterlebt. Wenn der Greif aufgeregt war oder ihn andere starke Emotionen ereilten, entrang sich seinem Schnabel ein klar artikuliertes Wort. Wann und wo er dieses Wort gelernt hatte und warum es anscheinend nur dieses eine war, welches er aussprechen konnte, das war seinem Herrn jedoch ein Rätsel.
Ein aus der Ferne zu ihm dringendes Geräusch – ein Schnaufen und Stampfen, begleitet von einem steten Dröhnen – riss den Elfen aus seinen Gedanken. Eine leichte Vibration, welche das gesamte Gebirge und die angrenzende Steppe zu erfassen schien, ging mit diesem Geräusch einher. Schnell robbte er zurück an den Rand des Plateaus, von wo aus er einen Zug beobachten konnte, der sich aus dem Westen über die bereits fertiggestellte Bahnstrecke näherte.
Es war nicht der erste Zug, den der Elf zu Gesicht bekam. Beinahe täglich zog eine solche schwarz-rot lackierte Dampflok eine Vielzahl nahezu identisch aussehender Waggons voller Material zur Baustelle. Doch der Anblick dieser mechanischen Abscheulichkeiten erschütterte ihn jedes Mal aufs Neue. Warum nur, so fragte er sich abermals, erschufen vernunftbegabte Wesen so widernatürliche Dinge, die ihrer Umwelt in solch hohem Maße Schaden zufügen? Sahen sie denn nicht die dicken Dampfwolken, mit denen dieses Ungetüm den sonst makellos blauen Himmel verdunkelte? Rochen sie denn nicht diesen abscheulichen Gestank nach verbrannter Kohle, Holz und Öl, den es verströmte? Selbst jetzt schon reizte dieser Gestank seine empfindliche Nase, obwohl der Zug noch Meilen entfernt war.
Wahrscheinlich war es ihnen egal, schlussfolgerte der Elf. Dies bekräftigte ihn in seiner Meinung, dass Menschen und Zwerge skrupellose, unsensible Wesen waren, die sich nur von ihrer Gier, ihrer Bequemlichkeit und ihrem absurden Glauben an den technischen Fortschritt leiten ließen.
»Richtige Husos«, benutzte der Elf flüsternd eine unter den Moonytoads übliche Beleidigung, welche die Nachkommen einer wenig keuschen Frau beschreibt. »Irgendwann werden die Götter sie für all ihre Frevel bestrafen. Früher oder später, auf die ein oder andere Art – aber echt ey!«
Der Zug brauchte nicht lange, um sein Ziel zu erreichen. Als ob dieser Koloss nicht schon genug Lärm verursacht hätte, betätigte der Lokführer die Dampfpfeife, bevor er bremste, um die Arbeiter an den Gleisen zu warnen. Diese wichen ein paar Schritte zurück und mit lautem Quietschen und Kreischen kam der Zug schließlich inmitten der Baustelle zum Stehen.
Zunächst konnte der elfische Späher nichts Außergewöhnliches an dem Güterzug entdecken. Dessen Zugmaschine verpestete weiterhin, leise zischend und qualmend, die Luft.
Doch dann lenkte ein lautes Poltern seine Aufmerksamkeit auf einen der schmucklosen, hölzernen Frachtwaggons, auf dessen Außenseite irgendjemand – wahrscheinlich irgendein Halbstarker – obszöne Malereien und Sprüche mit weißer Farbe hinterlassen hatte. Etwas bewegte sich in diesem Waggon, etwas, das so groß war, dass es ihn trotz seiner Größe hin und her schwanken ließ.
Seine Vermutung, dass es sich möglicherweise um Pferde handeln könnte, verwarf der Elf schnell wieder. Mithilfe seiner geschulten Sinne blendete er alle anderen Geräusche der Umgebung aus und statt Wiehern oder Hufschlägen vernahm er nur ein Knurren, das alles andere als freundlich klang.
Auch die anwesenden Arbeiter hatten Notiz von der ungewöhnlichen Fracht genommen. Schnell versammelten sie sich vor dem Waggon wie die Besucher eines Jahrmarktes vor der neuesten Attraktion, was das Interesse des Elfen noch steigerte.
Seine Neugier sollte befriedigt werden, als der Lokomotivführer – ein dicklicher Zwerg in blauer Latzhose mit einer albern aussehenden, blauen Kappe auf dem Kopf – seinen Führerstand verließ und durch die Horde Schaulustiger zu dem Waggon hinüberschlenderte. Er schloss das überdimensional große Schloss auf, welches die breite Schiebetür des Waggons gesichert hatte und schob selbige beiseite. Damit gab er den Blick frei auf die mächtige Gestalt, die im Inneren kauerte.
Ein Raunen ging durch die Menge
Obwohl die Sicht auf dieses Wesen bedingt durch dessen gekrümmte Haltung eingeschränkt war, konnte man erkennen, dass es bestimmt zweieinhalb mal so groß wie ein ausgewachsener Mensch war. Keinerlei Behaarung wies es auf und es besaß menschenähnliche, wenn auch wesentlich gröbere, Gesichtszüge.
Dem Elfen stockte für einen Moment der Atem. Diese Idioten hatten einen Oger gefangen, ein Geschöpf, das für seine Unberechenbarkeit ebenso bekannt war wie für seine Sturheit und seine enormen Körperkräfte. Wenn man ihnen ihre Ruhe ließ, hatte man von Ogern in der Regel nicht viel zu befürchten. Doch diese Narren hatten ihn seiner Ruhe beraubt.
Das war der erster Fehler, den sie begangen hatten.
Der zweite Fehler war es, den riesigen Burschen in einen für ihn viel zu kleinen Waggon zu pferchen. Wohl über Stunden hatte er in unbequemer Haltung dort hocken müssen, was seine Laune gewiss nicht gerade verbessert hatte.
Fehler Nummer drei war die offensichtliche Absicht, den Oger als Lastenschlepper oder anderweitige Arbeitskraft einsetzen zu wollen. Der Elf war sich sicher, die Reaktion auf den nächsten Fehler würde für ihn äußerst amüsant werden, für die Menschen und Zwerge dort unten allerdings bedeutend weniger.
Der Lokführer zog nun an der langen Kette, welche die Handgelenke des Ogers fesselte und gebot ihm so, den Waggon zu verlassen. Knurrend und grollend kam der Gigant dieser groben Aufforderung nach. Bis er seinen massigen Körper ins Freie gewuchtet hatte, dauerte es eine ganze Weile. Seine ausladende Körpermitte – eine enorme Wampe, die über seinem Lendenschurz hing und diesen von vorn fast verdeckte – behinderte ihn dabei nicht unwesentlich. Der Güterwaggon schaukelte, ächzte und knirschte bei jeder Bewegung des massigen Kerls. Als dieser ihn endlich verlassen hatte, gab der Wagen ein Geräusch von sich, das fast schon wie ein erleichtertes Seufzen klang.
»Nun komm schon, du sturer Fleischberg!«, maulte der Lokführer und zog erneut an der Kette.
Doch der riesige Bursche bewegte sich nun keinen Millimeter mehr. Wie angewurzelt blieb er vor dem Waggon stehen, über den er mühelos hinwegsehen konnte. Ausgiebig und lange schaute er sich erst einmal in seiner neuen Umgebung um. Irgendwie machte er dabei einen fast entspannten Eindruck, doch die hasserfüllten Blicke, mit denen er die anwesenden Arbeiter musterte, ließen nichts Gutes erahnen.
Ein weiterer Zwerg eilte dem Lokführer zu Hilfe, dann ein Mensch und schon bald waren es drei Menschen und drei Zwerge, die an der Kette zerrten. Das hatte allerdings nur zur Folge, dass die überproportional langen Arme des Ogers, welche beinahe bis zum Boden reichten, ein wenig nach vorne gezogen wurden. Es sah fast so aus, als würden sich die Arbeiter in einem Tauziehen mit dem kahlköpfigen Hünen messen.
Irgendwann verlor einer der zuschauenden Menschen die Geduld und was dann geschah, war Fehler Nummer vier – der letzte Fehler.
Der einfältige Kerl lief los, verschwand kurz in einem Zelt südlich der Gleise und kehrte dann mit einer Peitsche zurück. Mit dieser schlug er auf den Oger ein wie auf ein störrisches Rindvieh. Was für eine kolossal blöde Tat er damit begangen hatte, das wurde wohl selbst ihm sehr schnell und auf äußerst unangenehme Art und Weise bewusst.
Zornig brüllend und mit einem kurzen Ruck befreite der Oger seine Handgelenke von der Kette, woraufhin alle, die daran gezogen hatten, auf ihre Hinterteile fielen. Dann schritt er zu dem Peitschenschwinger hinüber. Mit einem einzigen, wie beiläufig wirkenden, von oben geführten Hieb verwandelte er dessen Kopf in einen Klumpen blutigen Matsch.
Sämtliche Anwesenden verstummten sofort. Fassungslos und zutiefst schockiert blickten sie wie gebannt auf die langsam zu Boden tropfende Hirnmasse des Matschkopfes. Dessen Körper blieb noch einen Augenblick lang aufrecht stehen, bevor er leblos in sich zusammensackte.
Nun kümmerte sich der Oger um den Lokführer, der noch immer starr vor Schreck auf seinem Hosenboden saß. Mit seinen beiden riesigen Pranken ergriff er den Schädel des Zwerges, um ihn wie eine überreife Tomate zerplatzen zu lassen, sodass die alberne blaue Kappe von einer Blutfontäne in die Höhe geschossen wurde.
Das war das Startsignal für eine umgehend ausbrechende Panik. Menschen und Zwerge stoben auseinander wie eine Horde aufgeschreckter Hühner. Schreiend und kreischend liefen sie davon, sie stolperten übereinander oder rannten kopflos vor irgendwelche Hindernisse. Dabei verursachten sie einen Heidenlärm, der den zornigen Oger noch mehr in Rage versetzte.
Einen wütenden Oger mit einem Hurrikan oder einem ähnlich zerstörerischen Unwetter zu vergleichen, ist sehr treffend. Wie eine solche Naturgewalt fegte der rasende Gigant nun auch durch das Camp. Körper wirbelten durch die Luft, vollständig oder nur Teile davon; Holzhütten, Zelte sowie Gerüste wurden im Vorbeigehen komplett zerlegt und wimmernde Zwerge von riesigen Füßen zermalmt. Das, was Hunderte von Arbeitern in wochenlanger Arbeit aufgebaut hatten, zerstörte der wütende Oger in wenigen Sekunden.
Der Elf, hoch droben auf seinem Aussichtspunkt, war erstaunt über die Beweglichkeit und die Schnelligkeit, mit der sich der massige, plump wirkende Riese dabei bewegte.
»Wieselflink das Kerlchen«, flüsterte er anerkennend. »Ziemlich adipös, aber wieselflink.«
Er beobachtete beeindruckt weiter, wie der Oger nun eine Bahnschiene aufhob, deren Gewicht zu stemmen es eigentlich die Kraft mehrerer Arbeiter benötigt hätte. Mühelos warf er sie einem flüchtenden Menschen hinterher. Der ballistischen Flugbahn eines Wurfspeeres gleich beschrieb die Schiene einen spitzen Bogen in der Luft, bevor sie zu Boden raste und den Flüchtenden traf. Dieser hatte sich einen Augenblick zuvor umgedreht, um das Geschehen hinter sich beobachten zu können. Das schwere Wurfgeschoss rammte ihn in den Boden, sodass links und rechts davon nur noch seine Füße hervorlugten.
In der Zwischenzeit hatten einige Arbeiter offensichtlich ihren Verstand und ihre Eier wiedergefunden. Aus einem Holzverschlag, der anscheinend als Waffendepot diente, hatten sie sich Gewehre besorgt und nun eröffneten sie damit gemeinsam das Feuer auf den Oger.
Dieser schenkte dem Beschuss zunächst keinerlei Beachtung. Er war voll und ganz damit beschäftigt, mit dem ausgerissenen Bein eines Menschen auf einen Zwerg einzuprügeln. Erst als sich zwei der Geschosse in seinen Rücken bohrten, ließ er von seinem blutigen Tun ab. Er wirbelte herum, erspähte die Schützen und stürmte ihnen entgegen. Ungeachtet all der Treffer, die er dabei einstecken musste, bahnte er sich unbeirrt seinen Weg, was die meisten Gewehrschützen schließlich dazu bewog, das Weite zu suchen.
Nur einer blieb stehen und feuerte weiter, was angesichts des heranstürmenden, stinksauren Monstrums vermutlich ein respektables Maß an Courage erforderte. Dummerweise versagte sein Gewehr plötzlich aus unerfindlichen Gründen seinen Dienst.
Wahrscheinlich handelte es sich um ein iRifle, mutmaßte der Elf. Vor Regressansprüchen würde die Firma Peach aber wohl verschont bleiben, denn ihrem unzufriedenen Kunden spendierte der Oger kurz darauf einen Freiflug über die Baustelle. Kopfüber landete der bedauernswerte Bursche in dem großen, immer noch qualmenden Schornstein der Lokomotive. Das nur kurze Zucken seiner Beine ließ darauf schließen, dass sein Zug abgefahren war.
Aus unzähligen Schusswunden blutend, aber immer noch aufrecht, voller Zorn und Energie, stand der Oger nun da. Er blickte wild um sich, wahrscheinlich auf der Suche nach dem nächsten Ziel, an dem er seine unbändige Wut würde auslassen können.
Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Ein seltsames Knistern ertönte und ein greller Lichtstrahl, einem Blitz ähnelnd, jedoch schnurgerade, schoss waagerecht auf den voluminösen Kahlkopf zu. Bevor dieser sich der Gefahr bewusst wurde, traf ihn der Strahl. Er ließ ihn mit einem ohrenbetäubenden Knall in tausend Teile zerplatzen, so wie eine Nadel einen prall gefüllten Luftballon. Fleisch, Innereien und Gliedmaßen, allesamt verkohlt und noch qualmend, verteilten sich im ganzen Lager. Dort, wo der Oger gestanden hatte, war nur noch ein großer, rußschwarzer Fleck zu sehen.
Zutiefst erschrocken und verwirrt hielt der Elf Ausschau nach der Quelle dieses Lichtstrahls. Er fand sie kurz darauf in Gestalt eines hochgewachsenen, schlanken Mannes. Dieser hatte sich dem Oger unbemerkt von Westen her genähert, wo ein Zelt stand, das wesentlich größer war als all die anderen. Nun, nach dessen explosivem Ableben, schlenderte er gemächlich inmitten der qualmenden Überreste des Ungetümes umher. Seelenruhig betrachtete er sein Werk und ganz offensichtlich hatten ihn die Geschehnisse nicht im Geringsten beunruhigt.
Dieses beherrschte, fast schon kaltblütige Auftreten des mysteriösen Mannes unterschied ihn ebenso von den anderen Anwesenden hier wie sein Äußeres. Statt grober Arbeitskleidung trug er einen eleganten, schwarzen Gehrock, Hose und Krawatte aus demselben feinen, dunklen Stoff und ebenso schwarze Lackschuhe. Selbst durch den Staub, der sie nahezu vollständig bedeckte, konnte man diese noch glänzen sehen. Über seinem makellos weißen Hemd trug er eine dunkelgraue Weste mit Nadelstreifen, die von der obligatorischen goldenen Uhrenkette geziert wurde. Der schwarze Zylinder, den er auf dem Kopf trug, und der Gehstock mit goldenem, rundem Knauf in seiner Linken vervollständigten diesen Kleidungsstil, der von den wohlhabenden Einwohnern der großen Städte im Norden Avaritias bevorzugt wurde. Letztendlich waren es aber der typische, nach oben gezwirbelte Schnäuzer und der schmale Kinnbart des seltsamen Fremden, die den Elfen schlussfolgern ließen, dass er aus dem Norden stammte. Aus dem Norden kamen fast nur reiche Kaufleute oder Magier in den Süden. Reiche Kaufleute verschossen in der Regel jedoch keine todbringenden Lichtstrahlen.
»Ein Magier!«, murmelte der Elf leise. »Was, bei allen Göttern, macht ein Magier in einem Eisenbahner-Camp?«
Ein zauberkundiger Mensch so nahe bei den Säulen der Unvergänglichkeit - das würde für einiges an Aufsehen im Dorf der Moonytoads sorgen. Weder dem Häuptling noch dem obersten Schamanen würde dieser Umstand besonders gut gefallen. Ihnen würde der Elf deshalb sofort Bericht darüber erstatten, sobald ein anderer Greifenreiter ihn abgelöst hatte und er ins Dorf zurückgekehrt war.
Doch so lange musste er nicht warten. Als er sich umwandte, um nach seinem Greifen zu sehen, welcher noch immer fügsam auf seinen Hinterläufen saß, entdeckte der Elf die Rauchzeichen, die im Süden emporstiegen. Sie kamen aus seinem Dorf und waren zweifellos an ihn gerichtet.
Form und Größe der einzelnen Rauchwolken ließen den Elfen erkennen, dass Donnernder Vogel diese Botschaft verfasst hatte. Nur Donnernder Vogel und Feuriger Fuchs waren im Dorf für das Erstellen von Rauchzeichen zuständig. Diese Nachricht war jedoch anders als die Mitteilungen, die Donnernder Vogel sonst versendete. Sie war nüchtern und kurz gehalten, ohne all die Scherze oder dummen Sprüche, mit denen er seine Übermittlungen üblicherweise würzte. Noch nicht einmal das seltsame Wort LOL kam darin vor – ein Begriff, von dem niemand genau wusste, was er eigentlich bedeuten sollte. Der Inhalt dieser Botschaft beunruhigte den Elfen zudem. Es wurde ihm aufgetragen, sofort ins Dorf zurückzukommen, ohne auf eine Ablösung zu warten.
Die Säulen der Unvergänglichkeit unbewacht zu lassen, wenn auch nur für kurze Zeit, das hatte es seit dem Krieg noch nie gegeben. Mit einem unguten Gefühl in sich kroch der Elf deshalb zu seinem Greif. Er schwang sich auf dessen Rücken, ergriff seine Zügel und tätschelte ihm sanft den Hals.
»Nun gut, Poe«, sprach er zu ihm. »Lass uns nachsehen, was es so überaus Wichtiges gibt.«
Von der Unruhe seines Reiters angesteckt, schien auch in dem Greif eine gewisse Nervosität zu erwachen.
»Nimmermehr!«, krächzte das schwarze Wesen. Dann flogen beide in Richtung Dorf davon.
4
Seit Jahren schon träumte ich – nur wenn ich schlief, versteht sich – immer den gleichen Traum vom Krieg. Auf Dauer war dies nicht nur recht langweilig, sondern darüber hinaus auch ziemlich merkwürdig. Das, was in diesem Traum geschah, war mir nämlich während meiner Zeit in der Army nie wirklich passiert.
In diesem Traum lag ich auf einer Bahre in einem Zelt – einem Sanitätszelt höchstwahrscheinlich, denn neben mir lagen noch andere Soldaten, die ganz offensichtlich verletzt waren. Es roch nach Blut, Schweiß sowie irgendwelchen Heilkräutern und schmerzerfülltes Stöhnen vermischte sich mit den Geräuschen einer weit entfernten Schlacht, die zu uns ins Zelt drangen. Hin und wieder konnte ich Kanonenschüsse und Explosionen hören, dann das Kriegsgeschrei der Elfen oder wilde Schießereien. Dazwischen wurde es immer mal wieder ganz ruhig bis auf das Röcheln der Verwundeten neben mir. Einige von denen waren offensichtlich dabei, ihren Löffel abzugeben.
»Hurra, lang lebe die Army!«, schoss es mir in diesem Traum jedes Mal durch den Kopf. »Wenn ihr es schon nicht dürft, ihr armen Schweine«.
Wie bereits erwähnt, hatte ich Ähnliches in der Realität niemals erlebt und vor allem hatte in Wirklichkeit niemals ein Elfenpfeil in meiner Brust gesteckt. An so etwas hätte ich mich doch ganz gewiss erinnert.
Ich lag also in meinem Traum so da und betrachtete den aus meiner Brust ragenden Pfeilschaft. Während ich das tat, dachte ich darüber nach, dass einem ein solches Geschoss im Leib nicht nur die Uniform, sondern auch den ganzen Tag versauen konnte. Plötzlich trat ein Fremder neben mich und lächelte voller Mitleid auf mich herab.
Er trug seltsamerweise nicht die Uniform eines Sanitäters oder den Kittel eines Arztes, sondern das Militärgewand eines Magiers. Diese Tatsache machte ihn in meinen Augen nicht unbedingt vertrauenswürdig.
Magier unterstützten die reguläre Armee in Gefechten mit Feuerbällen, Blitzstrahlen sowie anderem magischen Gedöns. Sie stellten somit das Pendant zu den elfischen Schamanen dar. Mir persönlich waren sie seit jeher unheimlich und nur wenig sympathisch, zumal ihnen bei Eintritt in die Army automatisch der Rang eines Offiziers verliehen wurde. In einem gewöhnlichen Private wie mir konnte diese bevorzugte Behandlung nur den Neid erwecken.
»Ich kümmere mich gleich um dich, mein Freund«, sagte der Magier und irgendwie weckte dieses Versprechen ein ungutes Gefühl in mir. Selbst in meinem Traum verpassten mir diese Worte eine Gänsehaut, auf der man Möhren hätte raspeln können. Sie klangen drohend und extrem unheilvoll.
Normalerweise endete mein Traum an dieser Stelle und er tat es auch dieses Mal – nur ein wenig anders als sonst. Von irgendwoher erklang Glockengeläut, leise erst, dann immer lauter, so dass es schon bald alle anderen Geräusche übertönte. Es musste eine seltsame Glocke sein, die dieses Geräusch von sich gab, denn es klang wenig melodisch, eher schief, irgendwie blechern. Erst als mich dieser Lärm langsam aus meinem Unterbewusstsein zurück in die Wirklichkeit lockte, erkannte ich, dass es gar keine Glocke war, die ihn verursachte.
Es war ein Blechnapf, der vor Gitterstäbe geschlagen wurde. Der Deputy war es, der mich auf so unsanfte Art weckte.
»Ombringer, du Arsch«, murmelte ich schlaftrunken. »Wenn man dich nach dem Aufwachen als Erstes sieht, wünscht man sich sofort in einen Albtraum zurück.«
Der rotbärtige Hilfssheriff drosch weiter mit demEssnapf auf die Gitterstäbe ein, obwohl ich bereits wach war, nur um mich zu ärgern. »Steh auf du Penner! Ich soll dich zum Bürgermeister bringen!«
Ich setzte mich auf und horchte für einen kurzen Moment in mich hinein. Elsa war verschwunden, ich hatte also lange genug geschlafen um sie und ihre Tanzwut zu vertreiben. Dafür zitterten meine Hände jetzt so sehr, dass jedes Glas Milch in ihnen zu Butter geworden wäre und eine unbeschreibliche Leere erfüllte mich. Doch das war nur die übliche Reaktion meines Körpers auf mehrstündigen Alkoholentzug. Anzumerken wäre jedoch, dass ich selbst mit diesem Flatterigen noch jedes Ziel mit einer Schusswaffe hätte treffen können.
»Was bitte soll ich denn beim Bürgermeister?«, wollte ich wissen.
Ombringer zuckte mit den Schultern. »Was weiß ich?Vielleicht will er dich für deine Verdienste zum Ehrenschluckspecht der Stadt ernennen. Der Sheriff ist schon bei ihm, also sieh zu, dass du deinen Hintern bewegst.«
Der Geschmack in meinem Mund war ebenso schal wie die Witze des Deputys, weshalb ich auf beides gerne verzichtet hätte.
»Hast du 'nen Drink oder 'ne Kippe für mich?«, fragte ich deshalb ohne mir große Hoffnung auf eine positive Reaktion darauf zu machen.
Sie fiel aus wie erwartet. »Einen Tritt in die Weichteile kannst du haben, das ist auch alles.«
Der Hilfssheriff schloss die Zellentür auf, die sich quietschend für mich öffnete. Ich erhob mich von der Pritsche und trat hinaus.
»Dreh dich um«, forderte Ombringer mich auf. »Hände auf den Rücken!«
Ich sah ihn ungläubig an. »Ernsthaft jetzt? Hast du ohne deinen Boss so viel Angst vor mir, dass du mir Handschellen anlegen musst, obwohl du eine Kanone hast und ich nicht?«
»Das hat nichts mit Angst zu tun«, erklärte der fiese Zwerg, während er mir die metallenen Handfesseln anlegte. »Ich schikaniere dich nur unheimlich gerne.«
Ich musterte ihn eingehend. »Kotzt es dich nicht manchmal an, Du zu sein?«, wollte ich wissen. »Ich meine, bist du mit deiner Gesamtsituation echt zufrieden? Niemand in der Stadt kann dich leiden und du wirst niemals mehr sein als der kleine, gemeine Gehilfe des Sheriffs. Ist doch erbärmlich, oder?«
Ombringer legte seinen Kopf auf die Seite und grinste mich spöttisch an. »Und das aus dem Munde des größten Säufers und Verlierers von ganz Copperhole.«
Ohne Handschellen hätte ich nun meinen Zeigefinger mahnend erhoben. So aber sah ich den Deputy nur an und hob meine linke Augenbraue – ein Minenspiel, dass ich lange vor dem Spiegel geübt hatte, da es mir ein unheimlich intelligentes, überlegenes Aussehen verlieh.
»Und genau das sollte dir zu denken geben!«
Doch das tat es nicht, wie ich nur wenig später feststellen musste. Als wir das Büro des Sheriffs verließen, stellte mir dieses linke Frettchen ein Bein, während er mich gleichzeitig nach vorne stieß. Ich strauchelte kurz und fiel schließlich vornüber. Da meine Hände hinter dem Rücken gefesselt waren und ich mich nicht mit selbigen abfangen konnte, stürzte ich ungebremst auf die staubige Straße. Ich schaffte es noch, mich im Fallen seitwärts zu drehen, sodass mir zumindest eine gebrochene Nase oder andere Blessuren im Gesicht erspart blieben.
»Da hat er bums gemacht und unten ist er«, frotzelte der Hilfssheriff hinter mir. »Los, steh auf, du hast doch lange genug geschlafen!«
Ich erwiderte nichts, während ich mich aufrappelte. Meine Liste mit den Dingen, die ich in meinem Leben unbedingt noch machen wollte, war jedoch soeben um den Punkt Ombringer umlegen erweitert worden.
Mein Hemd war an der Schulter eingerissen, meine Jeans mit Staub bedeckt und selbst in den Haaren trug ich noch ein paar Hinterlassenschaften der Straße – mein Outfit war also mehr als angemessen für einen Besuch beim Oberhaupt dieser Stadt, dessen Büro wir kurz darauf betraten.
Bürgermeister Jogrund Honesty residierte natürlich im Rathaus, einem Gebäude am südlichen Ende der Stadt, das sich eigentlich kaum von den anderen Holzbauten in Copperhole unterschied. Weder Erhabenheit noch Würde strahlte dieser Bau aus und repräsentative Insignien oder gar Prunk suchte man hier vergebens, sowohl außen als auch innen. Lediglich der schwere Schreibtisch des Bürgermeisters war aus einem edlen, dunklen Holz gefertigt, das perfekt mit der ebenfalls dunklen Wandvertäfelung in seinem Amtsraum harmonisierte. Hinter diesem Schreibtisch saß das Gemeindeoberhaupt dann auch. Er war ein älterer Zwerg mit grauem Haarkranz, einem ebenso grauen Backenbart und einer schmalen Lesebrille auf der Nase, über deren Rand er uns anblickte, als wir den Raum betraten.
Sheriff McHardy saß auf einem Sessel vor dem Schreibtisch. Er erhob sich verärgert, als er mich in Handschellen sah.
»Was soll denn dieser Blödsinn?«, fuhr er seinen Deputy an. »Nimm ihm sofort die Dinger ab!«
»Dein Büttel würde sogar ein Brathuhn fesseln, wenn er mit ihm allein sein müsste«, bemerkte ich, während ich von meinen Fesseln befreit wurde. »Es könnte ihn ja angreifen.«
Bürgermeister Honesty verzog keine Mine. Er musterte mich stumm und wandte sich dann dem Hilfssheriff zu. »Danke Deputy, Sie werden hier nicht mehr gebraucht!«
»Wie auch sonst nirgendwo«, fügte ich hinzu.
Während Ombringer sich trollte, nahm der Bürgermeister ein Schriftstück von seinem Tisch und überflog es kurz. Danach sah er mich mit vorwurfsvollem Blick an. Die Ernsthaftigkeit und Seriosität schienen ihm dabei aus jeder Pore zu dringen.
»Gungo Large, die Geißel dieser Stadt. Zweiundzwanzig Verhaftungen wegen Trunkenheit, Körperverletzung und ungebührlichem Verhalten allein in diesem Jahr.« Der grauhaarige Zwerg legte seine ohnehin schon runzlige Stirn noch mehr in Falten. »Das geht so nicht weiter. Stimmen Sie mir da zu, Mister Large?«
Ich nickte und versuchte ein möglichst unschuldiges, aufrichtiges Gesicht zu machen. »Ich bin da ganz Ihrer Meinung, Eure Bürgermeisterlichkeit. Der Sheriff muss endlich damit aufhören, mich ständig zu verhaften. Ich fühle mich auch schon in höchstem Maße gemobbt!«
Honesty erwiderte nichts. Er erhob sich von seinem Stuhl und begann, bedächtig schweigend in seinem Büro hin und her zu gehen. Den Kopf hielt er dabei gesenkt, so als würde er hoffen, auf dem Boden die passenden Wörter zu finden, nach denen er anscheinend suchte.
Sheriff McHardy saß währenddessen in seinem Sessel und hielt sich gänzlich aus der Unterhaltung raus. Doch während er einen ganz zufriedenen Eindruck machte, fragte ich mich, wieso im Rahmen unserer Zusammenkunft keine Drinks angeboten wurden. Unter Ehrenmännern war so was doch eigentlich selbstverständlich. Vielleicht würde es der Bürgermeister noch tun, so hoffte ich, denn meinem Wohlbefinden wäre ein Schluck Whisky sehr zuträglich gewesen.
Nach einer Weile blieb Honesty vor mir stehen.
»Lassen Sie mich ehrlich sein, Large.« Er verschränkte die Arme vor seiner Brust, kniff die Augen ein wenig zusammen und bedachte mich mit den abwertendsten Blicken, zu denen er wohl fähig war. »Ich will Sie nicht mehr in meiner Stadt haben! Sie sind wie ein Streifen Scheiße in einer sonst blütenweißen Unterhose und ich werde nicht zulassen, dass Sie diesen schönen Ort weiterhin mit Ihrer Anwesenheit verunreinigen.«
Solch einen rüden Tonfall hatte ich von so einem distinguierten, älteren Zwerg wahrlich nicht erwartet. Unverständlicherweise schien er keine sehr gute Meinung von mir zu haben, womit sich die Sache mit dem Drink wohl auch erledigt hatte.
Er entspannte sich jedoch schnell wieder ein wenig, trat einen Schritt zurück und lehnte sich lässig gegen seinen Schreibtisch.
»Sheriff McHardy hat mir allerdings von Ihrer, sagen wir mal, schwierigen finanziellen Situation berichtet und dass Sie weder über ein Pferd, noch über Barschaft verfügen. Ich bin kein gewissenloser Zwerg, Mister Large, und ich möchte Sie nur ungern so mittellos aus der Stadt jagen. Immerhin haben Sie als Kriegsveteran ja auch irgendwann mal unserem Land gedient. Darüber hinaus hat der Sheriff mir erzählt, dass Sie sich als eine Art Söldner sehen, aber in unserer friedlichen Stadt damit natürlich nur sehr wenig Erfolg haben.«
Die Mine des Bürgermeisters erhellte sich und plötzlich schenkte er mir sogar ein Lächeln, welches allerdings so falsch war wie ein rostender Goldbarren. »Nun, Mister Large, ich hätte da vielleicht einen passenden Job für Sie – eine kleine Aufgabe außerhalb der Stadt, die mehr als nur angemessen bezahlt wird. Mit dem Geld könnten Sie danach irgendwo neu anfangen, egal wo, Hauptsache weit weg von hier. Ein Pferd und etwas Proviant bekämen Sie von mir ebenfalls zur Verfügung gestellt. All das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Sie danach nie wieder – und ich meine nie wieder – nach Copperhole zurückkehren.«
Der Bürgermeister ging wieder hinter seinen Schreibtisch und setze sich, während ich ihn argwöhnisch beobachtete. Seine unerwartete Hilfsbereitschaft weckte das Misstrauen in mir, so wie es mir entgegengebrachte Wohltätigkeit grundsätzlich tut.
»Und was wäre das für ein Job?«, wollte ich wissen. »Irgendein Verlies von Riesenspinnen befreien, ein verwunschenes Artefakt suchen oder irgendwelche Schmuckstücke in heiße Lava schmeißen?«
Bürgermeister und Sheriff sahen mich irritiert an.
»Wie kommen Sie denn auf so abstruse Ideen?«, fragte Honesty. »Kommt das vom Alkohol? Na egal, natürlich ist es nichts derart Groteskes. Sagt Ihnen der Name Athuro etwas?«
Ich nickte. »Colonel Don Athuro, natürlich, wer kennt den Namen nicht? Er ist der größte, mächtigste und reichste Rancher hier in der Gegend. Im Grunde gehört ihm der halbe Westen Avaritias.«
»Und außerdem ist er mein Cousin«, fügte Honesty hinzu. »Er hat mich gebeten, ihm einen Zwerg zu schicken, der sich im Umgang mit Schusswaffen gut auskennt und der sich selbst zu helfen weiß. Nach allem, was ich über Sie gehört habe, wäre ein Raufbold wie Sie wohl genau der richtige Mann.«
»Sie haben so einflussreiche Verwandtschaft?«, wunderte ich mich. »Und trotzdem haben Sie es nur zum Bürgermeister eines so winzigen Kaffs gebracht? Irgendwie traurig. Was für eine Aufgabe hat Ihr Cousin denn nun für mich?«
Honesty ignorierte meine spitze Bemerkung und beschränkte sich etwas säuerlich dreinblickend auf die Beantwortung meiner Frage. »Das wollte er mir nicht verraten. Als Verwandter bin ich dennoch dazu verpflichtet, seinem Wunsch nachzukommen. Die Details müssten Sie also mit ihm selbst besprechen. Wie Sie vielleicht wissen, liegt seine Ranch etwa einen Tagesritt von hier entfernt. Nun, was sagen Sie?«
Ich ließ mir mit meiner Antwort etwas Zeit, obwohl ich mich eigentlich schon entschieden hatte. Ein Pferd, Proviant und eine Menge Geld – mir gingen tatsächlich die Argumente aus, um meinen Hintern nicht aus der Stadt bewegen zu müssen. Zudem war dies ein Angebot, das ich eigentlich gar nicht ablehnen konnte. Die Alternativen waren zwar gar nicht zur Sprache gekommen, doch sie würden wohl allesamt nicht gerade angenehm für mich sein. Der Bürgermeister würde wohl nicht zögern, mich ohne einen Cent in der Tasche oder einen Gaul unter dem Hintern aus der Stadt zu jagen. Vielleicht würde er mich vorher auch noch eine geraume Zeit lang in der Zelle schmoren lassen.
Honesty wartete ungeduldig mit seinen Fingern auf den Schreibtisch klopfend auf meine Antwort. Ich hatte Durst und die Unterhaltung fing an, mich zu langweilen. Also stimmte ich zu.
»Hervorragend!« Jogrund Honesty war sichtlich erfreut. »So soll es sein! Der Sheriff wird Sie hinausbegleiten und sich um alles Weitere kümmern. Aber lassen Sie es mich noch einmal ganz klar und deutlich sagen: Nie wieder! Dies war also definitiv unsere letzte Begegnung, womit wir beide wohl sehr gut leben können.«
»Sag niemals nie«, dachte ich. Dem Bürgermeister nickte ich als Abschiedsgruß aber nur stumm zu.
»Auf Nimmerwiedersehen!«, rief dieser mir noch nach, als ich gemeinsam mit McHardy sein Büro verließ.
Vor dem Rathaus sah mich der Sheriff mit einem klitzekleinen Funken Bedauern im Blick an. »Irgendwie wirst du mir fehlen, Gungo. Ohne dich werde ich nur noch halb so viel zu tun haben.«
»Dann kannst du deinen beschissenen Gehilfen ja entlassen«, scherzte ich und der Ordnungshüter grinste.