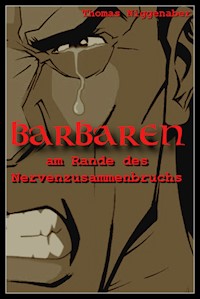
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Fantasy-Welt in der Sinnkrise! Ein Barbaren-Stamm sieht sich plötzlich mit Versagensängsten, Burn-out-Syndromen und anderen seelischen Leiden konfrontiert, edle Ritter gründen Selbsthilfegruppen, anstatt in den Krieg zu ziehen, Zwerge engagieren sich für den Tierschutz und Amazonen fordern eine Gleichstellungsbeauftragte. Bald schon finden die Helden dieser Geschichte heraus, dass diese Geschehnisse nur die Vorboten eines großen Unheils sind, das nicht nur ihre Welt bedroht. In diesem actionreichen Roman werden nicht nur gängige Fantasy-Klischees genussvoll durch den Kakao gezogen, sondern auch rollentypische Verhaltensweisen unseres Alltags auf amüsante Art und Weise hinterfragt. Abenteuer und Spannung kommen dabei freilich nicht zu kurz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Niggenaber
Barbaren
am Rande des
Nervenzusammenbruchs
Roman
Impressum
Texte: © 2021 Thomas Niggenaber
Umschlag: © 2021 Thomas Niggenaber
Verantwortlich
für den Inhalt: Thomas Niggenaber
Stockumer Str.12
44225 Dortmund
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
1
Erst nach vielen Stunden brachialer Gewalt fand die Schlacht an den Reißzahn-Bergen am späten Nachmittag ihr Ende.
Dort, wo in den frühen Morgenstunden die Armee der Barbaren auf das Heer der Orks geprallt war wie Brandung auf Fels, kehrte nun eine unheimliche Ruhe ein. Statt des Kampflärms war nur noch das Klagen der Verletzten und das Wimmern der Sterbenden zu hören, welches vom leisen Rauschen des Windes begleitet wurde.
Von den beiden einstmals gewaltigen Streitmächten vermochte es nur noch eine Handvoll Krieger, sich aus eigener Kraft fortzubewegen. In den meisten darniederliegenden Leibern steckte noch nicht einmal mehr ein Rest von Leben, was sie zu einer üppigen Mahlzeit für jeden Aasfresser machte.
Der Gestank von Blut und Tod lockte auch schon bald unzählige Krähen herbei. Ein schmackhaftes Stück toten Gedärms oder den ein oder anderen delikaten Augapfel wollten sich selbige freilich nicht entgehen lassen. Einem gewaltigen schwarzen Schleier gleich senkte sich dieser Schwarm auf die weite Ebene am Fuße des Gebirges nieder. Jedwede Tischmanieren vermissen lassend nahm sich die Vogelschar dann umgehend der vielen Leichen menschlicher und orkischer Krieger an.
Nur einer der dunkel gefiederten Gesellen – ein Exemplar, das aufgrund seiner Größe auch ein Rabe hätte sein können – stürzte sich nicht sofort auf die erst kürzlich dahingeschiedenen Leckerbissen. Er ließ sich auf dem kahlen Ast eines abgestorbenen Baumes nieder, der inmitten der kargen, mit blassbraunem Steppengras bewachsenen Landschaft stand. Aus tiefschwarzen, seltsam intelligent wirkenden Augen beobachtete er von hier aus seine Artgenossen bei ihrem grausigen Festschmaus.
Von den wenigen Überlebenden, die sich mühsam humpelnd, auf allen vieren oder sogar auf dem Bauch kriechend ihren Weg vom Schlachtfeld suchten, ließen sich die gefiederten Leichenfledderer nicht stören. Unbeeindruckt und gierig pickten sie an den toten Körpern herum, die sich hier und da sogar zu kleinen Hügeln häuften.
Auf einen dieser blutigen Leichenhaufen stieg Zorm der Zerfetzer, Heerführer der Nordland-Barbaren und einer der bekanntesten und gefürchtetsten Krieger Archainos. Selbst in den entlegensten Winkeln dieser Welt kannte man seinen Namen und seinen Ruf als grausame, gnadenlose und unbesiegbare Kampfmaschine. Wenn er guter Laune war – so erzählte man sich –, riss er seinen Gegnern Arme und Beine mit bloßen Händen aus. War seine Laune schlecht, fügte er ihnen meist sogar ernsthafte Schmerzen zu.
In seiner Rechten hielt Zorm sein mächtiges Breitschwert, dessen Klinge nahezu vollständig bedeckt war mit dem Blut seiner erschlagenen Feinde. Sein massiger, nur aus steinharten Muskeln bestehender Leib war ebenso blutbesudelt, was der Reinheit seiner Garderobe natürlich sehr abträglich war. Da diese jedoch ohnehin nur aus einem Lendenschurz und Fellstiefeln bestand, schenkte er diesem Umstand keinerlei Beachtung.
Auf dem Gipfel des Leichenhügels blieb der Zerfetzer stehen. Während seine lange, blonde Mähne im Wind wehte, blickte er mit grimmiger Miene und aus stahlblauen Augen gen Süden.
Von dort näherte sich langsam eine Gestalt, die ebenso beeindruckend und ehrfurchtgebietend war wie Zorm, wenn nicht vielleicht sogar noch ein wenig imposanter, massiger und blutbesudelter.
Es war Morack Meuchelhammer, Hordenführer der Bergorks.
In Sachen Grausamkeit war Morack dem Barbaren wohl mehr als nur ebenbürtig. Seine Halskette aus menschlichen Ohren und die vielen, ebenfalls menschlichen Skalps, die er an seinem Gürtel trug, legten davon Zeugnis ab. Manch Barde sang Balladen darüber, wie der Ork seinen Opfern manchmal die Därme aus den Körpern riss, um sie damit zu erdrosseln. Diese Lieder gehörten jedoch zu den gemäßigteren Stücken über Morack, die man auch schon mal auf Familienfeiern vortrug.
Während sich dieser grünhäutige Kampfkoloss gemächlich seinen Weg über das Schlachtfeld bahnte, erlöste er im Vorbeigehen noch so manch Sterbenden von seinen Qualen. Ganz gleich war es ihm, ob es sich dabei um Mensch oder Ork handelte. Ein kurzer Hieb mit seiner riesigen, mit spitzen Metalldornen bestückten Keule ließ die Lebenslichter beider Rassen gleichermaßen schnell erlöschen. Ob man von diesen armen Seelen vielleicht noch einige hätte retten können, tangierte Morack selbstverständlich überhaupt nicht. Ihr erbärmliches, unverschämt leidvolles Stöhnen entsprach einfach nicht seinem Sinn für Heldentum und Tapferkeit. Es nervte ihn deshalb in hohem Maße.
Als er sich dem Zerfetzer bis auf wenige Meter genähert hatte, breitete er seine muskelbepackten Arme aus und lachte laut. Das Dröhnen seiner Stimme scheuchte nun auch endlich die gefräßigen Krähen auf. Lauthals krächzend beschwerten sie sich über die Störung ihrer Mahlzeit, während sie erbost davonflogen. Nur der schwarze Bursche auf dem Baum blieb einsam sitzen und beobachtete weiter das Geschehen.
»Was für ein herrlicher Tag!« Der Ork grinste breit. Seine prächtigen Hauer, die aus seinem vorstehenden Unterkiefer hinauf bis zu seinen Augen ragten, glänzten dabei strahlend weiß im Licht der tief stehenden Sonne.
»Was für eine glorreiche Schlacht! Der Boden getränkt vom Blut der Erschlagenen, Hunderte von zerschmetterten Leibern und kaum ein Krieger, der noch aufrecht gehen kann – was kann man vom Leben mehr erwarten? Und nun folgt als krönender Abschluss das epische Gefecht der zwei mächtigsten Krieger des Landes. Lass uns beginnen, Zorm, die Götter wollen Blut sehen!«
Zur Überraschung des Orks machte der Zerfetzer keinerlei Anstalten, dieser Aufforderung nachzukommen. Er stand nur reglos, irgendwie erstaunlich unheldenhaft da und ließ die breiten Schultern kraftlos herabhängen. Noch verblüffter war Morack von dem Ausdruck der Bestürzung, der urplötzlich die Miene des Barbaren prägte.
»Das … das ist ja alles so furchtbar«, murmelte dieser leise. »All diese Toten, all diese bedauernswerten Kreaturen.« Mit gesenktem Kopf blickte er um sich. »Schau mich doch mal an – ich stehe auf einem Berg aus Leichen und bin von Kopf bis Fuß mit Blut beschmiert. Das ist doch krank!«
Der Ork stutze. »Hä, was stimmt denn mit dir nicht? Was soll denn an einem Haufen Kaputter so schlimm sein? Und Blut ist doch ungemein dekorativ, solange es nicht das eigene ist. Und jetzt lass uns endlich loslegen, daheim wartet mein Abendessen auf mich.«
Der Barbar schüttelte sein noch immer gebeugtes Haupt. »Nein, keine weitere Gewalt mehr! Ich ertrage dieses Morden und endlose Blutvergießen nicht mehr. Tun dir die vielen Gefallenen denn nicht auch leid? Empfindest du denn kein Mitleid für all diese armen Wesen? Nur weil wir sie in den Kampf geschickt haben, mussten sie alle sterben. Welch gigantische Schuld haben wir damit auf unsere Schultern geladen?«
Morack Meuchelhammer grunzte verächtlich. »Was erzählst du denn da für einen Kappes? Das war doch ein 1A-Gemetzel! Unsere Leute haben über Stunden fröhlich aufeinander eingedroschen. Sie sind voller Stolz und Elan in den Tod gegangen, haben alles gegeben, so wie es sich für echte Krieger geziemt. Nur dafür haben sie gelebt, nur dafür wurden sie geboren!«
»Also ich weiß ja nicht.« Zorms Stimme klang beinahe schon weinerlich. »Das kann doch nicht der Sinn unserer Existenz sein. Es gibt doch so viel Schönes auf dieser Welt, für das es sich zu leben lohnt: Freunde, ein bisschen Frieden, ein hübsches Zuhause und eine glückliche Familie.« Mit merkwürdig sanftem Blick sah er sein Gegenüber an. »Hast du Familie, Ork?«
Der grünhäutige Hüne atmete tief ein und der Stolz ließ seinen ohnehin schon gewaltigen Brustkorb dermaßen anschwellen, dass man bequem einen Humpen Met auf ihm hätte abstellen können. »Natürlich habe ich das! Ich habe achtundzwanzig Weiber, die mir so ungefähr einundfünfzig oder zweiundfünfzig Kinder geschenkt haben – so ganz genau weiß ich das nicht. Mehr als dreißig davon sind aber ganz sicher männlich.« Mit seiner zur Faust geballten linken Hand schlug sich der Ork vor die Brust, was einen dumpfen, hohlen Ton erzeugte. »Meinem leuchtenden Beispiel zu folgen und ein ebenso großer Krieger wie ich zu werden, das ist natürlich der sehnlichste Wunsch all meiner Söhne. Sie alle sind unsagbar stolz darauf, einen Vater wie mich zu haben und sie alle werden nach meinem Tod stolz die Geschichten meiner Heldentaten erzählen.«
»Ein lebender Vater würde ihnen dann gewiss lieber sein«, gab Zorm zu bedenken. »Ein Vater, der für sie da ist, der sich ihre Sorgen anhört und mal was Schönes mit ihnen unternimmt. Einen Ausflug ins Grüne oder ein nettes Gesellschaftsspiel zum Beispiel. Ich habe zwar noch keine Familie, aber ich werde eines Tages ein solcher Vater sein. Ich habe so viel Schlechtes getan, habe so viel Leid verursacht und so unglaublich vielen Wesen den Tod gebracht. Das muss nun ein Ende haben. Ich werde nur noch Gutes tun, ich werde eine Familie gründen, mit der ich gemeinsam die Liebe und den Frieden hinaus in die Welt tragen werde.«
Der blonde Barbar richtete sich auf. Er erhob sein Haupt und starrte in den dunkler werdenden Himmel, als würde er dort oben etwas Erhabenes, etwas Bedeutungsvolles erblicken.
Dann fuhr er mit lauter, feierlicher Stimme fort. »Hier und jetzt gelobe ich im Beisein Hunderter dahingemordeter Seelen: Mein Weg soll von nun an der Pazifismus sein!«
»Pattsi… was?« Die Augen des Orks verengten sich zu schmalen Schlitzen. »So ein Wort gibt es doch gar nicht!« Ein Augenblick verging, dann blitzte ein Funke vermeintlicher Erkenntnis in ihm auf. Voller Misstrauen musterte er den Barbaren. »Ist das vielleicht eine List, Mensch? Willst du mich etwa verwirren, weil du glaubst, mich so leichter besiegen zu können?«
»Aber nein, versteh doch«, flehte Zorm eindringlich. »Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nie wieder kämpfen. Kämpfen ist doof!«
Ob nun die Empörung oder die Verwirrung in ihm überwog, dessen war sich Meuchelhammer nicht gewiss. Sein Antlitz zeigte jedoch eindeutig die Anzeichen großer Verwunderung.
»Du willst echt nicht kämpfen?«, erkundigte er sich noch einmal ungläubig.
»Nein!«, erwiderte Zorm entschlossen.
»Etwas raufen vielleicht?«
»Nö!«
»Könntest du wenigstens dein Schwert erheben, damit ich dich reinen Gewissens erschlagen kann?«, schlug der Ork vor. »Du brauchst dich auch nicht zu wehren.«
Der Zerfetzter verneinte vehement. »Das werde ich auch nicht tun! Ich will nur noch nette Sachen machen – so wie Bilder malen, Gedichte schreiben oder einen kleinen Garten mit bunten Blumen anlegen.«
Während Morack Meuchelhammer nun versuchte, das soeben Gehörte zu verarbeiten, verfolgte der schwarz gefiederte Beobachter – noch immer unbemerkt von den beiden Kriegern auf seinem Ast hockend – das Gespräch aufmerksam. Es schien fast so, als könnte er jedes Wort der beiden Kontrahenten verstehen. Als der Ork plötzlich seine Keule erhob und sich dem Barbaren drohend näherte, zuckte er nur kurz und leicht erschrocken zusammen. Der blonde Barbar auf dem Leichenhaufen tat es ihm gleich.
»Jetzt hab ich die Schnauze aber so langsam voll!«, äußerte sich Morack lautstark. »Ich bin hierhergekommen, um gegen Zorm den Zerfetzer zu kämpfen, einen der mächtigsten Barbarenkrieger unserer Zeit. Man hat mir von deiner Wildheit, deiner Stärke und deiner Unerbittlichkeit erzählt. Du wärst beinahe ein so fähiger Kämpfer wie ich, haben sie gesagt, mir im Kampf vielleicht sogar ebenbürtig. Doch was sehe ich nun vor mir? Ein jammerndes, rückgratloses Etwas! Ein widerliches, feiges Gewürm, das sich mit wirren Worten einem anständigen Kampf zu entziehen versucht. Erhebe endlich dein Schwert, du Lappen!«
Morack Meuchelhammer hatte in dieser endlosen Schlacht, die er sein Leben nannte, schon viel gesehen. In die Augen unzähliger Feinde hatte er geblickt, während er ihnen den Bauch aufgeschlitzt, die Eingeweide herausgerissen oder Schlimmeres angetan hatte. Er hatte gegen Kreaturen gekämpft, deren bloßer Anblick andere in die Flucht geschlagen hätte oder sie sogar wahnsinnig hätte werden lassen.
Doch nun bot sich dem Ork ein Anblick, der ihn zutiefst verstörte und sein Weltbild bis ins Mark erschütterte: Über die ausgeprägten, nervös zuckenden Wangenknochen des Barbaren bahnte sich eine Träne langsam ihren Weg nach unten.
»Das … das war total fies von dir«, jammerte der Zerfetzer. »Warum sagst du so garstige Sachen zu mir? Denkst du denn gar nicht darüber nach, was solche Beleidigungen in den Seelen anderer Wesen anrichten können? Wörter können mehr verletzen als Schwerter, weißt du? Sie schneiden tief in dein Innerstes und hinterlassen dort Narben, die niemals richtig verheilen.«
»Ich werde dir dein Innerstes gleich mal zeigen!«, erwiderte Morack und seine Stimme wurde mehr und mehr zu einem bedrohlichen Knurren. »Dann kannst du ja mal nachschauen, was meine Worte dort hinterlassen haben. Weiß deine Mutter eigentlich, was für einen erbärmlichen Sitzpinkler sie in diese Welt gesetzt hat?« Ein höhnisches, boshaftes Grinsen machte sich im Gesicht der Grünhaut breit. »Oder hast du etwa gar keine Mutter? Hat dich vielleicht eine Ziege bei ihrem Stuhlgang versehentlich mit ausgeschissen? So muss es sein, Barbar: Deine Mutter ist eine alte, dreckige und stinkende Ziege!«
»Och menno!« Wie ein trotziges Kind stampfte Zorm mit seinem linken Bein auf, wobei er versehentlich den Schädel einer der unter ihm liegenden Leichen zertrümmerte. Blut, kleine Schädelsplitter und ein wenig Hirnmasse blieben an seinem Fellstiefel kleben. »Wieso beleidigst du denn jetzt auch noch meine Mutter? Weißt du eigentlich, wie lieb ich meine Mami habe? Meine Mutti ist die allerbeste Mutti auf der ganzen Welt! Du bist wirklich ein ganz ungehobelter Bursche – schlecht erzogen, total aggressiv und absolut unsensibel. Ich will mir diese Unverschämtheiten auch gar nicht mehr anhören!«
Mit einer ungelenken Bewegung warf Zorm der Zerfetzer sein blutbesudeltes Breitschwert von sich. Es landete scheppernd zu Füßen des verwirrt dreinblickenden Orks.
»Du … du ungehobelter, grünehäutiger Rüpel!« Diese Worte als Abschiedsgruß hinterlassend wandte sich der Barbar ab, um dann leise schluchzend den Leichenberg hinunterzulaufen.
Morack öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen und erhob dabei seine Hand. Er ließ sie jedoch wieder sinken, als er feststellen musste, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte. Stumm und in nicht unerheblichem Maße verwirrt blickte er dem Zerfetzer hinterher.
Dieser bahnte sich weiterhin heulend seinen Weg über die vielen Toten, für deren Ableben er zum größten Teil selbst gesorgt hatte. Dass ihm der Schatten einer kleinen, fliegenden Kreatur folgte, das bemerkte er nicht.
Ein einsamer, irgendwie verloren wirkender Ork blieb zurück. Erst nach einigen Minuten fand dieser seine Sprache wieder.
»Das war ja mal ein Ding«, sagte er leise zu sich selbst. »So was ist mir ja noch nie passiert.«
Ratlos schaute er um sich. Einen anderen würdigen Gegner suchte er vergeblich. Alles, was er hätte niedermähen können, war schon geflohen oder lag mehr oder weniger leblos und zumeist recht lädiert auf dem Boden herum.
Schulterzuckend entschloss er sich deshalb dazu, ebenfalls den Heimweg anzutreten. Nachdem er das Schwert des Barbaren aufgehoben hatte, schlenderte er langsam von dannen. Die seltsamen Worte des Zerfetzers hallten derweil in seinen Gedanken wider. Ja, auch er mochte seine Mutter sehr und es war wohl auch an der Zeit, sie mal wieder zu besuchen.
Vorher würde er ihr aber noch ein paar Blümchen pflücken.
2
Noch nie hatte ein Barbarenkönig eine solch unangenehme Unterredung führen müssen wie die, welche Storne Stahlhand nun bevorstand.
Etwas nervös saß er deshalb im herrschaftlichen Langhaus auf dem riesigen, wuchtigen Thron, der an der südlichen Wand des geräumigen Holzbaus stand. Zwei dicke, mehr als mannshohe, lodernde Fackeln flankierten dieses Ehrfurcht einflößende Symbol der Macht. Schon vor Jahrtausenden war dieses aus den bleichen Totenschädeln der unterschiedlichsten Kreaturen Archainos angefertigt worden. Mit viel Geschick hatte man die vielen fleischlosen Häupter zusammengefügt und anschließend mit einem speziellen Harz behandelt, sodass der Zahn der Zeit diesem imposanten Kunstwerk nichts anhaben konnte.
Sehr bequem saß man auf diesem morbiden Möbelstück allerdings nicht. Die Wölbungen der harten Schädel drückten sich selbst durch das dicke, rote Polster, mit dem man die Sitzfläche ausstaffiert hatte. Nach längerem Sitzen hinterließen sie deshalb kleine, schmerzende Dellen im Gesäß.
Dessen ungeachtet war es natürlich trotzdem eine große Ehre, auf dem Schädelthron sitzen zu dürfen. Jeder Angehörige des Barbarenstamms hätte weit mehr als ein schmerzendes Hinterteil in Kauf genommen, um dieses Privileg einmal für sich in Anspruch nehmen zu dürfen.
Doch selbiges war ausschließlich Storne Stahlhand vorbehalten. Erst vor Kurzem hatte man ihn zum neuen Oberhaupt des Stammes ernannt, weil er der stärkste, muskulöseste und braungebrannteste aller Nordland-Barbaren war. Nur Zorm der Zerfetzer wies nahezu identische physische Merkmale auf und wäre aufgrund dessen ebenfalls qualifiziert für das Amt des Königs gewesen. Da Storne jedoch seine Brustmuskeln sehr beeindruckend zucken lassen konnte, war die Wahl letztendlich doch auf ihn gefallen.
Nun stand dem König sein ehemaliger Konkurrent gegenüber. Er stand zwischen dem Thron und der langen, rustikalen Festtafel, die sich fast über die ganze verbleibende Länge des Langhauses erstreckte und an der mehrmals wöchentlich wilde Gelage gefeiert wurden. Die präparierten Tierköpfe, von denen unzählige die Wände aus groben, unbehauenen Baumstämmen zierten, schienen schon ungeduldig auf das Gespräch der beiden Barbaren zu warten.
Während Storne Stahlhand sein Gegenüber missmutig beäugte, rutschte er unruhig auf seinem Thron hin und her. Sein schmerzender Hosenboden war nicht die alleinige Ursache für diese Unrast.
»Nun, Zorm«, begann der König langsam, während er sich seufzend mit der rechten Hand durch sein rabenschwarzes Haar fuhr. Diese Angewohnheit war ihm seit jeher zu eigen und zeigte sich stets, wenn er ein ungutes Gefühl bei einer Sache verspürte. »Du kannst dir sicher denken, warum ich dich hab rufen lassen.«
»Wahrscheinlich geht es um die Schlacht an den Reißzahn-Bergen«, vermutete Zorm kleinlaut. Er hielt dabei seinen Blick auf die Spitzen seiner Stiefel gerichtet.
Allein dafür hätte Storne ihm schon gerne einen Scheitel mit der Breitaxt gezogen, der hinunter bis zu seinem Kinn gereicht hätte. Ein Barbar hatte nicht dazustehen wie ein geprügelter Hund; ein Barbar hatte aufrecht und stolz jedem Ungemach, welches ihm drohte, entgegenzusehen. Natürlich setzte der König seinen Wunsch nicht in die Tat um – zumindest vorerst nicht.
»Und ob es um die Schlacht an den Reißzahn-Bergen geht!«, schnauzte er stattdessen. Dann hielt er eine Schriftrolle hoch, die ihm ein Brieffalke aus dem Lager der Bergorks gebracht hatte. »Dieses Schreiben ist hier eingetroffen, kurz bevor du aus der Schlacht heimgekehrtbist. Es ist von Morack Meuchelhammer und was darin geschrieben steht, kann ich beim besten Willen nicht glauben. Bitte sag mir, dass du nicht – wie Morack es behauptet – vor dem Endkampf davongelaufen bist.«
Zorm hob seinen Blick und schüttelte den Kopf, was eine Welle der Erleichterung in Storne Stahlhand auslöste. Doch der Zerfetzer sollte dieses Wohlgefühl gleich wieder zunichtemachen.
»Ich bin nicht davongelaufen. Ich war es nur leid, mir die unflätigen Äußerungen des Orks anzuhören. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Konversation mit ihm zu beenden.«
»Also bist du doch weggerannt!«, stellte der König aufgebracht fest, wobei er mit seiner flachen Hand auf die Armlehne seines Throns schlug. »Wie peinlich ist das denn? Wie steht unser Stamm denn jetzt da?« Voller Verachtung warf er Zorm die zusammengerollte Schriftrolle an den Kopf. »Ein Heerführer der Nordland-Barbaren, der sich vor einem Kampf drückt. Meuchelhammer wird die schmachvolle Geschichte deiner feigen Flucht überall herumerzählen!«
»Morack Meuchelhammer ist ein ordinärer Flegel«, wandte Zorm der Zerfetzer ein und ein Hauch von Trotz schlich sich in seine Stimme. »Er hat mich und meine Mutter in einer außerordentlich vulgären Art und Weise beleidigt. Ich musste unser Gespräch beenden, um ihn für sein ungebührliches Verhalten zu bestrafen. Es wird ihm sicher eine Lehre sein. Demnächst wird er sein loses Mundwerk zügeln und seinen Gesprächspartnern den gebührenden Anstand entgegenbringen.«
»Ääääääh…«, war zunächst alles, was dem König dazu einfiel. Eine Verwirrung unbekannten Ausmaßes machte sich in ihm breit und nötigte ihm einige Sekunden ab, in denen er sich sammeln musste. Während er dies tat, zog er seine buschigen Augenbrauen zusammen, sodass sie wie ein weit geöffnetes V über seinen fast schwarzen Augen verweilten.
»Habe ich was verpasst?«, fragte er dann. »Seit wann reagieren wir Barbaren auf eine Beleidigung nicht mehr mit brutaler Gewalt und vollständiger Vernichtung? Hat es da irgendeine bedeutsame Veränderung in der natürlichen Ordnung der Welt gegeben, von der ich nichts mitbekommen habe?«
»Gewalt ist doch nicht die Lösung für alles«, sprach der Zerfetzer nun einen Satz aus, wie ihn seit Anbeginn der Zeit wohl noch kein Barbar je ausgesprochen hatte. Er tat dies zudem mit einer Selbstverständlichkeit, die den König in übermächtiges Erstaunen versetzte.
»Es gibt doch auch friedvollere, erwachsenere Methoden der Konfliktbewältigung«, fuhr der Zerfetzer fort. „Einfach mal über die persönlichen Differenzen reden, bei einem Schluck Tee oder auch Met. Dabei sollte man seinem Gegenüber natürlich den nötigen Respekt und auch Verständnis entgegenbringen. Man sollte nicht immer nur draufhauen, draufhauen, draufhauen. Mal das Gehirn zu benutzen, das könnte euch allen nicht schaden.«
»Dich kneift ja wohl dein Lendenschurz!« Maßlose Empörung ließ Storne von seinem Thron hochfahren.
Er kam jedoch nicht mehr dazu, dem blonden Barbaren eine passende und vielleicht sogar schmerzhafte Antwort auf seine unverschämte Bemerkung zu geben. Die hohe Doppeltür des Langhauses öffnete sich nämlich und Grahlum der Greise trat herein.
Grahlum war der Druide der Nordland-Barbaren und wie es sich für einen Druiden gehörte, trug er wesentlich mehr am Leib als die anderen Mitglieder des Stammes. Seine Gestalt wurde verhüllt von einem weiten, erdbraunen Gewand, dessen Kapuze sein Gesicht in tiefen Schatten tauchte. Nur die Spitze seines grauen, schwarz melierten Bartes lugte aus diesem hervor und zwei stechende, graublaue Augen funkelten in dieser Düsternis.
Den langen, knorrigen Stab aus Eichenholz, auf den er sich beim Hereinkommen stützte, benötigte er eigentlich gar nicht als Gehhilfe. Der Druide trug ihn stets als Waffe bei sich und um seiner Erscheinung ein etwas ehrwürdigeres Aussehen zu verleihen. Tatsächlich war er in einer außerordentlich guten körperlichen Verfassung und an Agilität mangelte es ihm in keiner Weise. Für einen Mann seines Alters war dies zweifellos ungewöhnlich, denn die Anzahl der von ihm gelebten Jahre war wirklich legendär hoch. Man munkelte sogar, dass er vor einiger Zeit schon sein fünfzigstes Lebensjahr vollendet hatte.
Solch ein enormer Fundus an Lebenserfahrung prädestinierte Grahlum natürlich dazu, dem König als Berater zu dienen. Darüber hinaus gehörte es zu seinen Aufgaben als Druide, sich um die mystischen, übersinnlichen Belange des Barbarenstamms zu kümmern. Dies beinhaltete das gelegentliche Opfern von Lebewesen, das Brauen geheimnisvoller Tränke und die Kommunikation mit diversen Naturgeistern. Nur noch selten kam er jedoch dazu, sich diesen Verpflichtungen zu widmen, denn auch die Kranken und Verwundeten des Stammes fielen in seinen Zuständigkeitsbereich.
Letztere gab es aufgrund der mehrmals wöchentlich stattfindenden Gemetzel natürlich massenhaft. Er behandelte deshalb nur diejenigen, deren Wiederherstellung voraussichtlich vollständig und somit wertvoll hinsichtlich der Kampfkraft des Stammes sein würde. Dem Rest bereitete er ein schnelles und humanes Ende mit der Streitaxt.
»Zorm!«, rief der Greise erfreut, als er den Zerfetzer sah. »Du bist wieder zurück aus der Schlacht! War bestimmt ein nettes kleines Massaker. Hattest du viel Spaß?«
Während der Druide frohen Mutes näher trat, sah Zorm ihn vorwurfsvoll an. Der uralte Barbar konnte sich natürlich nicht erklären, womit er diese strafenden Blicke verdient hatte.
»Ob ich Spaß hatte?«, fragte der blonde Krieger. »Wie kannst du mir eine so gefühllose Frage stellen? Es war eine grausame, blutige Tragödie! Ich habe den größten Teil meiner Männer in dieser Schlacht verloren. Kaum einer hat es zurück ins Dorf geschafft. Erschlagen und vergessen liegen sie nun fern der Heimat herum und dienen den Krähen als Futter! Und du fragst mich allen Ernstes, ob ich Spaß hatte?«
Man hätte fast meinen können, die Verwirrung würde sich wie ein Virus in dem Langhaus verbreiten, denn die gleiche Verblüffung ergriff nun Besitz von Grahlum, wie sie auch der König noch immer verspürte.
»Na und?«, wunderte sich der Druide. »Das ist doch bei all unseren Schlachten so. Oftmals kommt gar kein Kämpfer aus ihnen zurück und das ist auch ganz gut so. Schließlich berücksichtigen wir diese Verluste ja auch bei der Kalkulation unserer Nahrungsreserven.«
Unverhohlene Missachtung und Entrüstung schlugen dem Druiden nun aus dem Antlitz des Zerfetzers entgegen. »Wie könnt ihr nur so herzlos sein? Ist euch das Leben der anderen Stammesmitglieder denn gar nichts wert? Ihr sprecht vom Töten, als sei es das Normalste auf der Welt. Das ist doch … barbarisch!«
Der Barbar hielt verdutzt inne. Irgendwas schien ihn an seiner eigenen Aussage zu verstören.
»Unser guter Zorm tickt nicht mehr ganz richtig«, mischte sich nun der König wieder ein, der noch immer vor seinem Thron stand und sich mit der flachen Hand seinen Hintern rieb. »Du wirst es nicht glauben, Druide, aber er ist vor Morack Meuchelhammer aus dem Kampf geflohen. Er hat einfach die Biege gemacht und nun sülzt er mich voll mit irrem Geschwafel von friedvoller Konfliktbewältigung und ähnlichem Tinnef. Er hat sogar behauptet, dass Gewalt nicht die Lösung für alles sei.«
Von diesen Worten geradezu schockiert und mit sorgenvoller Miene betrachtete Grahlum den blonden Hünen eingehend. Dann ging er langsam um ihn herum, blieb vor ihm stehen und legte ihm die linke Hand auf seine Stirn.
»Hast du vielleicht einen Schlag auf den Kopf bekommen?« Mit dem Daumen schob er das linke Augenlid des Zerfetzers nach oben, um dessen Augapfel begutachten zu können. »Oder hast du irgendeine andere Verletzung während der Schlacht erlitten?«
Zorm wischte die Hand des Druiden mit einer groben Bewegung beiseite. »Mir fehlt gar nichts«, stellte er dann fest. »Ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie in diesem Moment. Nach all den Jahren des Kämpfens und des Mordens verspüre ich nämlich so etwas wie Frieden in mir. Die Erkenntnis ist in mir erwacht, dass nur ein friedvolles Miteinander aller Rassen dieser Welt ein erstrebenswertes Ziel ist. Nur diesem Ziel werde ich mich fortan widmen.«
Zorm der Zerfetzer musterte erst den Druiden, dann sogar den König mit abfälligen Blicken, die fast schon an Majestätsbeleidigung grenzten. »Aber das könnt ihr beiden natürlich nicht verstehen. Ihr seid weiterhin gefangen in diesem jahrhundertealten Irrglauben, dass Krieg und Zerstörung der Sinn eurer Existenz sei. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Einfühlungsvermögen – all das ist euch fremd. Euch fehlt die Fähigkeit zur Empathie.«
Als Geste der Hilflosigkeit warf Storne Stahlhand seine Arme in die Luft. »Jetzt lässt der sich auch noch neue Wörter einfallen! Die Blitzbirne ist doch total meschugge!«
Grahlum winkte den König wortlos zu sich. Gemeinsam entfernten sie sich so weit von Zorm, dass dieser ihre gedämpften Stimmen nicht mehr vernehmen konnte. Neben der Festtafel unter dem gestrengen Blick einer Elchtrophäe steckten sie ihre Köpfe zusammen.
»Ich habe keine Ahnung, was mit dem Burschen los ist«, gab der Druide flüsternd zu. »Aber so können wir ihn auf gar keinen Fall im Dorf herumlaufen lassen. Mit seinem ganzen Gequatsche von Frieden und diesen seltsamen, erfundenen Wörtern erschreckt er die anderen ja zu Tode.«
Storne nickte ernst. »Soll ich ihm die Runkel runterhauen?«
Erst nach einigem Zögern und Nachdenken verneinte Grahlum. »Vielleicht finde ich ja doch heraus, was mit ihm nicht stimmt. Bis dahin sollten wir ihn irgendwo einsperren. Wie wäre es mit der Rauschhöhle?«
Wieder stimmte der König ihm zu. Die Rauschhöhle befand sich am Rande des Dorfes. In ihr wurden alkoholisierte Barbaren eingesperrt, die bei einem der regelmäßig stattfindenden Besäufnisse über die Strenge schlugen oder bei den obligatorischen Schlägereien zu viel Schaden anrichteten. Für einen geistig derart aus der Fassung geratenen Burschen wie Zorm war dies natürlich eine ideale Unterbringungsmöglichkeit.
»Also gut«, sprach Storne deshalb. »Du lenkst ihn ab und ich setze ihn außer Gefecht.«
Während sich Grahlum nun mit einem aufgesetzten Lächeln Zorm zuwandte, schlenderte der König einmal um die Festtafel herum, um sich dem Zerfetzer unauffällig von hinten nähern zu können. Dabei nahm er einen der vielen Hocker mit, die um selbige herumstanden. Selbstverständlich waren diese Hocker sehr massiv und aus extrem harten Holz gefertigt. Immerhin mussten sie das Gewicht eines ausgewachsenen Barbaren aushalten und nur in den seltensten Fällen betrug selbiges weniger als einhundertzwanzig Kilo.
»Mein lieber Zorm«, begann der Druide nun weiterhin scheinheilig grinsend. »Wie stellst du dir denn dieses friedliche Miteinander aller Rassen so vor? Sollen wir eine Art Rat bilden, in den jede Rasse ihre Vertreter entsendet? Und anstatt sich wie bisher gegenseitig abzumurksen, diskutieren die dann dort miteinander?«
Augenscheinlich bereitete es dem alten Kapuzenträger einiges an Mühe, bei diesen Worten ein Kichern zu unterdrücken. Kein Wunder also, dass sein Verhalten das Misstrauen des Zerfetzers erregte.
Dieser legte seine Stirn in Falten. »Was soll das? Dein Interesse und deine Freundlichkeit sind ganz offensichtlich ebenso falsch wie dein Grinsen. Was hast du vor?«
»Aber Zorm, mein Freund, traust du mir etwa nicht?« Die vorgetäuschte Betroffenheit des Druiden war ganz sicher kein Beweis großer Schauspielkunst. »Ich will dir helfen und dich verstehen. Als Erstes möchte ich mehr über diese M-Party erfahren, von der du vorhin gesprochen hast.«
»Das heißt Empathie!«, entgegnete Zorm. »Und Leute wie du …«
Von weiteren Erklärungen hielt ihn ein Schlag ab, den er an seinem Hinterkopf verspürte. Dieser war zwar schmerzhaft, doch keinesfalls heftig genug, um den Barbaren niederstrecken zu können. Um einen massiven Holzhocker in Brennholz zu verwandeln, dafür reichte dessen Wucht allerdings aus.
Empört drehte sich Zorm zu dem hinter ihm stehenden König um. »Sag mal, was war denn das jetzt für eine Aktion? Dir ist schon klar, dass so etwas wehtut?«
Storne antwortete nicht, sondern zertrümmerte schweigend einen weiteren Hocker auf dem Schädel des Zerfetzers. Lediglich ein Bein des Möbelstücks behielt er in seiner Hand zurück. Nun begann Zorm zu wanken, doch noch immer vermochte er es, sich auf den Beinen zu halten. Erst nach ein paar weiteren Schlägen mit dem zum Knüppel umfunktionierten Hockerbein ging er endlich bewusstlos zu Boden.
»Ganz schön zäh, der gute Zorm«, stellte der König anerkennend fest, während er seine provisorische Schlagwaffe hinter sich warf.
Grahlum der Greise nickte. »Aber leider auch durchgeknallter als ein volltrunkener Iltis. Ich gehe vor und sehe nach, ob die Luft rein ist. Wir sollten unnötiges Aufsehen vermeiden. Es könnte etwas befremdlich auf die anderen Stammesmitglieder wirken, wenn ihr König einen besinnungslosen Heerführer durch das Dorf schleppt.«
Storne lud sich also den schlaffen Körper des niedergeschlagenen Barbaren ohne Mühe auf seine breite Schulter. Dann positionierte er sich neben der Doppeltür des Langhauses, während der Druide selbige durchschritt und langsam davon schlenderte. Sein gemächlicher Gang und das unbekümmerte Gebaren, welches er dabei zeigte, sollte den Eindruck von Gelassenheit und Gemütsruhe vermitteln. Um diesen Anschein noch zu verstärken, pfiff er dabei eine heitere Melodie vor sich hin.
Storne beobachtete den Greisen derweil aufmerksam und fasziniert. Zutiefst beeindruckt war er von diesem genialen, sehr originellen Einfall, mithilfe fröhlichen Pfeifens Unschuld vorzutäuschen. Wie dankbar er doch sein konnte, dass ihm ein solch weiser, erfahrener Mann zur Seite stand. Er würde sich diese grandiose Idee auf jeden Fall merken müssen.
Inmitten der Ortschaft, in der Nähe des Dorfbrunnens, blieb der Druide stehen. Noch immer Luft durch seine gespitzten Lippen pustend sah er sich um, weiterhin um ein möglichst harmlos erscheinendes Auftreten bemüht. Außer einer ungewöhnlich großen Krähe, die sich auf dem Dach des königlichen Langhauses niedergelassen hatte, konnte er jedoch keinerlei Lebenszeichen ausmachen.
Die Sonne hatte die Herrschaft über das Land schon fast gänzlich der Dunkelheit anvertraut, weshalb sich die meisten Einwohner des Dorfs bereits in ihre mit Stroh gedeckten Holzhütten zurückgezogen hatten. Durch die dicken Baumstämme der unverputzten Hüttenwände drangen hier und da ein paar gedämpfte Stimmen oder leises Gemurmel. Ansonsten war alles ruhig.
Grahlum gab dem König deshalb ein Zeichen, woraufhin sich dieser mit der Last auf seiner Schulter auf den Weg machte. Er hatte den Druiden schon erreicht und gemeinsam hatten sie sich bereits nach Süden in Richtung Rauschhöhle gewandt, als hinter ihnen eine unangenehm schrille Stimme erklang.
»Was treibt ihr beiden denn da?«, fragte die Stimme und ließ sowohl Storne als auch Grahlum erschrocken innehalten.
Den zwei Barbaren war diese Stimme wohlbekannt. Sie gehörte Froengi, einer betagten Dorfbewohnerin, die schon mehr als dreißig Winter erlebt hatte. Neben ihrem hohen Alter war sie vor allem für ihre Neugier und Geschwätzigkeit bekannt. Sie personifizierte deshalb genau das, was König und Druide momentan so gar nicht gebrauchen konnten. Zu dumm, dass sie gerade dieser alten Klatschbase auf ihrem Abendspaziergang begegnen mussten.
»Überlass das Reden mir«, flüsterte Grahlum deshalb, während sie sich Froengi zuwandten.
Diese näherte sich ihnen raschen Schrittes. Während sie das tat, betrachtete sie den bloßen, wohlgeratenen Oberkörper des Königs mit eindringlichen, lustvollen Blicken.
Storne erschauderte. Er fand es ekelhaft und geradezu widernatürlich, dass sich eine Frau in solch hohem Alter noch für das andere Geschlecht interessierte. Zumindest war sie altersgemäß gekleidet und trug nicht nur Lendenschurz und Bustier aus Fell, so wie es die jungen Frauen des Dorfs taten. Ihrem Alter entsprechend verbarg sie ihren bestimmt schon welken Körper unter einem weiten, grauen Gewand.
»Aber das ist doch Zorm der Zerfetzer«, stellte sie fest, ohne eine Antwort auf ihre vorherige Frage abzuwarten. »Was ist denn mit dem passiert?«
»Er wurde in der Schlacht verletzt«, antwortete der Druide rasch. »Konnte sich gerade noch so ins Dorf schleppen. Wir bringen ihn jetzt in meine Hütte, damit ich ihn behandeln kann.«
Froengi runzelte ihre Stirn, die in den Augen Stornes ohnehin schon sehr zerfurcht aussah. »Das ist aber seltsam. Ich bin ihm begegnet, als er ins Dorf zurückgekommen ist. Er schien ganz und gar nicht verletzt zu sein. Er ist aufrecht gegangen und ohne ein Zeichen der Schwäche. Wir haben sogar ein paar Worte miteinander gewechselt. Er hat gesagt, er sei des Kämpfens müde und würde sich ein friedliches und harmonisches Leben herbeisehnen.«
Grahlum räusperte sich und der König konnte es geradezu hören, wie der Druide in seinem Kopf nach geeigneten und glaubhaften Erklärungen herumwühlte.
»Wirres Gebrabbel ist ein ganz eindeutiges Symptom einer schweren Kopfverletzung.«, erklärte er dann. »Ebenso symptomatisch ist es, dass der Geschädigte einer solchen Verletzung plötzlich und unvermittelt zusammenklappt. So etwas nennt man Spätfolge. Der arme Zorm war gerade dabei, uns von der Schlacht zu erzählen, als er wie ein nasser Sack in sich zusammensank.«
»So ein Pech aber auch.« Froengis Anteilnahme schien aufrichtig zu sein. »Wo er doch so nette Sachen zu mir gesagt hat. Ich sei doch noch gar nicht so alt, hat er gesagt, eher reif und erfahren.« Ein fast schon entrückter Ausdruck erhellte ihr Antlitz. »Er hat mich sogar attraktiv genannt.«
»Na, daran siehst du ja, wie enorm verwirrt er bereits war«, bemerkte Grahlum. »Es wird bestimmt sehr lange dauern, bis er wieder er selbst ist – vorausgesetzt er überlebt diese Verletzung. Es ist deshalb wichtig, dass ich möglichst bald mit seiner Behandlung beginnen kann.«
»Aha!« Froengi nickte nachdenklich, dann wandte sie sich dem König zu. »Ich finde es aber befremdlich, dass unser König selbst einen Verwundeten durch das Dorf schleppt. So eine niedere Aufgabe sollte er doch seinen Untertanen überlassen. Schickt sich das überhaupt für einen Herrscher?«
Storne antwortete nicht, sondern sah nur hilfesuchend zu seinem Berater hinüber. Dieser verlor langsam die Geduld und verschärfte deshalb seinen Tonfall.
»Einem großen Krieger und Heerführer wie Zorm kann man eine solche Begünstigung schon mal angedeihen lassen. Du hingegen solltest dich mal lieber fragen, ob es sich für eine Frau deines Alters schickt, um diese Zeit noch im Dorf herumzulaufen. Du solltest schon längst im Bett liegen! Reife weibliche Haut benötigt sehr viel Schlaf, sonst trocknet sie aus und wird spröde und runzlig wie die einer getrockneten Pflaume.«
»Verzeiht mir, großer Druide.« Froengi senkte schuldbewusst den Blick. »Ich habe mich nur gefragt, ob ich Euch vielleicht irgendwie helfen kann.« Sie sah wieder auf und ein verschmitztes Lächeln erschien in ihrem Gesicht, das vor vielen Jahren vielleicht sogar mal hübsch gewesen war. »Es wäre nämlich wirklich schade um so einen ansehnlichen, stattlichen Burschen wie Zorm.«
Wieder schüttelte es den König. Alte Frauen mit solch unkeuschen Gedanken waren ihm wahrlich ein Graus. Zudem spürte er, wie sich die Last auf seiner Schulter leise regte. Allzu lang würde die Bewusstlosigkeit des Zerfetzers wohl nicht mehr anhalten.
»Genug, Weib!«, meldete er sich deshalb nun lautstark zu Wort. »Du hast gehört, was der Druide gesagt hat. Tue, was dir dein König nun befiehlt: Geh zurück in deine Hütte und belästige uns nicht weiter! Wir haben schon viel zu viel Zeit mit unnützem Geplapper verschwendet. Ende meiner herrschaftlichen Durchsage!«
Derart gescholten wich Froengi einen Schritt zurück. »Aber natürlich, Hoheit!«
Sie verbeugte sich zum Abschied vor ihrem Herrscher, jedoch nicht tief genug nach dessen Ermessen. Angesichts ihrer bestimmt schon morschen Knochen sah er ihr diese Verfehlung allerdings nach. Dann wendete sie sich endlich ab und ging langsam davon.
»Schwatzhafte, alte Vettel«, zischte Storne leise. »Wir hätten ihr nach dem Tod ihres Mannes schnell einen neuen beschaffen sollen. Das hätte ihre unerträgliche Neugier vielleicht im Zaum gehalten.«
Grahlum stieß ein höhnisches Schnaufen aus. »Sei nicht albern! Das verrottende Gestell hätte doch keiner mehr genommen.«
Er sah der Witwe misstrauisch hinterher. Selbige bewegte sich in einer enervierend mäßigen Geschwindigkeit von ihnen fort und warf immer wieder einen Blick über die Schulter zurück. Glücklicherweise lag die Behausung des Druiden auf halbem Weg zur Rauschhöhle, sodass es tatsächlich so aussah, als würden die beiden Barbaren den Bewusstlosen nun dorthin bringen. Als sie die Hütte erreicht hatten, überzeugten sie sich ausgiebig davon, dass Froengi fort war und auch sonst niemand ihr Tun beobachtete. Da nur die Krähe auf dem Langhaus ihnen weiterhin ihre Aufmerksamkeit schenkte, umgingen sie rasch die Heimstätte des Druiden. Anschließend setzten sie ihren Weg mit beschleunigtem Schritt fort.
Recht schnell und ohne weitere Störungen erreichten sie den kleinen bewaldeten Hügel am Rand des Dorfs, dessen Inneres die Rauschhöhle beherbergte. Deren Zugang war versperrt von einem hohen, massiven Holztor. Wie ein Fallgatter konnte dieses mittels einer dicken, über mehrere Rollen laufenden Kette nach oben gezogen werden. In Gang gesetzt wurde diese aufwendige Vorrichtung durch das Drehen eines großen Handrads, das dem Steuerrad eines Schiffes sehr ähnelte und sich seitlich des Höhleneingangs befand. Zwei oder mehr Personen waren üblicherweise für diesen Kraftakt vonnöten.
Der greise Druide schaffte es jedoch unter großen Anstrengungen auch alleine, das Tor ein wenig zu öffnen. Es hob sich gerade so weit, dass der König den bewusstlosen Körper Zorms davor ablegen und mit seinem Fuß darunter herschieben konnte. Danach ließ Grahlum das Handrad wieder los, woraufhin das Tor wieder nach unten fiel und sich mit einem dumpfen Krachen schloss.
»Das hätten wir«, stellte der Druide zufrieden schnaufend fest. Er schickte sich an, den Heimweg anzutreten, doch sein Begleiter erstarrte plötzlich.
»Moment mal«, sagte Storne. »Mir fällt da gerade etwas ein.«
»Was denn?«, wollte Grahlum wissen.
Der Barbarenkönig verzog sein Gesicht wie unter leichten Schmerzen, dann ließ er die Finger seiner rechten Hand durch die schwarze Mähne auf seinem Kopf gleiten. »Haben wir nicht vor Kurzem auch den Säbelzahntiger dort eingesperrt? Du weißt schon, den kräftigen Burschen, auf den ich letzte Woche im Wald gestoßen bin und den ich mit einem Fausthieb niedergestreckt habe. Ich wollte mir die Bestie doch zum Schoßtier abrichten.«
Im Gesicht des Greisen erschien ein Ausdruck jäher Erkenntnis und Erschreckens.
»Ups!«, machte er, dann hasteten die beiden Barbaren zum Tor.
Mit angehaltenem Atem pressten sie ihre Ohren gegen das dicke Holz und nach nur wenigen Sekunden konnten sie auch schon ein leises Knurren durch selbiges vernehmen. Dieses Knurren näherte sich begleitet vom Tapsen mächtiger Pfoten aus dem Inneren der Höhle. Dann löste ein deutlich wahrnehmbares Schnüffeln dieses Geräusch ab.
»Zorm?« Der König klopfte gegen das Höhlentor. »Zorm, du solltest jetzt vielleicht besser aufwachen!«
»Der rührt sich nicht«, stellte Grahlum fest.
Tatsächlich konnten sie keinerlei Geräusche vernehmen, die auf ein Erwachen des Zerfetzers schließen ließen. Stattdessen wurde es für eine Weile ganz still in der Höhle.
»Vielleicht sollten wir mal nachsehen«, schlug Storne vor.
Der Druide verspürte jedoch keine Lust, den schwergängigen Mechanismus des Tores wieder zu betätigen. Ein weiser Mann wie er war natürlich stets darauf bedacht, unnötige Anstrengungen zu vermeiden.
»Ich habe heute schon genug am Rad gedreht«, stellte er deshalb fest.
Ein lautes Fauchen, das urplötzlich die Stille zerriss, ließ sie diesen Vorschlag auch sofort wieder vergessen. Ein gellender Schrei, der sich ganz eindeutig einer menschlichen Kehle entrang, folgte diesem Fauchen. Die zwei erfahrenen Barbaren hatten freilich schon viele Schreie gehört, weshalb sie diesen auch eindeutig als Todesschrei identifizieren konnten. Danach wurde es wieder ruhiger und nur noch ein genussvollesSchmatzen drang durch das Tor aus der Rauschhöhle.
»Jetzt musst du dein zukünftiges Schoßtier zumindest nicht mehr füttern«, stellte der Druide fest. »So ein Bursche wie Zorm sollte für zwei, drei Tage reichen.«
Der König nickte. »Ich hätte ja gedacht, dass ein erfahrener Krieger wie er auch unbewaffnet gegen eine solche Bestie bestehen kann. Denkst du, dass dieser Wahnsinn, der ihn befallen hat, auch seine Fähigkeiten als Kämpfer beeinflusst hat?«
Grahlum der Greise wiegte nachdenklich den Kopf hin und her. »Entweder das hat seine Kampfkraft beeinflusst oder derUmstand, dass er noch bewusstlos war.«
»Oder das.« So wie sein Begleiter, so wandte sich auch Storne nun wieder dem Dorf zu.
»Es hätte mich aber schon interessiert, was eigentlich mit ihm los war«, bemerkte Grahlum, während sie nebeneinander hergingen.
»Wir werden es wohl nie erfahren«, seufzte der König etwas enttäuscht. Dann grinste er breit. »Eigentlich könnten wir Zorm den Zerfetzer jetzt in Zorm den Zerfetzten umbenennen.«
Der Druide schmunzelte ebenfalls. »Dein Humor ist so feinsinnig und taktvoll wie immer. Anscheinend hast du dich bei Zorm nicht mit dieser maßlos übertriebenen Empfindsamkeit angesteckt.«
Der Barbarenkönig hielt erschrocken inne. »Glaubst du etwa, dass so was möglich wäre?«
Der Greise zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Spürst du vielleicht das Bedürfnis, über deine Gefühle reden zu müssen?«
Die beiden Barbaren brachen angesichts dieser urkomisch absurden Frage in schallendes Gelächter aus. Sie lachten immer noch, als sie die Hütte des Druiden erreichten. Hier sollten sich ihre Wege trennen.
»Ich muss meinen alten Knochen nun etwas Ruhe gönnen«, sagte Grahlum. »Du solltest es mir gleichtun. Morgen willst du ja gegen die Amazonen ins Feld ziehen und deshalb liegt eine lange, anstrengende Reise vor dir. Falls noch irgendwas sein sollte, weißt du ja, wo du mich findest.«
Storne winkte lächelnd ab. »Was soll heute schon noch passieren? Außerdem bin ich König der Nordland-Barbaren, ich werde mit fast allem alleine fertig!«
Der Druide schlug ihm auf die Schulter. »So ist es, Hoheit. Schlaf gut!«
Nach diesen Worten verschwand er in seiner Behausung, während Storne sich auf den Weg zu seiner Heimstätte machte. Er ließ die Ereignisse des Tages noch einmal Revue passieren, während er durch das Dorf schlenderte, was immer wieder ein unwillkürliches Schütteln seines Kopfes verursachte. Seiner Überzeugung und Weltsicht zuliebe würde er sich darum bemühen, diese seltsamen Sachen zu vergessen, die Zorm der Zerfetzer zu ihnen gesagt hatte. Wie sonst sollte ein anständiger Barbar auch mit solch hanebüchenem Unsinn umgehen?
Derart in Gedanken versunken bemerkte er die Gestalt erst spät, die sich ihm in der Dunkelheit näherte. Er erkannte sie dann jedoch sofort. Es war Vorak der Verstümmler, ein weiterer Heerführer in seinen Diensten, dessen Fähigkeiten jedoch bei Weitem nicht an die des leider verblichenen Zerfetzers heranreichten.
»Ah, Vorak!«, begrüßte Storne seinen Untergebenen fröhlich. »Mein bester Feldherr, wie geht es dir denn so?«
Der rothaarige, bärtige Barbar sah seinen König überrascht an. »Bester Feldherr? Ich dachte, das wäre Zorm.«
»Äh, ja natürlich«, berichtigte sich Storne rasch. »Ich meinte ja auch zweitbester Feldherr. Aber darüber unterhalten wir uns ein andermal. Jetzt verrate mir doch erst einmal, ob deine Männer gut vorbereitet sind für den großen Feldzug gegen die Amazonen.«
»Na ja, darüber wollte ich gerade mit dir reden«, erklärte Vorak.
Er tat dies mit einem Zögern, das eines Barbaren natürlich nicht würdig war. Prompt fühlte sich Storne auf unangenehme Weise an das Gebaren Zorms erinnert. Noch mehr davon wollte der König jedoch auf gar keinen Fall über sich ergehen lassen. Sein Gesicht verfinsterte sich deshalb zusehends und in erschreckendem Maße.
»Sprich, Mann!«, forderte er mit einem drohenden Knurren. »Sprich sofort! Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich dir sonst die Zunge aus dem Maul reiße und sie dir an deine Stirn nagle.«
»Ein paar der Männer haben Bedenken bezüglich des Feldzugs geäußert«, berichtete Vorak nun hastig. »Nicht viele, nur vier oder fünf von ihnen. Sie sagten etwas von Gewalt gegen Frauen und dass sie damit nicht einverstanden wären. So etwas würde sich nicht mit ihren ethischen Grundsätzen vereinbaren lassen, haben sie gesagt.«
Storne Stahlhand zuckte zusammen. Schon wieder drangen völlig unbekannte Worte an sein Ohr, die nur einem gänzlich verwirrten Geist entsprungen sein konnten. Darüber hinaus verspürte er ein stärker werdendes Kribbeln in seiner rechten Hand. Irgendwas zog sie wie ein Magnet in Richtung seines Haupthaars.
Er rang sich trotzdem ein hohnvolles Lachen ab. »Jede Amazone würde sich totlachen über so alberne Einwände. Danach würde sie den, der sie geäußert hat, wahrscheinlich bei lebendigem Leib häuten und ihn dann noch mal fragen, was er da gerade über Gewalt gegen Frauen gesagt hat.«
»Ich sehe das ja auch so«, gab Vorak zu. »Aber die Jungs wollen trotzdem wissen, ob auch wirklich alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft wurden.«
Storne verlor nun gänzlich die Kontrolle über seine Rechte. Sie schoss nach oben und pflügte durch sein Haar.
»Natürlich wurden alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft«, erwiderte er entnervt. »Wir haben einen Unterhändler geschickt, der sich mit einer Abgesandten der Amazonen auf neutralem Boden getroffen hat. Dort hat er unsere berechtigten und äußerst vernünftigen Forderungen überbracht, dass sich die Amazonen gefälligst zu unterwerfen haben und sie meine uneingeschränkte Herrschaft bedingungslos anerkennen sollen. Die Gesandte der Amazonen hat dieses großzügige Angebot abgelehnt, woraufhin ihr unser Abgesandter den Kopf vom Hals geschlagen hat. Also mehr Diplomatie geht doch nun wirklich nicht!«
»Aha … nun gut. Aber da ist noch etwas.« Wieder druckste Vorak herum, doch ein Blick in die zornigen, tiefschwarzen Augen des Königs ließ ihn schleunigst fortfahren. »Wir alle bewundern natürlich deine enorme Stärke, deine mächtigen Muskeln und die Makellosigkeit deiner Bräune. Wie du deine Brustmuskeln zucken lassen kannst, imponiert uns natürlich auch ungemein. Doch einige von uns haben sich die Frage gestellt, ob diese Eigenschaften wirklich ausreichen, um ein guter Herrscher zu sein.«
Storne Stahlhand schwieg. Kein Laut drang über seine Lippen, während er seinen Untergebenen eine Zeit lang mit versteinerter Miene anstarrte. Dieser sah bereits sein Leben in einer irrsinnigen Geschwindigkeit an sich vorbeiziehen.
Dann jedoch wandte sich der König schweigend von ihm ab. Er sah zu der Hütte hinüber, in der Grahlum der Greise lebte und zum ersten Mal in seinem Leben stieß er einen lauten, verzweifelten Hilferuf aus. »Druideeeeeee!«
3
Mit einem leisen Sirren löste sich der Pfeil von der nach vorne schnellenden Bogensehne, bevor er sich seinen Weg durch den Dschungel bahnte. Er schoss zwischen hohen Farngewächsen hindurch, drang durch wild wuchernde Sträucher und durchschlug das große Blatt eines Philodendrons.
Sein Ziel jedoch verfehlte er. Stattdessen traf er den Stamm eines gewaltigen Baumriesens, in dem er fast bis zur Hälfte verschwand. Dann blieb er kurz vibrierend dort stecken.
Tissha – die Tochter von Khelea, Herrscherin der Amazonen – fluchte. Sie fluchte wesentlich lauter und derber, als es sich für eine Prinzessin geziemte. Glücklicherweise war niemand zugegen, dem ihre deftigen Kraftausdrücke die Schamesröte ins Gesicht hätten treiben können. Auch die Gestalt, welche sie nur schemenhaft durch das Dickicht hatte huschen sehen, war längst schon wieder verschwunden. Das plötzliche Auftauchen dieses Schattens hatte sie zu dem Schuss verleitet, den sie daraufhin reflexartig, voreilig und mit mangelnder Sorgfalt abgegeben hatte.
Sein Misslingen war jedoch nicht der Grund für ihren Ärger. Sie ärgerte sich über ihr törichtes, unbesonnenes Handeln, das einer erfahrenen Kriegerin wie ihr ganz sicher nicht zur Ehre gereichte. Der Pfeil hätte ihre Beute schwer verletzen oder sogar töten können und das entsprach nicht ihren Absichten. Ihre Intention war es, das entlaufene Haustier möglichst wohlbehalten und weitestgehend unversehrt nach Hause zurückzubringen. Immerhin gehörte es ihrer Mutter und die wäre bestimmt nicht erfreut darüber, wenn Tissha ihrem kleinen Liebling eine ernsthafte Verletzung zufügen würde. Eine solche Fehlleistung würde ihrem Ansehen und ihrem Ruf als Jägerin vielleicht sogar nachhaltigen Schaden zufügen können.
Sie atmete die schwere, feuchte Luft des Urwalds tief ein und spülte ihren Ärger damit hinunter, während sie sich selbst zur Ruhe gemahnte. Es gab keinen Grund zur Eile. Ihre Beute konnte ihr nicht entkommen – nicht hier, nicht in diesem dicht bewachsenen, schwer zu durchdringenden Labyrinth. Nicht mal ein Wesen mit der Geschmeidigkeit einer Schlange und der Gewitztheit einer Maus hätte sich hier fortbewegen können, ohne eine deutlich sichtbare Spur zu hinterlassen. Wie hätte dies also eine Kreatur vollbringen sollen, die so plump, grobschlächtig und zudem recht einfältig war wie jene, die sie verfolgte?
Zügig, doch sorgsam die Umgebung im Auge behaltend, setzte Tissha deshalb die Verfolgung fort. Zerbrochene Äste, geknickte Blätter und zertretenes Moos wiesen ihr dabei den Weg durch den Dschungel, in den aufgrund des dichten, hoch über ihr wuchernden Blätterdachs nur wenig Licht drang. Dieses Zwielicht beeinträchtigte die Amazone in ihrem Bestreben jedoch wenig. Sie hatte schon unter weitaus widrigeren Umständen gejagt und vermochte es sogar in dunkelster Nacht, einer Spur zu folgen. Dagegen war diese Jagd das reinste Kinderspiel. Mitunter hatte ihre Beute einen so komfortablen Pfad durch das Dickicht gepflügt, dass sie diesem mühelos und schnellen Schrittes folgen konnte, was sie natürlich auch tat.
Einige Zeit später fand dieses rasche Fortkommen jedoch ein jähes Ende. Noch immer konnte Tissha die Fährte eindeutig erkennen, doch nun führte sie durch eng verwachsenes Gestrüpp und über das oberirdisch wachsende, gewaltige Wurzelwerk der riesenhaften Bäume hinweg. Sie schulterte deshalb ihren Bogen, zog den Krummsäbel aus ihrem Gürtel und nahm den anstrengenden Teil der Verfolgung auf.
Sie schlug sich durch verworrenes, oftmals dorniges Geäst, erklomm meterhohe, moosbewachsene Wurzeln und ließ sich an seildicken Kletterpflanzen wieder herab. Sie sprang, kletterte, kroch und lief über viele Kilometer hinweg, ohne ein Anzeichen der Erschöpfung zu zeigen.
Selbst ihre Kleidung aus braunem, gehärtetem Leder geriet aufgrund dieser körperlichen Aktivitäten nicht aus der Form. Weder die hohen Stiefel noch der kurze Rock verloren ihren perfekten Sitz. Sogar das äußerst knappe Mieder, das ihre üppigen, wohlgeratenen Formen nur mit Mühe und Not zu bändigen schien, verrutschte um keinen Millimeter.
Das Dasein als Amazone hatte halt so seine Vorteile. Wie für alle Angehörigen ihres Volkes galten nämlich für Tissha ganz eigene physikalische Gesetze. Aus diesem Grund saß ihre Garderobe immer einwandfrei und die Schminke in ihrem makellosen Gesicht wurde niemals von Schweiß oder anderen Einflüssen verunstaltet. Auch ihr volles, blauschwarz schimmerndes Haar sah deshalb immer so aus, als hätte sie es gerade eben erst gekämmt – außer natürlich der Wind zerzauste es ihr in einer Art und Weise, die sie romantisch wild und überaus gut aussehen ließ.
Im Dschungel war es jedoch windstill, weshalb Tissha bald auch tadellos frisiert eine kleine Lichtung erreichte. Auf deren gegenüberliegenden Seite erspähte sie endlich das entlaufene Haustier. Erstaunlicherweise stand selbiges seelenruhig und mit dem Rücken zu ihr da, während es seine Notdurft in einen weiß blühenden Holunderbusch verrichtete. Von dieser Tätigkeit gänzlich vereinnahmt, hatte es die Ankunft der Amazone überhaupt nicht bemerkt.
Tissha grinste und schüttelte den Kopf – auf die Idee, während einer Flucht eine Pinkelpause einzulegen, konnte auch nur ein Mann kommen. Während sie einen Pfeil auf die Sehne ihres Bogens legte, näherte sie sich ihrer Beute behutsam. Noch einmal würde ihr dieser Kerl nicht entkommen. Ein wohlgezielter Schuss ins Bein sollte dies notfalls verhindern und stellte ja auch keine nennenswerte Beschädigung dar.
»Hab dich!«, rief sie, als sie sich ihrem Ziel bis auf wenige Meter genähert hatte. Der Schreck ließ den blonden, hageren Burschen heftig zusammenzucken und seine bislang sprudelnde Quelle schlagartig versiegen.
»Pack dein Gehänge ein, wir gehen heim.«
Hektisch verstaute der Mann seine Preziosen wieder in seinem Lendenschurz. Dann wendete er sich mit erhobenen Händen der Amazone zu. Bestürzt stellte diese fest, wie sehr ihm die Flucht durch den Dschungel geschadet hatte. Neben unzähligen kleinen Verletzungen und Abschürfungen, die seinen verschwitzten, ausgemergelten Körper zierten, war es natürlich der viele Schmutz, der das ausgeprägt ästhetische Empfinden der Amazone störte.
»Nun sieh dich doch nur mal an«, sagte sie weiterhin auf ihre Beute zielend. »Meine Mutter wird stinksauer sein, wenn ich dich so zurückbringe. Deine Tage als ihr Lieblingsgespiele sind wohl vorüber. Den Rest deines Lebens wirst du wahrscheinlich mit dem Verrichten niederer Arbeiten verbringen müssen. Für einen Mann ist das immer noch mehr als angemessen, wenn du mich fragst.«
Tisshas Worte schienen ihr Gegenüber gar nicht zu erreichen. Resigniert und mit leerem Blick starrte der dürre Knabe, der vielleicht gerade mal zwanzig Jahreswechsel erlebt hatte, sie an. Offensichtlich wurde ihm die Sinnlosigkeit seines Handelns nun bewusst und er erkannte, dass es für ihn kein Entkommen gab.
»Ist mir egal«, stellte er mit kraftloser Stimme fest. »Töte mich einfach, wenn du willst, denn zurückgehen werde ich auf gar keinen Fall. Ich möchte lieber tot als weiterhin ein Sklave sein.«
Etwas verblüfft musterte die Amazone das Häufchen Elend. Dessen Erschöpfung beeinträchtigte ganz offensichtlich auch sein Denkvermögen.
»Nun übertreib mal nicht«, bat sie, ihrer Stimme eine gewisse Sanftmut verleihend. »Warum solltest du sterben wollen? Euch geht es doch gut bei uns! Eure Käfige sind sauber und geräumig, ihr bekommt ausreichend Nahrung und gezüchtigt werdet ihr auch nur, wenn ihr es verdient habt. Vor dir ist deshalb auch noch nie eines unserer Haustiere auf die dumme Idee gekommen, solch ein behütetes Leben gegen die Gefahren und Mühseligkeiten der Freiheit tauschen zu wollen.«
»Ich bin ja auch kein Haustier!« Der Tonfall ihrer Beute wurde forscher, fast schon aufmüpfig, was Tissha überhaupt nicht gefiel. Scheinbar mit neuer Kraft erfüllt richtete sich der Bursche auf. »Ich bin ein freier Mann! Ich besitze einen eigenen Willen und habe als Individuum das Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen! Habe ich denn keinen Anspruch auf eigene Wünsche, Träume und Ziele im Leben? Soll es mir denn auf ewig verwehrt bleiben, mich selbst zu verwirklichen?« Er drückte seinen eingefallenen Brustkorb nach vorn, so als würde er ihn Tissha anbieten wollen. »Also los, Amazone, jage deinen Pfeil in mich! Dann sterbe ich zumindest als freies Wesen und für meine Überzeugung. Du jedoch wirst damit weiterleben müssen, dass du einer aufgeklärten, emanzipierten Existenz ein Ende bereitet hast.«
Tissha zog ihre wohlgeformte, dunkelrot geschminkte Oberlippe nach oben und verlieh damit ihrer Verwunderung Ausdruck. Das Mannsbild hatte vermutlich soeben mehr Worte von sich gegeben als in seinem gesamten bisherigen Leben. Üblicherweise beschränkten sich die Äußerungen der Haustiere auf rudimentäre Satzgebilde wie »Habe Hunger!«, »Will schlafen!« oder »Nicht hauen!«. Zudem hatte sie noch nicht einmal die Hälfte dieser komplizierten und in ihren Ohren frei erfunden klingenden Wortgebilde verstanden.
All das ließ sie schlussfolgern, dass dieses Männchen krank war und sie es vielleicht doch besser von seinen Qualen erlösen sollte. Vorher wollte sie aber noch mal nachschauen, ob es auch äußerliche Anzeichen einer Erkrankung an ihm gab.
Vorsichtig, allzeit bereit, den Pfeil auf ihrem Bogen seiner tödlichen Bestimmung zuzuführen, trat sie nahe an den vermeintlich Kranken heran. Mit dessen Dreistigkeit und Respektlosigkeit hatte sie jedoch nicht gerechnet.
Sein rechtes Bein schoss empor und traf ihre linke Schulter, sodass ihr Bogen zur Seite gedrückt wurde. Aufgrund der Erschütterung entwand sich die Sehne ihrem Griff und ihr Schuss löste sich. Nur um wenige Zentimeter verfehlte der Pfeil den blonden Burschen, der daraufhin mit einem Hechtsprung im Gebüsch verschwand.
Wieder stieß Tissha ein paar Flüche aus, die selbst eine Hafendirne in Schockstarre versetzt hätten. Dabei rieb sie sich ihre schmerzende Schulter. Krank hin, krank her – dieser Kerl malträtierte ihren zarten Geduldsfaden weit mehr, als es seiner Gesundheit zuträglich war. Ihn für sein ungebührliches Verhalten büßen zu lassen und seinen Kadaver als abschreckendes Beispiel vor den anderen Haustieren zu präsentieren, dieser Gedanke gewann für sie zunehmend an Attraktivität.
Sie nahm einen weiteren Pfeil aus ihrem Köcher und sondierte die Umgebung. Dieser Urwald war ihr wohlbekannt, weshalb es ihr auch schnell bewusst wurde, wohin der weitere Verlauf dieser Jagd sie beide führen würde. Das kopflos fliehende Männchen würde schon sehr bald einen Teil des Dschungels erreichen, der zu einem großen Teil überschwemmt und dessen Boden morastig, instabil und überaus tückisch war. Darüber hinaus beherbergte dieses Sumpfgebiet einige recht unfreundliche Kreaturen, auf deren Speiseplan auch Zweibeiner ihren Platz hatten. Wenn die Amazone also noch irgendwas von ihrer Beute mit nach Hause nehmen wollte, würde sie sich sputen müssen. Ohne noch länger zu zögern, folgte sie deshalb dem Flüchtenden weiter.
Noch nicht mal hundert Meter war sie seiner Spur gefolgt, als seine verzweifelt klingenden Hilferufe an ihr Ohr drangen. Trotz des zunehmend feuchter und schlammiger werdenden Untergrunds beschleunigte sie ihre Schritte, die sie dennoch geschickt und mit viel Bedacht setzte. Einen Fehltritt wollte sie natürlich vermeiden, denn sollte sie im Morast stecken bleiben, würden Jägerin und Gejagter nur noch im Duett um Hilfe schreien können.
Dank ihrer Erfahrung erreichte sie jedoch ohne Zwischenfälle das ausgedehnte Sumpfloch, welches schon fast einem kleinen See glich und in dessen trübem Wasser der blonde Bursche hilflos herumpaddelte. Der irrigen Annahme folgend, sie durchschwimmen zu können, war der Idiot einfach in die schmutzig braune Brühe gesprungen. Nun steckte er wahrscheinlich in dem schlammigen Boden fest, der sich unter der Wasseroberfläche verbarg. Selbige reichte ihm bereits bis zur Unterlippe.
»Na du Individuum?«, rief Tissha ihm hämisch grinsend zu. »Wie lebt es sich denn so frei und selbstbestimmt?«
»Bitte hilf mir!«, jammerte ihre Beute, anstatt auf ihre Frage zu antworten. »Meine Füße stecken im Schlamm fest und ich weiß nicht, wie lange ich meinen Kopf noch über Wasser halten kann!«
Die Amazone stieß einen schweren Seufzer aus. »Siehst du, Männeken, das ist der Grund, warum wir euch nicht frei herumlaufen lassen. Es ist noch nicht mal einen halben Tag her, dass du aus deinem Käfig geflohen bist und schon steckst du in einer aussichtslosen Lage. Ihr Männer seid einfach zu blöd – zu blöd sogar, um durch einen Wald zu rennen.«
»Bitte!«, flehte der Blondschopf erneut. Obwohl er versuchte, sich mit Schwimmbewegungen über Wasser zu halten, drang immer wieder etwas davon in seinen Mund. Seine Worte wurden deshalb immer wieder von Husten und Spucken unterbrochen. »Wenn du mir hilfst, werde ich mit dir zurückgehen, ohne Widerstand zu leisten.«
Tissha dachte über sein Angebot nach. Die Versuchung in ihr, ihn einfach absaufen zu lassen, war angesichts seiner unverschämten Taten natürlich groß. Andererseits wollte sie nur ungern mit leeren Händen vor ihre Mutter treten und ein lebendiger Mann war wesentlich leichter aus einem Sumpfloch zu bergen als eine Leiche. Zudem würde sie ein lebendiges Haustier nicht schleppen müssen. Was sie mit dem impertinenten Knaben anstellen würde, wenn sie erst mal wieder zu Hause waren, diese Frage ließ sie für den Moment offen.
»Also gut«, entschied sie deshalb. »Ich hol dich da raus, obwohl du es nicht verdient hast. Solltest du diesen Akt der Barmherzigkeit nicht zu schätzen wissen, werde ich die Bäume ringsum mit deinen Innereien schmücken.«
Mit kleinen, vorsichtigen Schritten arbeitete sich Tissha an das Sumpfloch heran. Dieses war begrenzt von einem etwa drei Meter breiten Streifen aus zähem Schlamm, der unter ihren Füßen sofort nachgab. Sie trat deshalb wieder zurück und schätzte die Entfernung zu dem im Wasser planschenden Burschen sorgsam ab. Dessen Sprung hatte ihn über den Schlammstreifen hinweg noch ungefähr zwei Meter weiter ins Wasser befördert. Die Amazone nahm dies mit einer gewissen Achtung zur Kenntnis. Die Leistungsfähigkeit seiner Beine überstieg die seines Gehirns scheinbar erheblich.
Dies gereichte ihm allerdings nun zum Nachteil, denn ohne Hilfsmittel würde ihn Tissha nicht aus seiner Notlage befreien können. Sie sah sich nach einem geeigneten Gegenstand um, fand jedoch nur einen dicken, etwa zweieinhalb Meter langen Ast. Wenn sie ihn damit aus dem Wasser ziehen wollte, würde sie den Rest der Distanz mittels Körpereinsatz überwinden müssen.
»Ich fasse es nicht«, knurrte sie leise, während sie ihre Waffen ablegte. Dann ließ sie sich bäuchlings in den Matsch nieder, um ihr Gewicht darauf möglichst gleichmäßig zu verteilen. »Alles nur wegen einem dämlichen, ungehorsamen Haustier.«
Den Ast in ihrer Linken haltend und begleitet von einem schmatzenden, schlürfenden Geräusch schob sie sich langsam vorwärts, dem Wasser entgegen. Ein Versinken in der breiigen Masse verhinderte sie so, doch als sehr angenehm empfand sie diese Art der Fortbewegung nicht. Der nasse, kühle Schlamm heftete sich an ihre Haut und drang in den Ausschnitt ihres Mieders. Dann schob er sich zwischen ihre Brüste, wo er als dicker, feuchter Klumpen hängen blieb. Diese Methode der Brustvergrößerung sagte Tissha überhaupt nicht zu, zumal sie so etwas ganz und gar nicht nötig hatte.
Kurz bevor sie das Wasser erreichte, hielt sie erschrocken inne. Ein paar Luftblasen waren einige Meter hinter dem blonden Burschen aufgestiegen. Die Amazone glaubte, dort auch eine Bewegung unter der Wasseroberfläche gesehen zu haben. Soweit es ihr möglich war, richtete sie ihren Oberkörper auf, um besser und weiter sehen zu können. Ein großer





























