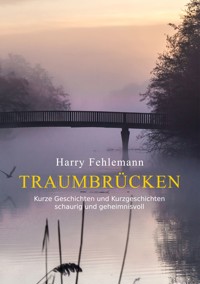5,99 €
Mehr erfahren.
Angst! Jeder hat sie, niemand spricht gerne darüber und doch ist sie latent bei jedem vorhanden. In der titelgebenden Geschichte bekommt ein Junge auf sehr außergewöhnliche Weise die Chance, seine Angst zu besiegen. Doch das hat seinen Preis. Ob er bereit ist, diesen Preis zu bezahlen? Auch der Autor, der in den spanischen Sierras neue Inspiration sucht, hat Angst. Denn jemand schreibt seine Geschichte neu. Die Überlebenden eines Absturzes auf einem fernen Planeten hoffen auf Rettung. Die kommt schnell - jedoch ganz anders, als erwartet. Eine sehr globale Angst lernt ein Geschäftsmann kennen, der auf eine sehr ungewöhnliche Reise geht. Sie wird sein Leben für immer verändern. Sanfter Grusel, ein Hauch Science-Fiction, eine Prise Fantasy und eine kräftige Portion Mystery ergeben zusammen mit einer Spur Gesellschaftskritik diesen abwechslungsreichen Genre-Mix aus 13 verrückten, teils bizarren aber stets unterhaltsamen Erzählungen. Lassen Sie sich entführen in eine Welt des Seltsamen und Ungewöhnlichen, eine Welt fern des Berechenbaren, die den Leser nicht selten auch nachdenklich zurücklässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Harry Fehlemann
Hab’ keine Angst
Neue phantastische Erzählungen und Kurzgeschichten
Harry Fehlemann
Hab’ keine Angst
Neue phantastische Erzählungen
und Kurzgeschichten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Harry Fehlemann
Cover: Harry Fehlemann Foto: © Marco Verch
Illustrationen: Alle Kapitelbilder basieren auf Fotos von Thomas Fabian, f.c. Franklin, worak, Sage Ross, gratuit, Chris Hunkeler, Stephanie Kraus, Gerry & Bonni, mouse, Martin Jacquet, symmetry_mind, Tim Evanson, SC National Guard.
Zu finden unter
www.flickr.com und www.freeimageslive.co.uk
Vielen Dank für die kostenlose Bereitstellung.
gesetzt mit SPBuchsatz
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung ”Impressumservice”, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
ISBN: 978-3-384-01492-4
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Arme Lenore
Karma
Das Tor
Der Junge
In Abgeschiedenheit
Verirrt
Das Rotkehlchen in der Schneekugel
Schmetterlinge
Heimkehr
Hab’ keine Angst
Die Motte
Wenn der Helikopter kommt
Die Läuterung
Hab' keine Angst
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Die Läuterung
Hab' keine Angst
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Vorwort
Dies ist nun also mein zweites Buch. Erstaunlicherweise konnte ich den Band schneller fertigstellen, als es anfangs den Anschein hatte. Doch einige wichtige Änderungen in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich sowohl die erforderliche Zeit aufbringen konnte, als auch den Kopf für noch mehr verrückte Gedanken frei hatte.
Die Geschichten in »Hab’ keine Angst« sind anders – nicht grundlegend, aber durchaus spürbar. Denn das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Ich habe neues erlebt, neue Ängste entwickelt, und auf diese Weise verarbeiten können. Doch vor allem konnte ich auch neue, schöne Seiten des Lebens genießen.
Im Gegensatz zu »Traumbrücken«, das eine Vielzahl meiner alten Erzählungen aus den 90er Jahren enthielt, finden sich in »Hab’ keine Angst« ausschließlich frische, aber nach wie vor wirre Gedanken eines Menschen mit zu viel Phantasie. An der einen oder anderen Stelle bediente ich mich zwar an Ideen, die ich vor Jahren irgendwo in meinen unzähligen Notizen festgehalten hatte, doch am Ende ist daraus stets etwas völlig Neues entstanden.
Weitgehend verabschiedet habe ich mich vom roten Faden der Alltagsgeschichten, wie es ihn noch in »Traumbrücken« gab. Dies geschah jedoch eher unbewusst. Denn ich liebe es, von der eigenen Phantasie überrascht zu werden. Deshalb greife ich mir oft einen Gedankenblitz oder eine Idee, schreibe einige Sätze dazu nieder und lasse alles Weitere auf mich zukommen. Die Geschichten entwickeln sich auf diese Weise so selbständig, als würde sie jemand anderes Schreiben (eine Story im Buch behandelt übrigens genau dieses Thema). Das Ende ist für mich oft selbst völlig überraschend.
Selbstverständlich spiegelt sich in »Hab‘ keine Angst« auch die aktuelle Wirklichkeit wider. Das Buch entstand zu großen Teilen während COVID-19 um sich griff und völlig neue Ängste zu Tage brachte, Ängste, die vorher niemand zu äußern gewagt hätte. Gleichzeitig war eine Verrohung der Gesellschaft für jeden deutlich spürbar, ein Zustand, der kontroverse Diskussionen bis heute beinahe unmöglich macht. Worte sind mehr denn je zur Waffe geworden und verbreiten zweifelhafte Botschaften. Die sozialen Netzwerke dienen dabei als willige Werkzeuge. Profitgier, Unvermögen oder Willkür der Politik fördern grausame Despoten, die sich der gedankenlosen Massen bedienen, um ihre Macht zu vergrößern. Sicher, man könnte meinen, es sei schon immer so gewesen, doch die Welt ist kleiner geworden und das Böse verbreitet sich schneller und wird gnadenloser.
Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich diese emotionsgeladene Gedankenwelt unterschwellig auch in den Zeilen des Buches manifestiert hat. Der Versuch, eine gewisse Ausgewogenheit zu erreichen, scheint mir dabei jedoch einigermaßen gelungen. Denn neben einigen wirklich bösen Geschichten finden sich ebenso viele, die eher versöhnlich stimmen. Es gibt solche, die im Dunkeln mit den Ängsten des Lesers spielen und andere, die hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Doch nichts ist wirklich schwarz oder weiß. Oft blickt man als Leser am Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf eine Geschichte zurück.
Mit »Hab’ keine Angst« erwartet Sie ein abwechslungsreicher Genre-Mix aus sanftem Grusel, einem Hauch Science-Fiction, einem Schuss Gesellschaftskritik, zusammengerührt zu einer Melange aus teils bizarren Ideen, die hoffentlich unterhaltsam daher kommen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der 13 Kurzgeschichten und kurzen Geschichten aus »Hab’ keine Angst«. Wenn Ihnen danach ist, würde ich mich über einen Kommentar auf meiner Webseite www.harryfehlemann.de oder Bewertungen auf den Seiten der Online-Buchhändler sehr freuen. Wenn sie mal eine Frage haben, bekommen sie selbstverständlich eine Antwort. Auch hier finden sie Kontaktmöglichkeiten auf der Internetseite.
Ihr Harry Fehlemann
Vielleicht wäre es anders gekommen, hätte ich versucht, mehr über das Mädchen zu erfahren. Vielleicht hätte ich dann sogar das Unerklärliche verstanden. Vermutlich wäre die Eskalation dennoch nicht zu verhindern gewesen. Doch nun ist es nicht mehr zu ändern und ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Geschehnisse zurück.
An einem warmen Frühlingsmorgen, die aufgehende Sonne schien gelb und leuchtend in das kleine Fenster meiner grob gezimmerten Hütte, trat ich auf die Veranda, sog tief die Luft ein und genoss die neu gewonnene Freiheit. Schon immer hatte ich mir gewünscht, unabhängig von allen gesellschaftlichen Zwängen zu leben, wenn ich wollte, den Tag einen guten Tag sein zu lassen und nichts und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Als die letzte meiner drei Ehen ebenfalls in die Brüche gegangen war, meine Tochter lieber ihrer Mutter, meiner Frau aus zweiter Ehe, nacheiferte und künstlich aufgedonnert durch Schönheitswettbewerbe schwadronierte, und mein Job nur noch eine Last war, zog ich schließlich die Konsequenzen. Ich kündigte – Job, Wohnung, das »wir bleiben aber Freunde« mit den drei Ex und mein altes Leben. Letzteres natürlich nur im übertragenen Sinne, denn ich hatte keineswegs vor, das Zeitliche zu segnen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich für einen solchen Schritt viel zu feige wäre, gab es unzählige Dinge, an denen ich mich erfreuen konnte.
Die Natur war eines davon. Mein lange gehegter Wunsch, in einer abgelegenen Holzhütte irgendwo im Nirgendwo zu leben, kam zum Greifen nahe, als mir mein alter Arbeitgeber nach 30 Jahren »Mitgliedschaft« eine, wie ich fand, durchaus angemessene Abfindung zahlte. Zunächst war ich ein wenig gekränkt, zeigte es mir doch, dass sie froh waren, mich loszuwerden. Gleichzeitig vollführte mein Herz aber einen kleinen Freudentanz angesichts des beachtlichen Betrages. In einem Alter, wo die Rente in nicht mehr ganz so weiter Ferne lag, ließ sich damit bis zum endgültigen Ruhestand einigermaßen gut leben – sofern man nicht für Frauen, Töchter und einen üppigen Lebensstil zahlen musste. All das hatte ich hinter mir gelassen. Die Hütte samt Grundstück hatte mir Charly Overman verkauft, der Besitzer des Lebensmittelladens im nahegelegenen Coppice Grove. Er machte mir einen knackigen Preis, für den ich nicht einmal an meine Abfindung ran musste. Es gab Strom, fließendes Wasser und ein Teil der Einrichtung war auch bereits vorhanden. An das morgendliche Feuer machen und das zugige Toilettenhäuschen, das sich außen an der Hütte befand, musste ich mich zwar erst etwas gewöhnen, aber nach einer Weile ging auch das. Am Rande eines kleinen angrenzenden Ackers hatte ich verschiedene Obstbäume gepflanzt und davor eine Reihe von Gemüsesorten gesetzt. Jetzt zum Beginn des Frühlings war zwar noch nicht viel zu erkennen, aber ich hoffte auf eine ertragreiche Ernte.
Mein Blick wanderte unschlüssig zwischen Schaukelstuhl und Acker, zwischen Faulheit und Tatendrang, hin und her. Also beschloss ich, mir erst einmal einen Kaffee zu machen. Die Beantwortung der Frage, ob ich mir heute mal wieder eine Dosis Aufregung gönnen sollte, schob ich zunächst auf. Die Nachrichten konnten warten und ob das altersschwache Notebook gerade in Arbeitslaune war, stand ohnehin noch in den Sternen. Ja, als Reminiszenz an mein altes Leben gönnte ich mir in der Hütte einen Internetzugang per Satellit. Nach einer Weile bereute ich diese Entscheidung allerdings ein wenig. Denn einerseits schaute ich nur noch selten ins Internet und wenn ich mich dann einmal dazu durchringen konnte, war mein Ärger über das Schlechte in dieser Welt vorprogrammiert. Andererseits wollte ich den Kontakt zur Außenwelt nicht ganz verlieren, auch wenn mein E-Mail-Account eher ein trostloses Schattendasein fristete.
Den dampfenden Pott Kaffee in der Hand, entschied ich, den Ärger zu vermeiden, griff mir eine leichte Jacke und fläzte mich in das weiche Kissen des Schaukelstuhls. Meine Gedanken wanderten zu den heute möglicherweise anstehenden Arbeiten und zu dem Buch, an dem ich seit einigen Wochen eher lustlos herumschrieb. Damals hielt ich es noch für eine gute Idee, in dieser Abgeschiedenheit mit dem Schreiben zu beginnen. Bald merkte ich aber, wie schwer es mir fiel, meine Gedanken in einigermaßen lesbaren Sätzen zu formulieren. Dennoch wollte ich diese Idee noch nicht völlig aufgeben, doch mich hinzusetzen und loszulegen kostete mich jedes Mal etwas Überwindung.
Die kleine Lichtung, auf der die Hütte erbaut war, lag auf einer leichten Anhöhe, umgeben von hohem Mischwald so weit das Auge reichte. Die Zufahrt war beschwerlich. Ein aus grobem Lehm festgefahrener Weg, der bei Regen meist zu einer glitschigen Rutschbahn wurde, führte fast vier Kilometer durch dichtes Gehölz. Ohne einen zumindest ansatzweise geländegängigen Wagen war die Chance, mich zu erreichen, relativ gering – erst recht bei Nacht. Zahlreiche scharfe Kurven und die Schwärze des Waldes konnten für Außenstehenden schnell zur Falle werden. Entweder verirrten sie sich heillos, weil sie vom schlecht erkennbaren Weg abgekommen waren, oder sie blieben einfach irgendwo stecken. Dann ging es meist nur zu Fuß weiter, denn Handyempfang gab es keinen. Zum Glück war so etwas erst einmal vorgekommen und die Situation ließ sich bald klären, da ich in düsterer Vorahnung dem Besucher entgegen gefahren war.
Aus der bequemen Perspektive des Schaukelstuhls streifte mein Hin und Her wandernder Blick über die Wipfel der hohen Bäume in der Ferne und verfolgte einen Schwarm Krähen, der am Himmel hinter einem Rotmilan herjagte. Als der Greifvogel entnervt in die schützenden Äste einer riesigen Kiefer niederging, erregte eine undeutliche, schattenhafte Bewegung im Augenwinkel meine Aufmerksamkeit. Möglicherweise war es auch nur die Ahnung einer Veränderung des inzwischen gewohnten Bildes, aber ich wandte mich ab und sah auf die grobe Umzäunung der Gemüsebeete.
Vor dem Zaun standen drei Personen. Ich erschrak angesichts der Lautlosigkeit, mit der sie erschienen waren. Auch ihr Aussehen wirkte auf mich erschreckend. Es waren eine Frau, ein Mann und ein etwa achtjähriges Mädchen. Ihre Kleidung bestand aus etwas, das man getrost als Lumpen bezeichnen konnte. Hosen, Kleid, Pullover, alles stand vor Dreck und war an vielen Stellen zumindest zerschlissen, wenn nicht gar aufgerissen. Der leicht gebückt dastehende Mann trug als einziger Schuhe, schlammverschmierte Stiefel ohne Schnürsenkel, deren Laschen wie Zungen nach vorne geklappt waren. Trotz der noch längst nicht warmen Temperaturen waren das Kind und die Frau barfuß. Das Alter der Erwachsenen zu schätzen war unmöglich. Sie hätten sowohl Ende zwanzig, als auch Ende vierzig sein können. Eine dicke Schmutzschicht verhinderte eine genauere Eingrenzung. Das Mädchen war nur als solches zu erkennen, weil ihr Gesicht etwas puppenhaftes hatten und von langen, zottigen Haaren eingerahmt war. Alle drei waren dünn wie Vogelscheuchen. Sie standen völlig reglos vor dem Jägerzaun und starrten mich an. Dabei schienen ihre pechschwarzen Augen geradezu in meinen Pupillen zu versinken, als versuchten sie, mich zu hypnotisieren. Nur mit Mühe konnte ich den Blick von dem unheimlichen Trio abwenden. Mit einem Ächzen hievte ich mich aus den Tiefen der Schaukelstuhlmulde und machte einen Schritt auf die drei zu. Mit aufgerissenen Augen wichen sie zurück und stießen dabei leicht gegen den Zaun.
»Hey, keine Angst. Ich beiße nicht.« Beschwichtigend hielt ich ihnen die Hände entgegen und symbolisierte damit meine Harmlosigkeit.
»Was macht ihr hier in dieser einsamen Wildnis?« Keine Antwort. Nur dieses Starren.
Ich startete einen weiteren Versuch im Plauderton. »Ihr solltet hier aber nicht sein. Der Wald kann ganz schön gefährlich sein, wenn man sich nicht auskennt.« Noch immer keine Reaktion. Nach einer Weile des Schweigens trat das Mädchen einen halben Schritt vor und mit einer seltsam rauen und leisen Stimme stieß sie nur ein Wort hervor. »Essen!«
Das hätte ich mir natürlich denken können. Der Zustand der drei legitimierte das Ansinnen des Kindes geradezu als selbstverständlich. Sie sahen aus, als hätten sie bereits seit Tagen keine vernünftige Mahlzeit mehr zu sich genommen. Für einen Moment überlegte ich, was ich tun sollte.
Ich hatte mich in meinem Bekanntenkreis nie als besonders geselliger Mensch gezeigt. Die wenigen Freunde, die ich in der Vergangenheit hatte, sahen in mir eher eine Art Spaßbremse, die nur selten aus sich heraus kam. Was ich aber definitiv nicht leiden konnte, waren Menschen in meinem eigenen Haus, die ich dort nicht haben wollte. Das hatte immer wieder zu Streit mit meinen Ex-Frauen geführt, die Schwiegermütter, Freundinnen und die Freundinnen unserer Tochter regelmäßig bei uns einquartierten. Bis zu einem gewissen Grad war ich bereit, das zu tolerieren, aber es gab Momente, wo diese Gäste ihr Gastrecht arg überstrapazierten. Das ließ mich immer wieder aus der Haut fahren. Zumindest meine erste Ehe hatte dieser eigenbrötlerischen Eigenart nicht standgehalten.
Hier in meinem ganz eigenen Domizil, bewusst fern ab jeglicher Zivilisation, wollte ich mich erst recht nicht mit Eindringlingen herumschlagen. Also beschloss ich, dies auch jetzt konsequent so zu halten – so bedauernswert die drei in meinem Vorgarten auch aussahen. Ich hatte weder die Lust, die Geduld, noch die nötige Barmherzigkeit, um mich mit ihren Problemen zu befassen. Es gab öffentliche Sozialeinrichtungen, die sich um solche Menschen kümmerten. Ich war der Falsche dafür.
Mit dem Wort »Moment« verschwand ich im Haus, packte einige Lebensmittel in einen Jutebeutel und kehrte zurück auf die Veranda. Die Situation war unverändert. Wie Statuten standen sie da und musterten jede meiner Bewegungen. Als ich die drei Stufen zum Vorgarten herunterstieg und den Beutel langsam auf dem Boden abstellte, drückten sie sich mit angstvollem Blick noch ein wenig mehr gegen den Zaun.
»Ich habe euch etwas zu Essen eingepackt. Mir fehlt der Platz, euch zu beherbergen, aber von dem, was ihr in der Tasche findet, sollte ihr erst einmal satt werden. Wenn ihr diesem Weg dort folgt«, ich deutete auf die unbefestigte Spur, die von meinem Haus wegführte, »dann kommt ihr zum nächsten Ort. Dort gibt es eine Sozialstation, die euch sicher weiterhelfen wird.«
Die schwarzen Augen blieben ausdruckslos. Nur das Mädchen zeigte eine Regung, die ich allerdings nicht zu deuten wusste. Am ehesten war es ein fragender Blick, der sich auf ihrem schmutzigen Gesicht abzeichnete. Mir war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, sie einfach fortzuschicken. Ich weigerte mich aber gleichzeitig, mir neue Probleme aufzuhalsen, jetzt, wo ich gerade begonnen hatte, das Leben endlich zu genießen.
Rückwärts stieg ich die Stufen zur Veranda hinauf, trat ins Haus und schloss die Tür hinter mir. Durch das Fenster beobachtete ich sie weiter. Nichts deutete zunächst darauf hin, dass sie ihren Platz verlassen würden. Die Lethargie, die von der kleinen Gruppe ausging, war geradezu greifbar. Nach einer ganzen Weile schob sich jedoch der zierliche Körper des Mädchens vorsichtig nach vorne, ohne dabei allerdings die Eingangstür, hinter der ich verschwunden war, aus den Augen zu lassen. Sie ergriff die abgestellte Tasche und trat schnell den Rückzug an.
Ein riesiger Schwarm Krähen schwebte in diesem Augenblick laut kreischend über mein Haus hinweg. Einige ließen sich kurz auf dem Zaun nieder, nur um dann mit schweren Schwingen ebenfalls dem Wald zuzustreben. Es waren nur wenige Sekunden der Ablenkung, doch als ich wieder nach den seltsamen Besuchern schaute, waren sie fort. Erneut überkam mich ein unheimliches Gefühl. Ich hatte den Eindruck, als seien sie nicht gekommen und gegangen, sondern erschienen und verschwunden, lautlos, wie Geister.
Dieses unwirkliche Ereignis verfolgte mich den ganzen Tag. Immer wieder suchte ich die Lichtung nach Personen ab, konnte aber niemanden entdecken. Ich nahm mir vor, am Nachmittag ins Dorf zu fahren und mir neue Lebensmittel zu kaufen. Auch wenn die Speisekammer stets ausreichend gefüllt war, würde mich das vielleicht ein wenig von den unbehaglichen Gedanken ablenken. Denn in meinem Kopf hatten sich jetzt doch einige Zweifel ausgebreitet. Vor allem wegen des Mädchens machte ich mir Vorwürfe. Ich hätte sie wohl besser nicht in den Wald zurückschicken sollen. Immerhin waren es mehr als fünf Kilometer bis nach Coppice Grove, und ob es dort wirklich eine Sozialstation gab, wagte ich sehr zu bezweifeln. Denn ehrlich gesagt wusste ich es nicht. Um die drei abzuwimmeln, hatte ich es schlicht behauptet. Früher konnte ich mit kleinen Notlügen recht gut leben, doch dieses Mal plagten mich Gewissensbisse. Ich redete mir ein, sie würden schon klarkommen. Immerhin handelte es sich um erwachsene Menschen, die sicherlich in der Lage sein würden, ein gewisses Maß an Eigeninitiative und Selbstverantwortung an den Tag zu legen. Auf diese Weise etwas beruhigter, machte ich mich an mein Tagewerk, das aus Holz hacken, Unkraut jäten, Geschirr abwaschen und vielen anderen Kleinigkeiten bestand. Die merkwürdige Familie, ich ging davon aus, dass es sich um eine Familie handelte, verstaute ich in einer hinteren Ecke meiner Erinnerung.
* * *
Der nächste Tag begann mit den gleichen wohltuend stressfreien Routinen, wie schon die vielen Tage zuvor. Doch auch wenn ich mich vorwiegend nur mit Dingen befassen wollte, zu denen ich Lust hatte, gab es solche, die unbedingt erledigt werden mussten. Dazu zählte die Prüfung der Essensvorräte. Es wurde zwar langsam Frühling, aber dennoch war in dieser Region nie völlig auszuschließen, dass es noch einmal zu einem plötzlichen Wintereinbruch kam. Eine Fahrt nach Coppice Grove konnte dann zu einem gefährlichen Abenteuer werden. Daher war eine gut gefüllte Vorratskammer unerlässlich. Der Vorfall am Tag zuvor hatte meine Vorräte schneller zusammenschrumpfen lassen, als vorgesehen. Also beschloss ich, den ursprünglich gestern geschmiedeten Plan heute umzusetzen und einen kleinen Ausflug zu Charly’s Grocery Store zu machen. Mein alter Toyota 4Runner brauchte ohnehin wieder etwas Bewegung und mir würde diese Abwechslung sicher auch nicht schaden. Das Wetter war gut, denn es war trocken und die Strecke durch den Wald damit gut befahrbar. Ideale Voraussetzungen.
Mit einer Einkaufsliste bewaffnet schwang ich mich in den Wagen und holperte den unebenen Pfad entlang. Sobald ich die Lichtung hinter mir gelassen hatte, wurde es trotz eines leicht diesigen, aber dennoch sonnigen Wetters, so dunkel, dass ich die Scheinwerfer einschalten musste. Denn so oft ich diese Strecke bereits zurückgelegt hatte, ich fühlte mich immer noch ein wenig unsicher angesichts ihrer Unübersichtlichkeit, den scharfen Kurven und plötzlichen Gefällen. Stets fuhr ich etwas vorsichtiger, als es ein echter Ortskundiger vermutlich getan hätte. Die festgefahrene Straße führte am Rande eines kleinen Tals entlang und wand sich in engen Serpentinen um einige Hügel und natürliche Felsformationen herum. In einer Senke kreuzte ein Bachlauf den Weg.
Gerade ließ ich den Wagen langsam das Gefälle vor dem Bach hinabgleiten, als ich abrupt auf die Bremse stieg. Obwohl es verhältnismäßig trocken war, rutsche das Fahrzeug noch einige Meter und kam direkt vor dem sanft plätschernden Rinnsal zum Stehen. Quer über der Fahrspur am Rande des Wasserlaufs lag ein schwerer Baumstamm. Krank oder altersschwach hatte er sich vermutlich erst kürzlich aus seiner sicheren Erdverankerung gerissen. Morsche Äste und Zweige lagen abgebrochen überall in der Umgebung verteilt und alles deuteten darauf hin, dass ihn seine Lebenskraft bereits vor langer Zeit verlassen hatte.
Ich fluchte leise in mich hinein und begann, die Chancen abzuschätzen, dieses hölzerne Monstrum beiseite zu räumen. Der Stamm erschien mir sehr schwer und obwohl mein Toyota über eine Seilwinde verfügte, bezweifelte ich, dass ihre Kraft ausreichen würde. Bei einer eingehenden Untersuchung der Baumleiche und der Möglichkeiten einer sicheren Befestigung des Seils fiel mein Blick auf etwas, das nicht hierher gehörte. Es war ein störendes Detail im sonstigen Gleichklang der natürlichen Flora und Fauna. Etwas hatte sich am Boden über einige niedrige Zweige ausgebreitet und ragte teilweise in das Wasser des Bachlaufs. Es war ein Tuch, dessen Farbe sich zwar in die Tönung der Umgebung einfügte, das aber alleine schon dadurch herausstach, dass es nicht natürlichen Ursprungs war. Das Graubraun des Stoffes wurde unterbrochen von einem dunkelroten Schimmer, der sich wie verschütteter Erdbeersaft darauf ausbreitete. Mit einem Zweig hob ich das Gewebe ein wenig an und glaubte, es wiederzuerkennen. Die schmutzige Farbe und das kaum erkennbare Muster hatte ich am Tag zuvor bereits gesehen. Es war der Rock der seltsamen Frau. Doch weshalb lag er hier? Ein leichtes Frösteln überkam mich und ich warf ängstliche Blicke nach links und rechts. Mir schwante Böses. Mit einer schnellen Bewegung hob ich das Kleidungsstück ganz von seiner Unterlage und dieses Mal war es nicht nur ein Frösteln. Zwischen Stauden, einigen Bruchsteinen und Zweigen lag ein schnürsenkelloser Stiefel, dessen Zunge nach vorne geklappt war. Auch darauf befand sich die gleiche dunkelrote Verfärbung, die ich auf dem Kleid entdeckt hatte. Langsam dämmerte mir, um was es sich dabei handelte. Es war Blut! An mehreren Stellen hatten sich weißlich schimmernde Stücke in der Lasche des Materials verklebt und ich wollte mir gar nicht erst nicht vorstellen, was das sein könnte. Mit klopfendem Herzen sprang ich zum Wagen, setzte ein wenig vor und ließ das Stahlseil ausfahren.
Es ging leichter, als erwartet. Das ganze Fahrzeug zitterte und vibrierte, als die schwere Winde den Stamm langsam aber stetig beiseite zog. Am Ende war der Weg frei und ich konnte die Fahrt fortsetzen. Das flaue Gefühl im Magen angesichts meiner Entdeckung blieb bestehen, doch ich musste mich zu sehr auf den unwegsamen Pfad konzentrieren, als dass ich einen Gedanken daran verschwenden konnte. Der Wald lag schließlich hinter mir und ich fuhr den letzten Kilometer die gut befestigte Landstraße entlang. Gleichzeitig setzte das Räderwerk in meinem Kopf wieder ein. Der Fund konnte alles Mögliche bedeuten, von einem Unfall über Raubtiere bis hin zu einem Verbrechen. Vielleicht gab es auch einen völlig harmlosen Grund, der sich klären würde, wenn … ja wenn was? Jemand nach ihnen suchte? Ich mich selbst auf die Suche nach ihnen begab? Weshalb sollte ich das tun? Es waren Fremde und ich hätte keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Wenn überhaupt, so mussten das offizielle Stellen übernehmen. Die kannten sich in der Gegend vermutlich aus und waren deutlich besser ausgerüstet für eine Suche im Dickicht des Waldes. Doch was konnte ich schon melden? Unbekannte Landstreicher haben von mir zu Essen bekommen und sind dann verschwunden? Das würde keinen Polizisten auch nur einen Deut scheren. Selbst das vermeintliche Blut und die Kleidungsstücke waren kaum ein Indiz dafür, dass ihnen etwas zugestoßen war. Ich beschloss, das Ganze auf sich beruhen zu lassen und betrat Charlys Lebensmittelgeschäft.
Charly war ein kleiner stämmiger Mittfünfziger mit Halbglatze und einem lustigen, seltsam unsymmetrischen Gesicht. In dem rotkarierten Flanellhemd, den schmutzigen Jeans und den Arbeitshandschuhen, die zu ihm gehörten, wie eine Uniform, wirkte er wie ein etwas zu kurz geratener Holzfäller. Ständig wuselte er zwischen den Gängen seines Ladens umher und räumte Waren von A nach B. Als ich eintrat, blickte er kurz von einer vollgeschriebenen Liste auf und grüßte beiläufig mit einer winkenden Armbewegung. Ein knappes Zurückwinken und schon schob ich einen Einkaufswagen an den gut gefüllten Regalen vorbei. Da ich mir angewöhnt hatte, meine Einkäufe vorher genau zu planen, und ich die Sortierung des Ladens bereits kannte, hatte ich schnell alles Notwendige zusammengesucht. An der Kasse legte Charly die Warenliste beiseite und widmete mir nun ganz seine Aufmerksamkeit.
»Na, alles in Ordnung bei dir?«, fragte er fröhlich und lächelte dabei sein schiefes Lächeln.
»Soweit ja, aber gestern ist etwas seltsames passiert.«
Ich erzählte ihm von den drei Landstreichern und ihrem merkwürdigen Verhalten. Auch die Entdeckung während der Fahrt nach Coppice Grove ließ ich nicht aus. Einen Moment wurde Charlys Gesichtsausdruck sehr nachdenklich. Dann meinte er ernst:
»Landstreicher sind hier zwar selten, aber auch ich habe schon einmal ein Pärchen erwischt, das versucht hat, mich zu beklauen. Mann, die sahen vielleicht abgerissen aus. Aus Mitleid habe ich schließlich ein paar Sachen für sie zusammengepackt und ihnen geraten, sich hier nicht mehr blicken zu lassen. Aber das ist schon ein, zwei Jahre her. Sonst sieht man hier eher selten welche.«
»Meinst du, ich sollte der Polizei davon erzählen?«
»Das kannst du dir vermutlich sparen. Wenn die nicht wirklich etwas angestellt haben, rühren die Deputies für sowas keinen Finger. Dafür sind sie viel zu träge – oder wie sie es nennen, zu ›beschäftigt‹. Außerdem weißt du ja nicht wirklich, was passiert ist.«
»Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Ich denke, es wird das Beste sein, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Vermutlich verbirgt sich ohnehin nichts Dramatisches dahinter. Danke und mach’s gut.«
Mit diesen Worten verließ ich den Laden, lud meine Einkäufe ein und machte mich auf den Heimweg. Als ich den Bachlauf passierte, konnte ich allerdings nicht umhin, noch einmal nach Hinweisen Ausschau zu halten, die möglicherweise Aufschluss darüber gaben, was hier geschehen sein könnte. Doch ich fand nichts und war einigermaßen beruhigt.
* * *
Schon aus der Ferne sah ich sie. Das Mädchen saß steif auf der obersten Stufe der Veranda und schaute mir mit scheuen Augen entgegen. Außer der Tatsache, dass sie dieses Mal offensichtlich alleine war, hatte sich nichts verändert. Als sie mich entdeckte, sprang sie mit gehetztem Blick auf und versteckte sich hinter einer dichten Hecke neben der Terrasse. Obwohl sie wusste, dass ich sie noch sehen konnte, schien ihr das ein wenig Sicherheit zu geben. Denn sie hatte jederzeit die Möglichkeit, schnell die Flucht zu ergreifen. In der Erkenntnis, dass sich das Problem vom Vortag wohl doch nicht erledigt hatte, kämpfte ich einen Moment mit einer Mischung aus Ärger, Schrecken und Mitleid. Unmittelbar fragte ich mich, wo ihre Eltern waren – sofern es sich um ihre Eltern gehandelt hatte. In meiner Phantasie spielten sich dazu angesichts der Entdeckung am Bach erschreckende Szenen ab. Nur mit Mühe gelang es mir, diese wilden Gedanken zu verdrängen. Stattdessen keimte die Sorge um das Wohl dieses verloren scheinenden Kindes in mir auf. Ein so junges Mädchen, zierlich, ängstlich, alleine in der Wildnis? Das durfte nicht sein. Es zerriss mir das Herz. Langsam stieg ich aus dem Wagen und ging vorsichtig auf sie zu. Dabei hoffte ich, im Augenwinkel doch noch irgendwo die Eltern zu entdecken. Vergeblich. Außer dem verschüchterten Wesen hinter der niedrigen Hecke war niemand zu sehen.
»Hab keine Angst.« Der Versuch, meiner Stimme eine beruhigende Tonlage zu geben, gelang mir einigermaßen. »Ich tue dir nichts.«
Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, wurde mir bewusst, wie abgedroschen sie klangen. Sicher sagten das auch Kinderschänder und Mörder, wenn sie sich ihren unbedarften Opfern näherten. Aber mir fehlte es gerade an einem besseren Repertoire, was zusätzlich deutlich machte, dass ich mit der Situation ziemlich überfordert war. Denn wie sollte es nun weitergehen? Keine Frage, ich musste das Mädchen schnellstmöglich den Eltern, wo auch immer sie sein mochten, oder der Polizei übergeben. Dort könnte sich die Fürsorge dann um sie kümmern. Doch was machte ich jetzt mit ihr? Vermutlich würde sie nicht freimütig in meinen Wagen steigen. Ich war für sie ein völlig Fremder und sicher hatten auch ihre Eltern ihr eindringlich erklärt, niemals zu Fremden ins Auto zu steigen. Anrufen war ebenfalls nicht möglich. Ich besaß weder Festnetztelefon noch Handy-Empfang. Internet! Das wäre eine Option. Doch die Reaktion auf eine E-Mail könnte im ungünstigen Fall Tage dauern. Zu allem Überfluss hatte ich sämtliche Kontakte, die früher potenziell in Frage gekommen wären, irgendwann abgebrochen. In meinem Hinterkopf notierte ich, zukünftig für solche oder ähnliche Notfälle vorzusorgen. Doch das half mir in diesem Augenblick nicht weiter.
Um nicht weiterhin den Eindruck eines Kinderschänders zu erwecken, sagte ich: »OK, ich weiß, du kennst mich nicht und ich kann mir vorstellen, dass du Angst hast. Ich werde jetzt in aller Ruhe meinen Wagen ausladen und ins Haus gehen. Du entscheidest, wann du bereit bist, mir zu folgen. Dann werden wir gemeinsam überlegen, was wir mit dir machen.« Ich biss mir auf die Zunge angesichts dieser etwas ungeschickten Formulierung, doch ich hoffte, sie würde verstehen. Immer einen Seitenblick auf das verängstigt am Boden kauernde Mädchen werfend, trug ich meine Einkäufe langsam zum Haus, ließ beim Eintreten die Tür offen stehen und begann die Vorräte zu verstauen.
Die Dunkelheit war bereits angebrochen, als sich ihr kleiner Schatten, beschienen vom Dämmerlicht der untergehenden Sonne, endlich im Türrahmen zeigte. Sie stand nur da, so wie sie auch am Vortag bereits vor ihren Eltern gestanden hatte – mit hängenden Schultern, schmutziger und zerrissener Kleidung und einem Gesicht, das gleichzeitig Panik und Flehen ausdrückte. Sie presste ihre vor Dreck starrenden Hände fest gegen spindeldürre Beine, die aus einem knielangen, fadenscheinigen Rock herausragten. Man konnte ihr deutlich die Anspannung und Überwindung, den Raum zu betreten, anmerken. Ich betrachtete sie aus einiger Distanz vorsichtig und dachte über die nächsten Schritte nach. Dabei erregte ein dunkler Fleck auf ihrer rechten Hand meine Aufmerksamkeit. Im Lichtschein der Zimmerlampe schimmerte etwas unter der grauen Schmutzschicht hindurch. Es sah aus, wie ein Zeichen oder ein Tattoo. Ich folgte den Linien des Schattens und versuchte, die Form genauer zu erkennen. Dann war ich mir sicher. Es handelte sich um einen Schriftzug. Der graubraune Belag auf ihrem Handrücken verdeckte einen Namen: Lenore.
* * *
»Du heißt Lenore, nicht wahr?« Ein kaum wahrnehmbares Blitzen in ihren dunklen, unergründlichen Augen zeigte mir, dass ich Recht hatte. »Möchtest du nicht reinkommen und dich ein wenig umschauen?« Wie konnte man das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der derart weit entfernt war? An die Antwort auf diese Frage tastete ich mich durch einen ruhigen Plauderton eher unsicher heran. Wahrscheinlich würde es helfen, zu erfahren, was für ein Leben dieses Mädchen bisher hatte erdulden müssen und wie sie in diese Lage geraten war? Doch es gab Geheimnisse, die für immer verborgen blieben, und ich hatte das unbestimmbare Gefühl, dies war eines davon.
Noch immer stand sie im Türrahmen. Die kühle Luft des beginnenden Abends wehte herein und ich fröstelte. Dennoch wollte ich die Tür jetzt nicht schließen, nicht bevor sie sich entschieden hatte, entweder draußen oder in meiner Hütte die Nacht zu verbringen. Sie senkte ihren Blick und strahlte mit dieser Bewegung in ihrer Zierlichkeit, der grenzenlosen Hilflosigkeit und der von Angst geprägten Anspannung eine unendliche Traurigkeit aus. Ich wollte diesem Mädchen helfen, doch fehlte mir jeglicher Ansatzpunkt, wie ich das bewerkstelligen könnte. Es war nicht die Tatsache, dass sie ein Kind war. Ich selbst hatte auch eine Tochter. Als Chloe in ihrem Alter war, sprühte sie vor Übermut und Lebensfreude. Nichts konnte ihr den Spaß am Leben nehmen, keine Lehrer, keine nervigen Mitschüler und schon gar nicht die Eltern, denen sie mit beinahe berechnender Selbstsicherheit auf der Nase herumtanzte. Nein, es war diese völlig neue Definition des Wortes »scheu«, die von diesem zerbrechlichen Wesen ausging, und das brachte mich an meine Grenzen.
Da es sinnlos war, hier herumzustehen und weiter das Mädchen anzustarren, begann ich, Feuerholz im Kamin aufzustapeln. Ich wandte mich bewusst ab, um der Situation etwas die Spannung zu nehmen. Die Scheite waren feuchter als erwartet und ich brauchte mehrere Anläufe, bis sich endlich eine stetige, aber qualmende Flamme an dem Holz ausbreitete. Lenore war einige Zentimeter näher gekommen und schaute nun mit großen erstaunten Augen auf das Züngeln des Feuers. Sie wirkte fasziniert und erstmalig zeigten sich neben der Angst andere Gefühlsregungen in ihren Gesichtszügen. Es waren echte, kindliche Empfindungen, die sich dort abzeichneten. Die Vorsicht war nicht gewichen, aber eine natürliche Neugierde gesellte sich hinzu. Das war ein Anfang.
Für meine Kochnische hatte ich eine Falttür anfertigen lassen, die es mir ermöglichte, die Unordnung der Küche auszuschließen. Nun schob ich die Tür zur Seite und begab mich an die Zubereitung eines Imbisses. Eigentlich hatte ich geplant, am Abend zu kochen, doch wollte ich Lenore nicht gleich überfordern. Mit wenigen Handgriffen bestrich ich einige Scheiben Weißbrot mit Erdnussbutter und belegte zwei weitere mit Käse.
Beides verteilte ich auf Teller, stellte einen auf meinen niedrigen Couchtisch, den zweiten mitten im Raum auf den Fußboden. Mit misstrauischem Blick verfolgte sie mein Treiben und wich sofort zurück, als ich den Teller mit den Sandwiches vor ihr abstellte. Dann begann ich zu essen – etwas zu demonstrativ, wie ich fand.
Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde, sie dazu zu bewegen, ins Auto zu steigen, um mit ihr nach Coppice Grove zu fahren. Doch hier konnte sie nicht bleiben. Mal abgesehen davon, dass es mir nicht zustand, über das Schicksal des Mädchens zu bestimmen, könnten im schlechtesten Falle auch noch üble Gerüchte aufkommen. Deshalb würde ich alles daran setzen, sie so bald wie möglich zur Polizei zu bringen. Ich musste es nur langsam angehen.
* * *
Irgendwann schlief ich in Gedanken versunken auf dem Sofa ein. Der ereignisreiche Tag forderte seinen Tribut. Als ich erwachte, war es 2:45 Uhr. Ein ungewöhnliches Geräusch hatte sich in meinen Schlaf gedrängt und verlangte nach Aufmerksamkeit. Missmutig stellte ich fest, dass sich ein Sofa so gar nicht für die nächtliche Ruhe eignete. Davon zeugten nun ein eingeschlafener Arm und ein stechendes Ziehen im Rücken. Von der Veranda her hörte ich ein dumpfes Rumpeln. Ich schaltete das Licht ein und überlegte kurz, wann ich es am Abend wohl ausgeschaltet haben mochte. Dann sah ich mich nach Lenore um. Keine Spur von ihr. Die Haustür war geschlossen, der Teller auf dem Fußboden leer. Wenigstens etwas, schoss es mir durch den Kopf. Erneut ein Poltern. Vielleicht war es das Mädchen, dass sich auf der Terrasse einen Schlafplatz suchte. Aber um diese Uhrzeit? Möglicherweise war es auch ein Wildschwein oder gar ein Bär, der auf der Suche nach Futter um das Haus strich. Jetzt machte ich mir Sorgen, denn dann wäre es für Lenore draußen gefährlich. Aus Selbstschutz und um das Mädchen nicht zu erschrecken, ging ich mit einer Taschenlampe bewaffnet vorsichtig zur Haustür und zog sie einen Spalt weit auf. Der Mond erhellte das Areal mit seinem kalten Schein und tauchte Wald und Lichtung in verschiedene Abstufungen von Dunkelgrau bis Schwarz. Mein schwerer Wagen wirkte dabei mit seinen glatten Formen wie ein Fremdkörper in der Unregelmäßigkeit der Natur. Von Lenore oder einem wilden Tier war nichts zu sehen. Ich schob die Tür weiter auf und ließ den scharfen Strahl der Taschenlampe zunächst an meinem Wagen entlanggleiten, um festzustellen, ob sich etwas dahinter versteckte. Dann tastete der Lichtkegel das Grundstück ab, kletterte an Büschen hoch, erhellte den Zufahrtsweg weiter hinten und schließlich die Winkel rechts und links der Veranda, wieder ohne Erfolg. Mit einem Anflug von Hoffnung redete ich mir ein, dass es vermutlich nur ein Eichhörnchen war, das eine Vase umgestoßen und vor dem Geräusch Reißaus genommen hatte. Doch wo befand sich Lenore? Ich nahm an, sie lag in einem versteckten Winkel hinter dem Haus, um nicht entdeckt zu werden. Es war durchaus verständlich, dass sie mir noch immer nicht traute. Zumindest wäre jedes andere Verhalten für mich eine Überraschung gewesen. Sollte ich sie suchen? Und dann? Sie würde niemals auf mein Drängen hin ins Haus kommen, zumal ich ihr diese Entscheidung völlig selbst überlassen wollte. Nur so hoffte ich, ihr Vertrauen gewinnen zu können.
Gerade wandte ich mich ab, als ich im Augenwinkel ein helles Leuchten wahrnahm. Es schien hinter der Hausecke hervor und wechselte ständig die Farbe. Deshalb erkannte ich es erst, als das Schwarz der Nacht plötzlich von einem strahlenden Weiß erfüllt wurde. Jegliche Vermutung zum Ursprung des Lichts konnte ich mir sparen, gab es doch nichts auf dem Grundstück, das auch nur annähernd dazu geeignet wäre, ein derartiges Strahlen zu erzeugen. Entsprechend groß waren Misstrauen und Vorsicht, als ich zaghaft um die Kante der Holzwand lugte. Was ich zu Sehen bekam, konnte mein Gehirn zunächst nicht einordnen. In der Mitte des Gemüsebeetes schwebte ein Licht, so hell, dass es in den Augen schmerzte. In dem kurzen Moment, den ich einen Blick darauf werfen konnte, bevor ich die Augen schließen musste, sah ich einen dunklen ellipsenförmigen Mittelpunkt, der die grellen Strahlen aufzusaugen schien. Die Farben der Umgebung lösten sich auf und flossen auf das Zentrum zu, wie verschüttete Tinte. Das Objekt schwebte wenige Zentimeter über dem Boden. Obwohl es eine sonnengleiche Helligkeit ausstrahlte, erhellte es nur einen sehr begrenzten Bereich. Die Ränder des Lichts waren unregelmäßig und ständiger Veränderung unterworfen, aber dennoch deutlich abgegrenzt. Vorsichtig hob ich die Augenlider und hoffte, mehr zu erkennen. Noch immer tanzten die Schatten der Blendung durch mein Sichtfeld und störten bei der Betrachtung, aber ich schaffte es, genauer hinzusehen. Ein helles Summen setzte mit einem Mal ein und breitete sich von dem Objekt aus. Es war kein elektronisches Geräusch, sondern das eines Menschen, eines Kindes, das versuchte, sich eine monotone Melodie ins Gedächtnis zu rufen. Lenore!
Unterschwellig war mir vom ersten Moment an klar gewesen, dass sich etwas Geheimnisvolles um das Mädchen rankte. Was ich aber jetzt erlebte, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Wer oder was war sie? Außerirdisch? Das Opfer misslungener Versuche in einem Geheimlabor? Im Grunde spielte es keine Rolle. Denn für mich blieb sie ein Kind, das Pflege, Eltern, Schule, also eine Kindheit brauchte. Es mochte naiv klingen angesichts dessen, was gerade direkt vor meinen Augen geschah, doch nichts anderes konnte ich in ihr sehen. All dies brandete im Schimmer des rätselhaften Leuchtens durch meine Gedanken und doch stand ich wie festgewachsen auf den Planken der Veranda und war nicht in der Lage auch nur den kleinsten Finger zu rühren.
Das Summen wurde lauter und drängender. Ein Rhythmus setzte ein, mit kurzen Aussetzern, die ekstatisch wirkten. Auch die Tonlage hatte sich verändert, stieg an, ab, an, ab, um schließlich in einen schrillen wilden Schrei auszubrechen. Dann war der Spuk vorbei. Das Licht erlosch, der Summton verstummte und übrig blieb ein kleines zierliches Kind, das inmitten meiner frisch angelegten Beete hockte. Erschöpft sackte sie in sich zusammen und verharrte so einige Sekunden. Endlich konnte ich mich wieder bewegen. Das Schauspiel in Gedanken immer noch vor Augen, machte ich einen Schritt auf sie zu. Aufgeschreckt durch das Knarren der Terrassenbohlen sprang sie auf, umrundete erstaunlich flink die gegenüberliegende Hausecke und verschwand aus meinem Sichtfeld. Mit einem Fluch auf den Lippen stieg ich die wenigen Stufen zum Garten hinab und suchte mit einer Taschenlampe beinahe die gesamte Lichtung ab. Doch sie war unauffindbar. Sie musste ein verdammt gutes Versteck gefunden haben. Daher beschloss ich erst einmal, den unterbrochenen Schlaf fortzusetzen und das Problem bei Sonnenaufgang anzugehen. Vielleicht würde sie am Tag wieder etwas Vertrauen zu mir aufbauen.
Doch an Schlaf war nicht mehr zu denken. Alles erschien zu bizarr, zu unwirklich, als dass ich es einfach beiseiteschieben könnte. Nichts, was ich je erlebt hatte, kam dem auch nur ansatzweise nahe. Das Gefühl, Zeuge eines schlechten Science-Fiction-Films geworden zu sein, hielt sich beständig. Kinder als Außerirdische mussten wegen ihrer vermeintlichen Unschuld im Kino immer wieder als gefährliche Monster herhalten. Und es funktionierte. Doch das eben war ohne Zweifel real gewesen, so phantastisch der Vorfall auch gewirkt hatte.
Obwohl mich langsam ein gewisser Ehrgeiz ergriff, das Geheimnis des Mädchens zu ergründen, schlichen sich auch die ersten Anzeichen von Angst bei mir ein. Angst vor dem Unbekannten, dem Unerklärlichen. Vielleicht war es auch die Befürchtung, dass ich mit diesem neu erweckten Beschützerinstinkt in eine Falle lief. Möglicherweise war sie ja gar nicht so unschuldig und schutzbedürftig, wie sie wirkte. Die Fassade verbarg womöglich etwas Gefährliches, das ich noch nicht sah. Doch all dies war nicht mehr, als eine Mischung aus wilden Vermutungen und Hirngespinsten. Deshalb beschloss ich, das Offensichtliche als gegeben zu akzeptieren und ihr zu helfen. Unnötige Zweifel würden mich nur von meinem Plan abhalten, sie möglichst am nächsten Morgen nach Coppice Grove zu fahren und der Polizei zu übergeben.
* * *
Bereits vor Sonnenaufgang stand ich auf. Die zurückliegenden Stunden hatte ich mich unruhig zwischen Dösen und Wachen herumgewälzt und schließlich die Zwecklosigkeit des Schlafversuchs erkannt. Ein Kaffee und ein wenig Frühsport, den ich eigentlich hasste, würden meinen Kreislauf sicher wieder in Schwung bringen – und die schlechte Laune hoffentlich vertreiben. Mit einer dampfenden Tasse trat ich auf die Veranda und genoss den klaren kühlen Duft des Waldes. Einige frühe Vögel begannen gerade ihre Nachbarn zu wecken. Der Tag stand bevor und es galt, den täglichen Kreislauf des Waldlebens weiterzuführen. Ein tiefer, belebender Atemzug transportierte eine Melange aus Kaffeearoma und Natur in meine Lungen. Doch da war noch etwas anderes, etwas, das nicht in das Bild von Freiheit und Abenteuer passte. Ein Geruch, unangenehm und störend, drängte sich scharf in das sonst naturbelassene Bouquet. Es roch kalt nach Gummi, verbranntem Öl und Plastik. Mein erster Gedanke war, dass es in der Umgebung ein Feuer gegeben haben musste. Etwa in Coppice Grove? Wenn der Geruch allerdings bis hierher wahrnehmbar war, handelte es sich vermutlich um einen sehr großen Brand. Aber eine andere Möglichkeit fiel mir zunächst nicht ein. Im näheren Umkreis des Anwesens gab es nicht viel, was bei einem Feuer diese unangenehme Note erzeugen könnte, es sei denn …
Einer bösen Vorahnung folgend trat ich zu meinem Wagen und betrachtete ihn von allen Seiten. Auf den ersten Blick deutete nichts auf einen Schaden hin. Gerade begann ich, mich wieder zu entspannen, als mir ein weiterer beunruhigender Gedanke kam. Mit einem Handgriff öffnete ich die Motorhaube, die eine ungewöhnliche Wärme abstrahlte, ganz so, als sei der Wagen erst kürzlich nach einer längeren Fahrt abgestellt worden. Ein Blick ins Innere bestätigte meine Befürchtung. Die frühe Dämmerung erschwerte die Sicht, doch das Wenige, was ich sah – und vor allem roch – reichte aus. Hier hatte ganz offensichtlich ein Feuer gewütet. Die Taschenlampe, die ich unter dem Fahrersitz hervorkramte, eröffnete mir dann das gesamte Ausmaß der Zerstörung, die gleichermaßen vollständig, wie rätselhaft war. Neben einer völlig intakten Batterie, einem unbeschädigten Wasserbehälter und der augenscheinlich noch funktionierenden Lichtmaschine war der Rest des Motors zu einer unförmigen Metallmasse zusammengeschmolzen. Zylinderkopf und Motorblock hatten sich aufgelöst, waren ineinandergeflossen und teilweise in das Bodenblech getropft. Schläuche und Kabel hingen lose oder in die Masse eingebacken zwischen den Streben des Antriebs. Es wirkte, als sei jemand mit einer gigantischen Lötlampe einmal längs durch den Motorraum gefahren und hätte ihn wie Wachs verflüssigt.
So etwas war unmöglich. Mit keinem Gerät der Welt ließ sich ein solcher Schaden erzeugen, nicht in der Kürze der Zeit und während ich halbwach im Bett lag, quasi direkt vor meiner Nase, geräuschlos und unbemerkt. Ich war fassungslos. Nicht, weil ich mir jetzt einen neuen Wagen zulegen musste. Das war zwar ärgerlich, aber noch erträglich. Die Umstände waren es, die mir zu schaffen machten. Hier ging etwas vor, das sich jeder vernünftigen Deutung entzog. Die letzte Nacht, das gleißende Leuchten und nun das. Mein Herz begann heftig zu schlagen und ein leichter Schweißfilm legte sich auf meine Haut, obwohl ich fror – eindeutige Zeichen der Angst, ein für mich bisher gänzlich unbekanntes Gefühl. Meine Gedanken schossen wild durcheinander und suchten nach Halt, etwas Greifbarem, nach Erklärungen, die es mir erleichtern würden, zu begreifen und zu reagieren. Und immer wieder tauchte in diesem Chaos ein Name auf: Lenore. Es war nicht nur mein Instinkt, der mir sagte, dass die unerklärlichen Vorfälle direkt mit ihr zu tun hatten. Ihre Beteiligung in der Nacht war mehr als ein Indiz hierfür. Vielleicht hatte sie nicht wissentlich den Anstoß für all dies gegeben, aber sie war definitiv die Ursache. Obwohl ich nie an Übersinnliches geglaubt hatte, zog ich es nun zumindest in Betracht und das Mädchen spielte dabei die Schlüsselrolle. Doch wie sollte ich auf diese Bedrohung – sofern es überhaupt eine war – reagieren? In meinem Kopf setzten sich die ersten Bruchstücke eines Plans zusammen. Demonstrativ gelassen schlenderte ich, den inzwischen kalten Kaffee in der Hand, zur Veranda zurück, ließ mich in den Schaukelstuhl fallen und wartete.
Es geschah nichts. Der Tag zog mit strahlendem Sonnenschein herauf und ich begann, innerlich bebend, äußerlich die Ruhe selbst, alltäglichen Arbeiten nachzugehen. Ich räumte die Hütte auf, wusch das wenige Geschirr ab, das ich benutzt hatte, und füllte meine Ein-Personen-Waschmaschine, die ich mir gegönnt hatte, weil mir das Waschen per Hand zu lästig war. Dann ging ich in den Garten. Beim Betreten meldete sich angesichts des unheimlichen Ereignisses am Tag zuvor eine Beklommenheit in mir, die in der Fassade der Gelassenheit einige Kratzer hinterließ. Ich betrachtete die niedergedrückten Triebe und den geschwärzten Boden, den vermutlich die Minisonne erzeugt hatte. Aus der Nähe wirkte der Platz nicht mehr ganz so bedrohlich. Doch dann entdeckte ich zwischen Unkräutern und jungen Stauden einen Gegenstand. Er passte nicht so recht ins Bild und mein Gehirn war zunächst nicht in der Lage, ihn zuzuordnen. In der Hocke stellte ich fest, dass er innerhalb der dunklen Fläche lag. Erst jetzt erkannte ich, dass der Boden nicht, wie angenommen, verkohlt war. Ränder und Farbe ließen auf etwas anderes schließen. Vorsichtig tupfte ich mit dem kleinen Finger ein wenig aus der Mitte und mir wurde klar, es war Blut. Die Kanten waren bereits angetrocknet, das Zentrum hingegen noch eine zähflüssige Masse, die jetzt an meinen Händen klebte. Und der Gegenstand unter dem Unkraut, den ich zunächst nicht zuzuordnen wusste, war ein Ohr – das abgerissene Ohr eines Tieres.
* * *
Es vergingen zwei ereignislose Tage. Eigentlich wäre es notwendig gewesen, mich um ein neues Auto zu kümmern. Allerdings war mir nicht wohl bei dem Gedanken, das Haus zu verlassen. In gewisser Weise fürchtete ich das, was mich bei der Rückkehr möglicherweise erwarten würde. Ich redete mich damit heraus, Lenore die Zeit geben zu wollen, wieder aktiv zu werden. Doch auch das bereitete mir Sorgen. Denn was mir anfangs noch wie ein Plan erschienen war, nämlich Lenore so schnell wie möglich nach Coppice Grove zu bringen, versank inzwischen im Wirbel sich ständig überschlagender Gedanken- und Gefühlswelten. Nichts war mehr vorhersehbar, meine Handlungen reduzierten sich auf rein intuitive Reaktionen. Sollte das Mädchen wieder auftauchen, würde ich vermutlich heillos improvisieren – und möglicherweise endgültig scheitern. Deshalb hoffte ich, dass es dazu nicht kommen würde. Denn wie lange sollte ich warten? Allerdings sagte mir meine innere Stimme, dass es noch nicht vorbei war. Ich wusste, dass sie irgendwann wieder im Türrahmen stehen und mir in ihrer elenden Erscheinung diesen flehend-ängstlichen Blick zuwerfen würde. Und zwei Tage nach Entdeckung des zerstörten Wagens geschah es dann.
Es war früher Nachmittag und ich hatte mich gerade entschlossen, mal wieder ein paar Zeilen in mein Notebook zu tippen. Der Sonnenschein, der die Veranda streifte und sie in eine angenehme Frühlingswärme tauchte, lud regelrecht dazu ein. Meine wilden Gedanken hatten sich ein wenig beruhigt, auch wenn das Chaos nie ganz abgeklungen war. Vielleicht hätte mich die Konzentration auf einen fiktiven Text etwas abgelenkt. Möglicherweise wären ja sogar die zurückliegenden Geschehnisse ein ergiebiges Thema für eine Geschichte gewesen. Als ich aber mit dem Notebook unter dem Arm die Tür des Hauses öffnete, stand sie da. Nichts hatte sich verändert. Unschuldig, vor Angst beinahe zitternd, im abgerissenen Kleidchen und mit schmutzigen Händen und Gesicht. Ihr Blick schien mir in diesen Augenblick sogar ein wenig flehender, als sonst. Obwohl ich mich innerlich maßregelte, dem äußeren Eindruck nicht zu erliegen, empfand ich wieder unendliches Mitleid mit diesem zerbrechlichen Wesen. An ihr war nichts Dämonisches, nichts Böses. Ja, es umgab sie durchaus ein Geheimnis, das ich noch nicht ergründen konnte. Doch vielleicht war ja genau das der Grund, weshalb sie seit unserer ersten Begegnung nicht ein Wort gesprochen hatte – als Reaktion auf ein Trauma. Und schon wurde ich wieder weich wie warme Butter. Mein fester Blick lockerte sich. Ich lächelte und sagte: »Na, Lenore, möchtest du etwas essen?« Erwartungsgemäß kam keine Antwort. Das anschließende Ritual folgte den Regeln des letzten Zusammentreffens. Ich bereitete Sandwiches zu und stellte sie auf einem Teller mit ein wenig Abstand vor ihr auf den Boden. Dann ging ich zum Sofa und ließ es mir selbst schmecken.
Zu meiner Überraschung trat sie zögernd und ohne mich aus den Augen zu lassen einige Schritte vor, schnappte sich mit langen Armen den Teller und kauerte sich in den Türrahmen. Dort begann sie, kleine Stücke von der Sandwichhälfte abzubeißen. Es wirkte nicht, als sei sie ausgehungert, wie ich angenommen hatte. Es machte eher den Eindruck, als würde sie nur aus Gesellschaft