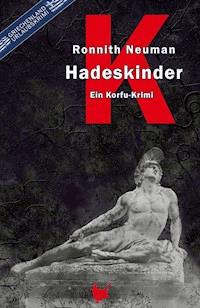
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Größenwahn Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Burgruine Angelokastro wird der Leichnam eines Jungen gefunden. Sein Körper in einer bizarren Stellung. Ein ungewöhnlicher Fall für das Ermittler-Duo Stelios Angelis und Stefania Stefanidou, die innerhalb der korfiotischen Polizei eine Einheit für Kapitalverbrechen bilden. Ihre Untersuchungen bringen frühere Todesfälle ans Licht, darunter eine ähnliche Mordinszenierung in München, Ende der 1980er Jahre. Haben es die jungen Beamten hier tatsächlich mit ein und demselben Täter zu tun, der unerkannt über Jahrzehnte hinweg an weit auseinanderliegenden Orten extravagante Morde begeht? Bevor das Puzzlespiel für die Ermittler überhaupt beginnen kann, sorgt eine neue Leiche für noch mehr Verwirrungen. Und eine mysteriöse Figur ist Zeuge des Geschehens: "Ich habe mich zu den Gaffern gesellt ... hinter ein paar großgewachsenen Jugendlichen in Sportkleidung, die eifrig über das spekulieren, was sie in der Ruine vermuten ... weit genug, um sich vor den Augen der Polizisten zu verstecken. Ich genieße diese Perspektive. Das Verborgene ... Oh ja, ich habe ein Recht darauf, es zu genießen. Nur für wenige Augenblicke, bevor ich … Doch das kann warten. Alles hat Zeit. Ich lasse mir diese Zeit. Ich kann es mir leisten. Ich darf das ..." Ronnith Neuman, die mit ihrem Ehemann seit Jahrzehnten auf Korfu lebt, kennt sich bestens mit den Gegebenheiten der Insel aus. Ihr Korfu-Krimi ist eine Ode an ihre Wahlheimat im ionischen Meer und die Handlung eine Hymne an die griechische Mythologie. Dieser erste Fall ist der Auftakt zur Korfu-Krimi-Reihe beim Größenwahn Verlag. Ein spannender Griechenland-Urlaubskrimi mit unerwartetem Finale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hadeskinder
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste Auflage 2018
© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main
www.groessenwahn-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-95771-212-7
eISBN: 978-3-95771-213-4
Ronnith Neuman
Hadeskinder
Ein Korfu-Krimi
IMPRESSUM
Hadeskinder
Autorin
Ronnith Neuman
Seitengestaltung
Größenwahn Verlag Frankfurt am Main
Schriften
Constantia
Covergestaltung
Marti O´Sigma
Coverbild
Achilleion, Korfu
Lektorat
Britta Voß
Druck und Bindung
Print Group Sp. z. o. o. Szczecin (Stettin)
Größenwahn Verlag Frankfurt am Main
April 2018
ISBN: 978-3-95771-212-7
eISBN: 978-3-95771-213-4
Handlungen und alle agierenden Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist rein zufällig.
Dieses Buch ist meinen Lesern gewidmet
die mich in meinem Vorhaben es zu schreiben bestärkt
und die Inspiration, die ich dafür brauchte,
durch ihr Interesse beflügelt haben.
Und
Cora, meiner kleinen vierbeinigen Muse.
Und wie immer
Günter, meinem Mann,
dessen Kunst mich in meinem Schreiben
immer wieder aufs Neue anregt.
Es ist leicht,
den Glauben eines Menschen
an sich selbst zu erschüttern.
Das auszunutzen, um die Seele
eines Menschen zu zerstören,
ist Teufelswerk.
George Bernhard Shaw
Das Unbewusste
kennt keine Zeit.
Sigmund Freud
Noch hört er ihre Stimmen. Solange er die Stimmen hört, ist alles gut. Obwohl nichts gut ist. Schon lange nicht mehr. Seit der Feuernacht vor zwei Jahren. Kurz nach seinem vierten Geburtstag. Damals stürzte er durch die brennende Felsspalte in die Hölle hinab.
Er lauscht.
Solange er ihre Stimmen über sich hört, ist es gut. Es ist Tag. Vielleicht Nachmittag? Früher oder später Abend? Solange er die Stimmen hört, gibt es Hoffnung. Die Stimmen sind seine Uhr. Seine Verbindung zur Außenwelt. Zu dem, was sie Leben nennen.
Das Oben und das Unten.
Unten – das ist die Hölle.
Wenn die Stimmen schweigen, ist es Nacht.
Der fensterlose Raum ist dunkel. Ein Kellerloch mit maroden, pilzbefallenen Wänden, die aus dem feuchten Erdreich wachsen. Früher wurde hier Wein gekeltert und Schnaps gebrannt. So erzählen die Alten. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Damals gab es ihn noch nicht.
Wozu gibt es ihn heute?
Manchmal stellt er sich solche Fragen.
Jetzt sind die Wandregale leer. Überall auf dem Boden liegen Tonscherben von zerbrochenen Amphoren und Fässern. In der Mitte thront noch der schwere gusseiserne Tisch, an dem sie ihre Geschäfte abwickelten. Von den ehemals acht mit Bast bezogenen Holzstühlen sind zwei geblieben. Auf einem der Stühle sitzt er. Seine Fußgelenke sind an die Stuhlbeine gekettet, sein Gesäß mit Riemen an die Sitzfläche fixiert. Kopf, Oberkörper und Arme kann er frei bewegen. Er kann sich zur Seite neigen. Die Arme heben, sich kratzen. Mit den Händen sein Gesicht zerkratzen. In die Haare greifen, sie in Büscheln ausreißen. Er kann seine Finger über die Brust bis hinab zur Gürtellinie führen. Darüber hinaus geht nichts. Wie in einem Kinderstuhl sitzt er gefangen inmitten einer zum Tisch hin offenen Eisenschiene, die ihn umrundet und deren Enden mit dem Tisch verkoppelt sind. Wütend hämmert er mit seinen Fäusten auf die schwere Eisentischplatte. Sie spaltet seinen Körper. In ein Oben und Unten.
Er friert.
Er hat Hunger.
Noch mehr Durst.
Er friert immer. Er hat immerzu Durst. Seine nackten Füße unter dem Tisch stehen in einer Bodensenke mit Wasser. Doch er kann das Wasser nicht erreichen. Die Tischplatte hindert ihn daran. Über ihm an einem hölzernen Deckenbalken, hängt ein Korb mit Früchten. Er kann ihren Duft riechen. Doch selbst wenn er sich ganz lang macht, Arme und Finger streckt, er kann die erfrischenden Köstlichkeiten nicht erreichen.
Wie oft hat er es zu Anfang versucht?
Er hat aufgegeben. Schon vor langer Zeit.
Die Stunden vergehen. Die Stimmen über ihm verlöschen. Die Stille ist wie eine gierige Schlange, die sich langsam und gnadenlos um seinen mageren Körper windet, ihm die Luft aus den Lungen presst. Die Wände um ihn herum steigen steil auf, schrägen sich, verjüngen sich nach oben, wachsen zusammen wie ein himmelwärts gerichteter Pfeil.
Er ist das Innere des Pfeils.
Ein zu Fleisch gewordener Kern.
Durch das Herz des Pfeils pumpt sein Blut.
Er sitzt jetzt ganz still. Er riecht den Duft der Früchte. Stellt sich vor, wie der Pfeil sie mit seiner Spitze durchbohrt. Jede einzelne Frucht, bis das Blut aus ihr rinnt und er die köstliche Süße auf seiner ausgedörrten Zunge schmeckt.
Er starrt mit brennenden Augen in die Nacht.
Lauscht der Stille.
Und wartet …
Prolog
München, März 1988
Er konnte kaum glauben, dass er entkommen war.
Nun stand er inmitten dieser fremden Stadt, auf einem mittelalterlich anmutenden Platz, der sich Viktualienmarkt nannte, und konnte sich nicht sattsehen an all der Heiterkeit, die sogar in dem trüben Licht hell und farbenfroh schillerte. Trotz des Nieselregens reihten sich Verkaufsstände aller Art dicht aneinander, belagert von Menschen aller Hautfarben und Nationalitäten. Händler, die lauthals ihre Waren anpriesen, gewagt dekolletierte Dirndl und stramme Lederhosen. Miniröcke, schrille Frisuren, Visagen, die offenbar einer Farbpalette entwachsen waren. Allerorts schier unüberschaubare Gruppen von Asiaten, die, das festgefrorene Lächeln wie ein Markenzeichen ins Gesicht gepflanzt, alles fotografierten. Er staunte über das Ausmaß an Sorglosigkeit, über die Ausgelassenheit, die ihn wie ein Moloch in sich einsog und zugleich ausgrenzte.
Er zog den Gürtel seines neuen Trenchcoats enger und biss in eine riesige Bretzel, die er für ein paar Deutsche Mark erstanden hatte. Noch immer war er erfüllt von jener nebulösen Wolke, die vor nicht allzu langer Zeit die selbstzerstörerische Traurigkeit abgelöst hatte, und die nun nichts anderes zuließ als dumpfe Gleichgültigkeit. Das Wort Gewissen machte ihm keine Angst mehr. Gewissen war ein schwammiges, nicht greifbares Etwas, das jenseits seines Denkvermögens lag. In seiner Seele - wenn sie denn überhaupt existierte – fühlte er nur noch Eiseskälte. Die Kälte war gleichermaßen Schutz und Antrieb. Das Fehlen jeglichen Gefühls war zu seiner Stärke geworden. Anstelle von Empathie war eine Form von Dominanz getreten.
So war es. So sollte es bleiben. Für alle Zeiten.
Eine andere Form des Seins war für ihn nicht mehr vorstellbar.
Während um ihn her das tobte, was andere als das wahre Leben bezeichneten, schmiedete er bereits die ersten Pläne.
Er hatte nicht vor, lange mit seinem Vorhaben zu warten. Er wusste, es musste geschehen. Es war unaufhaltsam. Es war die Eintrittskarte zu seinem neuen Leben. Die Weichen hatte er bereits vor langer Zeit gestellt.
Er hatte hart gekämpft für dieses neue Leben. Warum also sollte er es hinauszögern? Er brauchte einen Anfang. Einen spek-takulären Auftakt.
Es war Zeit, die Kontrolle zu übernehmen.
Sie mussten seine Macht spüren.
Um zu überleben brauchte er ihre Angst.
1
Korfu, September 2012
Stefania Stefanidou stülpte die Überzieher über ihre Schuhe, schlüpfte in ihre kühlen Nitrilhandschuhe und betrat hinter Stelios Angelis die Ruine von Angelokastro. Sie musste unwillkürlich den Atem anhalten, und auch jetzt, nachdem sie das Geschehen grob erfasst hatte, entwich die Luft nur sehr langsam aus ihren Lungen. In dem jahrhundertealten verwitterten Gemäuer an der Nordwestspitze der Insel wirkten sie beide wie riesige Schatten, die sich über die kleine Gestalt beugten, die rücklings langgetreckt, mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem lehmigen Steinboden lag.
Durch ein hohes schmales Seitenfenster brach auf einmal morgendlich frühe Septembersonne. In dem scharfen Lichtstrahl tanzten Staubpartikel und verstärkten auf vielleicht barmherzige Weise das Unwirkliche der Szenerie. Stefania machte einen unachtsamen Schritt nach vorn und prallte gegen Stelios, der im selben Moment zurückwich. Stelios fuhr erschrocken zusammen, Stefania drückte ihre Hand sanft gegen sein Schulterblatt. Die Zeit schien still zu stehen, während sie schweigend auf das hinunter starrten, was da vor ihnen am Boden lag.
»Mein Gott, was für ein Alptraum …«, flüsterte Stelios.
Ich wollte, es wäre einer, dachte Stefania. Nur ein Alptraum. Ich wollte, ich könnte hinaus spazieren, ins Meer springen, mich auf Wellenkämmen davontragen lassen und mich danach zuhause auf meiner Veranda einer Selbstgedrehten und einem süffigen, schweren Wein hingeben, der dieses Bild in meinem Hirn auslöscht. Doch das Bild verspottete ihre Gedanken. Es hinterließ in Stefania ein Echo, das sie verstummen ließ.
Wie alt mochte der Junge sein? Zwölf, dreizehn? Höchstens vierzehn. Nicht älter. In keinem Fall älter.
»Er ist doch noch ein Kind … Warum ein Kind?«
Warum ein Kind … Stelios‘ Flüstern hallte in ihrem Innern wider. Es war eine Frage, auf die es keine Antwort gab. Niemals geben würde.
Und so schwieg Stefania.
Sie beneidete den Polizeifotografen, der mit seiner Digitalkamera langsam um den Leichnam herumging. Das kühle, glatte Gehäuse gab ihm Schutz, wenngleich einen zweifelhaften Schutz. Sachlichkeit der Technik als Schutzwall vor dem unfassbaren Grauen. Von Kriegsberichterstattern wusste Stefania, dass nicht wenige Fotografen ihren Zorn und ihre Ohnmacht angesichts der unnennbaren Grausamkeiten, die sie für die ahnungslose Außenwelt festhalten mussten, hinter dem kalten, gefühllosen Kameraauge versteckten.
Darauf bedacht, die Arbeit des Gerichtsmediziners und des Polizeifotografen nicht zu stören, schritt sie langsam um den toten Jungen herum. Es war nur eine vage Erinnerung. Erinnerungsfetzen, die nicht weichen wollten. Dabei war es nicht nur der von oben einfallende Lichtstrahl, der den Raum zerschnitt. Nein, da war noch etwas anderes. Etwas, das das Bild zerriss, ihm zugleich transparente Einheit verlieh.
Stefania zog den Kopf ein und trat durch den niedrigen Ausgang der Ruine ins Freie. Sie kniff die Augenlider zusammen und spähte hinüber zur anderen Seite. Vielleicht stand er dort drüben. Hinter den Büschen. Jenseits der Mauerreste. Das Ungeheuer, dem sie das Schreckensszenario, diesen Alptraum da drinnen verdankten. Vielleicht stand er hinter der polizeilichen Absperrung, zwischen den Gaffern, die in den frühen Morgenstunden nach ihrem Aufstieg zur Ruine von Angelokastro anstelle der erwarteten Aussicht etwas völlig anderes geboten bekamen.
Vielleicht steht dieses Ungeheuer dort drüben.
Schaut zu uns herüber. Beobachtet uns …
*
Ich habe mich zu den Gaffern gesellt. Ein wenig abseits, zwischen die Büsche, hinter ein paar großgewachsene Jugendliche in Sportkleidung, die eifrig über das spekulieren, was sie in der Ruine vermuten. Zu dieser frühen Stunde gibt es nicht viele Gaffer, dennoch genug, um sich vor den Augen der Polizisten zu verstecken. Ich genieße diese Perspektive. Das Verborgene. Verbotene. Es bietet sich mir nicht jeden Tag. Oh ja, ich habe ein Recht darauf, es zu genießen. Nur für wenige Augenblicke, bevor ich …
Doch das kann warten. Hat noch ein wenig Zeit. Alles hat Zeit. Jetzt. Ich lasse mir diese Zeit. Ich kann es mir leisten. Ich darf das.
Zeit …
Dieser unsinnige Begriff! Diese Leerformel! Manche Wissenschaftler behaupten, es gäbe sie gar nicht. Sie existiere einfach nicht - die Zeit. Betrachten wir zum Beispiel die Tiere. Sie kennen keine Zeit. Hunde besitzen keinerlei Vorstellung von Zeit. Sie spüren nicht, ob eine Minute vergeht oder eine Stunde. Sie leben im Glückszustand des Augenblicks.
Verstehen Sie, was ich meine?
Ich jedenfalls habe Zeit.
Wie immer danach habe ich unendlich viel Zeit.
Erstaunlich, wie einfach es wieder war. Wie üblich hatte ich den Jungen zuvor beobachtet. Ich hatte seine Gewohnheiten studiert, seine Vorlieben, alles, was das sichtbare Leben eines Menschen ausmacht. Währenddessen hatte ich dreimal meine Verkleidungen gewechselt.
Oh ja, ich bin ein Meister der Verkleidung!
Bei der Auswahl der Verkleidungen lege ich Wert darauf, dass ein Detail ins Auge springt. Eine hässliche Narbe, ein besonders geformter Bart, eine Mütze oder ein Hut, eine auffallende Brille. Etwaige Zeugen werden sich später immer nur an dieses eine Detail erinnern. Alles andere wird in ihrer Erinnerung verblassen. Sie werden lediglich diese eine, ins Auge springende Beobachtung beschreiben können. Die Feinheiten einer Person werden dabei untergehen.
Aber zurück zu dem Jungen.
Er hatte genau die richtige Größe. Das ist mir besonders wichtig. Die richtige Körpergröße. Auch sonst stimmte alles. Ich hatte ihn sorgfältig ausgewählt. Ihn, ebenso wie die anderen, erwählt.
Das bin ich ihnen und mir schuldig.
Ich vergewisserte mich, dass keiner uns beobachtete. Trotz sorgsamster Verkleidung, Fensterglasbrille und auffallendem Bart, ist es immer noch am besten, wenn es gar keine Zeugen gibt. Ich folgte dem Jungen, bis ich ihn schließlich auf einem verlassenen Teil der Hafenmole von Paleokastritsa ansprach. Das Übliche, banale Freundlichkeiten über das Wetter, die vergangene Hitzeperiode, den milden Septemberabend, wie man das gemeinhin macht, ein alltäglicher Smalltalk. Wir schlenderten eine Weile wie zwei gute alte Bekannte nebeneinander her, plauderten und scherzten.
Es war offensichtlich: Der Junge genoss es. Er besaß keine Freunde. Auch hatte ich ihn nie in Begleitung eines Mädchens gesehen. Er war immer allein. Vielleicht mied er andere Menschen, genau wie ich. Vielleicht mieden sie ihn. Keiner erwartete ihn. Oder hielt nach ihm Ausschau. Weder Freunde noch Geschwister oder Eltern. Der Junge schien einsam. Nicht zufällig oder gewollt allein. Nein, er war einsam. Wirklich einsam! Es war, als hätte er auf mich gewartet. Als wären wir beide füreinander bestimmt.
Zwei einsame Wölfe.
Zwei verwandte Seelen.
Der Junge folgte mir bis zum Wagen. Ohne Aufforderung, ohne Absprache, keine Fragen. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, einem Fremden zu dessen Wagen zu folgen. Während ich ihm half, sich auf dem Beifahrersitz anzuschnallen, fragte er mich nach meinem Namen. Ich ignorierte die Frage. Tat, als hätte ich sie nicht gehört und startete den Motor. In der einsetzenden Abenddämmerung fuhren wir Richtung Angelokastro.
Den Namen des Jungen kannte ich nicht. Wollte ihn nicht kennen.
Die Vertrautheit eines Namens zerstört alles.
Solange sie namenlos sind, sind sie anonym. Gesichtslos. Auch dann noch, wenn man das Gesicht kennt, die Sprache der Gebärden. Solange ein Mensch keinen Namen besitzt, der ihm den Stempel einer bestimmten, unverwechselbaren Persönlichkeit aufdrückt, ist er konturlos. Ein verschwommenes Etwas, ein Ding, weit entfernt von einem spezifischen Ich.
Nähe zerstört alles!
Oh nein, ich erwarte nicht, dass Sie meinen Gedanken folgen können. Eigentlich erwarte ich gar nichts von Ihnen. Ganz sicher nicht irgendeine Art von Verständnis. Aber Sie scheinen mir recht neugierig. Sonst würden Sie sich doch spätestens an dieser Stelle von mir abwenden. Mir vielleicht sogar irgendeine obszöne Geste zeigen, oder? Aber Neugier zeugt bekanntlich von Intelligenz. Und nichts anderes erwarte ich von Ihnen.
Der Parkplatz war gähnend leer. Weit und breit keine Menschenseele. So war es ein Leichtes, den Wagen ein wenig abseits abzustellen. Das Meer leckte in sanften Wellen den kiesigen Uferstreifen unterhalb der betonierten Fläche, und die Augen des Jungen funkelten mit dem Plankton um die Wette, als ich ihm meinen Plan unterbreitete. Also öffnete ich den Kofferraum und schnappte mir meinen Rucksack, den ich seit dem Morgen für diesen Zweck bereithielt. Wie erwartet, fragte der Junge nach einer Taschenlampe. Ich tat erschrocken, schüttelte bedauernd den Kopf. Der Junge kniff die Augen zusammen, schaute sich unentschlossen um. Ich gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter, der Junge lächelte verlegen. Ich schnallte mir schwungvoll den Rucksack auf den Rücken und drückte auf die Zentralverriegelung des Wagens.
Der steinige Pfad hinauf zur Ruine schlummerte in nächtlicher Unschuld. Stille umgab uns, nur das Zirpen und Zischeln der Grillen und Insekten, die entfernten Rufe der Nachtvögel. Unheilvolle Stimmen der Finsternis. Die Einsamkeit war körperlich spürbar. Wie sich langsam erhebende Dämonen wuchsen aus dem Hügel über uns die Umrisse von Angelokastro, geisterhaft beleuchtet von der aufgehenden Mondsichel. In einem Seitenfach meines Rucksacks lag meine kleine Halogenlampe. Für den Notfall. Ich hoffte, es würde keinen Notfall geben. Wenn alles glatt verlief, würde ich keine Lampe brauchen. Ich brauchte kein Licht. Ich kannte den Weg. Ich kannte das, was uns dort oben erwartete. Ich hatte alles gut vorbereitet: Das Timing. Die Auswahl des Platzes. Die Bühne. Eine Festung, die einst eine der wichtigsten Verteidigungsanlagen Korfus war, und deren strategisch schwer einnehmbare Position jahrhundertelang großen Einfluss über das Schicksal und die Entwicklung der Insel hatte, schien mir genau der passende Ort für mein Vorhaben. Denn schließlich war das, was ich in der Ruine erledigen musste, nichts anderes als eine Art von Selbstverteidigung.
Wie immer hatte ich nichts dem Zufall überlassen. Wie immer war alles perfekt. Was ich brauchte, hatte ich dabei: Die mit Käse gefüllten Teigtaschen, Kekse, Saft, Cola und Wein. Das Messer, die Fesseln, Lumpenhose und Pferderiemen, die Injektionsspritze mit dem kleinen Infusionsbeutel und den mausgrauen Plastikvogel mit dem blutroten Schnabel.
*
»Fundort ist gleich Tatort.« Der Rechtsmediziner Georgios Katzounis stemmte seinen massigen Körper ächzend aus der Hocke hoch. »Erstaunliche Präzision, mit der hier gearbeitet wurde. Da stimmt jedes Detail.«
»Deine Begeisterung in Ehren, Georgios. Aber kannst du mir vielleicht sagen, welches kranke Hirn sich sowas ausdenkt?« Stelios Angelis biss die Zähne so kräftig aufeinander, dass ihm die Kiefermuskeln wehtaten. Ein Techniker im weißen Overall der Spurensicherung versuchte sich mit seinem Instrumentenkoffer an ihm vorbeizuschieben. Stelios trat einen Schritt zurück und ließ den Mann durch. Dieser hockte sich neben die Leiche und begann mittels Klebestreifen und einem Kleiderroller nach Faserspuren auf der Kleidung des Toten zu suchen. Die Kleidung bestand aus ein paar grauen Lumpen, die von den Lenden knapp über die Oberschenkel reichten und das Geschlecht des Jungen verdeckten. Lumpenshorts, im Schritt zugenäht. Um den Hals trug er eine runde, im Durchmesser etwa ein Zentimeter dicke Schlinge aus festem, abgegriffenem Leder, die im Nacken locker geknüpft war. Ansonsten war der Junge nackt.
Der Techniker kämmte die Haare des toten Jungen mit einem kleinen Spezialkamm, entnahm mit einem dünnen Spachtel Proben unter den Fingernägeln und verteilte die gewonnenen Spuren in einzelne Asservatenbeutel. Zwei weitere Techniker vermaßen den Tatort und übertrugen die Maße auf eine Bleistiftskizze. Als Kriminalkommissar auf Korfu waren Stelios Angelis bisher nur wenige Fälle begegnet, die ihn bis ins Mark hinein erschüttert hatten.
Dies hier war ein solcher Fall.
Georgios Katzounis zwirbelte mit düsterer Miene die Spitzen seines imposanten Schnurrbartes und massierte mit der anderen Hand seinen Stiernacken. »Bizarr, was? Schätze, deine Frage könnte uns allenfalls ein Seelenklempner beantworten. Ich für meinen Teil kann nur sagen, was es darstellen soll.« Er ließ von Bart und Nacken ab, zwinkerte Stelios zu. »Obwohl bekanntermaßen Kenntnisse der Mythologie nicht unbedingt in meinen Fachbereich gehören.«
»Was es darstellen soll, ist wohl ziemlich eindeutig«, murmelte Stelios. »Was sagst du zu der Verletzung?«
Der Mediziner hob verblüfft die Brauen. »Die passt ins Bild.«
»Auch das ist mir bekannt«, seufzte Stelios genervt.
»Aber wenn es dich beruhigt, bei dem wenigen Blut gehe ich davon aus, dass sie ihm postmortal zugefügt wurde.«
Stelios verzog das Gesicht.
Beruhigte ihn das? Angesichts eines solchen Alptraums?
»Was denkst du?«, fragte er Stefania, die urplötzlich aus dem Schatten der Ruine neben ihm auftauchte. Sie starrte auf den grauen Plastikvogel, der auf dem nackten Bauch des toten Jungen thronte. Aus dem roten leicht geöffneten Schnabel hing ein Stück schrumpeliges rohes Fleisch. Das Fleisch stammte eindeutig aus der klaffenden Wunde, unterhalb der sich die Leber des Jungen befand.
»Der Titan Prometheus«, begann Stefania leise. »Zeus befahl, ihn an eine Felsspitze im Kaukasus zu schmieden, wo ein Adler jeden Tag seine Leber heraus hackte, die über Nacht wieder nachwuchs.«
Die altgriechische Mythologie faszinierte Stefania und unwillkürlich war das antike Bild vor ihrem geistigen Auge erschienen. Sie wich einem der Techniker aus, der sich neben dem Leichnam hinkniete, den Vogel mit dem Leberstück vorsichtig eintütete und ihn in eine Kühlbox aus Styropor legte. Sie ging um den Mann herum und starrte auf den freigelegten Schnitt: seitlich links, ein kleiner tiefer Einschnitt, etwa drei Zentimeter lang.
Stefania nahm den Geruch von Verwesung wahr, diesen morbiden, metallisch süßlichen Geruch des Todes. Ein plötzlicher Schwindel erfasste sie. Stefania verspürte Übelkeit, klaustrophobische Enge schnürte ihr den Hals zu. Als sie rückwärts taumelte, stolperte sie über einen harten, kantigen Gegenstand. Im Straucheln spürte sie eisiges Wasser, das über ihrem Kopf zusammenschlug, und eine Hand unter ihrer Achsel, die sie aus dem Wasser nach oben zog. Kreise und Punkte tanzten vor ihren Augen. Hechelnd wie ein Hund lehnte sie sich gegen die kalten Mauersteine. Doch die Steinmauer in ihrem Rücken gab nach. Schwankend versuchte sie sich von der Mauer abzustoßen. Nein, nicht sie schwankte. Die Mauer schwankte. Die gesamte Ruine schwankte. Die Menschen um sie herum. Stefania stand mit geschlossenen Augen, die Schultern gegen das Gemäuer gelehnt. Ihr Atem ging stoßweise, sie vernahm sich entfernende Stimmen, dann Stille ...
Als Stefania ihre Augen öffnete, schaute sie in zwei besorgte Gesichter, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Während Sie sich fragte, wie viel Zeit wohl vergangen war, wanderte ihr Blick von dem gutmütigen aber grobschlächtigen Gesicht des Rechtsmediziners zu Stelios Angelis‘ schmaler Miene mit den aristokratisch feingeschnittenen Zügen. Erleichtert stellte sie fest, dass sie noch immer auf ihren eigenen zwei Füßen stand, was in ihrem bisherigen Leben nicht immer selbstverständlich gewesen war.
Sie spürte eine Hand, die sie behutsam am Ellbogen fasste.
»Wie wär’s mit etwas Wasser?«, schlug Stelios mit sanfter Stimme vor. »Ich habe eine Flasche im Auto. Eiskalt und erfrischend.«
Stefania lächelte matt und löste ihren Arm aus Stelios‘ Griff. Sie musste ihre gesamte Energie aufwenden, sich ihren Zorn nicht anmerken zu lassen. Wie konnte sie sich nur so gehenlassen?
Verdammt, Mädchen, reiß dich zusammen! Du bist ein Profi!
Sie bohrte ihren Blick in den gezwirbelten, mächtigen Schnurrbart des Mediziners. »Und du bist sicher, dass diese Inszenierung erst nach dem Tod des Jungen stattfand?«
»Ja. Ganz sicher.«
Seltsam, dachte Georgios Katzounis, der Gedanke kam ihm zum ersten Mal innerhalb seiner langjährigen Tätigkeit als Gerichtsmediziner: So entsetzlich und entwürdigend diese Todesinszenierung war, sie strahlte zugleich auch etwas Sauberes aus. Etwas Reines. »Es mag seltsam klingen«, setzte er seinen Gedanken laut fort, »aber das Ganze wirkt auf mich wie eine Art Reinigungsbad. Als hätte sich der Täter durch sein Ritual gereinigt. Oder als hätte er den toten Jungen gereinigt. Vielleicht auch sie beide.«
Stefania hob die Brauen. »Ich dachte, du bist kein Profiler?«
»Das dachte ich auch.«
»Dann sollte es uns vielleicht trösten, dass der Junge nichts mehr von der Reinigung mitbekommen hat«, meinte Stelios trocken. »Und woran ist er nun gestorben? Kannst du da schon was sagen, Dok?«
Der Arzt hob die Schultern. »Erwürgt wurde er jedenfalls nicht. Trotz dieser Lederschlinge um seinen Hals.«
»Die Lederschlinge ist ein Pferderiemen«, schaltete sich einer der Techniker ein. »Ich bin selber Reiter, und das da ist eindeutig ein Stück von einem Zügel.«
»Aha«, machte Stelios. »Und was hat der Pferdezügel zu bedeuten?«
Der Techniker, ein hochaufgeschossener, drahtiger Kerl, grinste herablassend. »Die Beantwortung dieser Frage fällt wohl eher in euer Ressort«, meinte er arrogant. Und damit schloss er die Kühlbox, ließ die Schlösser seiner Instrumententasche lautstark zuschnappen und kehrte den dreien seinen langen, asketischen Rücken.
Sympathischer Mensch, dachte Stelios, dem der Name des Technikers – Napoleon – urplötzlich wieder einfiel. Er begegnete Stefanias Blick, die unverkennbar das gleiche dachte. Er trat einen Schritt von der Leiche zurück. Sein Blick wanderte umher, während er jedes Detail noch einmal auf sich wirken ließ. Dann schaltete er sein Diktaphon ein, um seine Eindrücke über den Tatort und dessen Dynamik festzuhalten.
Der Arzt klatschte in die Hände. »Ihr Lieben, schafft ihn mir …«
»… so rasch wie möglich rüber«, brummte Stelios, »danach reden wir weiter.«
»Ich sehe, Kommissar, du hast deinen Text brav gelernt.«
»Nun komm schon, Dok, kein klitzekleiner Verdacht?«
»Woran der Junge gestorben ist?«
»Ja?«
»So, wie es sich momentan darstellt, nicht.«
»Meinst du, er wurde missbraucht?«, fragte Stefania.
Der Arzt wog skeptisch den Kopf. »Nun ja, abgesehen von den Lumpenshorts und dem Riemen um den Hals ist der Leichnam fast unbekleidet. Andererseits deutet der zugenähte Schritt eher auf ein nichtsexuelles Motiv hin.«
»Und der Todeszeitpunkt?«, hakte Stelios nach.
»Letzte Nacht. Irgendwann zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens.«
Die Stimmen über ihm erwachen.
Noch ist es dunkel. Nein, es ist bereits hell. Nur hier unten ist es dunkel. Hier unten ist es immer dunkel. Ewige Nacht …
Oben ist es hell. Es ist Tag und die Sonne scheint. Oben scheint immer die Sonne. Von morgens bis abends. Bis in die Nacht.
Oben ist immer Tag. Auch, wenn die Sonne nicht scheint.
Er lauscht den Stimmen. Die eisernen Fesseln bohren sich tief in sein Fleisch. Er hat sich aufgebissen. Die Wut hat es ihm befohlen. Er hat den Geschmack von Blut auf der Zunge.
Blut …
Es ist der einzige Geschmack, an den er sich noch Jahre später erinnern wird. Und an die Gerüche. Von Früchten und Wasser. Von Moder und Fäulnis. Und er wird sich an die Lumpenhose erinnern. Die Sünderhose. Und an den Pferderiemen um seinen Hals.
Er kann es nicht mehr einhalten. Er spürt den heißen Urin an seinen Beinen hinunter rinnen. Bald wird der Gestank ihn von unten her einhüllen. Scham und Schmerz verzerren sein Gesicht. Er spürt die Tränen, die ihm über die Wangen rollen. Seine Augen brennen. Er starrt in die Finsternis. Versucht einen Punkt auszumachen. Nur einen winzigen hellen Lichtpunkt. Einen Fixpunkt, an den er sich klammern kann. Etwas, das ihn hoffen lässt.
Doch er hört nur ihre Stimmen.
Weit oben. Weit, weit oben …
Das Oben und das Unten.
Im Oben scheint immer die Sonne.
Im Unten herrscht ewige Nacht.
2
Kreta, August 1998
D a war sie wieder, diese Gestalt. Sie tauchte immer wieder auf. Unvermutet. Immer dann, wenn Sedina am wenigsten damit rechnete. In der Nähe der Stranddusche, im Schatten der hohen Pinien, in der kleinen Fischtaverne, wo sie manchmal zu Abend aßen. Wie eine sphärische Erscheinung im Dunst des nächtlichen Lagerfeuers oder wie jetzt in der Morgendämmerung, wenn Sedina noch ein wenig bekifft und schwankend aus ihrer Felsenhöhle heraustrat. Eine leicht nach vorn gebeugte Gestalt, die sich auf seltsame Weise nah und zugleich fern von ihr hielt. Eine Silhouette auf der Horizontlinie von Tag und Nacht, zu flüchtig, um ein Gesicht zu erkennen.
Die Gestalt stand ganz still, starrte zu ihr herüber. Sedina rieb sich die Augen, versuchte ihren Blick von den Schlieren der Nacht zu befreien, doch als sie wieder hinsah, war die Gestalt verschwunden. Im Austritt der Nachbarhöhle erschien Moses‘ verschlafenes Gesicht im milchigen Licht des frühen Tages. Er schwankte gähnend heraus, riss die Arme in die Höhe, stieß seinen allmorgendlichen Urschrei aus und stolperte ungelenk und barfüßig über die glatten, runden Felsen auf Sedina zu. Mit wild rudernden Armen bekam er schließlich ihr Handgelenk zu fassen und zog sie im Fallen neben sich, in eine der über die Jahrtausende vom Salzwasser ausgewaschenen Steinwannen.
»Er war wieder da«, flüsterte Sedina.
»Dein Phantom«, grunzte Moses.
»Kein Phantom, Moses! Der Kerl verfolgt mich.«
»Warum flüsterst du?« Moses beschattete mit der freien Hand die Augen und spähte aus halbgeschlossenen Lidern über die Felsen zur Bucht hinunter. »Nichts«, stellte er zufrieden fest. »Niemand da. Nur die üblichen Frühsportler mit ihren suizidalen Verrenkungen. Abartig, wenn du mich fragst. Aber du fragst mich ja nicht.«
Sedina schüttelte seine Hand ab. »Verdammt, Moses, warum glaubst du mir nicht?«, fauchte sie. »Der Kerl taucht wie ein Geist auf, steht plötzlich da und starrt mich an.«
»Ohgotttohgott«, jaulte Moses theatralisch. »Vielleicht ist er ein Geist. Eine arme verlorene Seele, die den Weg zu Reinheit und Liebe sucht.«
»Blödsinn!« Wütend rieb sich Sedina das Handgelenk. »Der Mann verfolgt mich. Wenn ich nur wüsste, warum.«
»Und du bist ganz sicher, dass er ein Mann ist?«
Sedina rollte mit den Augen. Moses lachte wiehernd. Als abgebrochener Student der Romanistik liebte er seine eigenen Scherze. Er lugte verstohlen in Sedinas versteinerte Miene, und sein Wiehern ging in ein unterdrücktes Glucksen über. »La belle et la bête«, raunte er dicht an ihrem Ohr. »Das ewig alte Spiel, meine Schöne.« Seine Finger krochen über ihren Arm, nahmen zielsicher den Weg zu ihren Brüsten. »Die Schöne und das Biest. Spiel mit mir, Schwesterchen.«
»Im Moment kein Bedarf, Bruder.« Sedina schlug seine Hand weg und sprang auf die Füße. »Trotzdem, danke. Ich weiß den Rat des Weisen zu schätzen.« Sie hob den Fuß, tätschelte Moses mit nackten staubigen Zehen Stirn und Wangen und lächelte zu ihm herab. »Man sieht sich, Brüderchen.« Damit schritt sie hoch erhobenen Hauptes davon und winkte Moses, der ihr mit albernem Grinsen hinterher glotzte, mit drei Fingern über die Schulter zu.
»Gewiss, meine Süße«, murmelte Moses. »Mein kleiner Appetithappen, ganz gewiss sieht man sich.« Wie ein schnurrender Kater ringelte er sich in der Felswanne zusammen und schlief augenblicklich ein.
Mit ihrem Eintritt in die Höhle schlug Rafael die Augen auf. Und wie an jedem Morgen stellte er die einzige Frage, die hier, an diesem Ort des leidenschaftlichen Müßiggangs, außer ihn keinen interessierte:
»Wie spät ist es, Mama?«
Und wie an jedem Morgen antwortete Sedina wahrheitsgetreu:
»Ich habe keine Ahnung, mein Engel. Doch die Sonne steht bereits auf ihrem Posten …«
»… also Zeit für uns, sie zu begrüßen«, vollendete Rafael das Ritual.
Sedina beugte sich über ihren Sohn, wuschelte ihm lachend durchs Haar. Er verzog das Gesicht, sie biss ihm zärtlich in die Nasenspitze, krabbelte mit den Händen in seinen Schlafsack und kitzelte ihn, bis er prustend ›aufhören, aufhören‹ schrie. Dann ging sie zu ihrer eigenen Felsnische hinüber, schlug mit wenigen geübten Griffen ihren Schlafsack zusammen und hockte sich daneben. Sie strich das hüftlange Haar zurück und lehnte den Kopf gegen die Felswand. Mit heimlicher Freude beobachtete sie Rafael, der sich auf der Steinliege gegenüber aus seinem Schlafsack kämpfte. Sein drahtiger, für sein Alter ein wenig zu klein geratener, von der Sonne tief gebräunter Körper rührte sie jedes Mal von Neuem. Und während Rafael die Schlafanzughose gegen Badehose und ausgefranste Jeans-Shorts tauschte, sich mit ernster Miene und kindlich schlaksigen Bewegungen die halblangen, von Salz und Sonne gebleichten Haarzotteln aus dem Gesicht bürstete, tauchte sie hinein in jenen wohlig warmen, vertrauten Strom.
Rafael.
Was oder wen auch immer die Zukunft für sie bereithielt, ihr Sohn würde das Wichtigste in ihrem Leben bleiben. Seit knapp drei Wochen lebten sie beide nun in einer der Steinhöhlen von Matala. Die während der Jungsteinzeit in das poröse, weiche Gestein gegrabenen Wohnhöhlen dienten zur Zeit der römischen Belagerung Kretas als Grabstätten. Vom Strand aus gesehen, wirkten die runden und ovalen Eingänge, die in willkürlichen Abständen in den hoch aus dem Meer aufragenden weißen Felsenberg geschlagen waren, wie überdimensionale Einschusslöcher eines vergangenen Krieges. Eine dieser neolithischen Wohnhöhlen, in denen nach den römischen Toten die internationale Hippieszene der sechziger Jahre neben jungen Amerikanern, die ihre Teilnahme am Vietnamkrieg verweigerten, in Kommunen ihren Sex-no-war bis zum Exzess kultivierten, und wo heute die blasse Enkelgeneration jener Sixties in den Fußstapfen ihrer AIDS-freien, von jeglichen Konventionen und Hemmungen befreiten Vorfahren hinterher zu hinken versucht - eine dieser Wohnhöhlen diente nun Sedina und Rafael als Urlaubsdomizil. Für drei Sommermonate hatten Mutter und Sohn die enge, muffige Stadtwohnung im hektischen Zentrum von Heraklion gegen die noch engere Steinhöhle ohne Küche und Bad getauscht. Die Luxusausstattung der Höhle bestand aus zwei gegenüberliegenden, in den Fels geschlagenen Steinbänken, in salz- und sonnendurchfluteter Freiheit.
»Was gibt’s zum Frühstück, Mama?«
Sedina fuhr erschrocken zusammen. Sie blinzelte ins Licht. War sie eingeschlafen?
»Ich hab Hunger, Mama. Hast du was zu essen?«
Die Hände in die Hüften gestemmt, baute sich ihr Sohn vor ihr auf. »ICH – HABE – HUN – GER!«
»ICH – HABE – ES – VERSTANDEN! – Hier …« Sedina kramte einen Schein aus den Falten ihres Miniwickelrocks. »Hol dir was vom Kiosk.«
Rafael schnappte sich den Schein und stopfte ihn in die Gesäßtasche seiner Shorts.
»Aber hol dir was Vernünftiges, hörst du?«
Rafael blinzelte schelmisch. »Was ist was Vernünftiges?«
»Was einigermaßen Gesundes. Zum Sattwerden, du weißt schon. Ach ja … Und vergiss nicht, dich zu waschen.«
»Ich geh doch gleich schwimmen«, maulte er.
»Und die Zähne, junger Mann?«
»Zuviel Zähneputzen ist gar nicht gesund«, stellte Rafael sachlich fest.
Die allmorgendliche Diskussion, dachte Sedina. Ein Überbleibsel der Zivilisation. Sie lächelte in sich hinein.
»Hör mal, mein Sohn, ein Mindestmaß …«
»… an Sauberkeit muss sein! Ich weiß, Mama.«
Rafael zog eine Grimasse, Sedina schnellte kichernd nach vorn, doch der Junge war schneller und entglitt ihrem Griff.
»Hast du eigentlich den komischen Mann wiedergesehen, Mama?«
»Ja, mein Herz.«
»Wo?«, fragte Rafael aufgeregt. »Wo ist er?«
»Fort. Er ist fort.«
»Und wenn er wiederkommt?«
»Dann sagen wir den anderen Bescheid.«
»Und dann?«
»Dann sehen wir weiter.«
»Vielleicht ist er ja ganz okay«, meinte der Junge zögerlich. »Vielleicht ist er allein und sucht nur jemanden zum Reden oder Spielen.«
»Vielleicht … Ich weiß nicht … Wir werden sehen.«
Sedina blinzelte zu ihrem Sohn hinüber, derweil die Müdigkeit sie sanft wie eine weiche Meereswoge umhüllte. Die Silhouette von Rafaels Gestalt füllte den Ausgang der Höhle. Das Licht schlang sich wie eine helle Aura um seinen zarten Jungenkörper. Wie erwachsen er schon war, ihr Sohn. Wie er sich bemühte, den Part des männlichen Beschützers zu übernehmen. Doch so sehr sie sein Bemühen anrührte, Sedina brauchte keinen Beschützer. Keinen männlichen Partner. Sie brauchte nur ihren Sohn. Rafael. Ihr Kind. Ihr Baby. Die Liebe zu ihrem Sohn war das Einzige, was für sie zählte.
Sedinas Augen brannten, unmöglich sie länger offenzuhalten. Zu viel Wein letzte Nacht. Zu viel Koks. Zu viel Liebe. Sofern man das, was zwischen ihr und Moses und auch einigen anderen hier ablief, als Liebe bezeichnen konnte. Aber es machte Spaß. Verdammt viel Spaß! Und nur darauf kam es an: auf diese spezielle Art sexueller Freiheit, die sie hier lebten. Auslebten! Wenngleich es eine zweifelhafte Freiheit war. Das war Sedina von Anfang an klar gewesen, als sie die Skrupel ihres bürgerlichen Gewissens ausradiert und mit dem Kopf voran ins Selfservice-Tauchbecken des Fisch-dir-raus-was-immer-du-willst hineingesprungen war.
Dass es wieder anders werden musste. Dass es aufhören musste, das Lotterleben, war ihr klar. So konnte sie nicht weitermachen. Nicht mit einem Kind im Schlepptau. Spätestens nach diesem Urlaub, der so etwas wie ein Befreiungsschlag für sie beide sein sollte, eine Scheidungsnachlese, würde sie auf den Pfad der Tugend zurückkehren. Schläfrig schaute Sedina ihrem Sohn hinterher, dessen Silhouette sich im Weißlicht des Einschussloches auflöste.
Als sie erwachte, hatte sich das Licht verändert.
Von draußen drangen Stimmen an ihr Ohr. Kinderstimmen. Erwachsenenstimmen. Satzfetzen. Gelächter. Ein Schrei. Von plötzlicher Unruhe getrieben, sprang Sedina auf, stürzte ins Freie. Alles so wie immer. Felsen. Strand. Wasser. Schattenplätze unter Pinien. Die Sonne war ein gutes Stück weiter gewandert. Über den Sand flimmerte die Hitze. Menschen aalten sich in der Sonne, hockten unter Sonnenschirmen, spielten Beach- und Volleyball und schwammen durch seichte Wellen. Von hier oben ließ sich die Bucht fast vollständig einsehen. Sedina stolperte über die Felsen, kletterte weiter hinauf, weiter und immer weiter, höher hinauf. Die heißen, glatten Steine glühten unter ihren nackten Fußsohlen, doch Sedina spürte keinen Schmerz. Sie rief seinen Namen. Sie rief Rafael … Rafael … Rafael … Sie rannte hinunter zum Strand und rief und rief, während Menschen sie mit neugierigen Blicken anstarrten und dunkle Angst sich wie eine Faust um ihren Nacken schloss.
*
Sie waren immer schneller die Felsen hinauf geklettert. Immer schneller, schneller, schneller. Bis die Stimmen aus der Bucht unter ihnen leiser geworden waren, bis sie sich nur noch wie das geheimnisvolle Wispern eines Baches anhörten. Dann war auch das Wispern verstummt, und der Fremde hatte ihn weiter zur Eile angetrieben. Denn ganz oben, in der höchsten Höhle, dort würde er ihn sehen: den Königsadler. Unvorstellbar riesig mit einer Flügelspannweite von drei Metern und mit einem gewaltigen Schnabel, mit dem er sein Federkleid putzte. Ein Adler, so majestätisch, wie nur ein König es war. Der Fremde hatte dem Adler einen Namen gegeben: Zeus. Er behauptete, jener Zeus sei einst in Stiergestalt mit einer von ihm entführten phönizischen Prinzessin namens Europa in dieser Bucht an Land gegangen, wo er sich in einen Adler verwandelte.
Rafael hatte noch nie einen Königsadler gesehen. Er hatte überhaupt noch keinen Adler gesehen. Keinen lebendigen. Schon gar nicht aus solcher Nähe, wie der Mann ihm versprach. So war sein Wunsch, jenem Tier zu begegnen, überwältigend. Der Wunsch hatte sich auf unwiderstehliche Weise in ihm ausgebreitet und das Bild des prachtvollen Vogels in seine Phantasie gezeichnet. Wäre da nur nicht die Stimme in seinem Kopf, die Stimme seiner Mutter, die er zu ignorieren versuchte:
Folge keinem Fremden! Steige nie in ein fremdes Auto! Nimm nichts von einem Fremden an, kein Geschenk, nichts Süßes, kein Versprechen!
Und nun tat er genau das:
Er folgte einem Fremden. Nahm sein Versprechen an.
Rafael zögerte. Schließlich warf er die Warnungen seiner Mutter und das Versprechen des Fremden in die Waagschalen seiner Neugier und traf eine Entscheidung: Er musste den Adler sehen. Außerdem war der Mann eigentlich gar kein Fremder. Zumindest nicht für seine Mutter und ein paar andere aus der Clique. Zwar hatte keiner von ihnen je mit dem Mann gesprochen, dennoch verging kaum ein Tag, an dem Sedina und die anderen nicht über ihn lästerten: Wie der Kerl auftaucht und verschwindet. Wie er schweigend dasteht, zu ihnen herüber starrt.
Er erscheint und verschwindet wie eine Geistererscheinung, sagte Sedina. Und Moses lachte und nannte den Mann einen Spanner oder so ähnlich. Auf Rafaels Frage, was das sei, ein Spanner, lachte Moses noch lauter. Er kniff Rafael in die Wange und zwinkerte Sedina zu. Dann krümmten sich beide vor Lachen, fielen übereinander her und wälzten sich unter wilden Gebärden im Sand, während er mit hochrotem Kopf dabeistand und zuschaute. Als sich das Knäuel von Armen und Beinen endlich auflöste und Moses sich von Sedina herunter stemmte, blinzelte er grinsend zu ihm hoch und brummte: Jetzt weißt du, Kleiner, was ein Spanner ist. Was definitiv nicht zutraf. Rafael wusste es immer noch nicht. Was aber letztendlich egal war.
Weniger egal war ihm der Adler, dem er in wenigen Minuten von Angesicht zu Angesicht, wie der Fremde ihm versprach, begegnen würde.
EIN KÖNIGSADLER!
Rafael zitterte vor Aufregung, konnte es kaum erwarten. Konnte sein Glück nicht fassen, dass ein solches Geschenk für ihn bereithielt. Offenbar erging es seinem Begleiter nicht anders. Er trieb Rafael zur Eile an, und Rafael hörte den schweren Atem des Mannes hinter sich, seine aufmunternden Worte und verstand immer weniger, warum die anderen über den Fremden, der kein Fremder war, lachten. Warum sie ihn mieden, ihn einen Spanner oder schlimmer noch nannten. Wo er doch nur - wie Rafael ihn getauft hatte - ein einsamer Mauerblümchenmann war, der jemanden zum Reden suchte oder einfach nur einen, der etwas mit ihm gemeinsam unternahm.
Wie Rafael es jetzt tat.
Als er zurückschaute, lag der Strand schon weit unter ihm. Die Menschen auf dem Sand und im Wasser bewegten sich wie die Figuren seines Playmobil. Rafael lauschte den sich entfernenden Stimmen, dem Kreischen der Mädchen im Wasser. Er nahm Rufe wahr, die sich zu wiederholen schienen. Er spitzte die Ohren, hielt die Luft an, um besser hören zu können. Doch so weit oben auf den Felsen war es unmöglich, die Stimme zu erkennen oder etwas zu verstehen. Und als er auf Anweisung des Mauerblümchenmanns vorsichtig um einen der Felsen herum kletterte, verschwand der Strand unter ihm und mit ihm die Stimmen und die Rufe. Er blieb stehen, hielt sich an einem Felsvorsprung fest und starrte hinab.
Außerhalb der Bucht war die See wesentlich rauer. Kämme hoher Wellen brandeten um die nackten Felsen, die aus dem wü-tend schäumenden Wasser emporwuchsen. Rafael, dem es nun etwas unheimlich zumute war, suchte den Blickkontakt zum Mauerblümchenmann, der etwas tiefer auf einem kleinen Felspla-teau stand. Er sah, wie die Lippen des anderen sich zu Worten formten, doch das Krachen und Tosen des Wassers schluckte jeden anderen Laut. Sein neuer Freund lächelte aufmunternd und deutete mit der Hand nach oben. Rafael klammerte sich mit bei-den Händen an den Fels und hob vorsichtig den Blick. Direkt über sich erkannte er den Eingang einer größeren Höhle. Wäh-rend er fasziniert nach oben starrte, war der Mauerblümchen-mann zu ihm hinaufgeklettert. Er stand nun unmittelbar neben ihm.
»Siehst du«, der Mann legte eine Hand auf Rafaels Schulter und wies mit der anderen nach oben. »Dort oben ist die Höhle des Königsadlers. Dort oben erwartet dich Zeus. Wie ich es dir versprochen habe. Jetzt sind es nur noch wenige Meter, die uns von ihm trennen.«
Mit weltmännischer Gebärde schob Rafael die Hand seines neuen Freundes von seiner Schulter. »Also los, worauf warten wir dann noch?«
»Genau das frage ich mich auch«, grinste der Mann und klemmte die Daumen unter die Riemen seines geschulterten Rucksacks.
Feuernacht.
So nennt er den Tag, der sein Leben von Grund auf veränderte. Obwohl die Veränderung weder mit einem Feuer noch mit der Dunkelheit etwas zu tun hatte. Niemand ist verbrannt. Es war helllichter Tag, als es geschah. Dennoch hat sich das Bild von Feuer und Finsternis in ihm festgesetzt.
Feuernacht.
Es brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, ihn von der Kante einer glücklichen Kindheit in die Hölle hinabzustoßen. Fortan befand er sich auf der Kehrseite des Lichts.
Er starrt in die Finsternis.
Wieder ist es Nacht. Oder noch immer? Wie lange schon?
Manchmal verliert er die Zeit, kann Tage und Nächte nicht mehr unterscheiden. Die Stimmen scheinen ihm jetzt weiter entfernt als sonst. Vielleicht verliert er auch langsam sein Gehör. Vielleicht auch den Verstand. Die Stimmen sind nun wie ein langgezogener Klang. Ein Stakkato, ein verzerrter, nicht berechenbarer Rhythmus. Er versteht kein einziges Wort, kann ihren Sinn nicht deuten. Doch der Klang genügt, um ihm ein wenig von der Einsamkeit zu nehmen. Eine Illusion nur. Er weiß es. Allein der Nachhall des Klangs hilft ihm, sich weniger einsam zu fühlen.
In dem Klang gibt es viele Stimmen. Stimmen unterschiedlicher Tonarten. Metallene, gurgelnde Untertöne. Grelle, quietschende Obertöne. Und die Musik. Stimmen und Musik. Sie kommen aus dem Fernseher. Dieser leuchtende Kasten… Wie gern würde er jetzt dort hineinschauen. Sich von den flirrenden, bunten Bildern über das Meer tragen lassen. Bilder, auf dreißig mal fünfzig Zentimeter begrenzt. Zusammengeschrumpfte Realität. Eine andere Welt. Die Illusion einer schöneren Welt.
Er schließt die Augen. Er will fliegen.
Ein Vogel sein … So frei …
Er lauscht dem fernen Klang der Stimmen, dem Hämmern der Musik.
Flieg, Vogel, flieg …
Flieg weit, weit fort …
Er breitet die Arme zur Seite. Spreizt die Finger. Winkelt die Ellbogen ein wenig an. Bewegt die Arme auf und nieder, die Hände im Rhythmus des Fluges. Auf und nieder, auf und nieder. Arme und Hände, die zu Schwingen werden. Zu den Schwingen einer Möwe.
Eines Adlers.
Er denkt an den Greifvogel, der manchmal über dem Tal schwebt. Er folgt dem Adler über die ölbaumbewaldeten Hügelkuppen, über die nackten Felsen, umrahmt von Pinien und Zypressen. Er fliegt höher hinauf über Hügel, Felsen und Bäume, folgt dem Adler höher und höher hinauf, in die unendlichen Weiten des Himmels…
Er spürt den harten Sitz unter sich, über sich riecht er die Freiheit.
Er will ein Greifvogel sein. Ein Adler. Über der Welt schweben.
Er will Herr sein über Welten und Meere.
Seine Träume verselbständigen sich, folgen eigenen Wegen. Er durchstreift eine Miniaturwelt. Eine Spielzeugwelt, bevölkert von leblosen Menschenhüllen. Plastikmenschen in Häusern und Städten aus Pappmaché. Eine Welt, deren jämmerliches Leben allein aus Organismen, Mikroben, Pflanzen und Insekten besteht.
Er stellt sich vor, wie er sich aus der Luft herablässt, die Ad-lerschwingen an den Körper gelegt. Er stellt sich vor, in ei-ner solchen Miniaturwelt zu leben. Lautlos. Nicht greifbar. Unantastbar. In einer Welt aus Pflanzen und kleinzelligen Wesen, aus willenlosen Plastikmenschen in Pappmaché-Häusern. In einer Welt, die auf Knopfdruck funktioniert. Auf die Umdrehung eines Schlüssels. Eines einzigen Schlüssels, der sich allein in seinem Kopf befindet. In seinem zur All-macht mutierten Hirn.
3
Korfu, September 2012
Das wenigstens hatten sie geschafft. Nach dreijährigem Kampf gegen die Windmühlen der Bürokratie hatte man in den höheren Etagen des Polizeiapparates endlich entschieden, Stelios Angelis und Stefania Stefanidou im Gebäude der Astynomia am San Rocco ein eigenes Büro zuzuteilen. Einen kleinen Eckraum mit einem offenen, mit Aktenordnern vollgestellten Wandregal, einer Computerecke und einem betagten, mehrfach abgeschliffenen, im Gegensatz zum bescheidenen Ambiente des Raumes gigantisch wirkenden Holzschreibtisch, an dem sie nun in Pseudoledersesseln, zwei Becher Kaffee vor sich, einander gegenüber saßen.
Stefania schlug die Beine übereinander und steckte sich eine Selbstgedrehte zwischen die Lippen. »Die Inszenierung passt nicht zu Prometheus.«
»Sondern?« Stelios lehnte sich in seinem nagelneuen Drehsessel, der so gar nicht zu dem alten Schreibtisch passen wollte, zurück und fächelte diskret Rauch von sich fort.
Stefania zog nachdenklich an ihrer Zigarette, hob das Kinn und entließ den Rauch gemächlich gegen die Decke. »Zu Tityos. Ein euböischer Riese. Sohn des Zeus und der Elare. Laut Mythos wurde er von Apollon und Artemis erschossen, nachdem er versucht hat – vermutlich aus Rache von Hera angestiftet - ihre Mutter Leto zu missbrauchen.«
Stelios hob beeindruckt die Brauen. »Und woher hast du das mit Tityos?«
Stefania nippte an ihrem Kaffee. »Du weißt doch, unsere Vorfahren aus der Antike interessieren mich. Und das Leben im gläsernen Zeitalter von Google erleichtert so manches.«
»Gott, ich Hinterwäldler!« Stelios schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Ich lebe doch wirklich noch auf dem Mond.«
Stefania rang sich ein schiefes Lächeln ab über seine nicht sonderlich überzeugende Selbstkritik. Computer waren für Stelios Angelis sowas wie unheimliche Wesen der dritten Art, nützliche Ungeheuer mit einem unberechenbaren Eigenleben.
»Und der Rache nicht genug«, spann sie den mythologischen Faden weiter, »wurde Tityos auf Ewigkeit im Hades bestraft. Hilflos auf dem Boden ausgestreckt, sein Körper bedeckt von neun Morgen Land, fraßen zwei Geier an seiner Leber, die bei jedem Neumond nachwuchs.« Sie schaute zwei zerfasernden Rauchkringeln hinterher. »Prometheus wurde an einen Felsen gefesselt, Tityos auf den Boden gelegt.« Stefania starrte auf die Glut der Zigarette. »Ebenso wie der tote Junge«, fügte sie leise hinzu, wobei Stelios das Zittern ihrer Hand nicht entging.
»Neun Morgen Land«, sagte er nachdenklich. »Dazu passen die Erdkrumen, die der Rechtsmediziner in der Wunde gefunden hat.«
»Und der Neumond. Vergangene Nacht hatten wir Neumond.«
»Und was ist mit dem Pferderiemen um den Hals? Und die Lumpenhose, in die er gekleidet war? Wie passen die ins Bild?«
»Auf Abbildungen der Antike sind immer wieder Pferde zu sehen«, erklärte Stefania. »Der Hades hatte viel mit Pferden zu tun. Die Lumpen könnten eine Art Sünderkleidung darstellen. Immerhin wurden nur Sünder wie Tityos in den Hades verbannt.«
»Ein Sechzehnjähriger als Sünder«, stöhnte Stelios. »Mein Gott, in was für einer Welt leben wir eigentlich?«
Sie starrten schweigend auf das sanfte Wippen der Stechpalmenblätter vor dem einzigen Fenster. Der ›Palmengarten‹ dahinter bestand aus drei verwahrlosten, staubigen Palmen, umkränzt von niedrigen Dornenhecken. Eine Anlage, bei der die Hand eines Gärtners in die Rubrik ›futuristische Herausforderung‹ gehörte. Über ihnen rotierten leise surrend die drei Flügel des altertümlichen Ventilators, den Stelios vor mehr als einem Jahrzehnt in einem schwachen Moment für das halbe Monatsgehalt eines jungen Polizisten auf einem Markt in Athen erstanden hatte. Stefania sah in dem Monstrum eher einen geflügelten Kraken, der eines Tages mit seinen mächtigen Armen den kleinen Raum ergreifen und verschlingen würde. Als sie Stelios ihren Eindruck kichernd unterbreitete, wäre er ihr fast an die Gurgel gesprungen. Also schluckte Stefania jeden weiteren Kommentar hinunter und arrangierte sich mit dem unliebsamen Giganten, der zumindest die abgestandene Luft im Raum umwälzte und damit erfolgreich für etwas frische Kühle sorgte.
In den wesentlichen Fragen jedoch waren Stefania und Stelios ein gutes Team, ein sehr gutes sogar, wenngleich ein wenig auf dem Abstellgleis. Als Ermittler für Kapitalverbrechen wurden sie auf einer Insel wie Korfu nicht gerade mit Arbeit überhäuft. Familiäre Fehden, die in zwei Fällen mit einem tödlichen ›Unfall‹ endeten, in einem weiteren mit Totschlag, zwei Einbrüche mit Todesfolge und ein Saisonarbeiter, der als ›besonderen Kick‹, wie er aussagte, der Fahrerin, die ihn als Anhalter mitgenommen hatte, die Kehle durchschnitt, waren die finsteren Highlights der letzten fünf Jahre. Zugegeben, ein bequemer, wenngleich ein magerer und ziemlich eintöniger Job.
Den Ausgleich hierfür schaffte eine gemeinsame Leidenschaft, die sie im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Einrosten bewahrte: der Rembetiko. Gemeinsam mit drei anderen spielten sie ein- bis zweimal im Monat in einer Taverne oberhalb der Garitsa-Bay. Sobald die klagenden, leiernden Töne der Mandolinen und Gitarren den spärlich beleuchteten Raum erfüllten, und Stefania, begleitet von den Hintergrundstimmen der Gäste, die alten Lieder des Rembetiko sang, schien es ihr, als verließe sie ihren Körper. Der Rembetiko, der griechische Blues, mit seinen erotischen, traurigen, kritischen, bisweilen bissigen Texten war Stefanias Zufluchtsort. Ein Ort des zeitweiligen Vergessens, der die Vergangenheit ausblendete und die Zukunft besänftigte.
Mit einem Seufzer führte Stelios den Kaffeebecher zum Mund und gab es auf, den Rauch weg zu wedeln. Als ehemaliger Raucher - nunmehr militanter Nichtraucher - war es eines der Dinge, die er an Stefania hasste. Zugegeben eines der wenigen Dinge. Doch eher hätte er einer Fliege das Summen abgewöhnen können, als Stefania Stefanidou das Rauchen.
»Also, was wissen wir bis jetzt?« Stelios zerknüllte den leeren Becher und verfehlte den Papierkorb um Haaresbreite.
Stefania kippte den Rest Kaffee in sich hinein und streifte die Asche am Becherrand ab. »Nicht gerade viel, wenn man das so sagen darf.«
Die Spurensuche hatte wenig erbracht: keine Speichel-, keine Fremdfaserspuren, kein Sperma. Es gab keinen Hinweis auf einen sexuellen Kontakt, weder anal noch oral. Der Täter hatte die schenkelkurze Lumpenhose, in die er die Leiche des Opfers gekleidet hatte, so weit heruntergezogen, dass der Bauch frei lag. Trotz des Pferderiemens um den Hals wurde der Junge, laut Georgios Katzounis, nicht erdrosselt. Es fanden sich keine Haar- oder Hautpartikel, auch nicht unter den Finger- oder Fußnägeln des Opfers. Offenbar hatte der Junge sich nicht gewehrt, oder der Täter hatte nach der Tat alles penibel gesäubert. Nach Meinung des Rechtsmediziners könnte beides zutreffen. Womit sie es eindeutig mit einem Profi zu tun hatten. Auch die Fesselspuren an Hand- und Fußgelenken waren sauber, die Fesselungsmale sprachen für ein dünnes, glattes Seil. Um den Leichnam herum gab es keine frischen Fingerabdrücke, außer vom Opfer, keine frischen Schuhabdrücke, außer von dem toten Jungen. Vermutlich hatte der Täter Überschuhe und Handschuhe getragen und zusätzlich im Umkreis der Leiche seine eigenen Spuren verwischt, was ebenfalls für einen Profi sprach. Alle anderen Spuren, außerhalb des Gemäuers und auf dem Weg dorthin, waren Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahrzehnte alt, unzählige übereinander gelagerte Schichten, nicht verwendbar.
»Er ist mit dem Jungen den Weg zur Festung hinaufgegangen«, sagte Stelios. »Er kannte sich aus. Er hat alles gut vorbereitet. Er hat aufgepasst, dass es keine Zeugen gab. Es gab keine Zeugen. Nicht um diese nächtliche Stunde. Keiner, der ihm begegnete, ihn störte. Er konnte in Ruhe arbeiten. Er hat den Jungen getötet. Hat ihn gesäubert. Dann hat er sein Szenario aufgebaut. Sorgsam, wie auf einer Bühne. Durchdacht, wie für ein Theaterstück.«
Stefania drehte sich eine weitere Zigarette. »Was wissen wir über den Jungen?«
»Nicht viel. Ioannis Bardis. Sechzehn Jahre. Seine Eltern führen einen Lebensmittelladen in Paleokastritsa.«
Stefania fuhr mit der Zungenspitze über das Zigarettenpapier und klebte die Ränder zusammen. »Wer überbringt die Todesnachricht?«
Stelios hob ergeben die Schultern. »Na, wer wohl?«
Stefania taxierte ihn mit einem kurzen Blick, und abermals registrierte Stelios den unbekannten harten Zug um ihre Lippen und das seltsame Glitzern in ihren Augen, die ihn bereits am Tatort irritiert hatten.
»Wissen wir irgendwas über den Täter?«, fragte Stefania. Sie zog an der Zigarette, Rauchfahnen umwehten ihren Mund.
Um dem Rauch auszuweichen, drehte sich Stelios in seinem Sessel ein wenig zur Seite. »Außer, dass er keinerlei Spuren hinterlässt, nichts. Er kommt, begeht die Tat und verschwindet.«
»Lautlos wie eine Raubkatze.« Stefania nickte. »Er hat einen Plan. Ein Konzept. Und so, wie es ablief, hat er sowas vermutlich nicht zum ersten Mal getan.«
»Sieht jedenfalls danach aus. Es ist alles zu perfekt.« Stelios erhob sich, schnappte sich die Tatortfotos und heftete sie an die Pinnwand hinter dem Schreibtisch. »Vom Opfer wissen wir, dass der Junge zu klein war für sein Alter. Der Arzt meint, die physische Entwicklung entspricht der eines Fünfzehn-, Sechzehnjährigen. Die Körpergröße jedoch der eines Zwölfjährigen.«
»Was vielleicht ein Hinweis auf den Täter sein könnte«, überlegte Stefania laut. »Zwerg und Riese … Im Mythos ist Tityos ein Riese. Doch der Täter hat ihn für seine Zwecke zu einem Zwerg schrumpfen lassen. Denn das Todesszenario spiegelt für mich eindeutig Tityos‘ Leiden wider.« Abermals landete ein sich gefährlich krümmender Aschestrang in ihrem leeren Kaffeebecher. »Das beweist allein die Lage des auf dem Boden ausgestreckten Körpers.«
Alles deutete auf den Riesen Tityos hin. Die Tat geschah in einer Neumondnacht. Und auch die Erdkrumen in der Schnittwunde, die einen Teil der Leber freilegte, sowie der Plastikvogel, der ein Stück der Leber im blutroten Schnabel trug, waren für Stefania eindeutige Hinweise.
»Die Erdkrumen wurden wahrscheinlich absichtlich in die Wunde gelegt«, sagte sie.
»Das meint auch Katzounis«, erwiderte Stelios.
Stefania trat neben Stelios vor die Pinnwand. Als sie die fast aufgerauchte Zigarette an die Lippen führte, begann ihre Hand derart heftig zu zittern, dass das Mundstück um ein Haar sein Ziel verfehlte. Sie versuchte, das Beben unter Kontrolle zu bekommen.
»Was?«, fauchte sie, als sie Stelios‘ Blick bemerkte.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Alles okay.«
Wenn es okay ist, dass ein junger Mensch auf diese Weise stirbt …
Sie zog an der Zigarette und kniff die Lider vor dem beißenden Rauch zusammen. »Mach weiter«, meinte sie locker, ohne seinem Blick auszuweichen.
Von ihrer gespielten Leichtigkeit irritiert, fuhr Stelios fort. »Der Einschnitt über der Leber wurde, ebenso wie die gesamte Inszenierung, postmortal ausgeführt.«
»Auch das deckt sich mit dem Schicksal des zur ewigen Verdammnis verurteilten Riesen. Tityos erlitt seine Bestrafung im Hades, nachdem er von Apollon und Artemis erschossen wurde.«
»Der Junge wurde aber nicht erschossen«, wandte Stelios ein.
»Ein weiterer Punkt, der vom Mythos abweicht. Es gibt also zwei Widersprüche«, resümierte Stefania. »Die Körpergröße des Opfers und die Art des Todes.« Sie warf sich in ihren Drehsessel, die Selbstgedrehte ertrank unter zischendem Protest im Kaffeesatz des Plastikbechers. »Und woran ist er nun gestorben?«
»Gute Frage«, seufzte Stelios. »Der Dok weiß es noch nicht.«
Er lehnte sich ans Fensterbrett, die Fußknöchel gekreuzt. Draußen, in der heißen Mittagsbrise, raschelten die Fächer der Palmenkronen mit den Stechpalmenblättern um die Wette. Das Handy an seinem Gürtel vibrierte. Stelios schaute auf das Display und nahm das Gespräch an.
»Der Tod des Jungen trat zwischen eins und drei in der Nacht ein, und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit«, begann der Rechtsmediziner Georgios Katzounis ohne weitere Einleitung. »Der Kerl hat Kaliumchlorid benutzt. Die Einstichstelle liegt verdeckt in der Leiste. Deshalb habe ich sie auch nicht sofort entdeckt.«
»Kaliumchlorid … Das Zeug verwenden sie doch in Amerika als Todesstrafe durch die Giftspritze, oder?«
»Ganz genau. Intravenös gespritzt, in Form einer Kurzinfusion in die Vene femoralis, erhöht es die Kaliumkonzentration im Körper. Die Hyperkaliämie führt zur Lähmung der Herzmuskulatur und somit zum Tod.«
»Hm«, brummte Stelios. »Das sind ja nette Aussichten.« Sollten sie es hier, auf der friedlichen Insel Korfu, plötzlich mit einer völlig neuen Dimension von Kriminalität zu tun bekommen?
»Aber sicher kannst du es nicht sagen, Dok, oder?«, hakte er nach.
»Nein. So etwas kann man meist nur indirekt nachweisen, da der natürliche Kaliumspiegel nach dem Tod ohnehin auf die zwei- bis dreifache Konzentration ansteigt. Der Junge ist an Herzversagen gestorben. Obwohl sein Herz intakt und unversehrt ist. So jedenfalls stellt es sich dar. Ein weiteres Indiz ist die Einstichstelle. Sowie eine erhöhte Chlorid-Konzentration.«
»Der perfekte Mord also.«
»Könnte man so sagen«, bestätigte der Arzt. »Wenn die Inszenierung, die er uns mitgeliefert hat, nicht das Gegenteil bezeugen würde.«
»Kaliumchlorid«, murmelte Stefania nachdenklich, nachdem Stelios das Gespräch mit Georgios Katzounis beendet hatte. »Passt überhaupt nicht zum Mythos, oder?«
»Nun ja, sowas kannten sie im Hades ganz sicher noch nicht.«
»Dennoch«, grübelte sie, »vielleicht sind es gerade die Dinge, die vom Mythos abweichen, ihm also widersprechen.« Sie schürzte die Lippen. »Vielleicht sind es genau die, die uns etwas über den Täter verraten.«
*
Ich war vier, als meine Mutter mich verließ. Es geschah ganz plötzlich, mitten aus meinem eintönigen, glücklichen Kinderleben heraus.
Aus dem Leben gerissen …
Bei Mama passte diese Plattitüde. Sie starb durch einen Verkehrsunfall. Mein Vater erkannte den entgegenkommenden Lastwagen zu spät. Mama war auf der Stelle tot. So erklärten es die Sanitäter meinem Onkel. Mama hatte ihn also nicht einmal bemerkt, den Übergang in die jenseitige Welt, aus der sie nun zu mir herabblickte, ohne mich wirklich zu sehen.
Wie sonst wäre das alles mit mir geschehen?
Mama hätte die abscheulichen Dinge, denen ihr kleiner Junge fortan ausgesetzt war, nie und nimmer zugelassen. Kraft ihrer Allmacht hätte sie mich aus den Fängen des Onkels befreit.
Ja, Mama war allmächtig!
Mama war jetzt bei Gott!
In meiner kindlichen Vorstellung war sie im Himmel, oder wo auch immer sie sein mochte, zu einer Matrone beeindruckenden Ausmaßes mutiert. Wunderschön, mächtig und erhaben wachte sie über die Sterblichen meiner kleinen Welt.
Die Frau des Onkels, meine Tante, war das genaue Gegenteil. Eine verhärmte, schwache, unterwürfige Frau, ängstlich und unbedeutend. Ein Schattengespenst. Sie spielte im Leben meines Onkels eine untergeordnete Rolle. Wie eine Küchenmaschine. Oder ein Kehrbesen, schweigsam, pflegeleicht, stets funktionsbereit, den man nach Gebrauch in die Ecke zurückstellte.
Manchmal starrte ich hinauf zum Himmel. Ich dachte, vielleicht sieht sie mich, meine Mama. Vielleicht schaut sie gerade, in diesem Augenblick, durch das Wolkenloch über mir auf die Erde hinab. Ich gab die Hoffnung nicht auf. Wann immer der Onkel von mir abließ, ich mich unbeobachtet fühlte, ging mein Blick nach oben. Ich starrte hinauf gen Himmel und hoffte. Vielleicht entdeckte mich Mama zwischen all den anderen Sterblichen, die sie behüten musste. Vielleicht weinte sie um mich. Vielleicht erwartete ich auch zu viel, und Mamas Macht reichte doch nicht bis zur Erde hinunter, um mir zu helfen. Vielleicht konnte sie einfach nichts daran ändern, dass all diese schrecklichen Dinge mit mir geschahen.
Der Weg von oben nach unten ist weit.
Unvorstellbar weit …
Wie weit muss eine Seele fliegen, um vom Himmel bis hinunter ins Irdische zu gelangen? Als ich mir den Kopf darüber zergrübelte, war ich sechs. Damals beschloss mein Körper, nicht mehr zu wachsen. Ich blieb ein Zwerg. Viele grausame Jahre lang. Doch sollten noch weitere etliche Jahre vergehen, bis mir klar wurde, dass die Seele meiner Mutter nicht existierte. Dass es überhaupt keine Seelen gab. Weder im Himmel noch auf Erden und schon gar nicht in der Hölle.
Als ich dies erkannte, war ich erwachsen.
Und es war zu spät umzukehren.
Die Zeit hatte ihre Weichen gestellt.
Der unheilvolle Zug war längst abgefahren.
Mein Vater überlebte meine Mutter zwei volle Stunden. Die Sanitäter berichteten, er hätte auf dem Transport ins Krankenhaus bis in den Operationssaal hinein geschrien. Nach dem kurzen Eingriff sei er nicht wieder aus der Narkose erwacht. Der Onkel, ein Bruder meiner Mutter, bekreuzigte sich drei Tage und Nächte lang. Dann spuckte er vor der Familiengruft auf Papas Sarg und schickte ihn mit einem Schwall schmutziger Flüche und Verwünschungen zur Hölle.
Der Tod, sagte der Onkel, sei meinem Vater gnädig gewesen. Er hätte es ihm leicht gemacht, Hades in die ewige Verdammnis zu folgen.
Verzeihen Sie, aber an dieser Stelle möchte ich die Aussage des Onkels doch ein wenig revidieren:
Ich glaube, der Gott der Unterwelt hatte einen Pakt mit meinem Vater geschlossen. Sein Leben gegen den Zorn des Onkels. Mein Vater willigte ein und der Totengott half ihm, dem Onkel zu entkommen. Denn das Martyrium, das sich der Onkel ausgedacht hatte, übertraf jede Verdammnis. Dagegen ist der Hades ein warmes, kuscheliges Plätzchen am Kamin der Unendlichkeit.
Ein jeder, erklärte der Onkel, müsse für seine Schuld zahlen. So sei es immer gewesen, im Leben wie im Tode. Mein Vater, sagte er, habe das Leben meiner Mutter, seiner geliebten Schwester, ausgelöscht und sich anschließend feige der irdischen Gerechtigkeit entzogen. Daher müsse nun ich, der Sohn des Sünders, stellvertretend für den Vater büßen.
Sicher, es bleibt Ihnen überlassen, mir zu glauben oder auch nicht.
Doch ich versichere Ihnen, beim Frieden meiner geliebten Mutter: Jedes meiner Worte ist wahr. So wahr ich auf dieser Erde existiere. So wahr Sie noch unter den Sterblichen weilen. So wahr ich gerade Sie auserwählt habe, ein kleines Stück von mei-nem irdischen Lebenskuchen zu probieren.
4
Das Thermometer auf der Veranda zeigte noch immer achtundzwanzig Grad. Stefania streifte die Sandalen von den Füßen, zog im Gehen das verschwitzte Baumwolltop über den Kopf, blieb stehen und schlüpfte aus ihrer dreiviertellangen Jeans. Sie hob die Jeans auf, schleuderte die Klamotten in einen der zwei Korbsessel, die einen niedrigen Korbtisch flankierten, und ließ sich in BH und Slip in den anderen fallen. Sie streckte die Beine, legte sich seufzend zurück, verschränkte die Arme im Nacken und starrte hinauf zur Verandadecke. Im purpurnen Licht der einfallenden Abendsonne rangen die Schattenarme der Bougainvillea in einem Schlangentanz miteinander. Eine laue Brise strich vom Meer her über sie hinweg, jagte sanfte Schauer über ihre nackte Haut und richtete die Härchen auf ihren dunkel gebräunten Armen auf.
Stefania schloss die Augen.





























