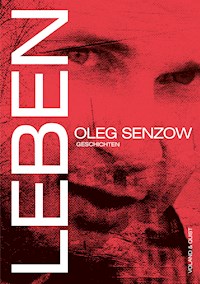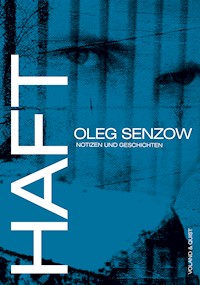
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
145 Tage lang war der ukrainische Regisseur und Maidan-Aktivist Oleg Senzow im Hungerstreik. In dieser Zeit hat er Tagebuch und Kurzgeschichten geschrieben. Seine Schilderungen geben Einblick in den Alltag in der russischen Strafkolonie "Eisbär" in Labytnangi Polarkreis, in der er seine Lagerstrafe bis zu seiner vorzeitigen Freilassung verbüßen musste. Senzow beschreibt die körperlichen Veränderungen, die während der ausgesetzten Nahrungsaufnahme mit ihm vor sich gehen, das launische Wetter in dieser unwirtlichen Gegend, seine Lektüren und die Erinnerungen an die Revolution auf dem Maidan im Winter 2013/14, an der er unmittelbar beteiligt war. Er porträtiert Mitgefangene und beleuchtet die Mechanismen eines brutalen und menschenverachtenden Rechts- und Haftsystems, in dem der betreuende Lagerarzt Senzows einzige vertrauenswürdige Stütze ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonar 33
Oleg Senzow, geboren 1976 in Simferopol auf der Halbinsel Krim, ist ukrainischer Autor und Filmemacher. Am 11. Mai 2014 wurde er mit drei weiteren Aktivisten wegen angeblicher terroristischer Handlungen vom russländischen Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen. Er wurde zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Menschenrechtsorganisationen schätzten das Verfahren und Urteil als politisch motiviert ein und stellten gravierende Verstöße gegen internationale Rechtsnormen fest. Im September 2019 wurde Senzow nach einem großen Gefangenenaustausch freigelassen und ist in die Ukraine zurückgekehrt.
Claudia Dathe, geboren 1971, studierte Übersetzungswissenschaft (Russisch, Polnisch) und Betriebswirtschaftslehre in Leipzig, Pjatigorsk (Russland) und Krakau. Nach längeren Auslandstätigkeiten in Kasachstan und der Ukraine arbeitet sie seit 2005 als literarische Übersetzerin und Kulturmanagerin. Sie übersetzt Literatur aus dem Russischen und Ukrainischen, u.a. von Andrej Kurkow, Serhij Zhadan, Ostap Slyvynsky und Yevgenia Belorusets. Im Jahr 2021 wurde sie für ihre Übersetzungen aus dem Ukrainischen mit dem Drahomán-Preis ausgezeichnet.
Aus dem Russischen von Claudia Dathe
HAFT
OLEG SENZOW
NOTIZEN UND GESCHICHTEN
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert im Rahmen des Programms »Neustart Kultur« aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie vom Ukrainischen Buchinstitut.
Ein Einblick in den Übersetzungsprozess von Claudia Dathe findet sich auf der Website von TOLEDO – Übersetzer·innen im Austausch der Kulturen (www.toledo-programm.de).
Originaltitel: Хроника одной голодовки, 4 с половиной шага
© Oleg Senzow, 2020
Originally published by Wydawnyztwo Staroho Lewa (The Old Lion Publishing House), Lwiw, Ukraine
Aus dem Russischen von Claudia Dathe
Sonar 33
Deutsche Erstausgabe
© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2021
Lektorat: Helge Pfannenschmidt
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Umschlagfoto: Eva Vradiy
Satz: Fred Uhde
ISBN 978-3-86391-292-5
eISBN 978-3-86391-327-4
www.voland-quist.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Chroniken eines Hungerstreiks. Tagebuch
Viereinhalb Schritte. Erzählungen
Glossar
Vorwort
Der Schriftsteller Andrej Kurkow schrieb in seinem Vorwort zu Oleg Senzows Buch »Leben« Folgendes: »Gewiss werden Ihnen beim Lesen dieses Buches Fragen kommen, die Sie dem Autor gern stellen würden. Rechnen Sie nicht so bald mit der Möglichkeit, diese Fragen auf einer Lesung in Berlin oder zur Frankfurter Buchmesse von ihm beantwortet zu bekommen.« Es war Februar 2019. Doch er sollte nicht recht behalten. Am 7. September desselben Jahres hat Oleg Senzow, verurteilt zu zwanzig Jahren wegen vermeintlichem Terrorismus, die Strafkolonie IK-8 (genannt Eisbär) im russischen Labytnangi am Polarkreis Gott sei Dank verlassen.
Als Oleg Senzow endlich freikam, war ich erleichtert, aber gleichzeitig aktivistisch schon sehr ausgebrannt. Ich hatte einfach genug von der Tänzerei vor den Botschaften und dem Überzeugen der Öffentlichkeit und Medien, dass Menschenrechte wichtig sind. Und dass wir Tschechen, jetzt, da wir frei sind, uns auch für die Welt und Menschenrechte interessieren können, dass es sogar unsere Pflicht ist. Als Senzow in März 2020 wegen des Filmfestivals »One World« Prag besuchte und ich ihn getroffen habe, ist mir trotzdem ein bisschen schwindlig geworden. Jemand, über den ich so viel nachgedacht habe, den ich nicht kannte und nie kennenlernen würde, verkörperte sich vor mir. Ein Verhältnis fast vergleichbar mit dem zu literarischen Figuren, um die man sich Sorgen macht und mit denen man sich freut, wenn es dazu einen Grund gibt.
Ich kenne Oleg Senzow nicht, ich habe nie mit ihm gesprochen, ich habe ihn also nie gefragt, ob er unsere Briefe bekommen hat und von unseren Demos wusste. Von der Dichterin und Fotografin Liu Xia, der Witwe des chinesischen Menschenrechtlers Liu Xiaobo, weiß ich, wie anstrengend es ist, durch die Welt zu reisen und sich überall bedanken zu müssen. Freiwilliger unbezahlter Aktivismus ist ja auch so eine Sache, die man nicht nur für die Welt tut, sondern auch für sich selbst. Und man soll es nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen.
»Haft« zu lesen ist für mich ein psychosomatisches Erlebnis – genauso wie damals die ganzen einhundertfünfundvierzig Hungertage durch Medien, soziale Netzwerke und vor allem durch die Informationen von Senzows Anwalt mitzuerleben. Es mag pathetisch klingen, aber ich erinnere mich bis heute daran, wie ich mich schämte, dass ich gegessen habe, etwas Kleines oder auch Großes, etwas Gutes oder auch nicht so Tolles, aber auf jeden Fall, dass ich esse. Und ER nicht. Was soll man dazu sagen?
Das Buch ist aus mehreren Gründen interessant. Erstens, man ist dabei. Man weiß, wie es ausgeht. (Er nicht: »Aber warten wir es erst einmal ab, eine Chance gibt es immer, für das Tagebuch und auch für mich.«) Trotzdem ist man buchstäblich körperlich davon bewegt. Die Schilderung davon, wie sein Körper langsam den Dienst versagt, ist einfach, aber sehr eindringlich. Zweitens, es passiert wirklich nicht viel, aber so ist es halt im Leben allgemein. Ich mag Texte, in denen nichts und gleichzeitig alles passiert, Texte, die einfach ein detailreiches Protokoll davon sind, was gerade passiert: »Es ist schwierig, die Wahrheit zu schreiben und erst recht die Wahrheit über sich selbst, aber ich werde mir Mühe geben.« Man ist dabei. Man lebt durch den Augenblick. Und das ist für mich Literatur.
Drittens finde ich spannend, dass Oleg im Gefängnis viel gelesen hat. Man ist durch die Lektüre seiner Chronik auch in anderen Chroniken: Murakami, Steinbeck usw. Die Notizen über seine Lektüre zeugen auch von der Masse der Zeit, die er dort verbringen musste. Einer Zeit, die normalerweise so kostbar ist. Im Gefängnis bekommt man aber plötzlich eine andere Beziehung zur Zeit. »Vier Monate Hungerstreik sind vorbei. Ich fühle mich wie in einem dunklen Wald. Woher ich komme und wohin ich gehe, wo der Weg ist – alles ist unklar. Ich bewege mich tastend weiter. Das Ziel und der Weg liegen hinter hohen umzingelnden Bäumen verborgen. Gehen muss ich dennoch – hier stehenzubleiben, würde erst recht zu nichts führen.«
Ich bin sehr glücklich darüber, dass Oleg Senzow Oleg Senzow geblieben ist – wenigstens meiner Meinung nach und nach allem, was ich verfolgen kann. Bei einigen befreiten politischen Häftlingen sieht man, wie Ruhm und plötzliche Macht sie verändern, sie wollen sich plötzlich auf Verhandlungen mit dem Teufel selbst einlassen. Senzow wusste, dass er ein Filmemacher ist, der Pech hatte und von Putins Regime als Terrorist bezeichnet wurde. Er macht jetzt weiterhin Filme und engagiert sich gleichzeitig für andere politischen Häftlinge. Er tut das, was er gut kann.
Am meisten bewegen mich an der »Haft« Kleinigkeiten: die Schilderung der Aufseher, die manchmal aus ihrer Rolle fallen, der Briefe, in denen sich Leute Senzow mit ihren Problemchen anvertrauen, der Wetterlage, die in Labytnangi am Polarkreis extrem ist und die Gesundheit des Häftlings zusätzlich angreift. Und die Schilderung der Träume. Eine Freundin und ich haben ja an alle möglichen ukrainischen sowie russischen politischen Häftlinge eine kurze Anleitung zur Traumdeutung geschickt. Und sofort muss ich daran denken, dass ich wieder einen Stapel von solchen Briefen schicken soll, und schäme mich dafür, dass ich es nicht schon längst getan habe.
Deswegen möchte ich mit demselben Plädoyer abschließen wie Andrej Kurkow: Schreiben Sie an die politischen Häftlinge. Und denken Sie nicht nur an die ukrainischen. Es gibt auch zahlreiche russische, weißrussische (und auch andere …), die Hilfe brauchen. Das ist das Wenigste, was ein Westeuropäer tun kann. Sich damit rausreden, das man nicht Russisch kann, funktioniert dank Internet nicht mehr. Und jetzt schreibe ich etwas, was Sie lieber nicht in die Briefe schreiben sollten: Героям слава! (Ruhm den Helden!)
TEREZA SEMOTAMOVÁ
PRAG, JUNI 2021
Chronik eines Hungerstreiks. Tagebuch
Ich habe nie Tagebuch geführt, noch nicht mal während der Pubertät, da machen das ja viele. Das hier ist mein erstes und wohl auch mein letztes Tagebuch. In vielerlei Hinsicht. Später möchte ich auch noch Aufzeichnungen machen, genauer gesagt Notizen zu konkreten Projekten. Das ist aber noch lange hin, im Moment sitze ich hier in der Zelle, also werde ich darüber nicht schreiben. Ich verrate meine Pläne sowieso nicht gern. Nicht etwa, weil ich so verschlossen oder gar wortkarg bin, sondern weil es mir einfach peinlich wäre, etwas anzukündigen, das dann nicht klappt, peinlich vor allem für mich selbst, und wenn alles gelingt wie angekündigt, wäre es für die anderen ja keine Überraschung mehr.
Den Entschluss, Tagebuch zu schreiben, habe ich am dritten Tag meines Hungerstreiks gefasst. Es ist schwierig, die Wahrheit zu schreiben und erst recht die Wahrheit über sich selbst, aber ich werde mir Mühe geben. Ich wollte immer lesbar, authentisch und interessant schreiben. Ob mir das bisher gelungen ist, weiß ich nicht, aber jetzt hält mich ja nun wirklich nichts ab. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee mit dem Tagebuch gekommen bin, da war ein erster Gedanke, dann gab es ein paar Sätze, es kamen weitere hinzu, neue Gedanken, und da habe ich beschlossen, alles aufzuschreiben, eigentlich war das gar nicht geplant. So ist das bei mir immer, zumindest bei den kreativen Dingen, aber eigentlich auch im normalen Leben. Der Autor existiert ja nicht getrennt von seinem Leben. Sein Schaffen ist ein Teil davon.
Nachdem ich meinen Entschluss gefasst hatte, habe ich lange überlegt, ob ich die beschriebenen Blätter verstecken oder ob ich offen damit umgehen soll. Ich habe mich für Letzteres entschieden, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich versuche, das Lager nicht so oft zu erwähnen, damit sie mir nicht vorwerfen, ich würde das Wach- und Sicherheitssystem der Anstalt beschreiben, und mir die Hefte unter diesem Vorwand wegnehmen. Ich werde mir Mühe geben, aber die Chancen, dass das Heft die Lagermauern überwindet und nach draußen gelangt, sind trotzdem ziemlich gering. Genauso wie meine, das zu erreichen, weswegen ich in den Hungerstreik getreten bin. Aber warten wir es erst einmal ab, eine Chance gibt es immer, für das Tagebuch und auch für mich. Weil ich weiß, dass das alles wahrscheinlich nie jemand lesen wird und dass die Sache womöglich ein trauriges Ende nimmt, schreibe ich authentischer. Wie es so schön in einem Lied von Jurij Schewtschuk heißt: »Je näher die Leute dem Tod sind, umso reiner ist ihr Herz.«
[…]
Tag 1
Um sechs Uhr morgens, nach dem Wecken, habe ich dem Beamten die Hungerstreik-Erklärung übergeben. Der ist wütend geworden und hat das Blatt Richtung Nachttisch geschleudert. Es ist allerdings nicht weit genug geflogen, sondern auf dem Boden gelandet. Milizionäre mögen es nicht, wenn jemand in den Hungerstreik tritt. Dann hat er mich in die Dienststube geschleift.
Der diensthabende Major ist auch erst mal ausgeflippt, hat sich aber dann zusammengerissen und einen auf verständnisvoll gemacht. Fünfzehn Minuten hat er mit mir überwiegend in Monologform gesprochen und ist zum Schluss auf die Ukraine gekommen, er stammt zwar ebenfalls von da, ist aber mittlerweile ein glühender Putin-Anhänger. Anschließend hat er mich zur Tür begleitet und mir mitgeteilt, ich solle meine Erklärung vor dem Frühstück abgeben und die Leute nicht am frühen Morgen schon verrücktmachen. Er hat sich natürlich geärgert, dass es ausgerechnet in seiner Schicht zu diesem Zwischenfall gekommen ist, alle ärgern sich, wenn in ihrer Schicht etwas Unangenehmes passiert, als würden am Jahresende dafür schlechte Noten verteilt. Also gut, das Frühstück ist um acht, dann warte ich eben so lange.
Ich wurde in die Abteilung zurückgebracht und um acht wieder in die Dienststube, da war die Natschalstwo, die Leitung, da, um mit mir zu reden. Also haben wir geredet. Als die Beamten hörten, dass ich – wenn auch utopische – politische Forderungen stelle, waren sie sichtlich erleichtert. Sie baten mich, eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass ich keine Beschwerden gegenüber dem Lager erhebe. Ich habe das abgelehnt: Meine Worte reichen ihnen nicht, sie brauchen unbedingt ein Papierchen, hinter dem sie sich verstecken können. In diesem System vertraut man niemandem, einem Knacki sowieso nicht, aber auch niemandem andern. Ich solle doch, schlugen sie mir vor, auf meinen Anwalt warten und die Entscheidung mit ihm zusammen treffen. Ich habe das abgelehnt: Meine Entscheidung ist gefallen, meinen Anwalt brauche ich dazu nicht. Sie wollten sich noch einmal vergewissern, dass ich keine Beschwerde gegen das Lager einreichen will. Ich bestätigte das ein weiteres Mal und verwies darauf, dass ich in den ganzen vier Jahren Haft noch keine einzige Beschwerde eingereicht hätte. Keine Ahnung, ob sie mir geglaubt haben, jedenfalls war das Gespräch zu Ende. Ich kam ins Stakan, das ist so ein vergitterter Käfig, in dem sie einen stehen und warten lassen. Ein Gitterkäfig in der Dienststube. Ich musste vier Stunden stehen. In der Zeit kam praktisch die ganze Leitung vorbei, einer nach dem anderen. Ein und dieselben Fragen und Antworten. Sie waren höflich, haben mir nicht gedroht, sondern mich nur vor den Folgen gewarnt, vor allem für meine Gesundheit. Haben mich beschuldigt, ich würde mit anderen Häftlingen ein Komplott schmieden und mit ihnen verdächtige Dinge anstellen. Haben behauptet, ich ließe mich ausnutzen. Darauf habe ich ihnen geantwortet, ich würde alles allein machen und ließe mich nicht manipulieren. Die stundenlangen Gespräche endeten alle mit demselben Dialog: »Wir haben dich nicht hier eingesperrt!« – »Ich kämpfe ja auch nicht gegen euch!«
So viele nette Milizionäre habe ich nicht mal in Fernsehserien über nette Milizionäre gesehen. Nach drei Stunden im Stakan bekam ich sogar einen Hocker. Natürlich sind die Vollzugsbediensteten in Gefängnissen und Lagern keine Milizionäre, aber die Häftlinge sagen trotzdem oft »Miliz«, wenn sie kein Jargonwort verwenden können. Irgendwann gegen Mittag haben sie mich gefilzt und in eine Einzelzelle gebracht. Das war zu erwarten, wer in den Hungerstreik tritt, wird isoliert. Damit der Hungerstreik auch tatsächlich korrekt durchgeführt wird und man den renitenten Geist in der Nähe hat, um ihn entsprechend zu bearbeiten. Bearbeiten werden sie mich nicht, so viel ist klar, aber sie werden auf mich einreden und warten, bis ich von selbst aufgebe.
Die Zelle kannte ich, nach der Ankunft im Lager war ich hier gleichzeitig in Quarantäne und in Einzelhaft gewesen, fünfzehn Tage lang. Ein kleines, einzeln stehendes Gebäude des Sicherheitsdienstes, im ersten Stock sind ein paar Büros, unten ein paar Zellen und die Kleiderkammer. Die Zelle ist geräumig, wie für ein Double, zehn Quadratmeter, für einen Einzelnen ein richtiges Gemach, bis jetzt hatte ich immer irgendwelche winzigen Einzelzellen. Die Ausstattung war Standard: hochklappbare Doppelpritsche, Tisch mit Sitzbank, Hockklo, Waschbecken, kleines Regal. Und natürlich eine doppelt vergitterte Tür und ein schmales, doppelt vergittertes Fenster mit einer kleinen Lüftungsklappe. In der Ecke lauerte wie eine Spinne das allsehende Auge der Videodauerüberwachung. Knast all inclusive. Der einzige – tatsächlich schwerwiegende – Nachteil war der zwar große, aber kaum wärmende Heizkörper, die Zelle war ein Eckraum und deshalb kalt. Wie gemacht für lästige Hitzköpfe, hier konnten sie ein bisschen abkühlen. Das war ja auch der Sinn der Sache. Ich bekam Kleidung von hier, die genauso aussah wie meine, nur älter war, und die gleiche warme Unterwäsche. Warum auch immer. So ist es vorgeschrieben. Eine Logik sucht man in diesem System sowieso vergeblich. Hier geht’s nicht nach dem gesunden Menschenverstand, sondern nach den IDB1.
Ich habe mich schnell eingerichtet. Wie gesagt, kenne ich die Zelle ja schon, bis jetzt habe ich weder meine noch irgendwelche anderen Sachen bekommen. Ich schlage die Zeit tot, wärme mich an der lauen Heizung oder gehe in der Zelle auf und ab. Der hiesige Schlüsselwart hat mir vor dem Einschluss eine Matratze und Bettwäsche gegeben. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der Schlüsselwart ist ein Häftling, der für die Verwaltung arbeitet, Sawchos und Aufseher in einem. Zertrümmerte Nase und Augen wie ein Folterknecht. Als ich vor einem halben Jahr hier in dieser Hütte2 saß, bin ich ihm zum letzten Mal begegnet. Dreizehn Jahre Knast, der hat alles gesehen. Er wollte wissen, warum ich das mache, er sucht nach verborgenen Motiven, Komplotts und den unweigerlichen Folgen. Sein Fazit am Ende des Tages: »Entweder bist du total bescheuert oder total schlau.«
Die Fressluke3 klappt zu. Einschluss. Ich lege mich in meinen Kleidern schlafen, ich habe den ganzen Tag gefroren. Der neue Ort, die Kälte, der Hunger, ich dachte, ich würde ewig nicht einschlafen, aber dann war ich ganz schnell weg.
1IDB für Interne Durchführungsbestimmungen von PWD, Prawila Wnutrennego Rasporjadka – die Regeln, an die sich der Gefangene zu halten hat. Hier und im Weiteren, falls nicht anders angegeben, die Anmerkungen des Autors.
2Zelle
3Kleines Fenster in der Zellentür zur Essensausgabe oder Kommunikation mit dem Wachdienst
Tag 2
Wecken ist immer um sechs. Draußen wirbelt Schnee, aber in der Nacht habe ich nicht gefroren, das ist gut, das hätte mir gerade noch gefehlt, dass ich vor Kälte nicht schlafen kann.
Alle zwei Stunden kommt ein Beamter und erfasst mit einem Registriergerät, dass ich anwesend und nicht geflohen bin. Schon seit ich hier bin, seit einem halben Jahr also, trage ich den roten Streifen für »Flieger«4. Tagsüber registrieren sie dich wach, mit dem Familiennamen und allem Pipapo, nachts schlafend, dazu wird eine kleine Lampe am Registriergerät eingeschaltet. Manche Beamten leuchten dich aus einem gewissen Abstand an, um dich nicht zu wecken, andere zielen absichtlich ins Gesicht, um das Gegenteil zu bewirken. Ein Milizionär ist dem anderen Feind. Außer der Registrierung gibt es noch die Kontrolle. In meiner Zelle, die offiziell als GH5 bezeichnet wird, geht die Kontrolle schnell: Ein Bediensteter kommt und kontrolliert innerhalb von einer Minute, dass du da bist, zweimal pro Tag, morgens und abends. Das hat gewisse Vorteile, wenn du nämlich in einer Baracke lebst, musst du mit dem ganzen Lager auf dem Platz in Reih und Glied antreten, mit Musik, und warten, bis alle durchgezählt sind. Das dauert ungefähr eine Stunde und ist ziemlich anstrengend, besonders bei minus 20 Grad und Wind. Bei unter minus 25 Grad findet die Kontrolle in den Baracken statt, das ist natürlich viel angenehmer, kommt aber nur selten vor, nur bei wirklich starkem Frost.
Es gibt noch ein weiteres obligatorisches Ritual: die Essensverweigerung, auch sie wird per Registriergerät erfasst, dreimal pro Tag. Und einmal pro Tag findet die obligatorische Durchsuchung statt. Das ist auch schon alles, den Rest des Tages habe ich frei und kann machen, was ich will, ich versuche vor allem, warm zu werden. Es ist nicht erlaubt, sich auf den Sack6 zu setzen oder sich gar hinzulegen, darüber wacht die unermüdliche Videokamera in der Zimmerecke. Und auch der Schlüsselwart ist immer in der Nähe, auf seinem Posten. Auch wenn man ihn den ganzen Tag nicht sieht, ist er doch im rechten Moment zur Stelle.
Nach der Morgenkontrolle kamen der Lagerleiter und der Menschenrechtsbeauftragte. Hoch im Rang, Dienstgrad Oberst. Wer von beiden mich nun bewachen und wer mich schützen soll, ist schwer zu erkennen. Der Natschalnik trägt jedenfalls eine Karakulmütze, und der sich angeblich für mich einsetzen soll, eine einfache Mütze. Das ist der einzige Unterschied. Mein scheinbarer Fürsprecher ist sogar mehr besorgt um das Lager als der eigentliche Chef, er sagt, der Hungerstreik sei eine Ordnungswidrigkeit, und erzählt mir was von Zwangsernährung. Ich antworte, Zwangsernährung, das ist, wenn man festgehalten und mit dem Löffel gefüttert wird, das gilt als Folter, in Frage käme höchstens eine medikamentöse Unterstützung für den geschwächten Organismus. Das haben wir ausführlich diskutiert. Wahrscheinlich endet die Freundlichkeit der Milizionäre mit dem Rang des Majors. Und denjenigen, die sich für meine Rechte einsetzen sollen, geht sie total ab. Die »Freundlichkeit« der Ersteren ist allerdings auch höchst zweifelhaft und höchstwahrscheinlich nicht von Dauer.
Gegen Mittag wurde ich zu meinem Anwalt gebracht. Wir unterhielten uns zwei Stunden lang konstruktiv, wie er sich ausdrückte. Er fliegt heute zurück, nimmt Briefe von mir mit und auch eine unverschlossene Notiz mit der Erklärung des Hungerstreiks und den dazugehörigen Erläuterungen. Und vor allem einen Brief an meine Tochter. Gestern Abend wurde mir der langersehnte Brief von ihr und meiner Mutter ausgehändigt, und da gebe ich meinem Anwalt gleich die Antwort mit, meine Tochter verreist ja demnächst, da würde sie die Antwort auf dem normalen Postweg womöglich nicht mehr erreichen. An meine Mutter schreibe ich heute Abend und schicke den Brief mit der normalen Post, sie ist ja zu Hause und freut sich immer, wenn sie Nachricht von mir erhält. Nachdem ich gestern Abend die Briefe bekommen und ein paar Mal gelesen hatte, fühlte ich mich allerdings ziemlich niedergedrückt. Plötzlich wurde mir klar, wie lang die Liste derer ist, die ich unglücklich gemacht habe, und dass das alles Menschen sind, die mir nahestehen, die Spalte derer, die ich glücklich gemacht habe, ist gähnend leer.
[…]
Der heutige Abend war viel angenehmer – ich bekam die Sachen, um die ich gebeten hatte, und dazu noch einen kleinen Fernseher, um den ich nicht gebeten hatte. Außerdem wurde mir ein Heizlüfter in Aussicht gestellt, da das Thermometer beim Messen in der Zelle nur 16,5 Grad zeigte. Nach den offiziellen Festlegungen ist das ein halbes Grad über Minimaltemperatur, also eigentlich alles im grünen Bereich. Aber sie wollen mich nicht frieren lassen, das freut mich natürlich. Wenn der Anwalt da ist, kennt die Freundlichkeit der Milizionäre keine Grenzen. Ich habe nichts dagegen.
Vor dem Einschluss habe ich mir die Nachrichten angesehen, sonst lief auf den zwei Kanälen, die die Kiste hat, nichts Interessantes, also bin ich ins Bett gegangen. Der Schlüsselwart hat mir einen kleinen Heizlüfter gebracht, und in der letzten Stunde vor der Nachtruhe wurde es in der Zelle ein bisschen wärmer, aber über Nacht hat er mir den Lüfter wieder weggenommen. Ich habe Wasser heiß gemacht und gierig getrunken. Als ich mich etwas erwärmt hatte, beschloss ich, meine Sachen auszuziehen und in der Thermowäsche zu schlafen. Das sollte sich als Fehler erweisen.
4Obligatorische Kennzeichnung eines Häftlings, bei dem Fluchtgefahr besteht; seine Anwesenheit wird alle zwei Stunden kontrolliert.
5GH für Gesicherter Haftraum von BM – Besopasnoje Mesto, eine normale Isolierzelle, in die Gefangene gebracht werden, wenn von anderen Gefangenen oder Bediensteten eine Gefahr für ihr Leben ausgeht, im Haftalltag werden die Zellen für die verschiedensten operativen Ziele genutzt.
6Gefängnisbett, Pritsche
Tag 3
Der Tag war verkorkst, schon allein wegen der Nacht. Die Gefängniskluft ist zwar dünn, aber offenbar hat sie gefehlt, damit ich halbwegs ruhig schlafen kann. Ich habe gefroren und bin ständig aufgewacht. Nachts bin ich irgendwie nicht auf die Idee gekommen, mich wieder anzuziehen. Stattdessen hatte ich das Bedürfnis, aufs Klo zu gehen. Ich bin zwar eigentlich nicht abrupt aufgesprungen, trotzdem wurde mir schwindlig und schwarz vor Augen, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, es war auch schnell wieder vorbei, aber das ist kein gutes Zeichen, vor allem weil es so früh auftritt, mit dieser Art special effects hatte ich jetzt eigentlich noch nicht gerechnet.
Am Morgen habe ich mir Wasser heiß gemacht und den Fernseher eingeschaltet. Abgesehen von den Nachrichten kam auch am Vormittag nichts Sehenswertes, und das würde bis zum Abend so bleiben. Diese dämlichen Serien und Shows finde ich schon lange zum Kotzen. Die Nachrichten waren auch nicht wirklich interessant, aber immerhin noch besser als der ganze andere Mist. Dasselbe wie gestern: Putin fährt in einem LKW über eine neue Brücke auf die Krim, wie symbolisch! Die Nachrichten auf dem zweiten Kanal unterscheiden sich nicht von denen auf dem ersten, als hätte man sie einfach übernommen, nur die Szenen wurden hier und da getauscht und anders geschnitten, aber Putin hinterm Steuer ist überall Szene Nummer eins. Ansonsten im Wechsel Lobhudeleien auf Russland und Wut auf den Westen und die Ukraine. In den vier Jahren im Lager habe ich gelernt, aus dieser Flut von Schmutz und Lüge winzige Bröckchen an Wahrheit herauszufiltern, aber das ist eine sehr mühsame Beschäftigung. Zum Glück gibt es noch Zeitungen und Briefe, um wenigstens irgendetwas Substantielles und Reales zu erfahren. Wie lange wird sich dieser Berg aus falschen Informationen wohl noch halten? Ich hatte damit gerechnet, dass er einstürzt und seine Schöpfer unter sich begräbt, aber nein, den Nachrichten nach zu urteilen, wächst er weiter zur schönsten Zufriedenheit. Die einzige nützliche Information kam in der Laufzeile, dass nämlich heute Jurij Schewtschuk Geburtstag hat, der nämliche, den ich neulich zitiert habe. Es finden sich eben doch überall unerklärliche und unsichtbare Verbindungen. Wie dem auch sei – herzlichen Glückwunsch, Jurij! Danke, dass es dich gibt. Aber das war’s auch schon mit den guten Nachrichten.
Nach den morgendlichen Kontrollen und Registrierungen kam wutschnaubend der Diensthabende, genau der, der als erster von meinem Hungerstreik erfahren hatte und an dem Tag recht freundlich und höflich gewesen war. Aber die Freundlichkeit eines Milizionärs währt nicht ewig, vor allem wenn der Anwalt gerade abgereist ist. Er nahm den Fernseher und ein paar andere Sachen mit und klappte die Pritsche hoch. Vor allem aber beschlagnahmte er auch den Wasserkocher! Auf den Fernseher und den anderen Kram lege ich keinen großen Wert, aber der Wasserkocher? Schließlich ist das meine einzige Quelle für warmes Wasser und Wärme! Den Heizlüfter habe ich schon abgeschrieben, aber das heiße Wasser? Der Beamte zischte, ein Wasserkocher stünde mir nicht zu, ich sei ja im Hungerstreik. Wie immer entbehrt das jeder Logik, denn sogar in dem Reglement, das an der Zellentür zu lesen steht, ist der Wasserkocher in der Liste der erlaubten Gegenstände aufgeführt. Aber viele Milizionäre kennen das Reglement entweder gar nicht oder legen es nach eigenem Gutdünken aus. Es war sinnlos, sich mit ihm anzulegen, als Reaktion ließ der Bedienstete seine Augen umherschweifen, um zu prüfen, was er in der ohnehin spärlich ausgestatteten Zelle noch konfiszieren könnte. Was soll’s, ich werde mich später an einen zugänglicheren Beamten wenden, außerdem darf der Schlüsselwart mir auf mein Verlangen hin heißes Wasser machen. Das ist nicht ganz so einfach, ich bitte nicht gern um etwas, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber das ist alles unerheblich. Das Herz und der Schwindel machen mir mehr Sorge. Die Pumpe will nicht recht, das spüre ich, und das schon am Anfang des Marathons.
Am Nachmittag wurde ich in den Krankentrakt gebracht. Der leitende Arzt, im Rang eines Oberstleutnants, ist ganz in Ordnung, hat aber seine Grillen. Das ist ja bei Ärzten nicht so selten. Von nun an muss ich mich täglich dieser Untersuchung unterziehen. Puls und Blutdruck liegen noch im Normalbereich, allerdings an der unteren Grenze. Es wurden Proben genommen. Das Blut strömte nur langsam aus dem angepiksten Finger – das Herz hatte tatsächlich Mühe. Im Urin war bereits Azeton nachweisbar, und der Arzt hatte gleich etliche schaurige Storys parat: wie der Organismus langsam das körpereigene Eiweiß abbaut, über irreversible Prozesse, über die individuellen kritischen Schwellenwerte. Nach seinen Abschreckungsversuchen kam er auf die Politik zu sprechen, und eine halbe Stunde später war er wenig überraschend bei der Ukraine gelandet. Ich habe es längst aufgegeben, irgendwelche Argumente anzuführen; wenn mir irgendwann das Wort erteilt wird, beschränke ich mich auf ein konstatierendes: »Wir werden sehen.« Dem lässt sich kaum widersprechen, und auch der Oberstleutnant, der gerade seine fünfte Zigarette aufrauchte, widersprach nicht, obwohl seine eindeutig russophile Position mit einem gewissen Hang zum Orthodox-Imperialen vielleicht sogar interessant gewesen wäre. Aber ganz gewiss nicht für mich – von Psychiatrie habe ich keine Ahnung.
Zum Schluss musste ich noch auf die Waage. 84 Kilo ohne Kleidung. Noch ein Kilo drauf für die letzten drei Tage. Dann habe ich den Hungerstreik also mit 85 Kilo begonnen. Mmh, das ist mein Minimalgewicht, so viel habe ich in meiner mageren Jugend gewogen und manchmal im Gefängnis. Normalerweise wiege ich 90, bei regelmäßigem Training im Fitnessstudio durchaus auch 95. Mein Gewicht ist Substanz, ich hatte nie überflüssige Pfunde und Fett schon gar nicht. Ich habe mich auf den Hungerstreik vorbereitet, indem ich auf alle zusätzlichen Rationen aus dem hiesigen Kiosk verzichtet und mich im letzten Monat nur noch von Balanda ernährt habe, damit mir der Wechsel in den Hungerstreik nicht schwerfällt. Und tatsächlich habe ich gar keine Probleme: Der Magen rebelliert nicht, und ich habe überhaupt kein Hungergefühl. Allerdings treten Schwindel, Schwäche und Ohrensausen auf. Ich spüre, wie das Herz schlägt. Vielleicht hätte ich eine andere Taktik wählen sollen – lieber zunehmen, damit ich etwas zum Zusetzen habe? Ich hatte allerdings keinen Ernährungswissenschaftler, den ich hätte zu Rate ziehen können. Aber jetzt ist es sowieso zu spät: Der Rubikon ist überschritten, unsere Armeen stehen auf der anderen Seite, aber bis nach Rom ist es noch ein ordentliches Stück, ohne Kampf geht’s gewiss nicht ab …
Tag 4
Das wichtigste Ereignis des Tages: Ich bekam Bettruhe verordnet. Ich darf mich also jetzt auch tagsüber auf die Pritsche legen. Ich wusste, dass das irgendwann kommen würde, hatte aber nicht so zeitig damit gerechnet. Beim Hungerstreik ist das eine große Unterstützung: Man kann sich aufwärmen und ausruhen, spart Energie und Wärme und muss nicht die ganze Zeit auf der kleinen Bank sitzen und sich an den lauwarmen Heizkörper pressen oder sich mit dem Abschreiten der Zelle warmhalten.
Aber das geschah erst gegen Mittag. Am Morgen, als ich meine Matratze in den Flur trug und die Doppelpritsche hochklappte, merkte ich, wie schwach ich war. Ich merkte, dass mir das von Tag zu Tag schwerer fallen würde. Wie hatte ich nur früher 100 Kilo schwere Hanteln gestemmt? Und jetzt ist plötzlich alles anders: Ich muss die Matratze nicht mehr in den Flur tragen und auch die Pritsche nicht mehr anheben – ich kann schlafen oder rumliegen, so viel ich Lust habe. Allerdings werde ich versuchen, nicht unnötig viel Gebrauch davon zu machen, sonst kann ich nachts nicht mehr schlafen und wache zerschlagen auf, um dann tagsüber wieder zu schlafen, und dann ist der ganze Rhythmus kaputt. Ein paar Stündchen habe ich tagsüber dann doch gelegen und bin auch eingeschlafen. Ich habe von meinem Vater geträumt, er stand neben seinem roten Moskwitsch, und ich saß in meinem vorletzten Peugeot. Die Bremsen waren kaputt, und ich konnte nicht neben ihm einparken, mein Vater schaute gar nicht zu mir, stattdessen stand er an einem Kiosk und unterhielt sich. All das passierte in meinem Dorf, an der Kreuzung der Straße, die von der Garage, in der mein Vater arbeitete, zum Kindergarten führte, in dem meine Mutter beschäftigt war. Irgendwann hatte ich das Steuer wieder unter Kontrolle und parkte weiter oben ein, neben anderen Autos, nicht an dieser gefährlichen Einmündung. So war der Traum. Kurz, aber klar wie die Wirklichkeit. Wenn man mit Toten spricht, ist das ja angeblich kein gutes Zeichen, aber wir haben uns nicht unterhalten, er hat mich nicht einmal angeschaut.
Die gesundheitlichen Probleme werden nicht mehr lange auf sich warten lassen, aber heute fühle ich mich besser – langsam gewöhnt sich der Organismus an den Nahrungsentzug. Der Schwindel hat etwas nachgelassen, allerdings laufen die Zehennägel bisweilen blau an. Vielleicht kommt das von der Kälte, vielleicht ist es auch das Herz, das es nicht schafft. Ich musste wieder zum Arzt. Der hat den Blutdruck gemessen und sich gewundert, dass ich so kalte Hände habe. Bei mir in der Zelle hätte er auch kalte Hände, habe ich ihm erklärt, im Sprechzimmer sind 22 Grad, er sitzt im T-Shirt da. Heute hat er mir von seiner Heimat in Tadschikistan erzählt. Er ist zwar Russe, stammt aber von dort. Es ging um den Bürgerkrieg, der dort schon seit zehn Jahren tobt und von dem ich nichts wusste.
[…]
Draußen schneit es wieder. Schnee im Mai ist für mich, der ich aus dem Süden komme, ein absurder Anblick, um diese Zeit ist es bei uns schon richtig heiß, und die Erdbeeren sind reif. Dann war der Otrjadnik da, der Chef von meiner Abteilung, Hauptmann, ein netter Typ. Am ersten Abend hatte er mir die beiden Briefe von meiner Familie gebracht. Heute habe ich ihm den Antwortbrief an meine Mutter übergeben, dann musste ich ein Papier unterschreiben, in dem ich erkläre, dass ich im Fall der medizinischen Indikation zwangsernährt werde. Wir haben zusammen im Strafgesetzbuch der Russischen Föderation gelesen, die entsprechenden Paragrafen diskutiert, und er hat meine Version bestätigt: Tropf – ja, Einführung von Nahrung in den Mund – nein. Ich wollte ihm noch sagen, dass es, wenn alle Milizionäre so wären wie er, wahrscheinlich weniger Verbrecher gäbe. Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen. Das nächste Mal dann.
Tag 5
Die Nacht war übel. Weil ich gestern tagsüber ein paar Stunden geschlafen hatte, habe ich lange wachgelegen, und außerdem hatte ich schrecklich kalte Füße. Ich hatte zwar Socken an und lag unter der Decke, trotzdem sind die Füße zu Eisklumpen erstarrt. Vielleicht schafft es das Herz nicht, das Blut bis dahin zu pumpen, vielleicht liegt es auch an der Kälte, die Hände sind jedenfalls unter der Decke warm geworden und waren nicht mehr blau. Ich glaube, wenn ich liege, macht die Pumpe besser mit, dann ist es nicht so anstrengend wie im Sitzen oder Stehen. Als ich nachts mal rausmusste – aufgesprungen bin ich eigentlich nicht –, ist mir schlecht geworden, so ein Flimmern wie kurz vor der Ohnmacht. Ich habe es nur mit Ach und Krach wieder zurück ins Bett geschafft. Halb so schlimm, danach konnte ich mich ja ausruhen.
[…]
Halb sieben erschienen der Diensthabende und der Suppenkapo7 und brachten mir meine Ration direkt in die Zelle. Meine dreimal täglich auf dem Registriergerät erfasste Verweigerung der Essensaufnahme genügte nicht mehr, sie beschlossen, mich zu versuchen wie Jesus. Auf meine Frage, was dieser Zirkus solle, hieß es: »Das Essen wird dir zugeteilt, ob du es isst, ist deine Sache. In zwei Stunden holen wir es wieder ab.« Na, wenigstens nicht erst in zwei Tagen. Sie denken, der Anblick des Essens lässt mich schwach werden. Die Balanda verströmt keinen allzu starken und appetitlichen Geruch, außerdem habe ich Schnupfen, weil es in der Zelle so kalt ist, der Geruch ist also gar kein Problem. Damit mich das Essen auf dem Tisch, an dem ich sitze, lese und schreibe, nicht stört, stelle ich es weg, auf die obere Liege, direkt unter die Videokamera. Der Sack ist übrigens sehr gut, er ist lang, aus Winkelstahl geschweißt und hat eine Holzauflage. Wie praktisch! Trotz meiner Größe habe ich genug Platz, und er ist nicht kalt. Alle Zellen, in denen ich bislang saß, auch die Einzelzellen, hatten Eisenbetten, die kurz und unbequem waren. Auf denen schläft man miserabel und friert sich alles Mögliche ab, zumal die Matratzen in den Arrestzellen und Durchgangsgefängnissen furchtbar sind. Damit verglichen ist das hier schon fast ein königliches Lager.
Seit dem zweiten Tag, an dem ich meine Sachen einschließlich zweier Bücher bekommen habe, lese ich Murakami. Ich mag den Autor, habe schon viel von ihm gelesen und fand das meiste gut. Das jetzige Buch heißt »Die Chroniken des Aufziehvogels«. Murakami hat einen unnachahmlichen Stil, er schreibt einfach, im Wesentlichen über den Alltag, das Leben, die Beziehungen, ein bisschen Mystik und Philosophie sind auch dabei. Das ergibt einen coolen Mix. Hemingway schreibt auch einfach, aber seine Einfachheit ist anders, irgendwie rau, wie eine abgetragene Armee- oder Jägerjacke. Murakamis Einfachheit erinnert eher an das Hemd eines Schülers, Studenten oder kleinen Beamten. Habe ich eigentlich einen Stil, und wie ist er? Sein eigenes Schaffen kann man ja selbst nur schwer beurteilen. Ich bin ziemlich selbstkritisch, aber ich schreibe trotzdem weiter, wahrscheinlich weil ich einfach Spaß daran habe. So wie auch jetzt: Ich hatte mir das mit dem Tagebuch gar nicht vorgenommen und habe trotzdem angefangen, und eigentlich geht es ja ganz gut, wie gut, ist schwer zu sagen, aber vielleicht auch nicht nötig. Aber wie nenne ich denn nun mein Werk? »Tagebuch eines Hungerstreiks« oder »Chroniken eines Hungerstreiks«? Der erste Titel ist genauer, der zweite schöner. Sollen doch die Lektoren entscheiden. Wenn der Text überhaupt bei ihnen ankommt. Wenn ich es wirklich bis zur Redaktion des Textes schaffe, werde ich nichts mehr ändern, es kann ruhig so bleiben, wie es ist, das ist dann authentischer und ehrlicher.
Der tägliche Gang zum Krankentrakt. Ich habe es nicht weit, nur bis ins Nachbargebäude, eine halbe Minute. Draußen scheint die Sonne, die Temperaturen steigen spürbar. Der Polarwinter geht zu Ende. Vielleicht wird es dann auch in meinem Verlies wärmer. Gewichtskontrolle, Puls, Blutdruck, eine weitere Urinprobe. 82 Kilo, Azeton und Eiweiß im Urin. Der Kommentar des Arztes: »Nichts Außergewöhnliches«, alles wie erwartet, so ist es nun mal im Hungerstreik. Er wollte wissen, wofür ich zwanzig Jahre bekommen habe. Eine gute Frage. Das würde mich auch mal interessieren.
Hin und zurück werde ich vom DGLL8 begleitet. Er kontrolliert auch alle zwei Stunden die Anwesenheit und steht dem feierlichen Auftragen der Tagesration und deren Abtragen zwei Stunden später vor. Dieser Vorgang hat heute Formen eines Rituals angenommen. Der Suppenkapo, der an der Essenausgabe normalerweise nicht mal den Buschlat ablegt, schlüpft jetzt in eine weiße Uniformjacke – wie ein richtiger Koch –, und in diesem Aufzug trägt er unter der Aufsicht des Diensthabenden den Teller in die Zelle. Gefängnis-Feng-Shui oder Zirkus mit Pferdenummer. Wenn jetzt nur noch der DGLL, der in seiner Schicht eigentlich für das ganze Lager zuständig ist, zu mir Zutritt hat, wird die Sache langsam ernst. Offenbar ist die Miliz unzufrieden und zieht die Zügel an. Über Funk bringen sie jetzt jeden Tag einen einstündigen Vortrag zu den Internen Durchführungsbestimmungen, das hat es in den letzten Tagen nicht gegeben. Das Hin und Her mit dem Wasserkocher geht indessen weiter. Ein anderer Vollzugsbeamter hat auf meine Nachfrage bezüglich des konfiszierten Wasserkochers mit dem Verweis auf eine Verfügung der Leitung reagiert. Obwohl er ganz genau weiß, dass das eine Regelverletzung ist. Dieses System hat ein distinktives Merkmal: Wenn es einen Fehler gemacht oder eine offensichtliche Dummheit begangen hat, rudert es nicht zurück, sondern hält verbissen an der Entscheidung fest, woraus neue Fehler und Dummheiten resultieren, und zwar auf allen Ebenen, egal ob es nun um den Wasserkocher geht oder um eine zwanzigjährige Haftstrafe. Zum Glück kriege ich vom Schlüsselwart wenigstens immer mein heißes Wasser, manchmal ist es allerdings nur lauwarm, weil er nicht versteht, dass ich das Wasser nicht nur trinken, sondern mich auch daran wärmen will. Ich habe versucht, ihm das zu erklären, aber er ist im Moment nicht scharf auf ein Gespräch mit mir – er spürt, dass sich da über mir was zusammenbraut, also verschwindet er so schnell wie möglich in seinem unterirdischen Labyrinth.
7Häftling, der in der Kantine arbeitet und die Balanda austeilt.
8DGLL für Diensthabender Gehilfe des Lagerleiters von DPNK – Deschurnyj Pomoschtschnik Natschalnika Kolonii
Tag 6
Die Nacht war wieder nicht gut, ich konnte lange nicht einschlafen und bin immer wieder aufgewacht. Vor Kälte. Die Füße sind bis zum Morgen überhaupt nicht warm geworden. Der Allgemeinzustand hat sich allerdings etwas verbessert, der Schwindel hat nachgelassen, das Ohrensausen klingt nicht mehr wie das Heulen eines Flugzeugs im ständigen Startmodus. Außer dem Herz, das regelmäßig Signale ans Gehirn sendet, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, machen sich jetzt auch die Nieren bemerkbar, die vor allem auf den Rücken ausstrahlen. Die Fußsohlen sind eiskalt. Oft auch die Hände. Die Knie erinnern sich an das chronische Rheuma und knacken wie bei einem alten Mann. In der Leiste hat sich ein bohrender Schmerz eingestellt, entweder sind das die Gelenke oder die Lymphknoten, es ist noch nicht klar. Der Magen grummelt von Zeit zu Zeit unzufrieden. Das Gehirn sendet daraufhin ermutigende Signale an die Organe: Haltet durch, das muss so sein, alles wird gut. Und so sind eigentlich alle ganz gelassen. Das Unterbewusstsein spielt langsam verrückt, es spürt, dass seine Zeit gekommen ist, wenn nämlich einer der wichtigsten Instinkte – der Hunger – die Oberhand gewinnt, dann kann es das Bewusstsein von der Führung verdrängen. Noch ist es nicht so weit, und ich hoffe, dass es noch ein bisschen dauert. Jetzt aber flutet das hinterhältige Unterbewusstsein das Gehirn mit Essenspropaganda und bombardiert es mit verschiedenen Bildern von Speisen, die der Körper irgendwann in seinem Leben zu sich genommen oder auch einfach nur gesehen hat oder es erfindet einfach irgendwas unglaublich Leckeres. Noch zeigt das keine Wirkung. In einem Menschen hausen viele Dämonen, die ihm ständig ihren Willen aufzwingen wollen. Ich habe die gefährlichsten dieser Gesellen längst vertrieben, die anderen müssen nach meiner Pfeife tanzen. Aber vielleicht nutzen sie die Situation jetzt aus und nehmen Rache. Mal sehen. Die Versuchung mit dem Essen, das fast den ganzen Tag bei mir in der Zelle rumsteht, funktioniert jedenfalls nicht.
Die Miliz pflegt nun mir gegenüber einen distanzierten Ton, außer zum Diensthabenden habe ich keinerlei Kontakte – wenn ich im Lager unterwegs bin, werden alle Hofkäfige9 eingefroren und alle Personen angehalten.
Heute habe ich die Zelle geputzt. Bislang stand das jeden Tag auf dem Plan, und einmal in der Woche war Großreinemachen, aber jetzt beschränkte ich mich auf ein paar Mal pro Woche – es ist irgendwie dämlich, auf allen Vieren mit dem Lappen über den Boden zu kriechen, Energie ist wichtiger als absolute Sauberkeit. Dabei habe ich auch die Fensterklappe geöffnet, um zu lüften, das mache ich sowieso mehrmals am Tag. Ich brauche immer frische Lust, in Kälte und Muff zu hocken, ist doppelt belastend.
Am Morgen hat sich das Wetter wieder verschlechtert: Nebel, Sprühregen, Nässe. Der Norden. »Bei uns ist es drei Monate im Jahr kalt, und der Rest ist voll für’n Arsch«, wie es ein Typ von hier neulich beschrieb.
Das Auftragen des Essens hat sich vollends zu einem Ritual entwickelt. Der Diensthabende öffnet die Tür und verkündet feierlich, dass die Zeit gekommen sei, das Essen einzunehmen. Der Suppenkapo in Weiß trägt die Speisen herein und stellt sie auf den Tisch. Beide Seiten verabschieden sich höflich, und die »Gäste« ziehen sich zurück. Ich hebe den Teller auf die obere Pritsche – weg von mir, direkt vor das allsehende Auge. Wenn ich das Brot und den Teller mit dem Brei oder der Suppe anfasse, habe ich komischerweise nicht das Verlangen, das zu essen. Das hat sicher mit meinem festen Vorsatz zu tun oder kommt daher, dass der Hungerstreik noch nicht allzu lange dauert. Wir werden sehen. Der Allgemeinzustand hat sich heute übrigens stabilisiert, nur im Mund hatte ich plötzlich einen unangenehmen Geschmack – vielleicht verdaut sich der Magen mittlerweile selbst. Zwischen Gürtel und Bauch hatte am Anfang der Woche nur der Mittelfinger Platz, mittlerweile passt die ganze Faust dazwischen.
Ich bin heute in die Banja gegangen. Nicht allein natürlich, sondern in Begleitung des Diensthabenden, die Häftlinge sagen immer von sich »bin gegangen« oder »bin gefahren«, wenn sie doch eigentlich gebracht oder gefahren wurden. Eine Illusion von Selbstständigkeit. Banja ist freilich eine Übertreibung – es ist ein größerer Waschraum mit zwei Dutzend Kannen und Bänken. Wenn sich hier eine ganze Truppe wäscht, gibt es Schlangen und ein riesiges Gedränge. Aber ich war allein. Getrennt von den anderen. Ich hatte zwanzig Minuten, um zu duschen. Das ist gut, mancherorts kriegt man nur fünfzehn Minuten, manchmal sogar nur zehn. Zehn Minuten Hochgenuss unter dem heißen Wasser. Ich habe mich geduscht und die Unterwäsche gewaschen. Mein Körper war dankbar, besonders meine Beine. Am Ende war mir ein bisschen schwindelig, das ist aber nicht so schlimm.
Danach habe ich mich gleich noch rasiert. Der Klingenwart hat mir meinen Rasierer und die Rasiercreme ausgehändigt – das hat er nämlich alles in Verwahrung, damit ich mir nicht aus Versehen die Pulsadern aufschneide. Beim Rasieren habe ich mich zum ersten Mal in dieser Woche im Spiegel angeschaut. In der Zelle gibt es nur einen kleinen Spiegel, der über dem Waschbecken in die Wand eingelassen ist, ziemlich weit unten, ich muss mich bücken, wenn ich mich darin sehen will. Weil ich so groß bin und sowieso nicht gern in den Spiegel schaue, habe ich hier in der Zelle noch gar keinen Blick hineingeworfen. Noch nicht einmal beim Zähneputzen. Obwohl ich keinen Zahnbelag habe, putze ich meine Zähne zweimal täglich, denn unter diesen Umständen verliert man schnell mal einen Zahn, diese Erfahrung musste ich vor Kurzem machen, und die Zähne wachsen ja leider nicht nach. Mein eigener Anblick war natürlich nicht sehr erfreulich: Die Backenknochen sind hervorgetreten, die Wangen eingefallen und zu Flecken geworden, die Augen liegen tief in den Höhlen, Falten haben sich in die Stirn gegraben, und die Stirn selbst ist nicht nur von geschwollenen Adern bedeckt, nein, sie drängt auch den Haaransatz zurück. Die Haare weichen, langsam und unweigerlich, und lassen nach dem Kampf nur kahles Terrain zurück. Nichts Erfreuliches, ich hätte mir den Anblick besser erspart. Ich musste daran denken, wie der Vater eines Freundes an Leberzirrhose erkrankt war und eines Tages mit seiner Familie zu uns zu Besuch kam. Alle unterhielten sich und lächelten ihm zu, als wäre nichts, als wüssten sie nicht, wie schlimm es um ihn stand. Auch er lächelte alle an mit seinem zahnlosen Mund im knochigen Schädel, nichts als die Augen waren ihm geblieben, und selbst die sahen so aus, als würden sie jeden Moment herausspringen. So weit war es bei mir zwar noch nicht, aber ich war schon auf dem besten Wege dahin.
9Kleine abgegrenzte Fläche vor einer Baracke, die für den Freigang, Appelle, Sport und andere Aktionen genutzt wird. »Alle Hofkäfige wurden eingefroren« bedeutet, dass sie abgeschlossen werden, falls sie offen waren, oder es wird untersagt, sie zu öffnen, das bedeutet, dass die Häftlinge für eine bestimmte Zeit nicht im Lager unterwegs sein dürfen.
Tag 7
Die Nacht verlief wie erwartet schlecht. Obwohl ich seit Langem in Unterwäsche und Häftlingskleidung schlafe und mich zudecke, friere ich, besonders an den Füßen. Die Decke ist eher ein dicker Überwurf, aber egal. In der Nacht macht sich noch ein weiterer Störfaktor bemerkbar. Die Zelle hat eine typische Gefängnistoilette: ein Loch im Boden, das mit einem Stöpsel an einer Schnur verschlossen wird, das Wasser kommt aus dem Waschbecken, was keine glückliche Konstruktion ist, und nicht vom Spülkasten über ein Rohr, wie es eigentlich sein sollte. Das wäre nämlich besser, effizienter. Aber der Spülkasten ist alt, die Konstruktion marode, er gibt ständig traurige Töne von sich: tropf, tropf oder energischer: klatsch, klatsch. Tagsüber hört man das so gut wie gar nicht, und es stört auch nicht. Auch wenn man schläft, hört man es nicht. Aber wenn man nachts wachliegt, gehen einem die Geräusche auf die Nerven. Reparaturversuche bringen auch keinen dauerhaften Erfolg. Der Kasten ist fünf Minuten still, und dann beginnt sein monotones Lied von Neuem. Manchmal stellt er seine Lebenszeichen von selbst ein, aber das hält meist nicht lange an.
[…]
Der Morgen begann wie gewöhnlich. Es ging mir ganz gut, aber ich fühlte mich sehr schwach. Ich schaffte es kaum, mein Bett zu machen, die Zähne putzte ich mir im Sitzen. Vielleicht würde es tagsüber besser werden, wenn ich erst mal in Schwung gekommen war. Als ich mich wusch, stach es in meinem Augenwinkel, eine harte Borke. Ich schaute in den Spiegel, und so war es auch: Das rechte Auge war ganz rot. Eine Bindehautentzündung als kleiner Bonus zu allem Übrigen. Wo habe ich mir die denn eingefangen? Ich hatte doch eigentlich die ganze Woche mit niemandem weiter Kontakt, und auf Sauberkeit achte ich auch unter allen Umständen. Ach, das geht schon vorbei, halb so schlimm.
Die Miliz hat das Servierritual um ein neues Element erweitert. Im Schlussteil. Der Diensthabende filmt den ganzen Vorgang mit seinem Registriergerät, und wenn der Suppenkapo das unberührte Essen an ihm vorbei aus der Zelle trägt, richtet er das Gerät auf den Teller und konstatiert: »Das Essen wurde nicht verzehrt.« Vorhang zu.
[…]
Ich lese immer noch Murakamis »Die Chroniken des Aufziehvogels«. Es gefällt mir. Ich mag Murakami und auch dieses konkrete Werk. Es gibt gute Bücher, die man verschlingt, und dann gibt es welche, die man langsam liest und sich das Vergnügen einteilt. Dieses Buch hier genieße ich langsam, Stück für Stück. Es ist ziemlich dick, und ich bin schon über der Hälfte. Ich merke, dass es diese Lektüre zu Wochenbeginn war, die mich dazu veranlasst hat, Tagebuch zu schreiben. Deswegen soll das Buch zu Ehren von Murakami »Die Chroniken eines Hungerstreiks« heißen. Da brauchen sich die Lektoren keine Gedanken mehr zu machen. Murakamis Protagonist hat im Übrigen drei Tage in einem trockenen Brunnen gesessen und gehungert und gefroren. Um sich selbst zu finden. Kommt mir bekannt vor. Gibt es tatsächlich jemanden, der glaubt, im Leben sei alles Zufall und ohne jeden Zusammenhang? Ich nicht. Der Hunger hat dem Protagonisten im Übrigen sehr zu schaffen gemacht, sein Magen hat gestochen und sich zusammengekrampft. Das ist bei mir nun überhaupt nicht der Fall, mein Magen ist ganz friedlich. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich einen gleitenden Übergang zum Hungerstreik hatte, mich vorbereitet und meine Ration immer weiter verkleinert habe? Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Ich habe viel vom Heilfasten gehört, es aber selbst nie ausprobiert, allerdings durchaus schon mit dem Gedanken gespielt. Und nun bietet sich mir die kostenlose Gelegenheit. Reinigung des Organismus, Ausscheidung von Schlacken usw. Schlacken habe ich zwar noch keine ausgeschieden, aber warten wir mal ab. Wir sollten die ganze Sache zunächst nicht als politisch motivierte Aktion betrachten, sondern als Kur! Wer ist dafür? Ich sehe keine Hände!
Tagsüber sind meine Füße nicht so kalt wie nachts unter der Decke, wahrscheinlich weil ich am Tag immer irgendwie in Bewegung bin. Ich habe die Fensterklappe geöffnet, um zu lüften. Die Luft draußen ist immerhin schon weniger stechend und eisig, warm würde ich sie aber auch noch nicht nennen. Der frisch gefallene Schnee auf den Wegen wurde weggefegt, ein Teil ist in der spärlichen Sonne getaut, aber in den Ecken türmen sich noch immer trübe, graue Haufen. Zwanzigster Mai. Angeblich kann es hier sogar im Juli schneien. Das möchte ich lieber nicht sehen.
Der unangenehme Geschmack im Mund wird stärker, außerdem fühlt sich die Mundhöhle trocken an. Das heiße Wasser hilft nur kurz. Leitungswasser möchte ich nicht trinken, außerdem ist es ungesund. Komischerweise hat schon etliche Tage keine Durchsuchung stattgefunden. Seit sie mir den roten Streifen für »fluchtverdächtig« aufs Namensschild geklebt haben, ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich nicht gefilzt wurde. Am Anfang, als ich in dieser Zelle hier saß, waren sie besonders eifrig: haben das Unterste zuoberst gekehrt, mich bis auf die Unterhose oder ganz nackt ausgezogen und gründlich abgesucht. Später, in der Abteilung, hat ihr Eifer etwas nachgelassen. Und jetzt kommen sie gar nicht mehr. Merkwürdig. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss.
Mein Traum von letzter Nacht ist mir wieder eingefallen, eigentlich ist es eher eine Aneinanderreihung verworrener Situationen ohne jeden Zusammenhang. Irgendwelche Leute, Autos, Busse, Züge, ich bin mit all dem unterwegs, allein, manchmal auch in Begleitung. Bahnhöfe, Gleise, Stationen. Ich sitze im Bus und habe die Füße auf der Rückbank gegen die Kopfstützen gelehnt. Meine Oma und meine Tante fahren auch mit, sie sitzen in einer anderen Reihe, meine Tante isst Eis, aber sie sehen ganz anders aus als meine richtigen Verwandten. Ich nehme die Füße herunter, weil sich das nicht gehört. Dann stehen wir auf dem Bahnhof an einem Gleis, meine Tante und meine Oma wollen sich in ihrem Tagebuch Notizen machen zu einem Jungen, der eben eine Heldentat vollbracht hat – er hat jemanden unter einem durchfahrenden Zug hervorgezogen. Der Junge und sein Vater stehen neben uns, aber einen Stift für die Notizen hat niemand. Obwohl um uns herum viele Leute stehen, springe ich über die Gleise auf den Nachbarbahnsteig, erkläre die Situation und frage einen vorbeilaufenden Hauptmann und seine Familie nach einem Stift. Dann springe ich zurück. Meinem Verhalten nach bin ich wohl in dem Traum auch noch klein. Für mich bergen Träume keine Zeichen und Omen. Sie haben eher etwas mit der Vergangenheit zu tun. Sind ein Mix aus Erinnerungen, durchlebten Gefühlen, verborgenen Gedanken oder Wünschen. Spannend sind Träume trotzdem.
Tag 8
Der achte Tag brach an. Wie in der Bibel oder bei Thornton Wilder. Die erste ruhige Nacht, ich habe fast gar nicht gefroren, sogar meine Füße sind warm geworden. Obwohl die Temperaturen in der Druckkammer und außenbords unverändert sind. Ich habe ganz gut geschlafen, nachdem ich erst lange wach lag. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was ich alles mit den Kindern koche, wenn wir wieder zusammen sind. Illusionen und Trost für Gehirn und Magen.
Mein Allgemeinbefinden ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Allerdings ist bei Weitem nicht alles verschwunden, was mir Sorgen macht. Weder die Schwäche noch der Schwindel noch das Ohrensausen noch der ganze andere lästige Kram, aber der Körper reagiert nicht mehr so stark, er hat sich daran gewöhnt. Er reagiert nur, wenn etwas Neues dazukommt oder vorhandene Beschwerden stärker werden, das ist aber im Moment nicht der Fall, also vorläufig Feuerpause an vorderster Front.
Eine Woche ist seit dem Beginn des Hungerstreiks vergangen. Wie lange werde ich durchhalten? Diese Frage interessiert sicher nicht nur die Milizionäre, sondern auch meine Unterstützer jenseits des Zauns und natürlich auch mich selbst. Wir werden sehen. »Wir werden sehen«, sang einst D’Artagnan in einem sowjetischen Film, »wer in welchen Kanonenstiefeln am Ende des Tages die Knie beugt.« Der Musikwart lässt im Flur den ganzen Tag Pop laufen. Nicht zum Aushalten. Ein Glück, dass es nicht so richtig bis zu mir dringt. Die ganze Woche kein einziger vernünftiger Song. Jetzt habe ich vage bekannte Töne gehört. Ich bin zur Tür gegangen und habe genauer hingehört. Das ist tatsächlich »Für die Wächter« von Boombox. Ein guter alter Song. Ich habe zugehört und mich nicht von der Stelle gerührt. Drei Minuten Vergnügen. Wie unterscheidet man einen guten Song von einem schlechten? Ein guter Song veraltet nicht. »Für die Wächter« ist nicht veraltet, kein einziger Takt.
Überhaupt bedeutet mir Musik sehr viel. Gute Musik. Die Lieder von Viktor Zoi haben meine Persönlichkeit wahrscheinlich stärker geprägt als alle Personen in meinem Umfeld zusammen. Deswegen kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn er schlecht gecovert wird. Ich kann mich noch erinnern, das war auf einem großen Filmfestival in Minsk, auf der Abschlussveranstaltung, da wollte ein bekannter russischer Schauspieler, der aus der Ukraine kam – als Programmhighlight – das geschätzte Publikum mit seinem stimmlichen Talent erfreuen. Mit seinem Talent war es nicht weit her, aber die Leute taten so, als gefiele es ihnen, schließlich war es die Abschlussgala, und danach würde es einen Empfang geben. Als er als drittes Stück »Gruppa krowi« von Zoi sang, verlor ich schon nach dem ersten falschen Ton die Nerven. Ich stand auf und ging raus. Das war gar nicht so einfach: ein riesiger Saal mit tausend Leuten, und ich saß in der zweiten Reihe in der Mitte, zwischen anderen Teilnehmern, die Hälfte musste zusammenrücken, um mich durchzulassen. Den Sänger brachte das nicht raus (obwohl: schlechter ging’s eigentlich gar nicht mehr); als ich über den breiten Mittelgang dem Ausgang zustrebte, setzte er noch einen drauf und sang mir verdrehte Zeilen einer weiteren Strophe hinterher. Keine schöne Erinnerung.
Es gibt auch schöne Erinnerungen, allerdings nicht mit Zoi. Nach einer schweren und schlaflosen Nacht im Arrest saß ich im Büro des Ermittlers im früheren Geheimdienst der Krim. Ich hatte gerade einen Anwerbeversuch abgelehnt und mich stattdessen für die zwanzig Jahre entschieden. Routiniert besiegelte der Ermittler das Protokoll und mein Schicksal, ich saß in Handschellen da und wartete darauf, in die Zelle zurückgebracht zu werden. Das Radio lief. Leise. Ein ukrainischer Sender, den man offenbar noch nicht abgeschaltet hatte. Da kam auf einmal »Wojnow sweta« von Ljapis. Die inoffizielle Hymne des Maidan. Hier, auf der Krim, die schon besetzt war, in meiner Situation. Als hätte mir jemand ein Zeichen geschickt: »Halte durch, Junge, alles wird gut.« Ich habe mich gleich besser gefühlt. Ich hatte niemanden verraten. Weder mich noch die anderen. Noch das Land, noch die hundert Jungs, die es seinerzeit auf der Instytutska erwischt hatte. Der Ermittler sagte, ich hätte mein Schicksal selbst besiegelt. Ich war der Meinung, dass ich die einzig richtige Entscheidung getroffen hatte. Und die Musik, die da aus den Lautsprechern kam, gab mir recht.
Ich war beim Arzt. Gewicht, Blutdruck, Puls, Temperatur – das Gewicht sinkt. Ich wiege noch knapp über 80 Kilo. Das Thermometer zeigt 36,2 Grad. »Du kühlst aus«, stellt der Arzt fest. Wir haben darüber diskutiert, bei welcher Raumtemperatur es sich am besten hungern lässt. Ich bin der Meinung, dass es sich im Warmen besser hungert, da der Körper keine zusätzliche Energie aufwenden muss, um die Temperatur zu halten. Der Arzt glaubt, man könne einen Hungerstreik bei Kälte besser durchstehen, dann würden sich nämlich die Stoffwechselprozesse im Körper verlangsamen, Anabiose und so. Was nun stimmt, ist unklar. Jeder bleibt bei Seinem: Er sitzt im T-Shirt in seinem warmen Sprechzimmer, ich in meiner eiskalten Zelle.
Der für die Rechtsaufsicht zuständige Staatsanwalt ist gekommen, hat sich von mir eine Erklärung der Gründe für den Hungerstreik geben lassen und meine Höhle und meine Krankenakte in Augenschein genommen. Die unwichtigen Dinge und Mängel habe ich in der Erklärung nicht erwähnt. Ich kämpfe nicht dagegen. Mein Hauptkampffeld ist woanders.
Tag 9
Das Leben stabilisiert sich langsam und läuft in gewohnten Bahnen. Die Tage folgen aufeinander wie eine kopierte Seite der anderen. So ist es immer in diesem System, wenn man an einem neuen Ort Fuß gefasst hat. Tagsüber fühle ich mich einigermaßen, nur die Schwäche macht mir zu schaffen, besonders morgens, es kostet mich Kraft, das Bett zu machen und die Zähne zu putzen. Nachts friere ich schon weniger. (Letzte Nacht habe ich allerdings wieder lange wach gelegen und mir vorgestellt, dass ich mit meinen Kindern eine Wanderung mache.)
Das Ritual des Auf- und Abtragens der Balanda wird ständig erweitert. Jetzt trägt der Suppenkapo außer der weißen Kochjacke noch Gummihandschuhe. In dem halben Jahr, in dem ich in der Kantine gegessen habe, konnte ich bei keinem seiner Kollegen je Handschuhe entdecken, ohne größere Sorgfalt wanderten da die Finger von einem Teller zum nächsten. Und plötzlich wird auf Etikette Wert gelegt. Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, und der Suppenkapo rückt in Kochmütze oder zumindest Barrett an.
Draußen ist Wind aufgekommen. Ein starker, kalter, schneidender Wind. Er rüttelt an der Scheibe, es klingt wie ein Stöhnen und Quietschen. Wer an einem großen Fluss im Norden lebt, weißt Bescheid. Wenn die Eisdecke reißt, wenn der Fluss aufbricht, wird eine große Menge Kälte frei, und dann bilden sich gegen Frühjahrsende starke Winde. So war es in Jakutsk, wo die Lena fließt. So ist es auch hier in Labytnangi am Ob. Der Wind weht eine Woche oder länger, und danach wird es warm. So haben mir zumindest die Einheimischen den Sachverhalt erklärt, und so ist es auch meistens. Wenn der Wind vorbei ist, wird es also endlich warm.
Das nächste Gespräch mit dem nächsten Leiter. Los ging’s ganz förmlich – Befinden, Beschwerden, Haftbedingungen, dann ging’s um banalere Dinge: Warum machst du das eigentlich, ändern kannst du sowieso nichts, du ruinierst dir bloß die Gesundheit, für immer und ewig usw. Dann kam wieder die Politik: Ein Saustall ist das da bei euch, die Ukraine fällt sowieso bald auseinander, du wirst doch nur ausgenutzt, solange sie dich brauchen, bist du gut genug, dann lassen sie dich fallen. Ich habe es aufgegeben, auf diese Floskeln irgendetwas zu erwidern, ich warte einfach, bis die übliche Tirade zu Ende ist. Dieser Mensch ist in seinem ganzen Leben noch nie in der Ukraine gewesen, war weder auf dem Maidan noch bei der Besetzung der Krim dabei und will mir als Experte erzählen, wie es dort wirklich aussieht. Das klassische Wissensrepertoire eines russischen Milizionärs, das sich aus der Rezeption lokaler Fernsehkanäle speist. Sogar 1:1 dieselben Formulierungen. Die ganzen vier Jahre, die ich hier bin, ein und dieselbe Leier. Noch ist die Ukraine allerdings nicht auseinandergefallen und noch hat mich niemand vergessen. Es steht also unentschieden. Wir beendeten unser Gespräch.
Ich war beim Arzt. Der hat mich zwei Tage nicht gesehen und sagt, ich sei eingefallen. »Du trocknest aus.« Er empfiehlt mir, mehr Wasser zu trinken. Was, noch mehr? Ich trinke ja schon sechs Tassen heißes Wasser pro Tag. Das sei zu wenig, sagt er, aber mehr schaffe ich nicht. Der Doktor ist sehr aufmerksam und fürsorglich, sogar einen Pickel auf der Stirn nimmt er ernst. Wie mir die Sonderbehandlung und Effekthascherei in diesem System auf die Nerven geht, um den einen springen alle rum und der andere muss sich die Pulsadern aufschneiden, damit er zum Zahnarzt darf, weil er die Schmerzen nicht mehr aushält. Gleichheit und Gerechtigkeit kannst du im Gefängnis voll vergessen.
Auf dem Weg »nach Hause« mischte sich Hagel in den Wind. Er flog fast parallel zum Boden und stach in die Augen. In Labytnangi ahnt wahrscheinlich niemand, dass die Leute woanders im Mai zum Picknick ins Grüne fahren.
Kaum habe ich an die Fressluke geschlagen, kommt der Wasserwart schon mit dem dampfenden Wasserkocher, er weiß immer schon im Voraus, was ich von ihm will. Er ist höflich und lächelt, aber auf persönliche Gespräche lässt er sich nicht mehr ein, offensichtlich hat er neue Anweisungen erhalten.