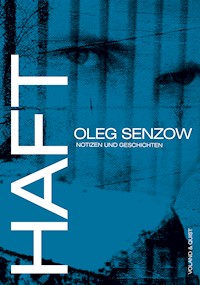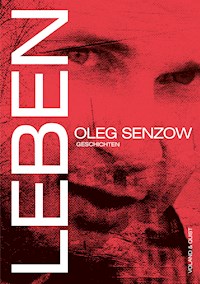
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Leben" erzählt Oleg Senzow von seiner Kindheit und Jugend. Die acht autobiografischen Geschichten zeigen "wie er zu dem furchtlosen Menschen wurde, der er heute ist." (Andrej Kurkow). Übersetzt wurden sie von Irina Bondas, Kati Brunner, Claudia Dathe, Christiane Körner, Alexander Kratochvil, Lydia Nagel, Olga Radetzkaja, Jennie Seitz, Andreas Tretner und Thomas Weiler. Mit einem Vorwort von Andrej Kurkow.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonar 28
Die Übersetzung entstand auf Initiative des Ukrainischen PEN-Zentrums (Translation Fund Grants) mit Unterstützung der International Renaissance Foundation.
© Oleh Sentsov, 2019
Originally published in 2015 by Laurus Publishing, Kiev, Ukraine, republished by Vydavnytstvo Staroho Leva (The Old Lion Publishing House), Lviv, Ukraine
Schule wurde erstmals publiziert in: Transit. Europäische Revue 48/2016, S. 172-180.
SONAR 28
DEUTSCHE ERSTAUSGABE
1. Auflage 2019
Verlag Voland & Quist, Berlin, Dresden, Leipzig, 2019
© der deutschen Ausgabe by Verlag Voland & Quist GmbH
Korrektorat: Annegret Schenkel
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Foto: Eva Vradiy
Satz: Fred Uhde
eISBN 978-3-86391-244-4
www.voland-quist.de
#FreeSentsov
#SaveOlegSentsov
OLEG SENZOW
LEBEN
GESCHICHTEN
Aus dem Russischen von:Irina Bondas, Kati Brunner, Claudia Dathe,Christiane Körner, Alexander Kratochvil,Lydia Nagel, Olga Radetzkaja, JennieSeitz, Andreas Tretner und Thomas Weiler
Inhalt
Andrej Kurkow: Zum Geleit
Der Hund
Kindheit
Krankenhaus
Schule
Letzter Wille
Meine Oma
Die Makars
Eine literarische Autobiografie
Oleg Senzow
Andrej Kurkow
Zum Geleit
Wäre die Situation um Oleg Senzow nicht so tragisch, man könnte düstere Scherze machen und sagen, das Gefängnis habe aus dem Filmregisseur einen Schriftsteller gemacht. Einen Film zu drehen ist eben schwierig, wenn du in einer Zelle hockst, im Gefängnis eines anderen Landes und noch dazu in dem, das der Grenze zu deiner Heimat, die von diesem Land überfallen wurde, am fernsten liegt, in einem Gefängnis dieses Aggressors.
In Wahrheit aber hat Oleg Senzow schon Prosa geschrieben, bevor er Filme gemacht hat. In Wahrheit nämlich hat er schon immer den Wunsch verspürt, ein Künstler oder Erfinder zu sein – und er wollte von Kind an ein ehrlicher Mensch sein und war bedacht auf seinen Ruf. Er verzichtete dafür sogar auf gute Zensuren in der Schule, wenn sie nicht verdient waren. Denn das Kostbarste für einen Künstler ist sein guter Ruf! Von der Begabung einmal abgesehen.
Zur Konkretion – im Film und in der Literatur – gelangten seine schöpferischen Pläne erst später, da war er schon ein reifer Mann.
Dass diese Reife neben der künstlerischen auch eine politische Dimension hat, haben wir an seinen Auftritten vor Gericht gesehen, wo er für Taten abgeurteilt wurde, die er nicht verübt hat – und für sein zivilgesellschaftliches Engagement. »Der Maidan war das Wichtigste, was ich in meinem Leben geleistet habe«, erklärte er zu Beginn des Prozesses. »Was aber nicht heißen soll, dass ich ein Radikaler wäre, einen Berkut-Polizisten angezündet oder sonst wem das Fell abgezogen hätte. Wir haben unseren Präsidenten, der ein Verbrecher ist, aus dem Amt gejagt. Und als Ihr Land die Krim okkupiert hat, ging ich dorthin zurück und leistete die gleiche Art Unterstützung wie zuvor auf dem Maidan. Ich hatte Kontakt zu Hunderten von Leuten. Gemeinsam überlegten wir, wie es weitergehen sollte. Aber nie habe ich jemanden zu Taten angestachelt, die für irgendwen hätten tödlich sein können, nie habe ich eine terroristische Vereinigung zu gründen versucht und erst recht hatte ich niemals etwas mit dem Rechten Sektor zu schaffen.«
Seit annähernd fünf Jahren sitzt Oleg Senzow in einem russischen Gefängnis. Dort stand er einen 145 Tage währenden Hungerstreik durch, verknüpft mit der Forderung nach Freilassung aller ukrainischen politischen Häftlinge, die in russischen Gefängnissen festgehalten werden. Dort schrieb er Drehbücher fürs Kino, und kürzlich ließ er hören, er habe einen neuen Roman beendet. Hoffentlich wusste er bei dieser Mitteilung Manuskript oder Datei dieses Romans schon in der Ukraine, an sicherem Ort.
Das Buch, das Sie in Händen halten, ist kein Roman. Es ist der ehrliche und offene autobiografische Bericht über seine Kindheit, die Schulzeit. Darin beschrieben ist seine Persönlichkeitswerdung – also wie er zu dem furchtlosen Menschen wurde, der er heute ist. Furchtlos zu sein ist eine seltene Gabe. Als Oleg seine Erzählungen schrieb, schien die Furchtlosigkeit, die sich darin äußert, eine Charaktersache zu sein und hatte, auch das ist wichtig, mit dem Leben auf der Krim zu tun, seinen Besonderheiten, den Problemen.
Seit 2014 weiß die ganze Welt von Olegs Furchtlosigkeit. Sie ist – und mit ihr die Bereitschaft, für Wahrheit und Werte einzustehen, das eigene Leben dafür aufs Spiel zu setzen, weil anders das Leben für ihn keinen Sinn hat – zum Maßstab geworden für Zivilcourage und echten Patriotismus. Ein Gericht der Russischen Föderation hat Oleg Senzow zu zwanzig Jahren Gefängnishaft verurteilt. Vor allem dafür, dass er, ein ethnischer Russe und Bewohner der Krim, es gewagt hat, mit der Annexion seiner Heimat durch Russland nicht einverstanden zu sein.
Fünf Jahre hat man ihm, dem ukrainischen Autor und Regisseur, bereits gestohlen. Zu hoffen bleibt, dass es uns, Lesern und Autoren und aufrechten Menschen in aller Welt, mit vereinten Kräften gelingt, Oleg Senzow aus seinem fernen Gefängnis in der Polarzone herauszuholen. Solange er aber noch dort ist, ist das Geringste, was wir für ihn tun können, seine Texte zu lesen. Die, die bereits erschienen sind, und die, die er dort schreibt. Wir dürfen ihn nicht vergessen – so wenig, wie Hunderte andere, Buchautoren und Nicht-Buchautoren, Filmemacher und Nicht-Filmemacher in den verschiedensten Ländern, vergessen sein dürfen, die gleich ihm grundlos in Haft sind. Gerechtigkeit existiert, solange wir an sie glauben. Und unser Glaube an die Gerechtigkeit ist es, der der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft!
Gewiss werden Ihnen beim Lesen dieses Buches Fragen kommen, die Sie dem Autor gern stellen würden. Rechnen Sie nicht so bald mit der Möglichkeit, diese Fragen auf einer Lesung in Berlin oder zur Frankfurter Buchmesse von ihm beantwortet zu bekommen. Stellen Sie sie ihm lieber brieflich! Die Adresse seines Gefängnisses finden Sie im Internet. Die einzige Schwierigkeit ist, dass das Gefängnis Briefe an seine Insassen nur in russischer Sprache entgegennimmt. Bedienen Sie sich der Hilfe von Übersetzern, und seien es automatische. Die Qualität der Übersetzung ist in diesem Fall nicht das Wichtigste. Auf Ihr Herz kommt es an!
Andrej Kurkow, im Februar 2019
Andrej Kurkow ist ein international bekannter ukrainischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Er hat zahlreiche Romane (darunter der Welterfolg »Picknick auf dem Eis«, 1999) veröffentlicht, die vielfach übersetzt wurden und auf Deutsch im Diogenes Verlag und im Haymon Verlag erscheinen.
Der Hund
Als Kind wollte ich einen Hund haben. Einen Schäferhund, und unbedingt einen Deutschen. Schäferhunde hatte ich in Filmen öfter gesehen, auch bei uns im Dorf gab es ein paar. So einen wollte ich auch. Ich wollte ihn ausführen, ihn erziehen. Mit ihm die Straße entlanglaufen, und alle würden mir hinterhergucken. Er würde auf mich hören, und wir hätten einander lieb.
Einen Hund hatte ich vorher schon mal gehabt. Genauer gesagt, nicht ich, sondern meine Familie. Er hieß ganz unheldenhaft Tusik. Ein mittelgroßer schwarzer Straßenköter, der uns zugelaufen war. Das bisherige Leben von Tus – so nannte ich ihn, weil das in meinen Ohren gewichtiger klang – war kein Zuckerschlecken gewesen, anscheinend wurde er ordentlich geschlagen und viel drangsaliert. Die erste Woche bei uns saß er in seiner Hundehütte und ging nicht mal zum Fressen nach draußen. Er war so froh, dass er in Ruhe gelassen wurde, das war ihm wichtiger als jede Nahrung.
Dann gewöhnte sich Tusik an uns und wir schlossen ihn ins Herz. Ich war damals vielleicht neun oder zehn. Ich ging mit ihm raus, in den Wald oder über die Felder. Ich hielt ihn an der Leine. Zu Hause wurde er angekettet und über Nacht von der Kette gelassen, er lief frei im Hof oder sogar auf der Straße herum und tat niemandem etwas. Tus war sehr klug, gutherzig und gehorsam. Aber das Erlebte hatte sich für immer in seine Züge eingebrannt. Es heißt, das Gesicht eines Menschen spiegelt seine Erfahrungen wider. Das stimmt. Auch in Hundeaugen spiegelt sich ein Hundeleben wider. Die Augen dieses schwarzen Straßenköters sollten für immer traurig bleiben.
Einige Jahre später weckte mich eines unauffälligen Morgens meine Mutter, setzte sich auf die Bettkante und sagte, Tusik sei tot. Irgendwer war unterwegs gewesen, um streunende Hunde zu erschießen, und dabei hatte es auch unseren Hund erwischt, frühmorgens auf der Straße, direkt vor unserem Tor. Meine Mutter meinte, ich solle mich ausweinen, aber ich konnte nicht. Ich konnte es nicht glauben. Ich verstand zwar, dass man ihn erschossen hatte, aber ich glaubte es nicht, ich begriff es nicht. Das ist immer so. Zwischen der Nachricht über den Tod eines nahen Angehörigen und dem Wahrnehmen des Verlustes vergeht immer etwas Zeit. Ich habe das mehr als einmal erlebt. Als ich zwanzig war und jemand zu mir kam und sagte, mein Vater sei gestorben, war mein erster Gedanke: »Das kann nicht sein.« Auch als ich ihn eine Stunde später wie schlafend daliegen sah, hatte sich das Gefühl des Verlustes nicht eingestellt.
Am nächsten Tag wurde er im Sarg aus dem Haus getragen – da spürte ich einen Stich, aber es zerriss mich nicht. Nach der Aufforderung an die Angehörigen, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden, gab der Mann auf dem Friedhof das Kommando, den Sarg zu schließen, und da spürte ich den zweiten Stich – die bereits im Deckel steckenden Nägel wurden mit einem wahnsinnig dumpfen Geräusch eingeschlagen. In der tiefen Grube lag noch eine Flasche, die die Totengräber leer getrunken und vergessen hatten.
Ich fühlte mich wie in einem wattigen Traum. Als passierte das alles nicht mir. Der Leichenschmaus in der Kantine, der Wodka, der einen nüchtern lässt, all diese Leute, zufällige oder mitfühlende Beobachter, irgendwelche Verwandten.
Spätabends, als etwas Ruhe einkehrte und nur noch die nächsten Angehörigen bei uns waren – das Haus war inzwischen wieder aufgeräumt, und nach dem schweren Tag machten sich alle langsam bettfertig –, setzte ich mich auf eine kleine Holzbank, die etwas abseits vor dem Haus im Dunkeln stand, außerhalb des Lichtkreises der Straßenlaterne. Ich war erschöpft und starrte schweigend in die Finsternis. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass ich genau an der Stelle saß, wo mein Vater gerne gesessen hatte, dass ich auf seiner Lieblingsbank saß, die er selbst gezimmert hatte. Mit einem Schlag war mir klar, er ist weg. Ich spürte es im ganzen Körper: Die Stelle ist da, die Bank ist da, ich bin da, aber er ist für immer weg. Dieses Gefühl der Leere und Schwärze war furchtbar. Und da fing ich langsam an zu weinen, leise, wortlos. Mein achtjähriger Neffe stand neben mir und sah, dass ich weinte. Ich tat ihm leid, und er zeigte mir sein Mitleid auf seine Kinderart, indem er mir über den Kopf strich. Auch er sagte nichts. So saß ich auf der Bank, mit gesenktem Kopf, und weinte leise, während er neben mir stand und mir wortlos über den Kopf strich.
Seit Tusiks Tod war fast ein Jahr vergangen. Endlich rang ich meinen Eltern einen neuen Hund ab. Einen Schäferhund! An meinem zwölften Geburtstag fuhr mein Vater mit mir in die Stadt und kaufte auf dem Markt einen Welpen, eine Mischung aus Deutschem und Kaukasischem Schäferhund. Der Welpe war winzig, knapp über eine Woche alt, konnte sich kaum fortbewegen und noch weniger fressen, er passte in meine Kinderhand. Einen Stammbaum hatte er nicht, aber dafür kostete er auch nur fünfzehn Rubel. In der Nacht fiepte er und robbte in meinem Zimmer auf dem Boden herum, bis meine Mutter genug hatte und ihn zu mir ins Bett legte, wo er es sich gemütlich machte und einschlief. Ich fütterte ihn mit Milch, die er mir vom Finger leckte; richtig trinken konnte er noch nicht. Wir tauften den Kleinen Dick.
Dick wurde schnell größer, er war ein kräftiger, zotteliger, unbeholfener Rüde und wie alle Welpen sehr verspielt. Als er heranwuchs, erlebte ich eine kleine Enttäuschung: Halbblut bleibt Halbblut, und obwohl Deutsche und Kaukasische Schäferhunde gezielt verpaart werden, um das Beste aus beiden Rassen herauszuholen, ähnelte mein Hund keinem der Bilder aus dem dünnen Kynologie-Buch, das ich mir irgendwann »nur kurz« von einem Bekannten geliehen hatte. Eine Zeit lang wurmte mich das sehr, aber dann triumphierte die Liebe zu meinem Hund über den Eindruck, er sei minderwertig.
Dick wurde riesig, er hatte das rötlich-schwarze Fell eines Deutschen Schäferhundes, aber er war breiter gebaut und ähnelte damit, wie auch mit seinen Schlappohren und der Ringelrute, eher dem Kaukasier. Er hing sehr an mir und ich an ihm. Wir waren viel draußen, ich dressierte ihn, und er lernte so manches, was ein Wachhund können muss. Allerdings war er ziemlich eigensinnig. Auf seinen Jagdinstinkt beim Anblick von Hühnern, Enten und sonstigem Geflügel war immer Verlass, was für zahllose Konflikte mit den Besitzern der zu Schaden gekommenen Hoftiere sorgte, unter anderem auch mit meinen eigenen Eltern.