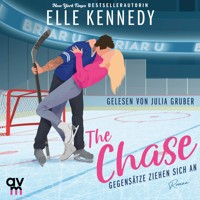0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,00, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Spannung zwischen archaisch-heroischen und christlich-höfischen Motiven scheint das Nibelungenlied wie ein roter Faden zu durchziehen. Diese Ambivalenz führte in der Forschung immer wieder zur kritischen Hinterfragung der Handlungskohärenz. Die vorliegende Arbeit nähert sich diesem Forschungsschwerpunkt unter diskursanalytischen Vorüberlegungen und versucht zunächst archaisch-heroisches und christlich-höfisches Handeln vorsichtig voneinander abzugrenzen und zu definieren. Schließlich wird die Sinnhaftigkeit dieser Modellvorstellung von zwei getrennten Diskuren an der Figur des Hagens eingehend analysiert - sowohl auf der Ebene der Figurenkonzeption, als auch in eingehenden Analysen von fünfzehn repräsentativen Hagen-Szenen des Nibelungenliedes. Die dabei entwickelte Hypothese, dass Hagen generell der Sphäre des Archaischen zugehört, aber in den Szenen, in denen er Verweischarakter für andere Charaktere besitzt, deren Herrschaftsdiskurs temporär übernehmen kann, wird in einem abschließenden Fazit bewertet und zusammengefaßt. Im Anhang findet sich zudem eine fünfseitige Tabelle aller Strophen des Nibelungenliedes, die Bezug zu Hagen nehmen - ein hilfreiches Werkzeug für jede Arbeit zu diesem Thema!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Die Figur Hagens von Tronje ist in der Nibelungenliteratur eine der umstrittensten Figuren. Der Grund dafür liegt in der Widersprüchlichkeit der Gesamtkonzeption dieser Gestalt, wie das obige Zitat bereits andeutet. Auf der einen Seite steht 'der Ritter' Hagen, der wichtiger Bestandteil der höfischen Welt zu Worms ist. Andererseits begegnet man immer wieder einem ganz unhöfischen Hagen, dessen Taten in keinster Weise einem Ritter anstünden. Wie können diese Widersprüche aber in einer einzigen Figur verbunden sein? War der Dichter ein Dilettant? Sind verschiedene Vorlagen schuld an diesen Spannungen? Oder wollte der Dichter seinen Hörern beide Seiten vorführen, um seine gesellschaftskritische Aussage in sein Werk hineinzuweben? Oder aber: Ist es vielleicht gar kein Widerspruch, lässt sich die Ambivalenz in dieser Hagenfigur vielleicht durch Regeln begründen, greifbar machen?
Auf jene Fragen möchte diese Arbeit versuchen Antworten zu finden. Bevor jedoch die eigentliche Thematik behandelt werden kann, soll zunächst ein kurzer Vorspann zur Theorie und zur Untersuchungsmethodik erfolgen. Hierbei ist besonders auf den Begriff des Diskurses einzugehen und einige wichtige Diskurstheoretiker vorzustellen. Es wird dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit gelegt werden, da das nicht dem Erkenntnisziel dieser Arbeit entspräche. Stattdessen sollen einzelne Aspekte und Methoden, die für die Untersuchungsziele von Bedeutung sind, herausgegriffen und skizziert werden.
In einem ersten Schritt soll zunächst die Kohärenz des Textes untersucht werden; damit geht die grundlegende Frage einher, ob die im Nibelungenlied anzutreffenden Diskursstränge sinnhaft, reflektiert eingesetzt sind, oder, ob der Dichter bei der Schaffung seines Epos grobe Brüche in der Struktur desselbigen zugelassen habe, wodurch ein neben- und übereinander verschiedener Diskursstränge eher 'Unfall' oder unbeabsichtigte 'Collage' denn Sinnstruktur
1Haymes: Nibelungenlied. S. 99.
Page 4
wäre. Im nächsten Schritt beginnt die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Nibelungenlied. Dabei werde ich mich entsprechend der diskursanalytischen Praxis vom Groben zum Feinen vorarbeiten: Zunächst bedarf es einer Analyse der Entstehungsgeschichte des Nibelungenliedes, um den sozio-kulturellen Hintergrund zu durchleuchten und dabei eventuell auch die Frage zu klären, inwiefern eine gesellschaftskritische Aussage durch die Ambivalenz Hagens überhaupt postuliert sein könnte.
Daraufhin gilt es die Existenz und die Beschaffenheit der beiden Diskursstränge im Nibelungenlied generell nachzuweisen, und schließlich sich der Hagenfigur strukturell zu nähern, indem einige konzeptionelle Aspekte querschnittartig durch das Nibelungenlied verfolgt werden sollen. Den größten Teil der Arbeit werden schließlich die Analysen einiger ausgewählter, repräsentativer Szenen aus dem Nibelungenlied einnehmen, an Hand derer die Zugehörigkeit Hagens zu einem jener diskursiven Systeme, oder aber eine Begründung für die eventuell vorzufindende Ambivalenz in der Hagendarstellung gefunden werden soll.
Page 5
2. Zum Diskursbegriff
Der Begriff des Diskurses ist selbst einem langen wissenschaftlichen Diskurs unterworfen worden. Verschiedene Wissenschaften haben ihn ihren Vorgehensweisen gemäß interpretiert, und auch innerhalb der einzelnen Wissenschaften herrscht keineswegs Klarheit über das, was man unter einem Diskurs, bzw. einer Diskursanalyse verstehen soll. Daher ist es zunächst unabdinglich, sich einen kurzen Überblick zu verschaffen, um schließlich zu einem sinngemäßen Diskursbegriff und zu einer praktikablen, dem Gegenstand angemessenen, analytischen Vorgehensweise zu gelangen.
Der Begriff "Diskurs", vom lat.discursus- das Hin- und Herlaufen, der Streifzug, meint in seiner ursprünglichen Bedeutung eine systematische Arbeit zu einem bestimmten Thema.2In der Linguistik begann man kohärente Texte als Diskurse zu bezeichnen, sie beispielsweise strukturalistisch zu analysieren und dadurch die Sprachfunktionen des Diskurses zu ermitteln.3
Anders wurde der Begriff in die Terminologie der Philosophie eingeführt, wo er besonders mit der sog. Frankfurter Schule und Jürgen Habermas in enger Verbindung steht: Habermas versteht unter einem Diskurs, beziehungsweise einer Diskursanalyse, den psychoanalytischen Ansatz einer Gesprächsanalyse,4wobei das Gespräch, also der Diskurs, als ungezwungene, auf Konsens abzielende Debatte über den Geltungsanspruch von Normen verstanden wird.5Habermas gesteht dem handelnden Subjekt dabei Souveränität gegenüber dem Diskurs zu, d.h. dass das der Handelnde den Diskurs konstituiert, und nicht dem schon präexistenten Diskurs unterworfen ist.6
In den Geschichts-, Literatur- und Sozialwissenschaften bezeichnet ein Diskurs ein "Systemdes Denkens und Argumentierens"7das durch einen Bezugsgegenstand, durch die "Regulari-tätender Rede"8und durch "Relationenzu anderen Diskursen"bestimmt ist."9Oder einfa-
2Winko:Diskursanalyse. S. 463.
3Winko: Diskursanalyse. S. 464.
4Link/Link-Heer: Diskurs. S. 88 f.
5Winko: Diskursanalyse. S. 464.
6Link/Link-Heer: Diskurs. S. 89.
7Titzman 1991, S. 406 nach Winko S. 464 unten, wegen Zitation noch mal checken!
8Ebd.
9Ebd.
Page 6
cher, nach Foucault: Ein Diskurs ist eine beliebige Anzahl von Aussagen10, die einem gemeinsamen Formationssystem angehören.11Innerhalb dieser literaturwissenschaftlichen Terminologie lassen sich erneut verschiedene Richtungen unterscheiden, die drei große Gruppen bilden: Die semiotisch-philosophische Richtung, die Diskursanalyse als dekonstruktiven Ansatz versteht, die linguistisch-psychologische Richtung, die versucht Diskurse psychologisch zu durchdringen, und schließlich die historisch-genealogische Richtung .12
Für die folgende Umsetzung wird besonders der historisch-genealogische Ansatz von Bedeutung sein; dies liegt besonders daran, dass zur Analyse mittelalterlicher Texte keine geisteswissenschaftlichen Modelle späterer Zeiten auf Vergangenes rückbezogen werden dürfen: Wenn also die Herrschaftsdiskurse um Hagen von Tronje analysiert werden sollen, können darauf keine psychologischen Analysetheorien bezogen werden, da diese bei der Abfassung des Nibelungenliedes noch für viele Jahrhunderte nicht bekannt waren und somit auch eine Psychoanalyse wenig Sinn ergeben würde.13Da für die Betrachtung des Nibelungenliedes besonders die Diskursanalyse nach historisch-genealogischen Standards Sinn ergeben wird, soll diese , besonders von Michel Foucault beeinflusste Theorie, nun kurz umrissen werden:
Es ist zu beachten, dass Foucault, als er in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahr-hunderts seine Diskurstheorien abfasste, nicht primär die Literatur im Zentrum seines Interesses stand.14Ferner ist noch einmal zu betonen, dass hier keine vollständige Analyse seiner Theorien erfolgen kann: Im Laufe seines produktiven wissenschaftlichen Lebens lassen sich drei Phasen unterscheiden,15in denen er vorhergehende Theorien überarbeitete und zum Teil revidierte.16Es sollen hier nur einzelne Aspekte dargelegt werden, wie sie für die weitere Analyse und die Untersuchungsziele dieser Arbeit für sinnvoll erachtet werden.
Für Foucault bestehen Diskurse sowohl aus den Aussagen des Diskurses, als auch aus den Bedingungen, in denen dieser Diskurs sich entwickelt hat; beides gilt es zu untersuchen.17Ein
10Nicht nur Sprechakte oder Worte stellen dabei für Foucault eine Aussage dar, sondern alle funktionstragen den Elemente eines Diskurses - also auch Nonverbales. Vgl. Landwehr: Geschichte des Sagbaren. S. 111.
11Kammler: Diskursanalyse. S. 38.
12Winko: Diskursanalyse. S. 465.
13Schulze: Nibelungenlied. S. 254.
14Kammler: Diskursanalyse. S. 50.
15Winko: Diskursanalyse. S. 469.
16Oder um mit den eloquenten Worten Kammlers zu sprechen: "DaFoucault selbst nie den Anspruch erhoben hat, ein homogenes Theoriegebäude zu entwickeln, [...] ist es nur legitim, wenn ihn die Literaturwissenschaft in einer selektiven und teilweise eklektizistischen Weise rezipiert."Kammler: Diskursanalyse. S. 44.
17Winko: Diskursanalyse. S. 468.
Page 7
Diskurs entsteht und entwickelt sich dabei nicht selbstständig, sondern er wird gegenüber anderen Diskursen abgegrenzt und in sich reguliert. Dieser Vorgang geschieht Foucault zu Folge durch das Einwirken von sozialen Machtverhältnissen, von sog. Praktiken der Macht.18Die machtstrategische Verbindung von Diskursen mit reellen, nicht diskursiven Praktiken, bezeichnet Foucault als Dispositive.19Somit hat Foucault keine systematische Analyseverfahren des literarischen Diskurses entwickelt, sondern hat sich viel mehr als für die Literatur per se, für die in ihr auffindbaren und rekonstruierbaren Machtmechanismen und die daraus resultierenden Herrschaftsdiskurse interessiert.20Ein sehr treffendes Beispiel für die negativ ausschließende Macht eines Diskurses fanden Link/Link-Heer, als sie ausführten, dass der medizinische Diskurs des 19. Jahrhunderts beispielsweise alle Fragestellungen ausschloss, welche nicht seinen klinischen Argumentationsmustern gehorchten; zudem schließt dieser Diskurs institutionell21die Diskursteilhabe aller jener Menschen aus, die nicht eine vom Diskurs vordefinierte medizinische Ausbildung vorzuweisen hatten.22
Wie kann nun ein Diskurs die Wahrnehmung der Realität ordnen? Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass der Diskurs von den ihn führenden Menschen prinzipiell kontrolliert und gestaltet ist, also beeinflussbar ist.23Foucault unterscheidet interne und externe Kontrollmechanismen, die den Diskurs bestimmen. Sie sind im Lauf der Geschichte der Diskurse und der Reflexion über sie historisch gewachsene, an sich zufällige Grenzziehungen, die sich auch historisch in ihrer Entwicklung verfolgen und nachweisen lassen.24
Die externen Mechanismen lassen sich in drei große Felder gliedern: Das Diskursverbot, die Ausgrenzung des Wahnsinns und den Willen zur Wahrheit.25Das Diskursverbot realisiert sich durch das Tabu über einen Gegenstand zu sprechen, das "Ritualder Umstände"26, d.h. dass bestimmte Situationen es verbieten über gewisse Dinge zu sprechen, und schließlich das "ausschließlicheRecht des sprechenden Subjekts"27- nicht jeder darf über alles sprechen, manche Diskurse werden nur ausgewählten Personen zugestanden. Die Ausgrenzung des
18Winko: Diskursanalyse. S. 468.
19Kammler: Diskursanalyse. S. 43.
20Winko: Diskursanalyse. S. 469.
21Zum sich institutionell nach außen hin abschließenden Diskurs siehe auch Foucault: Ordnung. S. 26.
22Link/Link-Heer: Diskurs. S. 90 f.
23Foucault: Ordnung. S. 10.
24Foucault: Ordnung. S. 13 f.
25Foucault: Ordnung. S. 16.
26Foucault: Ordnung. S. 11.
27Foucault: Ordnung. S. 11.
Page 8
Wahnsinns ist seit jeher in der menschlichen Kultur anzutreffen, denn das Wort des Wahnsinnigen hat für gewöhnlich keinen Wert, es wird ihm rechtlich keine Bedeutung zugebilligt.28Und schließlich der externe Kontrollmechanismus des Willens zur Wahrheit: Dieser war schon seit der Antike der entscheidende, denn er war der herrschende Diskurs, der Recht sprechen konnte, der die Zukunft vorhersah und ihre Verwirklichung erstrebte, der die Zustimmung der Menschen erhielt und sie somit auf sich verpflichtete.29Wie Foucault nachweist, ist der Wille zur Wahrheit der dominierende Kontrollmechanismus, der auf die anderen Zwänge und Grenzen ausübt und im Lauf der Geschichte die Bedeutung der anderen beiden immer mehr verdrängte.30Man sehe dies daran wie durch neue Wissenschaften das Wort des Wahnsinnigen auf einmal von Bedeutung wurde, wie die Verbote des Wortes immer weniger zu werden schienen.
Von diesen drei externen Kontrollmechanismen unterscheidet Foucault weitere interne Prozeduren, die einen Diskurs ordnen. Auch hier wieder nennt er drei Systeme: Den Kommentar, den Autor und die Disziplin.31Der Kommentar thematisiert einen Primärtext, ist die diskursive Aufarbeitung einen vorhandenen Diskurses, der ihn interpretiert und pointiert.32Unter dem Autor versteht er nicht das sprechende oder schreibende Individuum, sondern die Schnittstelle der dem Diskurs zugrunde liegenden Bedeutungen und Diskurse; der Autor schafft also gewissermaßen eine semantische Einheit aus vorhandenen Diskursen, erfüllt sie mit neuem Sinn und stiftet neue Zusammenhänge,33ohne dabei ein Genie oder alleiniger Urheber eines neuen Diskurses zu sein, sondern mehr der Dreh-und-Angelpunkt, das Brennglas durch das zahlreiche andere Diskurse und Variablen in sein Werk eindringen.34Zuletzt konstituiert sich ein Diskurs aus den vorgefundenen Regeln, Techniken und Methoden der Disziplin, der er sich zugehörig fühlt, und die er nicht missachten darf, wenn er der Disziplin zugehörig sein möchte.35So muss beispielsweise ein literaturwissenschaftlicher Text den Methoden und dem Vokabular der Wissenschaft versuchen zu entsprechen, damit er von ihr ernst genommen werden kann.
28Foucault: Ordnung. S. 12.
29Foucault: Ordnung. S. 14.
30Foucault: Ordnung. S. 16.
31Foucault: Ordnung. S. 18 ff.
32Foucault: Ordnung. S. 19.
33Foucault: Ordnung. S. 20 f.
34Kammler: Diskursanalyse. S. 45.
35Foucault: Ordnung. S. 22 f.
Page 9
Was ist nun aus Foucaults Diskursbegriff für die Analyse eines literarischen Textes abzuleiten? Wie bereits dargelegt wurde ist Foucaults Ziel nicht primär Literaturanalyse, er stellt hierzu ein kein unmittelbar anwendbares Handwerkszeug zur Verfügung. Für ihn hat Literatur illustrierenden Charakter, an ihr kann er diskursive Machtfaktoren nachweisen und den Wandel innerhalb der Diskurse sichtbar machen, da Literatur nicht nur aus innerdiskursiven Praxen (also beispielsweise ästhetischen Paradigmen) sondern auch aus außerliterarischen Diskursen aufgebaut ist, wie dem politischen, dem historischen oder dem biologischen Diskurs.36Um dieses Erkenntnisziel zu erreichen müsste ein größere Zahl von Texten mit diskursiven Schnittmengen verglichen werden, was aber nicht Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist. Auch Fragen wie: Beeinflusst der Diskurs das Handeln der Charaktere, oder gelingt es den Charakteren, den Diskurs um sich herum nach ihrem Willen zu beeinflussen?, sind möglicherweise in Anbetracht eines mittelalterlichen Textes mit gewisser Vorsicht zu diskutieren, da die nibelungischen Charaktere über keinen 'freien Willen' oder einen echten Charakter verfügen, vielmehr als Typen für bestimmte Konzepte anzusehen sind.37Aber gerade weil Figuren wie Hagen auch einen ganz bestimmten Typus personifizieren, kann an ihnen dieser Typus, jener Diskurs für den sie stehen, herausgelesen werden: Hierzu wird im faucoultschen Sinne besonders auf die Ordnung der Diskurse zu achten sein, also wie beispielsweise Hagen wem gegenüber wann spricht, wer wie darauf reagieren kann und darf, und wie einzelne Charaktere in bestimmten Situationen nicht reden oder handeln dürfen, also vom Diskurs ausgeschlossen werden.
2.1. Die Methode der kritischen Diskursanalyse
Nachdem nun mit Foucault der wichtigste Theoretiker des Diskurses vorgestellt wurde, und mit Link/Link-Heer auch eine der wichtigen Sekundärarbeiten zu diesem Thema angesprochen wurde, soll nun ein konkretes literaturwissenschaftliches Methodenrepertoire aufgestellt werden. Ebenfalls von Foucaults Diskursbegriff ausgehend hat sich hier besonders Siegfried Jäger verdient gemacht, dessen kritische Diskursanalyse zunächst porträtiert werden soll.
36Winko: Diskursanalyse. S. 469.
37Dazu auch Backenköhler: Untersuchungen. S. 211.