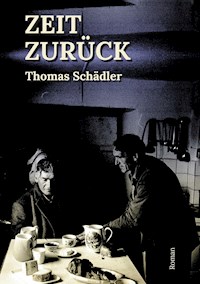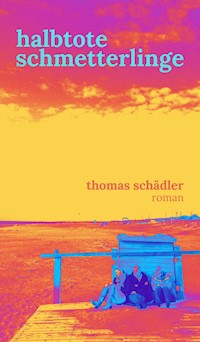
4,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurz vor fünfzig wird Ambühl mit unheilbarem Prostatakrebs diagnostiziert. Dieser »Anschlag auf das Leben« zieht ihm den Boden unter den Füßen weg und bringt sein kompliziertes Beziehungsgeflecht komplett durcheinander. Die Bedrohung der körperlichen Integrität, des seelischen Gleichgewichts und seiner Schaffenskraft stellt ihn vor schwierigste Herausforderungen und er schwankt zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Offenheit für Neues.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
thomas schädler
halbtoteSchmetterlinge
roman
Copyright: © 2021 Thomas Schädler
Umschlag & Satz: Erik Kinting – buchlektorat.net
Titelbild: © Thomas Schädler
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-41461-7 (Paperback)
978-3-347-41462-4 (Hardcover)
978-3-347-41463-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Between what is said and not meant, and what is meant and not said, most of love is lost.
Khalil Gibran
Prolog
An einem sonnigen Montagmittag Ende Juli raste auf der Autobahn ein knallroter Ferrari aus der Stadt in Richtung Süden. Immer auf der linken Spur bleibend, überholte er mit stark erhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug nach dem anderen und entging dabei mehrmals nur knapp einer Kollision.
Die unbändige Beschleunigung des Achtzylinders, das röhrende Heulen des Motors und die verschwommen an ihm vorbeiziehende Landschaft berauschten den Fahrer und ließen ihn Zeit und Raum vergessen.
In einer langgezogenen, nicht enden wollenden Rechtskurve beließ er den Fuß auf dem Gaspedal und forcierte den Wagen unaufhörlich weiter. Durch die enormen Kräfte, die dabei freigesetzt wurden, verlor das Fahrzeug die Bodenhaftung, scherte aus der Spur und streifte die Leitplanke. Brüllend drehte es sich mehrfach um die eigene Achse, schlitterte die steile Böschung auf der gegenüberliegenden Seite hinauf, um durch die Luft zurück auf die Fahrbahn katapultiert zu werden, auf der es sich ein paar Mal überschlug und schließlich gegen einen Brückenpfeiler prallte.
Sofort bildete sich hinter dem Unfall ein kilometerlanger Stau und die schnell herbeigerufenen Rettungskräfte hatten Mühe, die Einsatzstelle zu erreichen. Der rote Ferrari hatte sich buchstäblich um den Betonpfeiler gewickelt und das völlig zerstörte Fahrzeug konnte nur mit schwerem Gerät zerlegt werden, um den schwerverletzten Fahrer aus dem Auto zu ziehen.
Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
***
Am Freitag zuvor, kurz vor Geschäftsschluss, hatte ein sympathischer Mann mittleren Alters die Agentur in der Innenstadt, die Luxus- und Sportfahrzeuge der Extraklasse vermietet, betreten. Er ging an einem Stock, humpelte leicht und schien unter Schmerzen zu leiden. Trotzdem machte er einen seriösen Eindruck und hinterlegte, ohne zu zögern, eine größere Summe als Sicherheitsdepot. Den Ferrari hatte er vorab online für ein verlängertes Wochenende reserviert und erläuterte nun mit einem Lächeln, dass er damit zu einem Treffen mit alten Schulfreunden fahren wolle, um sie zu überraschen und zu beeindrucken. Von ihm würde niemand erwarten, einen solchen Wagen zu besitzen.
Nachdem die Formalitäten erledigt waren und ihn der Vermieter in die Bedienung des Sportwagens eingewiesen hatte, stieg er mit einiger Mühe in das tiefliegende Fahrzeug. Er legte den Stock auf den Beifahrersitz, startete den hochgezüchteten Motor, ließ die schwere Kupplung gefühlvoll kommen und fuhr ohne Rucken los.
1.
Das Beste, das Ambühl als Kind geschehen konnte, war, krank zu sein. Nicht wirklich schwerkrank. Aber gerade so krank, dass er nicht zur Schule gehen musste und zu Hause im Bett liegen bleiben durfte. Zugegeben, der Preis, den er dafür zu bezahlen hatte, war groß. Bei seiner Mutter galt die strikte Regel, zum Abschluss einer jeden Krankheit einen Tag fieberfrei im Bett bleiben zu müssen, bevor sie einen wieder in den Alltag entließ. Und das war bitterer Ernst. Vierundzwanzig Stunden gesund im Bett.
Gleichzeitig war Kranksein, wenn man sich einmal dazu entschieden hatte, das absolute Paradies. Besser konnte es einem Kind in der kleinen Vierzimmerwohnung gar nicht gehen. Vier Zimmer mögen zwar nach recht viel Platz klingen, doch da Ambühls Eltern – wohl aus Statusgründen – darauf bestanden hatten, ein separates Wohn- und Esszimmer einzurichten, und die Eltern den dritten Raum als Schlafzimmer bewohnten, blieb für zwei der drei Kinder lediglich ein Raum von zwölf Quadratmetern, den sie sich teilen mussten. Dieser wurde ausgefüllt von einem neuartigen Doppelstockbett, das „schwedisches Bett“ genannt wurde, um ihm eine besondere Note zu verleihen. Ambühls älterer Bruder passte in das kleine Zimmer nicht mehr rein. Für ihn wurde etwas anderes „Modernes" angeschafft. Im Esszimmer gab es für ihn ein Ausziehbett. Was tagsüber wie eine schlecht konzipierte Sitzgelegenheit aussah, ließ sich nachts mit wenigen Handgriffen in ein schäbiges Bett verwandeln. Dort schlief der Bruder.
Krank zu sein, war gut. Die Mutter kümmerte sich noch mehr um einen als sonst. Wenn er krank war, durfte Ambühl allein im Zimmer sein. Er wurde täglich in neue Bettlaken gehüllt, durfte sich sein Lieblingsessen wünschen und bekam tatsächlich „die Glocke“ auf den Nachttisch gestellt. Damit ließ sich jederzeit die Mutter rufen, um ihr einen weiteren Wunsch vorzutragen oder ein bisschen über Schmerzen zu klagen. Nicht, dass es dieser Glocke tatsächlich bedurft hätte. Im Gegenteil, die Wohnung war wirklich so klein, dass selbst ein leichtes Räuspern nicht hätte überhört werden können.
Die Glocke hatte eine magische Bedeutung. Sie symbolisierte das wirkliche Kranksein, das sogar so weit führte, dass sich Frau Ambühl dazu hinreißen ließ, bei der Nachbarin, die auf demselben Flur eine Dreizimmerwohnung bewohnte, zu klingeln, um sich einen Stapel Comics für ihr krankes Kind auszuleihen. Sowas hätte sie nie selbst gekauft.
Um die Dramatik der mütterlichen Selbsterhöhung dieser Aktion zu verstehen, ist es wichtig zu erwähnen, dass die Nachbarin eine geschiedene Frau war, die ihren Sohn gemäß der Einschätzung der Eltern nicht im Griff hatte. Weil sie eben ein „Lotterleben“ führte. Der Begriff faszinierte Ambühl, obwohl er ihn nicht einzuordnen wusste.
Der Sohn schaute immer fern, verbrachte ganze Abende allein zu Hause und nannte seine Mutter öfter mal derart laut eine „verfickte Nutte“, dass es im ganzen Haus zu hören war.
Für Ambühl aber war er vor allem ein Gelehrter des Fachbereichs Kindercomics. Er besaß eine ganze Kollektion davon. So stellte Kranksein für Ambühl auch eine Chance dar, endlich diese Heftchen zu lesen, damit in seinen „Studien des Banalen“ aufzuholen und am wahren Leben zu schnuppern.
Der absolute Höhepunkt jeder häuslichen Krankheitsgeschichte war der Besuch von Doktor Larcher. Er war der Kinderarzt der Familie und ein Hausbesuch die ausdrückliche Bestätigung dafür, dass die Mutter in ihrer Einschätzung recht behielt. Der letzte Krankheitszweifel wurde aus dem Weg geräumt. Gut vorbereitet, wurde die Visite von Frau Ambühl entsprechend inszeniert. Wenn Doktor Larcher endlich klingelte, lag das kranke Kind längst in einem frisch bezogenen Bett, trug einen netten Calida-Pyjama und die Mutter hielt für den Doktor sowohl einen Silberlöffel des Sonntagsbestecks als auch ein feines weißes Tuch von der besonderen Qualität bereit, das für gewöhnlich dem Vater zur morgendlichen Nassrasur vorbehalten war.
Der Doktor war ein freundlicher Mann. Wenn er mithilfe des Silberlöffels tief in den Rachen geschaut, sich die Hände gewaschen und sie mit dem feinen Tuch getrocknet hatte, stellte sich jedes Mal heraus, dass die Mutter einfach alles richtig gemacht hatte und der Patient lediglich ein paar Tabletten benötigte. Der GuteMutter-Stolz war das eigentliche Ziel des Arztbesuchs. Ambühl spürte, wie dieser sich nach dem Abgang von Doktor Larcher wie ein süßlicher Geruch in den vier Zimmern ausbreitete und sich auf alles legte. Es war klar, dass der Doktor Frau Ambühl bewunderte. Und sie sich auch.
Die Nachbarin hatte keine Chance.
2.
Ambühl saß bei Dr. Brenz in der etwas dunklen und nicht wirklich standesgemäß erscheinenden Praxis in der Innenstadt. Er hörte, dass es vielleicht nicht falsch sei, sich darüber Gedanken zu machen, in einem Jahr nicht mehr zu leben. Dr. Brenz war Professor für Urologie und Ambühl von mitwissenden und mitdenkenden Freunden als Koryphäe für die Notsituation empfohlen worden.
Er sah den unbekannten Arzt an, der gerade die Befunde seiner Prostatauntersuchung gelesen hatte und sonst nichts von ihm wusste. Er verstand, dass er in zwölf Monaten vielleicht schon tot sein könnte, und dennoch kam keine Panik in ihm auf, nur Ernsthaftigkeit und eine aufmerksame Sachlichkeit. Es war auch nicht die erste ärztliche Meinung. Dass er schwerkrank war, war Ambühl schon ein paar Tage zuvor klargemacht worden. Wegen einer kleinen Schwellung im Unterleib hatte sein Hausarzt angeordnet, alle möglichen Blutwerte bestimmen zu lassen.
Am darauffolgenden Tag hatte eine sehr aufgeregte Sprechstundenhilfe aus der Praxis angerufen und ihn gebeten, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Der PSA-Normwert bei einem gesunden Mann liegt bei 0,4. Der Hausarzt eröffnete Ambühl, sein PSA-Wert läge bei 159, dass es sich natürlich um einen Messfehler handeln könnte, Prostatakrebs sehr gut behandelbar sei und man nun sofort weitere Tests und Untersuchungen machen müsse.
Über Nacht hatte sich Ambühl via Internetrecherchen und langen Telefonaten mit befreundeten Ärzten über PSA-Werte und Prostatakrebs informiert. In den kurzen Momenten, in denen er den unglaublichen Schock beiseite hatte schieben können, begann er, sich mit dem Thema ernsthafter auseinanderzusetzen, und versuchte hilflos, die Krisen-Notfallpläne anzuwenden, die er aus dem Berufs-, Privat- und Liebesleben kannte.
Er war an einem hochgradig gefährlichen Krebs erkrankt und die Prostata musste schnellstmöglich entfernt werden. Dabei würden auch die Nerven zerstört, die zur Erektion nötig waren. An Krebs zu sterben oder impotent zu sein, was für eine Alternative! Ambühl wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sein Krebs schon über den Prostatarand hinausgewachsen war und auch die Lymphknoten befallen hatte. Dies machte die Krankheit systemisch und unheilbar.
Er wusste auch nichts von den Hormonentzugstherapien, die – neben der Bestrahlung – der Operation folgen sollten.
Er hatte Angst.
3.
In seiner Panik begann er, lange Listen zu schreiben, was alles noch zu tun und zu erledigen wäre, bevor er starb. Dabei fühlte sich Ambühl zugleich chaotisch und exaltiert. Alles war anders als jemals zuvor, so hatte er sich bisher noch nie erlebt.
Wie der Hasenstall zu reinigen sei, ohne die Glasscheibe zu beschädigen, wo die Bedienungsanleitung der neuen Waschmaschine deponiert, die Zugangsdaten für den WLAN-Router und die Verträge der TV-Kinderkanäle zu finden waren. Sämtliche Kontaktdaten der verschiedensten Handwerker fürs Bad, das Dach, das ab und zu undicht war, und das Garagentor, wenn es wieder einmal klemmte. Und dem neuen Gärtner sollte klargemacht werden, dass der alte Rasenmäher zwar beim Kaltstart erst einmal spuckte, er aber dessen ungeachtet nicht ersetzt werden müsse, weil er sonst noch recht gut funktionierte. Außerdem dürften die unteren Äste der Bäume nicht runtergeschnitten werden, weil die Kinder gerne daran hochkletterten. Eigentlich waren sie inzwischen schon fast zu alt dafür und interessierten sich mehr für freien Ausgang und ungestört pubertierendes Alleinsein in ihren Zimmern, für die er ihnen schon lange neue und altersgerechte Möbel versprochen, jedoch den verhassten Besuch im schwedischen Möbelhaus immer wieder hinausgeschoben hatte. Diese Einkaufstouren endeten regelmäßig mit völlig überladenen Einkaufswägen voller Dinge, die man eh nicht brauchte. Vor allem nicht, wenn man starb.
Die Nachbarn besaßen eine lange Leiter, die man ausleihen und ausziehen konnte, einmal im Jahr nur, im Herbst, zur Reinigung der Dachrinnen. Wie würden die wohl reagieren, wenn sie von ihm hörten? Man hatte zwar sonst fast keinen Kontakt, aber mochte sich distanziert. Und der Schlüssel zum Keller funktionierte ausschließlich, wenn man die Tür stark zu sich heranzog und leicht anhob, bevor man ihn drehte. Niemand außer ihm ging je in den Keller. Da gammelten neben nicht mehr benutzten, ausgetretenen Bergschuhen die Umzugskartons aus seinen früheren Leben. Spinnweben und schlechtes Licht. Eklig, da würde er auch noch ausmisten müssen, weil heute sicher nicht mehr alles, was dort gelagert wurde, in die immer wieder neu zusammengeschusterte Lebensgeschichte passte!
Wen sollte er benachrichtigen? Eltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen? Und was sollte er ihnen sagen? Gab es eine Verpflichtung, den Arbeitsgeber darüber zu informieren, dass man höchstwahrscheinlich bald sterben würde? Und die Freunde aus der Vergangenheit, zu denen er über den Zauber des Internets eben erst wieder Kontakt gefunden hatte. Was würden die sagen? Was würden sie in den entsprechenden Foren und Chats schreiben? Mein Gott, hast du es auch gehört? Von wem denn? Ist es wirklich so schlimm? Müsste man ihn dann noch ein letztes Mal besuchen? Und was, wenn er das nicht wollte? Wir standen uns doch gar nicht so nahe. Wie nimmt man überhaupt Abschied vor dem Tod? Ich glaube, der will das nicht.
Wie ließ sich ein Facebook-Konto löschen und wo blieben all die E-Mails, wenn der mit dem Passwort tot war? Die verschiedenen geheimen WhatsApp-Chats mit anderen Frauen? Blieben die irgendwo versteckt im Cyberspace? Hoffentlich. Ganz zu schweigen von Bankkonten und den komplizierten Online-Zugangslösungen für verschiedenste Dienstleitungen, Memberships und Abonnemente Abonnements. Wer kam da ran und würde sich darum kümmern, das kleine Vermögen gerecht zu verteilen? Und das diskrete Notfallkonto in der Schweiz, von dem niemand wusste? Das Geld war damals einfach so liegengeblieben und hatte ihm immer ein fadenscheiniges Gefühl der Sicherheit gegeben. Was passierte mit den Backups aller Familiencomputer und Telefone auf seinem leistungsstarken Laptop, die über seinen Namen und sein Konto liefen? Weil es damals einfacher gewesen war wegen der Kreditkarte und er nicht daran gedacht hatte, dass auch er sterben könnte. Müssten alle Nummern gewechselt werden? Die Kinder würden es hassen, da sie sich doch so viele Kontakte auf Instagram und TikTok aufgebaut hatten. Oder verstand er wieder etwas falsch, wie in letzter Zeit so oft bei den neuen sozialen Medien?
Quatsch, da gab es bestimmt eine Lösung. Er war nicht der erste, der starb.
Was sollte mit den restaurierten Motorrädern passieren? Er wollte sie nicht abgeben. An irgendeinen, der sie nicht so liebte und verstand wie er. Auf keinen Fall. Warum gab es heute keine Grabbeigaben mehr? Früher wurden die Menschen doch auch mit ihren Pferden begraben.
Wer würde Zugriff haben auf die ganzen digitalen Fotoarchive auf dem Laptop, in denen es vieles gab, was er löschen sollte, bevor es in trauernde Hände fiel? Passwortübergabe auf dem Sterbebett oder Passwort verweigern? Dann hätten die Kinder keinen Zugriff auf all die Fotos ihres Heranwachsens, die Familienfeste, Schultheater, Geburtstage, all das, was man zur Dokumentation der Familiengeschichte wichtig fand und fotografisch festzuhalten versuchte. Den ganzen Computer seinem Freund übergeben, der das ganze verräterische Ding aussortierte und löschte, aufteilte wie einen Kuchen und nur einzelne Schnitten weitergab? Das hätte er sich alles früher überlegen müssen!
Die gesamten digitalisierten Dokumente, Urkunden, Zeugnisse. Er hatte sich viel Mühe gegeben, keine Papierkopien mehr aufzubewahren. Alles sollte nun weg sein? Ausgelöscht, zusammen mit ihm? Brauchte das noch jemand? Er hatte mal eine Familie gekannt, die beim vollständigen Abbrand ihrer Wohnung alles verlor. Sie standen in Pyjamas auf der Straße. Alles war zerstört. Aber irgendwie ging es dann trotzdem weiter.
Ambühl wollte nicht, dass es ohne ihn weiterging.
4.
In einem Frühjahr, Jahrzehnte zuvor, traf Ambühl Monica. Irgendwo in einem kleinen, verwinkelten Fischerdorf an der ligurischen Küste. Auf halsbrecherische Art auf die Klippen gepflastert, die, vom Meer umspült, den Blick auf einen kleinen Hafen freigaben. Die brennende Sonne des Südens im Gesicht und seine alte Triumph Bonneville zwischen den Beinen, raste er von der Stadt weg und wollte einfach nur allein sein. Alles vergessen, den Kopf und die Seele leeren. Vielleicht auch Neues erleben. Er hatte die komplizierten Beziehungen satt, das ganze Drum und Dran, das verbindet, trennt, schmerzt und zerreißt.
Er jagte über die Alpen, durch das Piemont, dem Meer und der Hitze entgegen. Berauscht von der Geschwindigkeit, dem Dröhnen und Vibrieren des alten Zweizylinders, bestand die einzige Herausforderung darin, die nächste Kurve schnell und schön zu fahren. Die Vollkommenheit der Fahrt brachte Ambühl mit sich selbst in Einklang. Sein Geheimnis bestand darin, nie an die Strecke zu denken, die schon hinter ihm lag.
So wie in Beziehungen, ging es ihm durch den Kopf, als er vier Gänge runterschaltete und in die Einfahrt einer Tankstelle einschwenkte. Da stand eine Frau neben ihrem VW Käfer Cabriolet und haderte damit, dass die Benzinausgabe über Mittag geschlossen war.
Ambühl selbst gefiel die italienische Art, Beschaulichkeit mit Bequemlichkeit zu verbinden und sich dem Permanentkonsum, an den wir uns nördlich der Alpen so gewöhnt haben, zu verweigern.
Monica schien daran keinen Gefallen zu finden. Sie wollte weiter, schien getrieben und voller Unrast. Notgedrungen ließ sie sich dazu überreden, bei „da Franco“, der einzigen Bar in der Nähe, einen Kaffee zu trinken, um sich gemeinsam die Wartezeit zu verkürzen. Ambühl sagte gleich, dass er sie nicht Monica nennen konnte, denn es habe früher bereits eine Monika in seinem Leben gegeben und das kleine C mache nicht wirklich einen Unterschied. Die Kurzform Mo fände er unbelastet und reizvoller.
Sie lachte und wollte gleich die ganze Geschichte von Monika hören. Und damit begannen sie, sich unbeschwert aus ihren Leben zu berichten, und stellten fest, dass sie aus der gleichen Stadt stammten und gemeinsame Freunde hatten. Zufällig getroffen und ohne gemeinsame Vergangenheit, fiel es ihnen leicht, von einem Thema ins nächste zu taumeln, sodass sich der Nachmittag heimlich in den frühen Abend verlängerte. Bald wurden Wein, Pasta und Grappa aufgetischt und es war klar, dass sie die Nacht in der kleinen, unscheinbaren Herberge im Ort verbringen würden. Das Bett war alt, durchgebogen und knarrte fürchterlich. Mo lag nackt vor ihm als er aus der Dusche trat. Sie habe keinen Pyjama dabei, sagte sie grinsend und bemerkte erstaunt, wie schüchtern und zögerlich sich Ambühl näherte.
Sonnenbrillenpoesie für zwei, drei Tage trieb die beiden über das Meer der Unvernunft, ohne Vergangenheit und Zukunft. Das Unbekannte im Wesen des jeweils anderen und die nur ungern eingestandenen Gegensätze produzierten eine Spannung, die in körperlicher Nähe kulminierte und sich dort verführerisch auflöste. Sie erzählten sich ihre Geheimnisse und schafften Vertrauen auf unsicherem Grund.
Es war wieder einmal eine Chance, sich neu zu definieren und zu geben. Beide spürten, dass es das war, was sie suchten. Sie wollten herausschlüpfen aus sich selbst, um eine andere Version ihres Lebens auszuprobieren. Wissen die Raupen eigentlich, dass sie zu Schmetterlingen werden, wenn sie ihren Kokon bauen, fragte sie Ambühl, als sie gemeinsam den Sonnenuntergang betrachteten.
Am Hafen von La Spezia trennten sich ihre Wege. Sie nahmen Abschied und sprachen absichtlich nicht darüber, was zu Hause sein könnte. Monica fuhr los, verschaltete sich und überfuhr dabei beinahe einen italienischen Geschäftsmann, der in gutem Tuch gekleidet und mit Aktenkoffer belastet über die Straße hastete. Ambühl setzte seinen mattschwarzen Helm auf, schwang das Bein über den Sattel, drehte den Zündschlüssel und drückte fast gleichzeitig auf den Startknopf des Motorrads, das sofort ansprang und einen bemerkenswerten Abgang ermöglichte.
Abgänge waren wichtig.
Das provokativ laute Knattern des Motors machte ihn stark und überspielte die Leere, die sich in ihm ausbreitete. Er hatte Angst vor der Rückkehr in die Stadt und davor, sie dort wiederzutreffen. Er wollte nicht aufwachen.
Ein paar Tage später trafen sie sich zu Hause, fanden es seltsam und klammerten sich trotzdem an das Erlebte. Ein halbes Jahr mogelten sie sich durch eine Beziehung in der absurden Hoffnung, dies sei die Fortsetzung der Begegnung in der Bar „da Franco“. Erst im Herbst, wieder zusammen im Süden am Meer unterwegs, merkten sie, dass das, was einmal zwischen ihnen gewesen war, tatsächlich nicht mehr existierte. An einem Strand auf Korsika hatten sie sich nichts mehr zu sagen. Ambühl hielt ihre Nähe, ihre Zärtlichkeiten nicht mehr aus, wurde wütend und aggressiv, als Monica mit ihm schlafen wollte. Eine ganze Nacht lang lag er wach im Zelt, lauschte den Wellen, die unaufhörlich ans Ufer schlugen und sich tosend an den Felsen brachen. Sie war nur eine Handbreit neben ihm und spürte ebenfalls, dass es nicht mehr Frühjahr war. Am nächsten Morgen fuhren sie schnellstmöglich nach Hause.
5.
Seine heutige Beziehungssituation war komplex, wie er zu sagen pflegte. Nach genügend Alkoholkonsum und unter Freunden benutzte er Begriffe wie verschissen, ausweglos, zum Kotzen und beschämend, um zu beschreiben, wie es ihm dabei ging.
Mehrere Frauen waren involviert.
Da war die langjährige Beziehung mit Sabine, mit der Ambühl auch Kinder hatte. Das Familiending, das neben der Arbeit seinen Alltag, den Kontostand, die Ferienpläne, das tägliche Morgenritual und die meisten Abende bestimmte. Dazu gehörten die gewichtigen Schwieger- und Großeltern, Tanten, Onkel und, je länger, desto mehr, zusätzliche Nichten, Neffen, Cousinen und Cousins. Sie besaßen, seit sie sesshaft geworden waren, ein Haus mit großer Hypothek und kleinem Garten, dazu einen geleasten Familienwagen.
Lange schlafen, essen und trinken, Ausflüge und Besuche bei Freunden dominierten die Wochenenden. Unter der Woche ging es neben der Arbeit vor allem darum, dass der Tagesablauf für alle gut funktionierte. Organisieren, planen, kochen, einkaufen, plaudern, Hausaufgaben machen und sich über die Erlebnisse des Tages austauschen. Dazwischen die Kinder zum Musik- und Tanzunterricht chauffieren, mit ihnen am Frauenpilatesabend zu lange fernsehen und dafür gescholten werden und ab und zu an einem Abend selbst mit Freunden weggehen. Das alles waren keine exklusiven Aktivitäten. Sie hätten genauso gut mit und neben einem anderen Partner stattfinden können. Nur der immer weniger werdende Sex war vordergründig exklusiv.