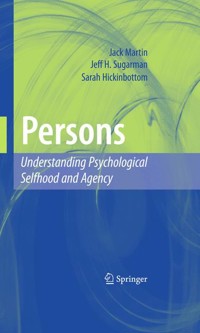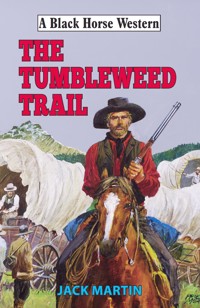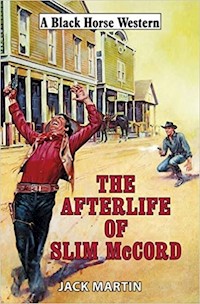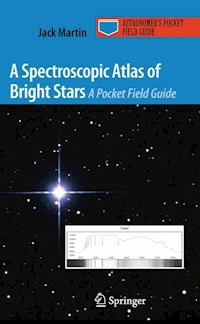5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wissen Sie, wo Ihre Kinder heute Nacht sind?
Die Straßen sind wie ausgestorben. Die Schatten werden länger, und die Nacht bricht herein.
Es ist Halloween!
Fürchterliche Schreie gellen durch die Straßen. Grinsende Totenschädel und groteske Gestalten schleichen durch die Dunkelheit...
Es ist die Nacht von Halloween, und diese unheimlichen Spuk-Gestalten sind nur Kinder, die ihren Spaß haben wollen.
Doch diese Nacht... ist anders.
Sie wird für viele die letzte sein...
Halloween IIII – Die Nacht der Entscheidung verzichtet darauf, die Geschichte des Killers Michael Myers weiterzuerzählen: Stattdessen besinnt sich Autor Jack Martin auf die Grundelemente des Halloween-Mythos (nach dem Horror-Film Halloween III – Season Of The Witch von Tommy Lee Wallace aus dem Jahr 1982) und präsentiert einen höchst eigenständigen modernen Zombie-Thriller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
JACK MARTIN
Halloween III -
Die Nacht der Entscheidung
Roman
Apex Horror, Band 10
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
HALLOWEEN III – DIE NACHT DER ENTSCHEIDUNG
Prolog
Erster Teil: Die Nacht, in der er wieder heimkehrte
Zweiter Teil: Ein Feuer in der Nacht
Dritter Teil: Irgendetwas stimmt nicht in Santa Mira
Vierter Teil: Demaskierung
Fünfter Teil: Endfertigung
Sechster Teil: Das letzte Halloween
Epilog
Das Buch
Wissen Sie, wo Ihre Kinder heute Nacht sind?
Die Straßen sind wie ausgestorben. Die Schatten werden länger, und die Nacht bricht herein.
Es ist Halloween!
Fürchterliche Schreie gellen durch die Straßen. Grinsende Totenschädel und groteske Gestalten schleichen durch die Dunkelheit...
Es ist die Nacht von Halloween, und diese unheimlichen Spuk-Gestalten sind nur Kinder, die ihren Spaß haben wollen.
Doch diese Nacht... ist anders.
Sie wird für viele die letzte sein...
Halloween IIII – Die Nacht der Entscheidung verzichtet darauf, die Geschichte des Killers Michael Myers weiterzuerzählen: Stattdessen besinnt sich Autor Jack Martin auf die Grundelemente des Halloween-Mythos (nach dem Horror-Film Halloween III – Season Of The Witch von Tommy Lee Wallace aus dem Jahr 1982) und präsentiert einen höchst eigenständigen modernen Zombie-Thriller.
HALLOWEEN III –
DIE NACHT DER ENTSCHEIDUNG
»Sofern es überhaupt einen Weg gibt, etwas zu verbessern,
so besteht er nur darin, dass man sich das Schlimmste genau ansieht.«
- Thomas Hardy
»Es war meine Absicht, einen Bericht über die Ereignisse für mich
und eine kleine Gruppe von Freunden niederzuschreiben –
und ich entdeckte sehr bald, dass das, was uns geschah,
allen Menschen widerfuhr.«
- Kenneth Patchen, The Journal of Albion Moonlight
Prolog
Challis war tot.
»ACHT TAGE NOCH BIS HALLOWEEN, BIS HALLOWEEN, HALLOWEEN...«
Dünne und blecherne Kinderstimmen schwebten herein, schlängelten sich vom Korridor hinein in das helle Licht, hallten von den sterilen Wänden wider und klangen wie gehämmertes Silber über den geneigten Kopf des Mannes in dem weißen Laborkittel.
Aber der rührte sich natürlich nicht.
»ACHT TAGE NOCH BIS HALLOWEEN...«
Der eindringliche Refrain, der albern zu der Melodie von London Bridge Is Falling Down gesungen wurde, war einige wenige Momente lang überall und übertönte sogar die Lautsprecher, die aufgehängt worden waren, um in dem Krankenhaus rund um die Uhr überall ein niemals enden wollendes Gedudel zu verbreiten. Challis hatte in der letzten Zeit immer mehr den Eindruck gehabt, dass die ganze Welt voll davon war.
Heute Nacht aber spürte er keinen Schmerz.
»...SILBER-KLEEBLATT!«
Als der Reklamespot endlich vorbei war, folgten ihm sofort ein paar Takte von etwas, das wie die Vorstellung klang, die man sich in der Madison Avenue von einem irischen Tanzlied machte. Dann verklang auch das, und ein süßlicher Schwall von nichtssagender, unverbindlicher instrumentaler Pop-Musik überflutete wieder alles. Es klang zähflüssig und schwermütig wie von Nebel gedämpfte Glocken, war mühelos anzuhören und verlangte nichts als passiven Konsum. In einer solchen Nacht hätte vermutlich sogar Challis sie als beruhigend empfunden. Es war die Musik des barmherzigen Vergessens.
Challis war nach vorn gesunken, und seine Stirn ruhte verzerrt auf der synthetischen Maserung eines Tisches im Personal-Aufenthaltsraum. Außer ihm war niemand da. In weiter Entfernung war dumpf eine Glocke zu hören. Ein Wagen aus vollkommen nahtlosem Stahl wurde durch die Gänge geschoben und knarrte leise, irgendwo quietschten Gummisohlen auf dem gebohnerten Boden, direkt darauf folgten knappe, geschäftsmäßige Stimmen, so brüchig und kalt wie Fensterglas, und aus einem anderen Teil des Gebäudes wehte das Geräusch von sich öffnenden und schließenden Türen herein.
Um diese Zeit, kurz bevor der größte Teil des Krankenhauspersonals nach der Pause die Schicht wechselte, hatte ihn noch niemand entdeckt.
Challis hätte es nicht besser planen können - selbst wenn er es versucht hätte.
Vor ihm hing ein Fernsehgerät von der Decke herab, das an die Videoanlage des Krankenhauses angeschlossen war. Der Ton war abgeschaltet, und ein schlecht eingestelltes Bild rollte von oben nach unten wie ein Mikrofilm-Lesegerät, das außer Kontrolle geraten war.
Sonst rührte sich nichts.
Nun aber war ein neues Geräusch zu hören. Es kam aus der Beleuchtung und klang, als sei ein Insekt hinter den Platten der Decke gefangen. Das Summen hielt einige Sekunden lang an. Dann surrte plötzlich eine der Neonröhren und ging aus, als hätten sich dunkle Flügel über diesen Teil des Raums gelegt.
Draußen vor dem Fenster blitzte es grell.
Sofort gingen auch die restlichen Lichter aus. Das flackernde Bild auf dem Fernsehschirm zuckte kurz auf und schrumpfte zu einem winzigen Punkt zusammen, ein einzelnes glühendes Auge, das sich schnell in einen Tunnel zurückzog, bis es ganz verschwunden war.
Der Raum versank in Dunkelheit.
Regen, beleuchtet von Autoscheinwerfern, prasselte an die Fenster. Einzelne Tropfen blieben an den Scheiben hängen, schienen in der Luft zu schweben und sich zu drehen, und jeder von ihnen zeigte wie eine Linse die Autos, die draußen auf der Straße vorbeifuhren. Nach kurzer Zeit flössen sie zusammen, rannen in Strömen an dem Glas herab und verwischten das Bild.
Der erste Donnerschlag ließ die Wände erzittern, und die Vibration erweckte die kalten Neonröhren wieder zum Leben. Die Lampen an der Decke wurden ohne eine bestimmte Reihenfolge wieder hell. Sie leuchteten hier und da in beliebiger Ordnung auf, bis das alte Schachbrettmuster an der Decke wiederhergestellt war.
Challis' Arm schien in dem eigenartig flackernden Licht auf dem Tisch zu zucken. Sein Kopf schien sich unsicher ein Inch, zwei Inches zu heben.
Draußen im Gang rannte jemand.
Die Tür wurde aufgestoßen.
Eine Krankenschwester stand mit auf die Hüften gestützten Händen im Eingang. Sie zögerte, bevor sie ganz hereinkam. Sie war nicht mehr die Jüngste, hatte sich mit ihrem Übergewicht abgefunden und trug auf ihrem Gesicht ständig den Ausdruck einer Frau, die genug Falsches und Abstoßendes für zwei Leben gesehen hat.
»Doktor? Fehlt Ihnen etwas?«
Sie stockte, warf einen Blick zurück auf die Unruhe im Gang und traf eine Entscheidung. Sie ging zwei Schritte weit in den Raum hinein.
»Sind Sie das, Dr. Challis?« Ihr Gesicht entspannte sich etwas. »Wie hat Ihnen das Feuerwerk gefallen? Noch eine von den kleinen Prüfungen des Lebens - ausgerechnet ein Stromausfall. Als hätten wir nicht sowieso schon Probleme genug, über die wir uns den Kopf zerbrechen müssen. Gottseidank hat sich ja der alte Not-Generator eingeschaltet, aber ich weiß wirklich nicht, wie lange Mr. Garret ihn noch... Dan? Fehlt Ihnen etwas?«
Sie spitzte ihre Lippen und durchquerte den Raum. »Der arme Mann. Wie üblich wieder zu viel gearbeitet.« Sie seufzte müde. »Na ja, heutzutage geht es wohl niemandem besser. Fast hat man das Gefühl, als wäre das Ende der Zeiten gekommen. Sie auf jeden Fall sehen jetzt schon tot aus.«
Sie hob ihren Arm und drehte an einem Knopf an dem Fernsehgerät. Das Bild lief nun nicht mehr durch, verschwand aber sofort hinter einem wilden Schneegestöber. Sie schlug mit der flachen Hand an die Seite des Geräts. Das Bild wurde daraufhin scharf. Es waren die Sieben-Uhr-Nachrichten mit Robert Mundy, dem aalglatten lokalen Fernsehreporter.
Sie stellte die Lautstärke ein.
»...UND SPÄTER WIRD TRINA IHNEN IN IHRER SPEZIAL-LIVE-SENDUNG ZEIGEN, WIE SIE AUS EINEM EINFACHEN KARTENTISCH EINE TAFEL MIT EINER PRACHTVOLLEN UND ELEGANTEN MAHLZEIT MACHEN KÖNNEN! AUSSERDEM WERDEN WIR IHNEN DIE LETZTEN EINZELHEITEN ÜBER DIESEN AUSSERGEWÖHNLICHEN FALL VON VANDALISMUS DRÜBEN IN MERRY OLD ENGLAND BERICHTEN. ZUNÄCHST ABER MÖCHTE ICH IHNEN DIE FOLGENDE WICHTIGE INFORMATION BRINGEN.«
Die Schwester legte ihre fleckige Hand auf das Genick von Challis.
Am Fernseher füllte ein grinsendes Hexengesicht den Schirm. Die faltige Haut glitzerte, und die Hexe schob ihre Nase voller Warzen direkt vor die Kamera und sah durch das Schneegestöber auf dem Bildschirm in den Raum. Es sah grotesk aus.
»Also, diese Masken«, sagte die Schwester angewidert. »Dieses Jahr sind sie einfach zu weit gegangen - sie sind zu realistisch.« Sie schüttelte sich. »Ich wünsche mir nur, wir könnten uns beeilen und Halloween hinter uns bringen. Ein widerlicher Feiertag! Nichts als Schwierigkeiten für die Kinder - für uns alle. Unchristlich ist das.«
»ACHT TAGE NOCH BIS HALLOWEEN...«
Das Bild begann wieder durchzulaufen, als ein neuer Blitz grell draußen am Himmel aufzuckte. Der Werbespot löste sich in rollende Bilder auf, aber der Chor von grellen Kinderstimmen ertönte weiter eindringlich aus dem quäkenden Lautsprecher.
»HAL-LO-WEEN, HAL-LO-WEEN...«
Wieder ließ ein Donnerschlag die Wände erzittern. Ein Teil der Lichter ging aus, und diesmal blieben sie es auch, weil das kleine Notstromaggregat des Krankenhauses es nur mit Mühe schaffte, die Hälfte der vorherigen Energie zu liefern.
Challis rührte sich in der trüben Beleuchtung. Unter seinem weißen Kragen schwoll sein Hals zornig an.
Erschrocken riss die Schwester ihre Hand weg.
»Geben sie denn nie auf?«, brüllte er los.
»ACHT TAGE NOCH BIS HALLOWEEN...«
»Machen Sie den Scheißkasten aus!«
Die Schwester fasste sich wieder. »Ja, selbst... selbst-verständlich.« Sie streckte ihren Arm nach oben und drehte den Ton ab.
»Aus habe ich gesagt! Sofort! Könnten Sie mir diesen kleinen Gefallen vielleicht tun, Agnes?«
Hastig drehte sie an dem Knopf, und das Bild löste sich auf und verschwand von dem Schirm.
»Danke, Agnes. Vielen Dank.«
»Es geht einem wirklich auf die Nerven, nicht wahr?«, sagte sie mitfühlend. »Dan, es ist bereits nach sieben Uhr. Ich habe nichts von Ihnen gehört und angefangen, mir Gedanken über Sie zu machen.«
»Ich weiß, ich weiß.« Challis rieb sich das Gesicht, als wolle er sich Spinnweben davon abwischen. »Tut mir wirklich leid, Agnes. Ich muss eingenickt sein.«
»Sie meinen wohl eher, Sie sind vor Erschöpfung bewusstlos geworden.« Sie stellte sich hinter ihn und begann, seine verkrampften Schultern durch seine Jacke zu massieren.
Er schien es nicht zu bemerken. Er legte seine Hände vor seine Augen und seufzte tief. »Sie sagen mir da nichts Neues. Mein Gott, das scheint allmählich zu einem regelmäßigen Bestandteil meiner Arbeit hier zu werden, nicht? Sagen Sie mir die Wahrheit, Agnes. Auf Sie kann ich mich verlassen. Sie sagen immer die Wahrheit, oder?«
»Nun, ich kann dazu nur sagen, niemand kann so lange ununterbrochen Dienst tun, ohne früher oder später den Preis dafür zahlen zu müssen.« Ihre Stimme nahm einen mütterlichen Tonfall an und klang zur gleichen Zeit vorwurfsvoll und besorgt.
»Alles«, sagte Challis nüchtern, »hat seinen Preis. Das wusste ich vorher. Aufgehalten hat es mich allerdings nicht, oder? Nein, doch mich nicht!« Voll Bitterkeit ließ er seine Stimme ersterben. Er schnaubte, um den Kloß in seinem Hals loszuwerden.
Mit überraschender Zärtlichkeit sagte die Schwester: »Wissen Sie, manchmal ist es die Sache nicht wert, den Preis dafür zu bezahlen. Haben Sie sich das schon einmal überlegt?«
»Das habe ich, Agnes, das habe ich wirklich. Sechs Monate lang habe ich mir das Tag und Nacht überlegt. Sogar noch länger, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Eigentlich seit dem ersten Jahr meiner Ehe mit Linda. Was sagen Sie dazu? Nach einer Weile habe ich nichts anderes getan, als zu überlegen. Nicht einmal schlafen konnte ich.«
»Und hat sich das jetzt gebessert?«
Darauf wusste Challis keine Antwort.
Von der Straße klang das Geräusch von Hupen herein, auf das eine Sirene folgte. Ein roter Lichtstreifen wischte über die nassen Scheiben.
»Also«, sagte Agnes schließlich und massierte mit ihren starken Daumen tief in seine Nackenmuskeln, »ich meine, es wäre Zeit, dass Sie heimgehen. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber ich glaube, wir können ein paar Stunden auch ohne Sie auskommen.«
»Heim?«, sagte Challis bitter. »Welches Heim?, Ich weiß, ich weiß, wie man sich bettet, so liegt man. War es das nicht, was Sie gerade sagen wollten?«
»Nun, wie hat doch der Herr damals zu Pilatus gesagt: Das waren deine Worte, nicht meine.«
»Zumindest habe ich ein Bett. Selbst wenn es nur eine Matratze auf dem Boden ist.«
Die Schwester ließ ihre Hände von seinem Hals herabsinken und schüttelte hinter seinem Rücken ihren Kopf. »Na, na, nur kein Selbstmitleid!«
»Sonst hat ja niemand Mitleid mit mir«, fuhr er sie an.
Er machte wieder ein versöhnlicheres Gesicht und drehte sich zu ihr um. Seine Wirbelsäule krachte dabei wie zerbrechende Salzstangen.
»Mensch, Aggie, Sie sind die einzige, mit der ich mich unterhalten kann. So, ich weine also wieder in mein Bier? Warum zum Teufel auch nicht? Das frage ich Sie ganz im Ernst.« Er versuchte ein Lächeln. Es kam tapfer, aber schief heraus. »Agnes, sagen Sie mal, haben Sie nicht irgendwo ein schönes kaltes Bier für mich versteckt? Das wollten Sie mir doch gerade sagen, nicht? Ich weiß es genau. Ich habe einen Geschmack im Mund wie eine Bettpfanne.«
Die Schwester versuchte zwar ihr Bestes, es zu unterdrücken, dennoch blitzten ihre Augen. »Machen Sie, dass Sie hier rauskommen, Daniel Challis. Und zwar sofort!«
»Wollen Sie sich heute Abend mit mir besaufen, Agnes?«
»Ich dachte, heute Abend besuchen Sie Ihre hübschen Kinder.«
Er ballte eine Faust und schlug sich damit an die Stirn. »Herrgott nochmal, Sie haben Recht.« Er seufzte heiser. »Das bedeutet, dass ich noch etwas für sie einkaufen muss. Noch ein Friedensangebot. Das hört einfach nie auf. Als ich noch bei ihnen gewohnt habe, habe ich nie so viel Geld für sie ausgegeben.«
»Sie wollen nicht Ihr Geld«, sagte sie vorwurfsvoll. »Sie wollen Sie.«
»Bitte verschonen Sie mich.« Er zog seinen Ärmel zurück und sah auf die Uhr.
»Sie wollen ihren Vater, wissen Sie das nicht? Das ist alles. Sie...«
Er stand abrupt auf. »Es geht jetzt nicht mehr darum, was sie wollen oder was sie nicht wollen.« Er knöpfte seinen weißen Kittel auf und ging auf die Tür zu. »Ihre Mutter ist jetzt die Vermittlerin. Sie ist schlimmer als ihr Rechtsanwalt, der verdammte Zuhälter. Die beiden werden nicht zufrieden sein, bis ich meine Körperteile verkauft habe, damit es ihnen gutgeht. Und wissen Sie was? Selbst dann werden sie noch nicht genug haben und glauben, ich habe irgendwo noch etwas versteckt.« Er stand nun im Gang. »Bis Morgen früh, Agnes. Sie wissen ja, wo Sie mich finden können, falls sich ein Notfall ergibt.«
»Im Haus, Dan?«, fragte sie hoffnungsvoll. »Die Nummer weiß ich auswendig. Ich könnte wetten, Linda freut sich so, Sie wiederzusehen, dass...«
»Im Apartment, Agnes, im Apartment. Ich wohne nicht mehr in dem Haus. Tun Sie mir den Gefallen und denken Sie daran.«
»Aber es ist doch trotzdem noch Ihr Haus. Ich bin sicher, wenn Sie dort wohnen wollten, dann...«
»Ich bin auch sicher«, unterbrach er sie. »Ich bin sicher, verstehen Sie? Es ist ja auch egal. Benutzen Sie den Piepser, das ist einfacher.«
Sie sah ihm nach, als er fortging.
»Der arme Mann«, flüsterte sie traurig. »Der arme, dumme Mann. Sie sind doch alle gleich. Sie lernen es nie.« Der Regen lief wie Tränen an den Fenstern herunter und warf wellige Schatten auf ihr Gesicht. »Und wenn sie's endlich kapiert haben, ist es zu spät.«
Sie schloss ihre Augen und hob ihr Gesicht in dem leeren Raum zur Decke hoch.
»Er ist ein guter Mann, Jesus«, sagte sie. »Nimm ihm die Schuppen von den Augen und lass ihn sehen und fülle sein Herz mit Deinem Wort, damit er darauf hört, bevor es zu spät ist, zu spät für uns alle. Dieser Mann ist wichtig. Er kann etwas ändern. Das glaube ich fest...«
Erster Teil: Die Nacht, in der er wieder heimkehrte
1.
Das Licht der Scheinwerfer bohrte sich in die Straße wie zwei Eispickel.
Challis ließ die Hauptstraße hinter sich und fuhr quer durch die Stadt zur Chestnut. Der Regen hatte nachgelassen, aber die Scheibenwischer zuckten weiter über die Windschutzscheibe und versuchten, sein Gesichtsfeld sauberzukriegen. Nun begannen sie, über das Glas zu springen, und die Wischerblätter rissen bei der sinnlosen Anstrengung ein. Er gab es auf und schaltete den Wischer ab.
Es war Sonntagabend, und praktisch jedes Geschäft hatte bis morgen früh geschlossen. Die einzigen potentiellen Lebenszeichen, an denen er vorbeifuhr, waren ein Schnellimbiss, eine Terrible-Herbst-Münztankstelle, ein Weenie Wigwam Drive In-Restaurant und ein Waschsalon, in dem schemenhafte Schlafwandler-Gestalten in Zeitlupe und wie unter Wasser zwischen gähnenden Waschmaschinen und Trocknern umherglitten und sich in der Nacht mit leicht beunruhigenden Bergen von schmutziger Wäsche abmühten. Als er an dem beschlagenen Schaufenster vorbeifuhr, tauchte eine längliche Gestalt von scheinbar unmöglicher Größe aus den Tiefen des Waschsalons auf und wurde in dem unangenehmen grünen Licht, das von den Münzautomaten auf sie fiel, immer größer.
Challis gab Gas und ließ die Gegend hinter sich. Seine Unruhe wurde immer stärker, als er näher zur 10th Avenue und seiner letzten verbleibenden Hoffnung kam.
Nur sie blieb ihm noch. Sonst hätte er sich Linda und den Kindern mit leeren Händen ausliefern müssen.
Kinder, dachte er. Sie vergessen nichts - dazu sind sie zu jung - und deshalb vergeben sie auch nichts. Sie sind die einzigen wirklich unzivilisierten Wesen, die es auf der Welt noch gibt, eine besondere Rasse, ein primitiver Stamm mit seinen eigenen Gesetzen. Wie Linda. Sie hat es zugelassen, dass sie sich auf ihre Ebene zurückentwickelt hat, ohne sich dabei die Mühe zu machen, auch einige von ihren Tugenden zu erwerben. Irgendwann während dieser Entwicklung ist sie zu einer schönen Frau geworden, der man eine Stahlstange in den Arsch geschoben hat, die bis zum Gehirn reicht. Sie kann sich nicht einen Zentimeter weit beugen, weil sie das umbringen könnte. Sie könnte ihren Schließmuskel entspannen und die Stange herausgleiten lassen, wann immer sie das will. Sie will es aber nicht. Das ist ihre Entscheidung, und ich kann es ihr einfach nicht vergeben.
Bella und Willie wachsen im Gegensatz dazu ständig weiter. Es sei denn, es gelingt ihr, ihnen auch eine Stahlstange in den Arsch zu schieben. Mit ihrer Hilfe werden sie schon gerade werden - kleinkarierte Faschisten werden sie sein, die voller Intoleranz ihre Schnellgerichte abhalten und unmenschlich starre Urteile fällen. Wie Maschinen.
Ich muss zusehen, dass ich dort hinkomme, dachte er, damit sofort, heute Abend noch, etwas wirkliches Leben durch dieses Haus weht, ganz gleich, was geschieht. Falls es nicht schon zu spät ist.
Er sah angestrengt nach vorn und suchte den Supermarkt, der seine letzte Chance war. Die schließen doch niemals, dachte er, das ist doch richtig, oder? Raul ist Tag und Nacht da, jedes Mal, wenn ich dort hineinschaue. Er hat sicher etwas. Etwas, damit ich nicht mehr zu zappeln brauche und die Kinder mich nicht für den Geizkragen halten, als den mich ihre Mutter ständig bei ihnen hinstellt.
Der Himmel über den Bäumen klarte sich auf, und das Neonlicht des Supermarkts tauchte aus dem Nebel auf.
Na, Gottseidank, dachte er und ging vom Gas. Ich bin also doch noch gerettet. Zumindest hoffe ich das.
Als er am Bordstein stoppte, sah er hinter dem Glas Rauls Rücken. Er stand über den Ladentisch gebeugt und studierte ein Automagazin. Dampf stieg von dem Neonlicht auf, und der Parkplatz glänzte schwarz wie die Kriechspur einer Schnecke. Challis zog die Handbremse an, ließ den Motor laufen und lief hinein.
Als er die Tür auf drückte, rasten zwei Autos wie Rennwagen mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz und kamen auf dem Bürgersteig zum Halten, so dass ihre Chromstoßstangen nur Zentimeter von dem Schaufenster entfernt waren. Ein Marshal-Tucker-Tape dröhnte aus dem Inneren von beiden Autos heraus. Stereo, dachte er. Er ging durch die Tür.
In diesem Augenblick hörte er Schritte an der Hinterseite des Parkplatzes.
Zwischen den Bäumen trat eine ungewöhnlich große Person - Frau oder Mann? - hervor und kam mit langsamen, merkwürdig regelmäßigen Schritten näher. Bevor sie aber den Lichtschein aus dem Schaufenster erreicht hatte, ging bei einem der Autos eine Tür auf und blockierte ihm die Sicht. Challis verlor das Interesse, ließ die schwere Ladentür hinter sich zufallen und wendete sich dem hellerleuchteten Laden zu.
Er ignorierte den Zeitschriftenstand und die Regalreihen mit Wein und Delikatessen und ging direkt zu der Geschenkabteilung. Er hegte die leise Hoffnung, dort wider Erwarten ein Mitbringsel für ein neunjähriges Mädchen und einen siebenjährigen Jungen zu finden. Am besten für beide. Richtig, so erinnerte er sich selbst, ich muss etwas für beide finden, oder sie werden mir damit nie die Ruhe lassen. Wenn ich nur ein Geschenk mitbringe, werden sie es vor meinen Augen in zwei Stücke reißen, und dann hat keiner etwas davon. Dann wäre es schon fast besser, wenn ich ohne etwas käme.
Er kam zu einem Regal mit Frisbees, die wie mit Leuchtfarben gestrichene Pizza-Teller aussahen, in Plastik verpackte Bündel von reduzierten Comics, Gummi-Wärmflaschen, Wegwerfwindeln für Kleinkinder, den neuesten Aluminium-Töpfen aus Hongkong und einer halben Reihe mit der letzten Neuheit, die sich Raumfährenschuhe nannte.
Er machte einen der Kartons auf.
Es waren Rollschuhe mit durchsichtigen Rädern und Bildern des Space Shuttles Columbia auf der Seite. Der Karton versprach, dass in jedes Paar ein Transistor-Radio eingebaut war. Die Zukunft hat schon begonnen. Nicht schlecht, dachte er. Natürlich absurd. Aber gar so schlecht auch wieder nicht. Das könnte ihnen gefallen.
Welche Größe?, fragte er sich in plötzlicher Panik. Augenblick mal, vielleicht gibt es nur drei Durchschnittsgrößen. Wahrscheinlich brauchen sie beide Medium, oder? Oder nein, Willie braucht wahrscheinlich die kleinste Größe und Bella Medium. Oder vielleicht sind sie ja nach Alter ausgezeichnet. Er suchte in dem Regal herum.
Dann sah er den Preis.
Damit ist die Sache erledigt, dachte er. Mit den Space-Shuttle-Schuhen würde er bis zu einer wichtigeren Gelegenheit wie einem Geburtstag warten. Oder einer Gehaltserhöhung. Falls er dann noch lebte.
Was wünschst du dir denn zu Weihnachten, Bella?
Space-Shuttle-Schuhe, Daddy! Bitte, bitte!
Space-Shuttle-Schuhe? Aber natürlich, mein Liebling. Ich weiß auch schon, wo ich sie kriegen kann. Wenn deine Mutter sie dir nicht schon gekauft hat.
Er knirschte mit den Zähnen und ging zur Kasse.
Raul war gerade damit beschäftigt, Zigaretten, Dosenfleisch und Strumpfhosen für eine angemalte Alabaster-Schlampe in die Kasse einzutippen. Hinter ihr trugen zwei Typen, die aussahen, als hätten sie bei Tag mit schwerer Maschinerie zu tun, schwer an je zwei Kartons mit sechs Dosen Old English 800. Challis schlurfte mit seinen Schuhen auf dem Boden und stellte sich in der Schlange an.
Die Lichter des Ladens schienen mit einem fast spürbaren Druck auf ihn herab. Er drückte sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel. Die zwei vor ihm unterhielten sich.
»...Und da sagt sie: Nicht aufhören, mein Hengst, das machst du wie eine Maschine!«
Der erste Mann, dem sein Schnurrbart so weit über seine dünnen Lippen hing, dass Challis sich fragte, wie er wohl aß (mit einem Strohhalm?), stieß seinem Freund in die Rippen und heulte los.
»Mensch, da war vielleicht was los!«, sagte der Freund und lachte wiehernd.
Wie eine Maschine. Ganz genau, dachte Challis. So wollen sie heutzutage sein: so sehr wie eine Maschine, wie sie es nur irgendwie schaffen können. Aus unerfindlichen Gründen haben manche Menschen Freude daran, so maschinenähnlich zu sein, wie die Gesetze es erlauben. Es ist eine alte Geschichte. Sie geht zurück bis auf den Stechschritt und die ganze Mystik des Militärs. Nein, es geht weiter zurück, viel weiter. Menschen, die sich wie Maschinen benehmen, Maschinen, die Menschen imitieren. Schick. Echt schick. Der letzte Schrei. Überall um uns herum wächst es, das Vierte Reich, wie Smog und Inflation. Worum geht es dabei eigentlich wirklich?, frage ich mich.
Challis atmete tief ein, um einen klaren Kopf zu bekommen. Seine Augen wanderten umher.
Über Raul war in der Ecke eine Video-Kamera montiert. Sie wanderte langsam über den Bereich bei der Kasse und machte alles und jeden zu einem potentiellen Fahndungsphoto. Bitte lächeln, dachte Challis, Sie treten in Vorsicht, Kamera auf. Eine Sekunde lang durchzuckte ihn die verrückte Idee, dem Beobachter eine Grimasse zu schneiden. Der Beobachter, dachte er, beobachtet mich, wie ich ihn beobachte, wie er mich beobachtet, und so weiter bis in die Unendlichkeit. Wie Spiegel. Der Gedanke ließ ihn schwindlig werden. Er zwang sich, woanders hinzusehen.
Er hörte ein leises Ping!, als die Schlampe hinausging und dabei an einem elektronischen Auge vorbeikam. Mein Gott, dachte er, während das vertraute Geräusch ihm noch hohl in den Ohren klang, ich habe ein Gefühl, als wäre ich noch immer im Dienst. Es ist eigentlich kein Unterschied. Ich komme einfach nicht aus dem Krankenhaus heraus; es begleitet mich, wohin ich auch gehe; ich trage es in mir. Deshalb kann ich auch nie Frieden finden.
Okay, versuchte er sich einzureden, irgendwie muss man seinen Lebensunterhalt wohl bestreiten.
Genau. Ein Lebensunterhalt. Und dafür gibt man das Leben.
Die Tür schloss sich flüsternd, und ein Luftzug wehte ihm lose Schlangen aus Krepp-Papier an den Kopf. Gelbrot und schwarz. Aus einer geschwungenen Schlange war eine Hexe auf einem Besenstiel ausgeschnitten, die zu einer weichen Landung auf einer Pyramide aus Kosmetik-Papiertüchern ansetzte. Er lächelte freudlos. Es fiel ihm unwillkürlich auf, dass die Hexe eine deutliche Ähnlichkeit mit Linda aufwies.
Halloween. Es kam immer näher - es war hier - und nichts konnte das aufhalten. Als ob all die Reklamefachleute mit all ihrem Geld uns das vergessen lassen könnten. Dazu schien dieses Halloween so viel bedrückender und kommerzieller zu sein als je zuvor. Vielleicht war es ja schon immer so gewesen, aber er hatte es bisher nur noch nicht bemerkt.
Halloween, dachte er, ist eine Philosophie. Es ist immer da. Zu anderen Zeiten zeigt sich bloß die wahre Hässlichkeit ihrer Geldgier nicht gar so überdeutlich.
Die Typen mit dem Bier gingen hinaus. Jetzt war er an der Reihe. Er trat vor und musterte das Regal an der Kasse. Da war nichts als Fernsehzeitschriften, Zigarren und Pakete mit Bic-Wegwerfkugelschreibern, Bic-Wegwerf- Feuerzeugen und Bic-Wegwerf-Rasierapparaten, das übliche. Nichts, was ein Kind interessieren könnte.
»Hallo, Raul«, sagte Challis. »Wie geht's?«
»Kann mich nicht beklagen.«
Der Mann sah an Challis vorbei, als würde er ihn nicht erkennen, oder als wollte er es nicht. »Was suchen Sie heute Abend?«
Das, dachte Challis, wäre zu viel verlangt. Frag' lieber nicht.
»Meine Kinder. Sie haben Geburtstag«, log er. »Ich wollte nur noch schnell eine Kleinigkeit mitnehmen, bevor ich heimfahre. Was könnten Sie mir empfehlen?«
Raul zeigte mit einer großspurigen Handbewegung auf die Regale. »Suchen Sie sich was aus. Alles gute Ware. Genau das, was der Arzt verschrieben hat.«
Challis ignorierte die unbeabsichtigte Ironie. »Sehen Sie mal, das ist so, ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Besonderes, wissen Sie. Heute Abend sind nicht mehr allzu viele Läden offen.«
»Wir sind der einzige«, sagte Raul. »Was Sie sehen, ist alles, was Sie kriegen können.«
Das kann noch Stunden so weitergehen, dachte Challis. Eine Pseudo-Konversation, die nicht durch Inhalt belastet wird. Er ist programmiert. Es ist so, als würde er mich gar nicht sehen. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich ganz genauso bin wie alle anderen, die hierherkommen, die Müden, die Verzweifelten, die Irren in Freiheit. Was macht es für jemanden schon aus, der in einem solchen Supermarkt arbeitet, wer man ist? Und welche Bedeutung hat er denn für mich? Und welche Bedeutung hat überhaupt eine beliebige Person für eine andere, da wir schon dabei sind? Sie wählen und zahlen. Das ist nur dann anders, wenn es gelingt, einen menschlichen Kontakt herzustellen, und davon gibt es in der letzten Zeit nicht mehr genug.
Challis sah sich die Süßigkeiten und die letzten Neuheiten für Kinder an. Kaugummi in Form von winzigen Mülleimern, Goldnuggets oder Hamburgern. Die letzten Tauschkarten aus Krieg der Sterne mit einem süßen kleinen Roboter auf dem Umschlag. Ein Glasschrank voller Polaroid-Kameras und Radios oder Feuerzeuge - er konnte nicht erkennen, was es nun wirklich war -, die aussahen wie Bierdosen oder Limonade-Flaschen, eine Kopie eines Schweizer Offiziersmessers aus Taiwan. Mein Gott, dachte er, das ist alles Schund. Linda würde es nie zulassen, dass so etwas in ihr Haus kommt. In ihr perfektes Haus.