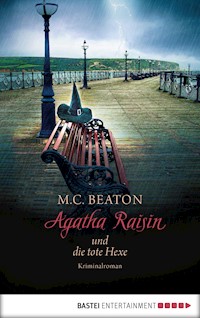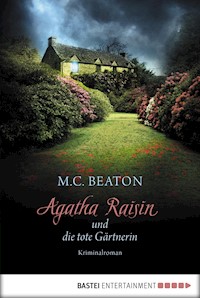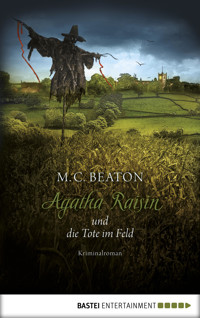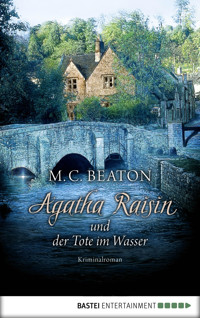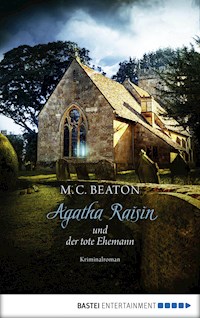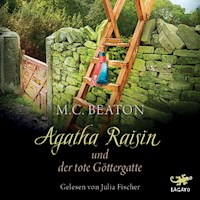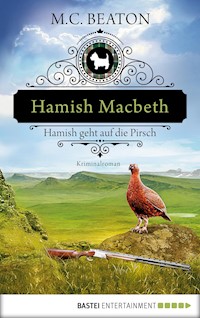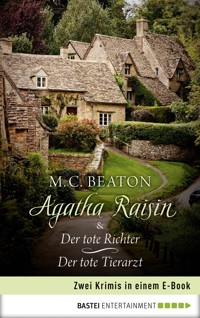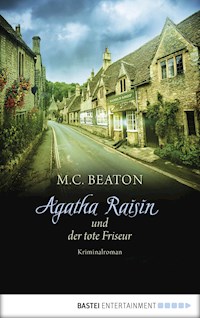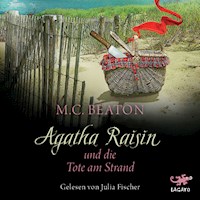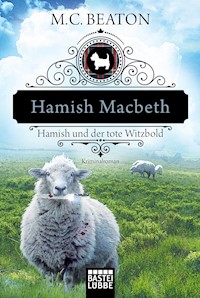
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der schottische Dorfpolizist Hamish Macbeth die Nachricht erhält, dass im Gutshaus des schonungslosen Witzbolds Arthur Trent ein Mord geschehen ist, hält er das zunächst für einen schlechten Scherz. Umso überraschter ist er, als er Trent tatsächlich erstochen und in einen Schrank gestopft auffindet. An Verdächtigen herrscht auch kein Mangel: Das Haus ist voller habgieriger Verwandter, die alle mehr am Inhalt des Testaments als an der Aufklärung des Verbrechens interessiert sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Über das Buch
Als der schottische Dorfpolizist Hamish Macbeth die Nachricht erhält, dass im Gutshaus des schonungslosen Witzbolds Arthur Trent ein Mord geschehen ist, hält er das zunächst für einen schlechten Scherz. Umso überraschter ist er, als er Trent tatsächlich erstochen und in einen Schrank gestopft auffindet. An Verdächtigen herrscht auch kein Mangel: Das Haus ist voller habgieriger Verwandter, die alle mehr am Inhalt des Testaments als an der Aufklärung des Verbrechens interessiert sind …
Über die Autorin
M. C. Beaton ist eines der zahlreichen Pseudonyme der schottischen Autorin Marion Chesney. Nachdem sie lange Zeit als Theaterkritikerin und Journalistin für verschiedene britische Zeitungen tätig war, beschloss sie, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Mit ihren Krimi-Reihen um den schottischen Dorfpolizisten Hamish Macbeth und die englische Detektivin Agatha Raisin feiert sie bis heute große Erfolge in über 17 Ländern. M. C. Beaton lebt abwechselnd in Paris und in den Cotswolds.
M. C. BEATON
Hamish Macbeth
Hamish und der tote Witzbold
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonSabine Schilasky
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:Copyright © 1992 by M. C. BeatonPublished by Arrangement with Marion Chesney GibbonsTitel der englischen Originalausgabe: »Death of a Prankster«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dorothee Cabras, GrevenbroichUmschlaggestaltung: Kirstin OsenauUnter Verwendung von Motiven von © Arndt Drechsler, Leipzig und © shutterstock: TashaNatasha | Vasya Kobelev | Margiorie VE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7805-4
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Meinen netten Nachbarn,Jean und Oliver Dicks, undihrer Tochter Kate, in Liebe
Erstes Kapitel
Denn was lachten sie, mit gespiegelter Schadenfreude,Über all seine Scherze, waren es doch so viele.
OLIVER GOLDSMITH
Geld oder die Aussicht auf welches lässt von jeher Hoffnungen sprießen, und wahrscheinlich war das der Grund, weshalb eine kleine Gruppe von Leuten ihre Taschen packte, um in den äußersten Norden Großbritanniens zu Mr. Trent zu reisen.
Ohne die Verlockung des Geldes stand zu bezweifeln, dass irgendeiner von ihnen sich in jene Gefilde aufgemacht hätte. Doch Mr. Andrew Trent hatte seiner Verwandtschaft geschrieben, ihm bliebe nicht mehr lange zu leben. Mr. Trent war ein derber Witzbold und auch in seinen Achtzigern noch nicht über Streiche mit verknoteten Bettdecken oder Furzkissen hinaus. Er war seit ungefähr dreißig Jahren verwitwet und hatte seine Frau laut der Verwandtschaft mit seinen endlosen Scherzen ins Grab getrieben. Arrat House, sein Zuhause, das außerhalb des Dorfes Arrat in Sutherland lag, war schlecht zu erreichen, und seinen Verwandten graute bei der Vorstellung, welche Streiche er sich diesmal für sie ausgedacht haben mochte. Möglicherweise lebten sie aus diesem Grund allesamt im Süden Englands, so weit weg von dem alten Mann, wie sie konnten. Nun hingegen sagte er, er würde sterben, und bei all dem Geld, das im Spiel war, mussten sie sich der langen Reise und der Aussicht auf einen unbequemen und eventuell erniedrigenden Aufenthalt stellen. Natürlich konnte es sein, dass der alte Mann nur scherzte …
»Falls ja, bringe ich ihn um«, erklärte seine Tochter Angela. Sie rühmte sich, stets direkt und zupackend zu sein. Sie war eine großgewachsene Frau und mit dem stahlgrauen Haar und dem beginnenden Damenbart von wenig gewinnendem Äußeren, kleidete sich eher wie ein Mann und besaß eine dröhnende Stimme. Ihre Schwester Betty und sie waren beide in den Fünfzigern und hatten nie geheiratet, obwohl sie in ihrer Jugend recht gut aussehend gewesen waren. Es ging das Gerücht, dass die furchtbaren Scherze ihres Vaters alle potenziellen Verehrer in die Flucht geschlagen hatten. Die Schwestern lebten seit Jahren zusammen in London, verachteten einander, waren sich indes in Rivalität und aus Gewohnheit verbunden. Betty war klein, still und gab sich schüchtern, jedoch nicht schüchtern genug, hin und wieder spitze, verletzende Bemerkungen zu machen.
»Das sagst du immer«, erwiderte sie nun, »und kaum siehst du ihn, zuckst du regelrecht zusammen.«
»Nein, tue ich nicht. Sei nicht so gehässig. Hast du meine langen Unterhosen gesehen?«
»Die brauchst du nicht. Dad hat eine gute Zentralheizung.«
»Pah!«, murmelte Angela und hielt eine lange wollene Unterhose in die Höhe. »Du glaubst doch nicht, dass ich den ganzen Tag mit ihm im Haus hocke. Ich will raus, ausgedehnte Spaziergänge unternehmen. Meinst du, er ist richtig krank?«
Betty neigte den Kopf zur Seite und schürzte die Lippen. »Gut möglich. Die Handschrift war zittrig, nicht wie sonst bei ihm.«
»Dann wäre das geklärt«, sagte Angela. »Wir dürfen nicht riskieren, nicht hinzufahren. Was ist, wenn er alles seinem Waschlappen von Sohn hinterlässt?«
Besagter »Waschlappen« war Mr. Trents Adoptivsohn Charles, ein sehr schöner Mann Ende zwanzig mit goldenen Locken, blauen Augen und von sportlicher Statur. Dass er in seinem bisherigen kurzen Leben versagt hatte, schien sein sonniges Gemüt nicht getrübt zu haben. In der Schule hatte er sich verhältnismäßig gut gemacht, aber danach war es rapide bergab gegangen. An der Universität in Oxford hielt er nur ein Semester durch, bevor er rausflog. Danach war er von einem Job zum anderen gewandert. Jedes Mal stürzte er sich begeistert in die neue Stelle, allerdings überdauerte sein Enthusiasmus nur wenige Monate. Er war unter anderem Fotograf gewesen, Versicherungsmakler, Werbetexter, und nun war er Vertreter für Lifehanz-Vitamine, die er an Läden im ganzen Land verkaufte. Auch er packte gerade, während Titchy Gold, seine Verlobte, in BH und Slip in seiner Einzimmerwohnung umhereilte. Jeder nahm an, dass es sich bei »Titchy Gold« um einen Künstlernamen handelte, ganz gleich, wie oft sie mit großen Augen beteuerte, ihre Eltern, beide Shakespeare-Darsteller, hätten sie auf diesen Namen getauft. Es war schwer nachzuvollziehen, was das eine mit dem anderen zu tun hatte, gab es doch in keinem von Shakespeares Stücken eine Titchy. Sie war Fernsehschauspielerin und mimte derzeit ein Flittchen in einer beliebten Krimiserie. Ihr Idol war Marilyn Monroe, und da Titchy blond und vollbusig war, gab sie sich alle Mühe, auch sonst wie die Monroe auszusehen.
Charles hatte ihr den Brief seines Adoptivvaters vorgelesen. »Ist er wirklich sehr reich?«, fragte Titchy.
»Er schwimmt in Geld«, antwortete Charles. »Massenhaft Knete, Kohle und Moos, meine Süße.«
»Das wird er dir vermachen«, sagte Titchy. »Muss er. Du bist sein Sohn. Wahrscheinlich verliebt er sich in mich. Das tun alte Männer immer.«
»Ich weiß nicht«, entgegnete Charles. »Er verachtet mich richtig, hält mich für faul. Könnte sein, dass er alles seinem Bruder vererbt.«
Mr. Andrew Trents Bruder Jeffrey, ein Börsenmakler, war ein hagerer, sparsamer und penibler Mann. Er war fünfzehn Jahre jünger als sein Bruder, und seine zweite Frau Jan war zwanzig Jahre jünger als er. Von der ersten Mrs. Trent hatte Jeffrey sich scheiden lassen.
Jan war eine kühle, elegante und boshafte Frau. »Irgendwann muss er sterben«, sagte sie. »Ich meine, da oben zu leben reicht schon, um einen umzubringen. Glaubst du, er vererbt dir irgendwas? Ich meine, das muss er doch eigentlich.«
»Er könnte Charles alles vermachen.«
»Wird er nicht«, widersprach Jan energisch. »Er kann den Jungen nicht ausstehen. Bei Paul ist es etwas ganz anderes. Ich habe ihm gesagt, dass er packen und hinkommen muss.«
»Er wird Paul nichts vererben«, rief Jeffrey aus.
»Könnte er«, erwiderte Jan. »Paul ist alles, was Charles nicht ist.« Paul war ihr Sohn aus erster Ehe.
Einen Tag später stand Paul vor der Abfahrtstafel im Bahnhof von King’s Cross und wartete auf seinen Zug nach Inverness. Der eulenhaft wirkende junge Mann von fünfundzwanzig Jahren arbeitete als Assistent in der Kernkraft-Forschungseinrichtung in Surrey, war ein sehr genauer und korrekter Mann in einem Dreiteiler und mit einer Hornbrille. Seine Mutter wusste nicht, dass er eine Freundin mitbrachte, was auch gut so war, denn die unterkühlte Jan würde Melissa Clarke garantiert auf Anhieb hassen. Ihre Erscheinung hatte etwas von einem Punk: schwarze Lederjacke und Lederhose, dickes weißes Make-up, lila Lidschatten, schwarze Lippen und Ohrringe, die wie Folterinstrumente aussahen. Sie war voller Ehrfurcht ob der Aussicht, auf ein Landgut zu reisen, und lächelte ein wenig zynisch, um so zu verbergen, dass sie sich extrem linkisch fühlte und wünschte, sie hätte sich konventioneller gekleidet. Außerdem war ihr Haar grellpink gefärbt, fransig geschnitten und nach hinten gegelt. Sie arbeitete mit Paul in der Forschungseinrichtung und hatte nicht mal gewusst, dass er ein Auge auf sie geworfen hatte. Diese seltsame Reise gen Norden war ihr erstes Date.
Er war im Labor leicht schwitzend auf sie zugekommen und hatte sie schlicht gefragt, ob sie sich freinehmen und mit ihm kommen könne. Fasziniert hatte sie zugesagt. Sie mochte Paul. Bisher hatte er sie nur in Rock, Bluse und Laborkittel gesehen, doch für die Reise hatte sie auf die Mode ihrer Studentenzeit zurückgegriffen. Nun verfluchte sie den tuntigen Friseur, der sie zu diesem pinken Albtraum überredet hatte, in das er ihr einst dichtes, schimmernd braunes Haar verwandelt hatte. Den Tränen nahe wollte sie weglaufen, und das Einzige, was sie davon abhielt, war die Tatsache, dass Paul ehrlich dankbar für ihre Unterstützung wirkte und ihr neues Äußeres überhaupt nicht wahrzunehmen schien.
»Du musst ihn sehr gern haben«, sagte sie.
»Wen?«, fragte Paul.
»Na, Mr. Trent, den wir besuchen«, antwortete Melissa.
»Ach der! Ich hasse ihn. Hoffentlich ist er tot, wenn wir ankommen! Ich fahre bloß hin, weil meine Mutter es will. Sie kommt natürlich auch.«
»Deine Mutter?«, quiekte Melissa erschrocken. »Von deiner Mutter hattest du nichts gesagt. Mein Gott, warum hast du mir das nicht erzählt?«
»Hier ist unser Zug«, erklärte Paul, der ihre Frage ignorierte. »Komm mit.«
Melissa war noch nie nördlicher als Yorkshire gewesen. Da Paul eingeschlafen war, sobald der Zug den Bahnhof verlassen hatte, konnte sie ihn auch nichts mehr fragen. Sie machte sich auf den Weg zum Speisewagen, kaufte sich einen Gin Tonic und eine Tüte Chips und kehrte damit zu ihrem Platz zurück. Draußen vor den Fenstern rollte die karge Februarlandschaft vorbei.
In Newcastle wachte Paul auf. Er streckte sich, gähnte und blinzelte dann Melissa einen Moment verwirrt an, als wäre er unsicher, wer sie war. »Dein Haar ist anders«, sagte er plötzlich. Melissa verkrampfte sich. »Es ist seltsam, aber ich mag es. Mit der Frisur siehst du wie ein Vogel aus.«
»Ich dachte, du hättest es nicht mal bemerkt«, erwiderte sie.
»Am Bahnhof hätte ich dich fast nicht erkannt«, gestand Paul. »Doch dann sah ich deine Augen. Keiner sonst hat solche Augen. Sie sind sehr schön.«
Melissa lächelte ihm liebevoll zu. Welcher Mann, der kein Zeitgenosse von Jane Austen war, sagte einer Frau noch, sie habe schöne Augen? »Verrate mir lieber, wer alles kommt«, bat sie. »Ich dachte, es wären nur wir zwei. Aber du erwähntest deine Mutter …«
»Oh, sie werden alle da sein und warten, dass der alte Mann den Löffel abgibt und ihnen etwas hinterlässt. Mutter kommt mit Jeffrey, meinem Stiefvater. Er ist Börsenmakler und ein staubtrockener Kauz. Andrew Trent ist sein Bruder. Dann ist da noch Charles, der Adoptivsohn vom alten Andrew, ein Faulpelz, mit seiner Verlobten, die auf den reizenden Namen Titchy Gold hört. Und seine Schwestern Angela und Betty, mehr so Arsen und Spitzenhäubchen, werden auch dort sein.«
»Und wie ist Mr. Andrew Trent so?«
»Total schrecklich. Ein Witzbold der übelsten Sorte. Ich kann ihn nicht ausstehen.«
»Warum fahren wir dann hin?«
»Weil Mutter es mir befohlen hat.«
»Und tust du normalerweise immer, was deine Mutter dir befiehlt?«
»Meistens«, antwortete er. »Es macht das Leben friedlicher.«
»Paul, findest du es nicht ein bisschen komisch, dass du mich gebeten hast, mit dir zu reisen? Ich meine nur, es ist ja nicht so, als wären wir zusammen, und … ich finde …«
»Ich wollte jemanden von außerhalb der Familie bei mir haben«, sagte Paul. »Außerdem mag ich dich schrecklich gern.«
Mit einem Lächeln überspielte Melissa ihre Angst vor der Begegnung mit seiner Mutter. »Und wohin fahren wir von Inverness aus?«, fragte sie.
»Heute gehen keine Züge mehr weiter nach Norden. Ich wollte in Inverness übernachten und morgen weiterfahren, aber Mutter hat gesagt, ich soll ein Taxi nehmen. Sie wollte, dass ich mit ihnen rauffahre, doch ich mag Jeffrey nicht besonders.«
»Wie viel wird das Taxi kosten?«
»Ungefähr fünfzig Pfund.«
»Wow, kannst du dir das leisten?«
»Mutter kann es, und sie bezahlt.«
Mutter, Mutter, Mutter, dachte Melissa skeptisch. Ob in Inverness noch ein Laden geöffnet hatte, in dem sie eine Haartönung kaufen konnte?
Aber der Zug hatte Verspätung, und es war beinahe neun Uhr, als sie in den eisigen Bahnhof von Inverness einfuhren. Am Ende des Bahnsteiges wartete ein Taxi auf sie. Jan hatte es hingeschickt, um ihren Sohn abzuholen.
Während das Taxi sie gen Norden brachte, begann es zu schneien – leicht zunächst, dann in dichten Flockenwirbeln. »Ist wohl besser, dass wir heute Abend noch nach Arrat House fahren«, sagte Paul. »Wahrscheinlich sind wir morgen früh eingeschneit.«
»Vielleicht schaffen es die anderen nicht hin«, mutmaßte Melissa hoffnungsfroh.
»Doch, sicher. Jeffrey fährt wie ein Berserker. Und soweit ich gehört habe, fliegen die anderen bis Inverness und fahren den Rest der Strecke ebenfalls mit dem Taxi.«
Melissa verfiel in sorgenvolles Schweigen. Welche Rolle spielte es, was Pauls Mutter von ihr hielt? Sie war nicht mit ihm verlobt. Sie hatten noch nicht mal Händchen gehalten.
Doch der Mut verließ sie, als sie vor Arrat House vorfuhren. Das Gebäude war von Flutlicht erhellt, und da der Schneefall ein wenig nachgelassen hatte, sah Melissa das riesige, Furcht einflößende Herrenhaus deutlich vor sich.
Der Taxifahrer sagte unverdrossen, er müsse die Nacht im Dorf verbringen, denn nach Inverness komme er nicht mehr zurück.
Ein Diener – ein Diener!, dachte Melissa – kam aus dem Haus und nahm ihre Taschen; sie folgten ihm in die Eingangshalle. Die erstickende Wärme drinnen traf sie wie ein Schlag vor den Kopf. Die Halle war groß und quadratisch. Auf dem Boden war ein karierter Teppich ausgelegt, und Geweihe und Hirschfelle hingen an der Wand. Zwei von Karodecken verhüllte Sessel – in einem anderen Schottenmuster als der Teppich – standen vor einem knisternden Kaminfeuer.
Sie gingen hinter dem Diener her die Treppe hinauf. Oben öffnete er eine Tür und stellte ihre Taschen in den Raum.
»Bringen Sie Miss Clarke lieber in einem eigenen Gästezimmer unter, Enrico«, sagte Paul.
»Ich werde Mr. Trent fragen«, antwortete der Diener und ging.
»Ein bisschen dreist von ihm zu denken, dass wir in einem Zimmer schlafen«, bemerkte Melissa.
»Du wurdest nicht erwartet«, erklärte Paul geduldig. »Und ich war seit ewigen Zeiten nicht hier. Enrico dachte gewiss, dass wir verheiratet sind.«
Der Diener kehrte zurück, nahm Melissas Koffer auf und bat sie, mit ihm zu kommen. Ihr Zimmer war drei Türen von Pauls entfernt. Es war stark beheizt, doch komfortabel eingerichtet mit einem großen Doppelbett, einem Schreibtisch und einem Stuhl am Fenster sowie einem niedrigen Tisch mit Sessel vor dem Kamin. Dennoch hatte es etwas Unpersönliches, wie ein Hotelzimmer. Enrico murmelte, dass sie im Salon rechts von der Eingangshalle erwartet werde. Nachdem er sie allein gelassen hatte, drehte Melissa rasch die Heizungen ab und öffnete das Fenster. Eine heulende Schneeböe blies ihr entgegen, sodass sie es gleich wieder schloss. Sie stellte fest, dass sie ein eigenes Bad hatte. Dort schrubbte sie sich das weiße Make-up vom Gesicht und kramte ein schlichtes schwarzes Wollkleid aus dem Koffer. Sie hatte eine schwarze Strumpfhose und ein Paar einfache schwarze Pumps mit mittelhohen Absätzen dabei. Ich sehe wie eine französische Dirne aus, dachte sie unglücklich und machte sich auf den Weg zu Pauls Zimmer. Er war nicht da.
Melissa verdrängte ihre Furcht und ging nach unten zum Salon.
Alle drehten sich zu ihr um. In diesem Raum lag ein Karoteppich in grellen Gelb- und Rottönen. Das Sofa und die Sessel hatten rosa Brokatbezüge, und alle Lampen hatten geraffte rosa Seidenschirme.
Ihr Gastgeber, Mr. Andrew Trent, stand auf einen Stock gestützt vor dem Feuer und sah bemerkenswert gesund aus. Er hatte dichtes graues Haar, ein sehr faltiges Gesicht, kleine Augen, eine breite Nase und volle Lippen. Und er hatte etwas von einem alten Komiker der Sorte, die Frauen in den Hintern zwackte und schlüpfrige Witze erzählte. In der schwarzen Samtjacke zum weißen Hemd, der karierten Weste und dem Kilt fielen vor allem seine dünnen, von Tartan-Strümpfen verhüllten Unterschenkel auf.
Paul kam auf Melissa zu und stellte sie vor. Sie wünschte allen murmelnd einen guten Abend und fand einen Sessel in einer Ecke. Sie hatte Hunger, und es standen Platten mit Sandwiches auf einem Couchtisch vor dem Kamin bereit, doch sie wagte nicht, sich eines zu nehmen. Wer mochte Pauls Mutter sein?
Titchy Gold war sofort zu erkennen, und der unglaublich gut aussehende junge Mann neben ihr musste Charles sein. Bei den beiden alten Schachteln dürfte es sich um die Arsen und Spitzenhäubchen-Schwestern handeln, womit nur noch der hagere Mann und die dünne, elegante Frau blieben, die Melissa anstarrte, als wollte sie ihren Augen nicht trauen. Sie musste Pauls Mutter sein.
Melissa machte sich in ihrer Ecke möglichst klein. Warum setzte Paul sich nicht zu ihr?
An der Universität hatte Melissa zu einer linksradikalen Gruppe gehört und deren Kleidungsstil weniger aus politischer Überzeugung übernommen denn wegen ihres Minderwertigkeitskomplexes, weil sie einer Arbeiterfamilie entstammte. Im Grunde war sie äußerst schüchtern, was sie mit schriller Kleidung und einem gelegentlich schroffen Betragen zu überspielen versuchte. In der Forschungseinrichtung indes hatten sie für eine kurze Weile weder Kleidung noch Schüchternheit beeinträchtigt, weil sie zu sehr in ihre Arbeit vertieft war. Es war ein seltsamer Job für jemanden, der zuvor bei Anti-Atomkraft-Demonstrationen mitmarschiert war, aber sie hatte einen hervorragenden Abschluss in Physik gemacht und diese Stelle ohne einen Hauch von Gewissensbissen angenommen.
Eine spanisch wirkende Frau ganz in Schwarz betrat den Salon. Sie griff sich die Sandwich-Platten und begann, sie herumzureichen. Als sie sich ihr näherte, nahm Melissa dankbar drei Sandwiches an. Die Frau fragte sie, ob sie ein Glas Wein wünschte, und Melissa bejahte leise.
Eben hatte sie in ihr erstes Sandwich gebissen, da erschien Jan vor ihr. »Paul hat uns nichts von Ihnen erzählt«, begann sie.
Melissa wartete.
»Ich finde es ein bisschen ungezogen, uns einfach mit Ihnen zu überfallen. Er hätte uns vorwarnen können.« Jan hatte eine Hüfte leicht vorgestellt und stemmte eine knochige, mit Ringen geschmückte Hand hinein. Ihre Augen standen leicht hervor, wie man es sonst eher bei fülligeren Gesichtern sah, und ihre sehr schmalen Lippen waren knallrot geschminkt. »Wie lange kennen Sie meinen Sohn schon?«
»Ich arbeite seit einigen Monaten in dem Forschungszentrum«, antwortete Melissa. »Paul ist ein Kollege, weiter nichts. Er hat mich gebeten, ihn bei diesem Besuch zu begleiten.«
»Und da haben Sie natürlich sofort zugegriffen«, sagte Jan verächtlich. »Tragen Sie Ihr Haar immer so?«
»Sind Sie immer so unhöflich?«, konterte Melissa.
»Werden Sie nicht frech. Ich erkenne Ihren Akzent, Surrey mit einer jammernden Note. Also sind Sie diese Art Gesellschaft nicht gewohnt. Und Sie werden sich auch nicht daran gewöhnen, wenn ich ein Wort mitzureden habe.«
»Verpissen Sie sich!«, erwiderte Melissa wütend.