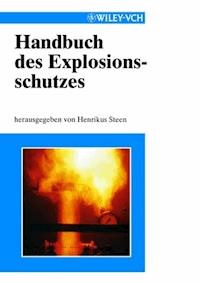
Handbuch des Explosionsschutzes E-Book
204,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Schutz gegen Explosionen von brennbaren Gasen, Dämpfen, Stäuben und Nebeln in Gegenwart von Luft oder anderen oxidierenden Gasen ist ein wichtiger Bestandteil von industriellen Prozessen und wird durch detaillierte Vorschriften, Normen und Regeln vorgegeben. Zum Thema dieses Buches gehören die Maßnahmen, die insbesondere die Auslösung und die entsprechenden Schäden solcher Explosionen verhindern oder einschränken. Herausgeber und Autoren dieses Buches verfügen über langjährige Berufserfahrung und beschreiben die Schutzverfahren und den einschlägigen Stand der Technik, verbunden mit experimentell gesicherten Daten. Betriebs-, Planungs-, Konstruktions- und Sicherheitsingenieure aus Industrie, Genehmigungsbehörden und Berufsgenossenschaften lernen in diesem Handbuch durch ein tiefergehendes Verständnis der naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen, einen den jeweiligen Verhältnissen angepassten Explosionsschutz anzuwenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1092
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Herausgeber und Autoren
Chapter 1: Explosionsvorgänge
1.1 Einleitung
1.2 Ausbreitung von Verbrennungsvorgängen in der Gasphase
1.3 Instationäre Flammenausbreitung – Explosionen
1.4 Explosionen im Freien
1.5 Literatur
Chapter 2: Zündvorgänge
2.1 Elektrische Zündquellen
2.2 Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung
2.3 Zündung durch heiße Oberflächen
2.4 Mechanisch erzeugte Funken
2.5 Adiabatische Kompression – Stoßwellen
2.6 Absorption optischer Strahlung
2.7 Selbstentzündung fester Stoffe (einschließlich Stäube)
2.8 Chemische Reaktionen
2.9 Literatur
Chapter 3: Eigenschaften reaktionsfähiger Gase und Dämpfe von Flüssigkeiten (Kenngrößen)
3.1 Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Dämpfen von Flüssigkeiten
3.2 Physikalisch-chemische Grundlagen zu den Eigenschaften brennbarer Gase und Dämpfe
3.3 Literatur
Chapter 4: Eigenschaften brennbarer Stäube (Kenngrößen)
4.1 Einleitung
4.2 Abgelagerte Stäube (Brandkenngrößen)
4.3 Aufgewirbelte Staub-Luft-Gemische (Explosionskenngrößen)
4.4 Literatur
Chapter 5: Eigenschaften brennbarer Nebel und Schäume
5.1 Brennbare Nebel und Sprühstrahlen
5.2 Heterogene Systeme aus organischen Flüssigkeiten und Sauerstoff
5.3 Literatur
Chapter 6: Maßnahmen gegen Explosionsvorgänge
6.1 Der Explosionsdruckverlauf in Behältern für deren Auslegung
6.2 Explosionsdruckentlastung
6.3 Explosionsunterdrückung
6.4 Explosionsentkopplung
6.5 Flammendurchschlagsicherungen
6.6 Literatur
Chapter 7: Grundsätze der Erfassung und Bewertung von Explosionsrisiken
7.1 Grundlegende Begriffe der Sicherheitstechnik
7.2 Explosionsrisiken
7.3 Literatur
Chapter 8: Stichwortverzeichnis
Professor Dr.-Ing. Henrikus Steen (Herausgeber)4 Meadows RoadWillingdon/EastbourneEast Sussex BN22 ONFEngland
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Herausgeber, Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Umschlag:Prüfung von Stäuben auf Explosionsfähigkeit im Hartmannrohr. Mit freundlicher Genehmigung der Degussa AG, Frankfurt.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhältlich
© WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim (Federal Republic of Germany). 2000 Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, Vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Daten Verarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form - by photoprinting, microfilm, or any other means - nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527298488
Epdf ISBN 978-3-527-62500-0
Epub ISBN 978-3-527-66086-5
Mobi ISBN 978-3-527-66085-8
Vorwort des Herausgebers
Dieses Buch ist das Nachfolgewerk des früheren Werkes “Handbuch der Raumexplosionen”, herausgegeben von H.-H. Freytag und letztmalig erschienen im Jahr 1963. Dieses seinerzeit ebenfalls von einem Autorenkollegium bearbeitete Sammelwerk über Explosionen von Gemischen aus brennbaren Gasen, Dämpfen, Stäuben und Nebeln mit Luft oder einem anderen Oxidationsmittel sowie deren Initiierung fand aufgrund der Bedeutung für die industrielle und sonstige Praxis einem enormen Widerhall. Bereits damals lag ein lebhaftes Interesse an einem vertieften Verständnis für die Einzelheiten und die Bedeutung der Gefahrenaspekte und der Einflußgrößen zum Explosionsschutz vor. Aufgrund dieser Tatsache und in Anbetracht der technisch-wissenschaftlichen Weiterentwicklung hielt auch der Verlag eine Neuherausgabe für dringend geboten.
Ziel dieser neuen Herausgabe ist es nicht so sehr, mit der detaillierten Beschreibung und Erläuterung der zahlreichen sicherheitstechnischen Vorschriften, Regeln und Normen zum Schutz vor den Gefahren durch derartige Explosionen vertraut zu machen. Ein solches Buch würde sich intensiv mit den vielen technischen und rechtlichen Details dieser Regeln zu befassen haben, der Umfang wäre entsprechend groß und sehr schwer zu überschauen. Es hätte auch den Nachteil, dem Leser nur eine Momentaufnahme des einschlägigen Stands der Technik und damit eines sich schnell verändernden rechtlichen und technischen Entwicklungsprozesses und so nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer anbieten zu können. Ziel dieses Buches ist es vielmehr, durch eine Darstellung der Grundlagen des Schutzes gegen derartige Explosionen das Verständnis des Lesers für die technisch-wissenschaftlichen Risiken und Schutzmöglichkeiten sowie deren Grenzen und für die Kompliziertheit der Einzelaspekte zu fördern. Damit wird der Leser dann den technischen und rechtlichen Veränderungen in den einschlägigen Regeln der Sicherheitstechnik leichter folgen können.
Das Buch richtet sich besonders an Naturwissenschaftler und Ingenieure in Industrie, in Forschung und in den für die Sicherheit zuständigen Organen sowie an die Studenten dieser Fachrichtungen.
Die Weiterentwicklung der Kenntnisse, bedingt durch die Erfolge der Forschung, sowie der technische Fortschritt und die Vielschichtigkeit der Themenkomplexe haben es notwendig gemacht, daß nicht alle zum Explosionsschutz gehörenden Einzelaspekte in diesem Buch behandelt werden konnten. Hierzu zählen beispielsweise die Gefahren beim Umgang mit Explosivstoffen (z.B. Sprengstoffen) und die sicherheitstechnisch sehr bedeutsamen Vorgänge der Entstehung und Ausbreitung der explosionsfähigen Gemische disperser Stoffe mit Luft oder anderen gasförmigen Oxidationsmitteln. Diese Vorgänge gehören zu den Voraussetzungen für den Eintritt der Explosionen. Die Komplexität und der jetzige Umfang der wissenschaftlich-technischen Kenntnisse gerade auf den letztgenannten Gebieten würde zu einer erheblichen Umfangssteigerung des Buches führen. Für diese wichtigen Themenbereiche wäre sicherlich eine Darstellung in einem gesonderten Buch wünschenswert.
Die Arbeit in einem Autorenkollegium bringt es mit sich, daß einzelne Punkte, Aspekte und Vorgänge unter verschiedenen Blickwinkeln in mehreren Kapiteln des Buches angesprochen werden. Dies kann für den Leser durchaus vorteilhaft sein, da so sein Verständnis für diese Themenbereiche zusätzlich gefördert werden kann.
Willingdon/England, im Februar 2000
Henrikus Steen
Herausgeber und Autoren
Herausgeber
Prof. Dr. Henrikus Steen
4 Meadows Road
Willingdon / Eastboume
East Sussex, BN22 ONF
U.K.
Autoren
Dipl.-Ing. Eberhard Behrend
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 2.4)
Dr. Elisabeth Brandes
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Postfach 33 45
38023 Braunschweig
(Kapitel 3.1)
Prof. Dr. Heino Bothe
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Postfach 33 45
38023 Braunschweig
(Kapitel 2.3 und 2.6)
Kenneth L. Cashdollar
Pittsburgh Research Center
National Institute for Occupational
Safety and Health
P.O. Box 18070
Pittsburgh, PA 15236-0070
USA
(Kapitel 4)
Dr. Siegmund Dietlen
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 3.1)
Dr. Hans Förster
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Postfach 33 45
38023 Braunschweig
(Kapitel 5.1 und 6.5)
Dr. Markus Gödde
BASF AG
ZAT/ES Geb. L511
67056 Ludwigshafen
(Kapitel 2.3)
Dr. Martin Glor
Schweizerisches Institut zur
Förderung der Sicherheit
K - 32.302
CH-4002 Basel
Schweiz
(Kapitel 2.1 und 2.2 (außer 2.2.6))
Prof. Dr. Martin Hattwig
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 6.2)
Dr.-Ing. Willi Hensel
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 2.7 und 4)
Dr. Hartmut Hieronymus
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 3.1 und 5.2)
Prof. Dr. Karlheinz Hoyermann
Institut für Physikalische Chemie
Universität Göttingen
Tammannstr. 6
37077 Göttingen
(Kapitel 3.2)
Prof. Dr. Winfried Karl
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 2.8)
Prof. Dr. Helmut Krämer †
ehem. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Postfach 33 45
38023 Braunschweig
(Kapitel 2.1, 2.2.6, 2.2.7 und 2.2.8)
Dr.-Ing. Ulrich Krause
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 2.7, 3.1 und 6.2)
Dr. Ulrich Löffler
BASF AG
67056 Ludwigshafen
(Kapitel 2.7)
Dr. Bodo Plewinsky
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 3.1 und 5.2)
Dr. Christophe Proust
INERIS-Institut national de
l’environnement industriel et des risques
Parc Technologique ALATA
B.P. 2
Rue Taffanael
F-60550 Vemeuil-en-Halatte
Frankreich
(Kapitel 6.2)
Dr. Tammo Redeker
IBExU GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg
(Kapitel 3.1)
Dr.-Ing. Klaus Ritter
Ulmenstr. 10
69493 Hirschberg
(Kapitel 2.4)
Dr. Volkmar Schröder
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 3.1)
Richard Siwek
Fa. Fire Ex
Dinggrabenstrasse 5
CH-4304 Griebenach
Schweiz
(Kapitel 6.3 und 6.4)
Prof. Dr. Henrikus Steen
4 Meadows Road
Willingdon/Eastbourne
East Sussex, BN22 ONF
U.K.
(Kapitel 2.3, 6.1 und 7)
Prof. Dr. H. Gg. Wagner
Institut für Physikalische Chemie
Universität Göttingen
Tammannstr. 6
37077 Göttingen
(Kapitel 1 und 2.5)
Dr. Wolfgang Wiechmann
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
(Kapitel 6.5)
1
Explosionsvorgänge
H. Gg. Wagner
1.1 Einleitung
Die Entwicklung der menschlichen Kultur ist sehr eng verbunden mit dem Gebrauch und der Nutzanwendung des Feuers durch den Menschen [1], Noch heute kommen z. B. über 90% der bereitgestellten Energie aus Verbrennungsprozessen, wobei sich die Zahl der – auch für andere Zwecke – angewandten Verbrennungsverfahren in den letzten Jahrzehnten eher etwas reduziert hat. Bemerkenswert an dieser über Tausende von Generationen gehenden Entwicklung ist das hohe Maß an „Betriebssicherheit“, das der Mensch im Umgang mit Verbrennungsprozessen seit langem zu erreichen und zu halten in der Lage war und ist. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, und wir hören gelegentlich von Schadensfeuern oder von Explosionsunglücken, von Verbrennungsprozessen, die außer Kontrolle geraten sind, von Vorgängen, die unerwartet und immer unerwünscht auftreten. Auch wenn deren Anteil am „Gesamtumsatz“ in Verbrennungsprozessen sehr klein ist, so kann doch die lokale Auswirkung verheerend sein. Es ist somit eine wirklich lohnenswerte Aufgabe, dafür zu sorgen, daß solche Ereignisse vermieden werden. Diese Abhandlung soll zur Verhütung von Explosionsunglücken beitragen.
Explosionen können bei der exothermen chemischen Umsetzung eines gasförmigen Brennstoff-Luft-Gemischs entstehen, ebenso können Mischungen aus Staub oder Brennstofftröpfchen mit Luft zu Explosionen führen. Dies sind Gemische, wie sie in technischen Verbrennungsanlagen, in Feuerungen, Brennkammern oder Motoren benutzt werden. Weiter gibt es auch exotherme Verbindungen, die ohne Beisein eines Oxidationsmittels in der Gasphase explodieren können. Als Beispiele seien hier Ozon, Azetylen und Azomethan genannt. Auch andere Oxidationsmittel als Luft, etwa reiner Sauerstoff, Halogene wie Fluor oder Chlor sowie Stickoxide u. a. können, gemischt mit Brennstoff, Anlaß zu sehr heftigen Explosionen sein. Man kann davon ausgehen, daß jeder Stoff oder jede Stoffkombination, die zu (hinreichend) exothermer Reaktion befähigt ist, unter geeigneten Bedingungen auch eine Explosion hervorrufen kann.
Für technische Verbrennungsprozesse bedient man sich zweier verschiedener Arten von Flammen, der vorgemischten Flammen und der Diffusionsflammen. In Brennkammern, in Heizungsbrennern, bei Gas- oder Ölbrennem wird ebenso wie in einer Kerzenflamme mit Diffusionsflammen gearbeitet; Brennstoff und Luft werden getrennt zugeführt. Den Umsatz bestimmt die Mischung beider Komponenten. Der Verbrennungsprozeß läßt sich relativ leicht regeln und stabil halten.
Vorgemischte Flammen sind z. B. vom Bunsenbrenner her bekannt: Brennstoff und Oxidationsmittel treten vorgemischt in die auf dem Brenner bei geeigneter Strömungsgeschwindigkeit des Gemisches stabilisierte Flammenzone ein. Vorgemischte Flammen werden bei Schweißbrennern oder instationär in Gas- und Benzinmotoren verwendet. Es ist unmittelbar einleuchtend, daß eine vorgemischte Flamme schwerer unter Kontrolle zu halten ist als eine Diffusionsflamme. Anders als bei Diffusionsflammen können viele instationäre Prozesse in Verbindung mit der Ausbreitung „vorgemischter Flammen“ bei vorgegebenen Anfangs- und Randbedingungen auftreten.
Damit eine Flamme entstehen kann, muß erfolgreich Entzündung stattgefunden haben. Für die Entzündung eines brennbaren Systems gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die im folgenden aufgeführt werden.
Eine durch erfolgreiche Zündung erzeugte Flamme kann, wie bereits erwähnt, unter entsprechenden Umständen stationär brennen, etwa eine Kerzenflamme oder eine Bunsenbrennerflamme. Unter bestimmten Bedingungen kann sich die Flamme in einem vorliegenden Gemisch räumlich ausbreiten, sie kann bei geeigneten Anfangs- und Randbedingungen in eine Explosion oder eine Detonation übergehen. Die treibende Kraft ist dabei die chemische Reaktion und die durch sie pro Zeit- und Volumeneinheit freigesetzte Energie, die durch geeignete Bedingungen wie Verdämmung, Turbulenz, Strömungshindernisse und viele andere Effekte beeinflußt und erhöht werden kann. Es sind diese Effekte, die in Verbindung mit dem Explosionsschutz besondere Aufmerksamkeit verdienen, besonders immer dann, wenn man den alten Grundsatz des Explosionsschutzes – „Zündquellen unter allen Umständen vermeiden“ – nicht sicher einhalten kann.
Für eine eingehende Behandlung von Verbrennungsvorgängen und für die Darstellung vieler Verbrennungsphänomene, die hier nicht oder nur kurz angesprochen werden können, sei verwiesen auf die regelmäßig erscheinenden Bände des Symposium (International) on Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh und natürlich auf die Unterlagen der der Sicherheitstechnik gewidmeten Tagungen. Weiter gibt es Spezialzeitschriften etwa Combustion and Flame, Combustion Science and Technology, Journal of hazardous Materials u. a., sowie Bücher, die der Verbrennung gewidmet sind, darunter die älteren wie W. Jost, Explosions- und Verbrennungsvorgänge in Gasen [2], W.A. Bone und D.T.A. Townend, Flame and Combustion in Gases [3] und neuere Darstellungen wie B. Lewis und G. von Elbe, Combustion Flames and Explosions in Gases [4], J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble, Combustion [5], K. Görner, Technische Verbrennungssysteme [6] und andere, die z. T. in der Literaturliste [6] aufgeführt sind, sowie R.M. Fristrom, Flame Structure and Processes [7] und die Bücher von Gaydon [8].
1.1.1 Quantitative Beschreibung von Verbrennungsprozessen
Für die quantitative Beschreibung von Verbrennungsprozessen geht man von den Navier-Stokes-Gleichungen aus. Zusätzlich wird die Wirkung der chemischen Reaktion als Wärmequelle und als Senke bzw. Quelle von Atomen, Molekülen und Radikalen unter Wahrung der Atomerhaltung berücksichtigt. Diese Gleichungen wurden nach Vorarbeiten u. a. von Jouguet von Damköhler aufgestellt [9]; und sie sollen hier kurz in der klassischen Form angegeben und erläutert werden.
Dazu wollen wir ein stark vereinfachtes eindimensionales System betrachten, in dem eine ebene Flamme in ein von links nach rechts strömendes brennbares Gas läuft (Abb. 1-1).
Abb. 1.1. Stationäre Flamme: Das Frischgas strömt mit der Geschwindigkeit v0, der Dichte ρ0, der Temperatur T0 bei dem Druck P0 von links in die Flamme und mit der Geschwindigkeit v1 (entsprechend ρ1, T1 und P1) nach rechts aus der Flamme ab. Δx bezeichnet ein Element der Dicke Δx der Flammenzone. Darunter ist schematisch der zugehörige Verlauf der Brennstoffkonzentration und der Temperatur aufgetragen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























