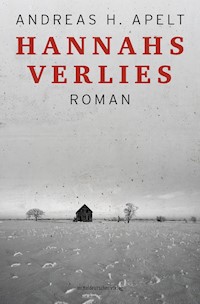
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Schuld und Sühne ein Leben zerstören Vielleicht, so dachte er, war Gott doch tot. Erschlagen bei den Kämpfen um Breslau, verhungert auf einer Kellerstufe im Lager von Ketschendorf, erfroren im zugigen Viehwaggon gen Osten oder in einer einsamen sibirischen Winternacht, in der der Wind um die Baracken heulte. Winter 1945. Um sie vor marodierenden Soldaten und einer drohenden Vergewaltigung zu schützen, mauert ein Fünfzehnjähriger seine Schwester im Keller eines Bauernhauses ein. Dann wird er verhaftet. Während er sich noch der ersten Deportation durch Flucht entziehen kann, erlebt der Kindersoldat in verschiedenen Fronteinsätzen die Gräuel des Krieges hautnah mit. Sein Versuch, sich zum Heimatdorf durchzuschlagen misslingt letztendlich kurz vor dem Ziel … Andreas H. Apelt erspart seinem Helden nichts: Er durchleidet das Kriegsende und die sowjetische Kriegsgefangenschaft in all den schrecklichen Facetten und kann nie mehr ein normales Leben führen. So erschütternd, dass einem beim Lesen der Atem stockt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
Ich hätte sie nicht einmauern dürfen. Nein, das hätte ich nicht. Hannah ist doch meine Schwester.
Diese drei kurzen Sätze standen auf der Rückseite eines zerknitterten Fotos. Vaters Sütterlinschrift, mit einem Bleistift ausgeführt, war deutlich zu erkennen. Das vergilbte Schwarz-Weiß-Foto zeigte ein junges Mädchen im schwarzen Kleidchen mit blonden geflochtenen Zöpfen und Sommersprossen, das in die Sonne blinzelte. Vielleicht war das Mädchen zwölf oder dreizehn. Das Bild lag auf einem Stapel anderer Fotos, Zettel, Briefe, loser Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungsausschnitten und wurde mit einem Einweckgummi zusammengehalten. Das Päckchen füllte einen alten aus der Form gefallenen Schuhkarton. Der Schuhkarton stand unter dem Bett. Es war das Bett, in dem Vater gestorben ist. Der Nachbar hatte ihn gefunden. Da war er schon über eine Woche tot.
Eine weitere Woche dauerte es, bis sie mich ausfindig machten. Ich fuhr sofort los, als ich am frühen Morgen den Anruf in der Redaktion bekam: Sind Sie der Sohn Helmuth Harders?
Von Hamburg nach Rehser ist es ein weiter Weg. Nach fünf Stunden Autofahrt auf der Berliner, später Dresdner Autobahn und dreißig Kilometern Landstraße war ich da. Von unterwegs rief ich meine Tochter in Berlin an. Es gab niemand anderen, den ich hätte informieren wollen. Marie kannte ihren Großvater nicht.
Als ich das alte Haus betrat, überkam mich ein merkwürdiges Gefühl. Eigentlich hätte es mir vertraut sein sollen, schließlich lebte ich hier zwanzig Jahre. Aber es war mir fremd, so fremd wie mein Vater. Dabei hatte sich gar nichts geändert, unten waren die große Küche, ein Wohn- und ein Schlafzimmer. Über einen Flur und eine knarrende Holztreppe ging es nach oben, dort befanden sich Vaters Kammer und die kleinen Zimmer von meiner Schwester und mir. Das Haus, ein ungeputzter Backsteinbau aus den Dreißigerjahren, war verwohnt, die Wände gekalkt oder mit Rollmustern bemalt. Ein Bad gab es schon früher nicht, nur ein Waschbecken im Flur und eine Toilette hinter einem Bretterverschlag neben der Holztreppe. Nicht einmal das Mobiliar hatte sich verändert. Vielleicht, so dachte ich, musste es mir fremd vorkommen. Schon die Stille war ich nicht gewöhnt, es fehlten die Bewohner. Dazu waren fast drei Jahrzehnte vergangen. Drei Jahrzehnte, in denen ich nicht mehr hier war. Ich hatte Rehser und das Vorwerk verlassen, als Mutter mit Mitte fünfzig an Krebs starb. Die Leute im Dorf sagten, sie sei an Vaters Schwermut gestorben.
Ich konnte diese Schwermut nicht ertragen. Vater lebte ganz in sich gekehrt, in einer Welt, in die er niemanden ließ. Eine Welt, die so klein war wie der Schuhkarton unter seinem Bett in der Dachkammer, gefüllt mit diesen losen Papieren, einem Stück Birkenrinde und einem alten Eisenschlüssel. Nicht selten redete er zusammenhangloses Zeug, das, egal wie ich es wendete, keinen Sinn ergab, aber mit seiner Geschichte zu tun haben musste. Bereits als Kind führte ich Tagebücher und schrieb vieles davon auf. Meist aus Neugier, aber auch um mir einen Reim auf etwas zu machen, was ich vom Hörensagen nicht verstand. Doch selbst beim Lesen erschloss sich damals nicht der Zusammenhang. Vater hatte mir ohnehin nur Bruchstücke seines Lebens anvertraut, alles andere überließ er meiner Fantasie. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich später einmal Journalist wurde. Die Neugier hatte mir Vater eingeimpft, nur hatte er sie nicht befriedigt.
Was blieb, war eine dunkle Vorahnung, die Geschichte dahinter erfassten weder ich noch meine jüngere Schwester Lisa. Und ich vermute, nicht einmal Mutter vermochte es. Irgendwann akzeptierte ich, dass ich Vater nicht verstehen konnte. Denn das konnte offenbar keiner. Weder in dem, was er sagte, noch in seiner Art, wie er es sagte.
Der Alkohol tat ein Übriges. Immer wieder der Alkohol, in allen Formen und Farben. Dass er nicht schon längst tot war, glich einem Wunder. Hilfe nahm er weder von mir noch von meiner Schwester an, obwohl sie ganz nach ihm kam. Mit einem schwermütigen Alkoholiker ein Haus in einem Vorwerk zwei Kilometer außerhalb des Dorfes zu teilen, war auf Dauer unerträglich. Es lähmte mich. Ich wurde unruhig, nervös, war oft gereizt und hatte alle Mühe, mich zu beherrschen. Ich musste weg.
Vielleicht hatte ich es mir zu leicht gemacht. Aber ich war Mitte zwanzig, wollte raus, wollte studieren, die Welt sehen. Es war eine Flucht, erst vor Vater, dann aus dieser Einöde und dem Land, das mich einmauerte. Am Ende vor mir selbst. Noch während meines Kunstgeschichtsstudiums in Berlin stellte ich einen Ausreiseantrag. Ich wurde sofort exmatrikuliert. Die Ausreise, nach zwei Jahren des üblichen Spießrutenlaufes durch die staatlichen Behörden, brachte mir zwar einen neuen Studienplatz in Hamburg, aber verhinderte für viele Jahre die Besuche an Mutters Grab. Strafe ist eben Strafe, hieß es. Meine Eingaben, mir doch besuchsweise die Einreise in die DDR zu erlauben, blieben erfolglos. Das hätten Sie sich eher überlegen sollen, Herr Harder! Damit war ein Schlussstrich unter mein bisheriges Leben gezogen, der höher war als jede Mauer der Welt.
Meine Schwester, mit der ich mich sonst gut verstand, verzieh mir die Ausreise nie. Wie könne ich nur Vater im Stich lassen. Ich widersprach. Ich hatte ihn nicht im Stich gelassen. Er ließ mich im Stich.
Meine erste Frage am Telefon hatte meiner Schwester gegolten. Sie könne nicht, hieß es. Ich fragte nicht nach, wunderte mich aber schon. Lisa war nie die Frau, die sich entzog. Sie hatte die Hilfsbereitschaft verinnerlicht bis zur Selbstaufgabe. Entsprechend oft wurde sie von Mitschülern ausgenutzt. Egal ob in der Schule oder später in der Ausbildung. Meine Schwester sah es nicht.
Als ich bei der ehemaligen Poststelle in Rheser den Schlüssel für das Haus meines Vaters abholte, erzählte mir die frühere Postangestellte ausführlich Lisas Geschichte. Danach litt meine Schwester an einer seltenen, aber heimtückischen Augenkrankheit, bei der sich die Netzhaut langsam vom Auge ablöst. Sie war seit Jahren blind. Fünfundzwanzig Jahre habe sie noch in dem Haus gewohnt. Erst habe sie sich um den Vater, dann er sich um sie gekümmert. Irgendwann konnte er, der schon über achtzig war, auch nicht mehr helfen. Lisa musste in das nächste Blindenheim, das sich in der Kreisstadt befand, und war damit für Vater genauso unerreichbar, wie er für sie.
Als ich das hörte, wurde mir schwindlig, ich bat um einen Stuhl. Die Frau, eine korpulente Rentnerin mit dicken weichen Unterarmen schob mich auf einen Küchenstuhl und reichte mir ungefragt ein Glas Wasser. Lisa tat mir unendlich leid. Ich wollte es nicht wahrhaben, meine Schwester blind! Ich sah ihr Gesicht, die großen dunklen Augen, ihr Leuchten, den Wimpernaufschlag. Und dann hörte ich Mutters Satz, wonach Lisa geboren sei, um anderen zu helfen. Das war ihre Berufung. Vielleicht wollte sie deshalb Ärztin werden, aber nachdem ich einen Ausreiseantrag stellte, wurde ihr das Studium untersagt. Widerspruch war zwecklos. Beschweren Sie sich bei Ihrem Bruder!, sagte der zuständige Prorektor. Lisa hielt mir das nie vor. Nur wegen Vater war sie erbost.
Ich wusste nichts über Vaters Familie. Nur so viel, dass Vater am 29. Mai 1929 in einem kleinen Straßendorf namens Sophienhof dreißig Kilometer südöstlich von Breslau geboren wurde. Seine Familie lebte dort in siebenter Generation auf einem Bauernhof. Er hatte drei Geschwister, darunter zwei Schwestern. Und ich ahnte, dass der Krieg mit der Vertreibung der schlesischen Sophienhofer nicht nur die Familie trennte, sondern dass unabhängig von der Vertreibungsgeschichte, den Überfällen und Plünderungen, etwas Fürchterliches passiert sein musste. So grausam, dass Vater niemals darüber sprach oder es auch nur andeutete. Nicht mal, wenn er betrunken war und ich ihn löcherte, mehr zu verraten. Seine Geschichte blieb ein großer weißer Fleck.
Ich hätte sie nicht einmauern dürfen … Die Sätze auf der Rückseite des Fotos elektrisierten mich. Sie ließen mich nicht los. Sie klebten an mir wie eine Nachricht aus einer anderen Welt. Und ich begriff sofort, dass sie eine Geschichte ist, die erforscht und erzählt werden wollte. Noch mehr als mir bewusst wurde, dass sie in diesem Karton steckte, der schon immer unter seinem Bett in der Dachkammer stand. Und an den er keinen Menschen, nicht einmal Mutter, ließ. Der Karton, so war ich überzeugt, beherbergte Vaters Geheimnis.
Die Kammer richtete sich Vater bereits kurz nach Bezug des Hauses Mitte der Fünfzigerjahre ein. Obgleich er hin und wieder mit Mutter das untere Schlafzimmer teilte, zog er sich doch in aller Regel in die Kammer zurück. Als Kind hatte er mir bereits Prügel angedroht, würde ich jemals in seiner Kammer herumschnüffeln. Das nahm ich sogar ernst, obgleich mich Vater niemals schlug. Vater war dafür zu weich, sehr weich. Er weinte bei jeder Gelegenheit. Aus Rührung oder Mitgefühl. Egal ob er getrunken hatte oder nicht. Anderen konnte er nicht wehtun. So ließ diese Drohung die Kammer und meinen Vater noch geheimnisvoller erscheinen.
Das Foto, das auf der Rückseite das Datum 6. Februar 1945 trug, machte die Beantwortung der Frage nicht einfacher. Neugierig begann ich alles, was mir im Haus in die Hände fiel, zu lesen. Doch umso mehr ich fand, Aufzeichnungen, Zeitungsausschnitte, Einladungen, Briefe, sogar meine alten Tagebuchaufzeichnungen, scheinbar lose Eintragungen und Beschreibungen oder nur simple Randbemerkungen, umso mehr Fragen taten sich auf. Ich kam nicht umhin, alles gründlich zu lesen und zu versuchen chronologisch zu ordnen. Die umfangreichen Aufzeichnungen, die Vater auf einzelne Zettel gekritzelt hatte, wurden offenbar in den Fünfzigerjahren angelegt. Später wurden sie immer spärlicher, was wohl an seinem zunehmenden Alkoholkonsum lag.
Angesichts dieser Umstände war ich ohnehin unsicher, welchen Wahrheitsgehalt die Texte hatten. Froh war ich dennoch, wenigstens etwas Authentisches zu finden, auch wenn mich die Entzifferung des handschriftlichen Gekritzels einige Mühe kosten würde. Darüber hinaus musste ich all jene Menschen befragen, derer ich irgendwie habhaft werden konnte, Nachbarn, frühere Arbeitskollegen, den Pfarrer. Und natürlich meine erblindete Schwester, bei der ich nicht nur Aufnahme und Anhörung erhoffte, sondern auch Informationen über einen Mann, den ich Vater nannte. Sie hatte die letzten Jahrzehnte allein mit ihm in unserem Haus gelebt und es lag nahe, dass er sich, wenn überhaupt, ihr anvertraut hatte.
Ursprünglich plante ich, noch am Abend nach Berlin und von dort am nächsten Morgen nach Hamburg zurückzufahren. Aber bereits am Nachmittag rief ich meinen Chefredakteur an und bat um Urlaub. Irgendwie ging das alles hier um mich, erklärte ich umständlich. Ich bekam ihn. Andere Verpflichtungen hatte ich seit meiner Scheidung vor drei Jahren nicht. Vermissen würde mich in Hamburg, wo ich seitdem eine kleine Zweizimmerwohnung in einem sanierten Altbau bewohnte, ohnehin niemand.
Noch am gleichen Tag begann ich, nachdem ich eine kleine Pension im Nachbardorf angemietet hatte, mit der Recherche und der Niederschrift erster Texte. Was daraus werden sollte, war mir nicht klar, möglicherweise eine verständliche Darstellung des Lebensweges eines Mannes und ein Stück Ahnengeschichte. Vielleicht auch eine Art Novelle, von der es bei Goethe hieß, dass sie eine „unerhörte Begebenheit“ schilderte. Immerhin war Helmuth Harder nicht nur mein Vater, sondern auch Maries Großvater. Es lag nahe, meiner Tochter, die inzwischen studierte, etwas Erzählendes zu hinterlassen. Und eine Gelegenheit, unseren sporadischen Kontakt zu verstetigen, weil es etwas gab, was uns verbinden konnte. Das Gespräch darüber sollte von allein kommen und Nähe schaffen. Dabei war mir klar, dass ich einige Lücken im Leben Helmuth Harders mit eigenen, manchmal weit ausfallenden Interpretationen und sogar Mutmaßungen füllen müsste. Mir würde es obliegen, die Geschichte nach meinen Vorstellungen auszuschmücken, ihr Farbe, Ton und Geruch zu geben. Zugegeben ein Eingriff, aber allein der Tatsache geschuldet, sie aufgrund fehlender eigener Kenntnisse anschaulich zu machen.
Trotzdem, ich weiß nicht, ob es klug war, dieses ganze Unternehmen zu starten. Denn der Sieg der Neugier über die Vernunft macht krank. Manche Dinge, und das hätte ich von meinem Vater lernen können, sollten wir besser nicht wissen. Und wenn wir sie wissen, sollten wir alles tun, um sie gleich wieder zu vergessen. Dafür aber war es jetzt zu spät.
2. Kapitel
Ich hätte sie nicht einmauern dürfen. Nein, das hätte ich nicht. Hannah ist doch meine Schwester. Mehr musste Helmuth Harder nicht sagen. Er sagte es ja vor keinem Gericht. Er sagte es zu sich selbst. Immer und immer wieder. So oft, dass er das Ungeheuerliche mit einem Bleistift auf der Rückseite des Fotos festhielt. Hannahs Foto. Es ist jenes Bild des jungen blonden Mädchens, das mir siebzig Jahre später in die Hände fiel. Mit diesen Sätzen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Als Vater diese Sätze im Februar 1945 notierte und das Foto zum Schutz in ein Zigarettenetui aus Messing legte, saß er bereits in einem Zug oder besser in einem Viehwaggon. Mit ihm waren eine halbe Hundertschaft Männer in dem dunklen Wagen eingesperrt. Ausgemergelte, vom Hunger und der Kälte gezeichnete Männer in Uniform oder Zivil. Der Atem hing weiß über ihren Köpfen. Auch Kinder fanden sich darunter. Eigentlich war auch er noch ein Kind, mit seinen fünfzehn Jahren. Aber das würde er nicht gesagt haben. Schon gar nicht nach dem, was er in den letzten Tagen und Stunden erlebt hatte.
Ich hätte sie nicht einmauern dürfen, dieser Satz stand auch am Anfang eines Gespräches zwischen Vater und meiner Schwester. Es ist der Satz, der sie aufhorchen ließ. Damals, einige Jahre vor Vaters Tod. Vielleicht war es der besonderen, ja dramatischen Situation geschuldet, dass sich Vater ihr öffnete.
Und er wiederholte den Satz noch einmal, viele Monate später, so als habe ihn die Sache keinesfalls in Ruhe gelassen. Und wieder trug er einen Teil seiner Geschichte zusammen, die noch immer große Lücken hatte. Es war egal. Denn auch jetzt war es ein besonderer Umstand, Lisas letzter Abend im Vorwerk bei Vater. Am nächsten Morgen sollte die Fahrbereitschaft kommen und sie abholen. Das Ziel war das Blindenheim der Kreisstadt, ein roter Backsteinbau, in dem sie von der Pflegeversicherung ein Zimmer zugewiesen bekam. Vater hatte zugestimmt. Aber nur, weil er inzwischen mit seinen dreiundachtzig Jahren einsah, dass er meine Schwester nicht länger versorgen konnte. Die Unterschrift unter ein notwendiges Dokument fiel ihm nicht leicht. Die schmale Hand zitterte und verlor fast den Stift. Von nun an war er ganz allein. Allein mit sich und den Gespenstern der Vergangenheit.
Für mich war schon erstaunlich, dass sich Vater am Ende seines Lebens überhaupt noch öffnete. Er nutzte damit die letzte Chance, ein Familiengeheimnis weiterzutragen, was sonst unweigerlich verloren wäre oder eben nur bruchstückhaft auf einzelnen Zetteln in seinem Schuhkarton erhalten geblieben wäre. Allerdings nur für die nächste Generation, denn er konnte davon ausgehen, dass es meine Schwester mit ins Grab nehmen würde. Und dass jemand jemals die Papiere seines Kartons lesen würde, war auch nicht zu erwarten. Ich selbst spielte für Vater keine Rolle mehr.
Wie sehr meine um fünf Jahre jüngere Schwester unter diesem Wissen litt, lässt sich nur erahnen. Aber sie wollte Vater helfen, durch Trost und Mitleid, und hörte sich eine Geschichte an, deren Dimension sie selbst erst nach und nach erfasste. Ihr war klar, dass er unmöglich allein mit dieser Bürde fertig werden konnte. Schließlich hatte er es sieben Jahrzehnte probiert und war daran gescheitert.
Ich selbst wusste von alledem nichts, als ich einen Tag nach dem Fund des Fotos meine Schwester in ihrem Blindenheim besuchte. Ich ahnte auch nicht, mit welcher Detailtreue sie alle seine Erzählungen behalten hatte. So, als hätte er sich erst am Vortag ihr anvertraut. Möglicherweise war es ihrer Blindheit geschuldet, eine besondere Begabung für die Erinnerung an gesprochene Worte zu entwickeln. Immerhin hatte sie damit Vaters Geschichte auf ihre Art konserviert.
Erstaunlich war Lisas warmherziger Empfang, denn zunächst bedurfte es für mich einiger Überwindung sie aufzusuchen. Ich dachte an meinen Abschied aus unserem Vorwerk und ihren Vorwurf: Du lässt Vater im Stich!
Meine Entgegnung: Vater lässt mich im Stich, quittierte sie damals mit einem ungläubigen Kopfschütteln. Er ist doch dein Vater!, sagte sie wütend. Ich glaubte sogar Tränen in ihren Augen gesehen zu haben. Ich wandte mich ab und ging wortlos. Vielleicht war ich sogar von Lisa enttäuscht. Denn ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte und hoffte vergeblich auf ihren Beistand.
Das alles war lange her. Inzwischen hatte sich die Welt weitergedreht, die Mauer war gefallen und ich lebte seit bald dreißig Jahren in der großen alten Hansestadt, die mit der Lebenswirklichkeit im verschlafenen Rehser nichts zu tun hatte. Und doch blieb die Angst, mit Lisa jemanden aus einer anderen Welt zu begegnen, in dessen Augen ich ein Verräter sein konnte. Verräter an der gemeinsamen Geschichte, der Heimat. Ich fürchtete um Vorhaltungen und quälende Fragen. Aber nicht nur das, ich konnte mir denken, dass Lisa in besonderer Weise unter Vaters Tod litt. Sie war ihm immer sehr nah, egal was er tat, und übte noch Nachsicht, wo ich mich längst abgewandt hatte.
Im Foyer des Blindenheims kam mir eine schlanke, fast hagere Frau mit braunem, nach hinten gebundenem Haar entgegen. Sie trug eine dunkle große Brille. Ich wusste sofort, dass es Lisa ist. Es war ihr gerader Gang und die Art, wie sie den Kopf beim Gehen leicht schräg hielt. Erschrocken blieb ich mitten im Raum stehen. Ich hatte mit ihrer Blindheit gerechnet, aber wollte es doch nicht wahrhaben. Umso mehr erschütterte mich die Wahrheit, ich war unfähig, angemessen zu reagieren. Aber was heißt angemessen bei einem Menschen, mit dem man die Kindheit und Jugend verbrachte und der plötzlich blind vor einem steht. Vor lauter Unsicherheit sagte ich nichts. Mitleid war genauso fehl am Platz wie das Ignorieren der Umstände.
Du bist gekommen, sagte sie mit einer dunklen leicht heiseren Stimme und das in einem Tonfall, als hätte sie mich schon erwartet.
Ja, das bin ich, antwortete ich und schaute sie noch immer ungläubig an. Es war eine beklemmende Situation, mein Herz schlug bis zum Hals. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Musste ich Lisa mein Beileid aussprechen? Erwartete sie es? Ich wollte so viel und dann auch wieder nichts sagen.
Lisa lächelte, dann gab sie mir die Hand. Gedrückt haben wir uns auch früher nicht, das war nicht üblich. Es war ein fester Griff, trotz ihrer schmalen Hand. Er reichte aus, um mir die erste Angst zu nehmen. Auch meine Schwester war erleichtert, vielleicht sogar froh und freute sich, mich zu sehen oder besser zu hören und berühren zu können. Schön, dass du da bist, sagte sie und hielt lange meine Hand. In der Stimme schwang ein Stück Wehmut mit.
Mir war es fast unheimlich, denn es gab keinen einzigen Vorwurf, auch wenn sie gute Gründe dafür hatte. Schließlich trug sie, so lange sie sehen konnte, die Last mit unserem Vater und seiner Alkoholsucht allein. Noch als ich in Berlin studierte, verzichtete sie selbstlos auf eigene Freundschaften. Nicht zuletzt, weil sie Angst hatte, Vater ihren Freunden oder gar Verehrern vorstellen zu müssen. Ein früher Versuch war bereits eine große Blamage für sie und beendete schnell ihre erste große Liebe. Dabei war sie, die bei Jungen eher schüchtern und zurückhaltend war, so glücklich. Wir alle hatten ihr das Glück mit dem zwei Jahre älteren Schulkameraden aus dem Nachbardorf gegönnt. Doch Vater war so betrunken, dass er Lisas Freund in den Arm fiel und ihn mit seinem neuen teuren Anzug im vom Regen aufgeweichten Hof zu Boden riss. Diesen filmreifen Auftritt vergaß auch meine Schwester nie. Ihrem späteren Mann war so ein Auftritt zwar erspart geblieben, doch wurde er Opfer anderer Peinlichkeiten.
Lisa, so vermutete ich, war froh, mit mir nicht nur einen vertrauten Menschen, sondern auch einen Teil ihrer Familie und Geschichte zurückzubekommen. Aber noch mehr jemanden, der bereit war, an ihrem Wissen Anteil zu nehmen. Mit mir konnte sie, trotz aller anfänglichen Zurückhaltung, auch ohne Rechtfertigungen und Begründungen über Vaters Geheimnisse reden. Ich war willens zuzuhören und wollte wie sie verstehen, was geschehen war. So machte uns Vaters Tod zu Komplizen.
Dankbar, so freundlich aufgenommen zu werden, begleitete ich Lisa, die ein schwarzes langes Kleid trug und ohne Blindenstock lief, in den großen Park. Dieser schloss sich hinter dem Heim an. In ihm stand eine weiße Holzbank, auf der wir uns niederließen. Dort erzählte sie in langsamen, aber präzisen Ausführungen über den Verlauf der heimtückischen Krankheit. Meine Netzhaut, sagte sie, begann sich wenige Monate nach deinem Weggang aus Rehser zu lösen. Keiner der Ärzte wusste Rat. Auch nicht in der Berliner Charité. Dort kannte man zwar die Krankheit mit dem lateinischen Namen Ablatio retinae, aber konnte auch keine Heilung versprechen. Nicht einmal aufhalten konnte man sie.
Ich stellte mir vor, welchen Schock die Diagnose bei meiner Schwester auslöste. Sie hatte nach der Absage des Medizinstudiums eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin absolviert und in einem evangelischen Krankenhaus in Dresden eine erfüllte Arbeit in ihrem Beruf gefunden. Auch hier war sie für andere Menschen da. Nur sich selbst konnte sie nicht helfen.
Das konnte auch nicht ihr Mann, mit dem sie sich gerade in einem neu gebauten Haus am Dresdener Stadtrand eingerichtet hatte. Harald, der mir nicht unsympathisch schien, trennte sich ein Jahr nach der Diagnose von Lisa. Ihm sei eine blinde Frau nicht zuzumuten, war seine Erklärung bei der Einreichung der Scheidung. Diese dauerte dann auch nicht lange, Kinder hatte das Paar nicht und meine Schwester verzichtete zugunsten ihres Mannes, der technischer Leiter der Klinik war, auf die Anteile am Haus. Sie tat das alles mit einem gewissen Stolz und beschämte ihren Mann damit umso mehr. Kurz darauf erhielt sie ihre amtliche Berufsunfähigkeit und zog mit einer Sehkraft von fünfzig Prozent zurück ins Rehsersche Vorwerk.
Dort hätte sie sich, so erzählte Lisa, soweit es die Krankheit zuließ, in all den Jahren um Vater gekümmert. Die Wege im Haus kannte sie, alles war ihr vertraut und so habe sie versucht trotz der Umstände ein möglichst normales Leben zu führen. Doch es gab Grenzen.
Lisa atmete tief und es war, als hörte sie dabei in sich hinein. Die Krankheit, so meine Schwester, nahm sich viel Zeit. Langsam und doch unaufhaltsam verlor ich das Augenlicht.
Warum hast du mir nicht geschrieben, fragte ich. Ich hätte kommen müssen.
Aber wie? Du warst doch im Westen. Das Einreisen war dir untersagt.
Ja, das war es. Aber trotzdem, die DDR hatte auch ein Ende!
Lisa hob die Schultern. So hätte sie es auch damals gemacht. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass es wieder Lisas Stolz war, sie sich lieber mit Vater oder gar allein quälte, statt um Hilfe zu bitten. Du hattest mit dem Studium begonnen, entgegnete sie. Und wir wussten um deinen Abschied. Weder Vater noch ich wollten dich unter Druck setzen. Du hattest mit Rehser und uns gebrochen. Und du wirst es nicht glauben, Vater hatte sogar Verständnis dafür.
Verständnis?
Meine Schwester nickte.
Wie konnte er nur Verständnis haben, dachte ich, ging er doch an seiner Schwermut und dem täglichen Alkohol langsam zugrunde. Wie viel Platz sollte da für ein Gefühl des Bedauerns oder gar Verständnisses sein. Aber ich wollte nicht widersprechen. Lieber schwieg ich dazu und berichtete dafür über mein Leben als Redakteur einer Wochenzeitung, meine gescheiterte Ehe, meine Tochter Marie, die inzwischen selbst studierte, und die Schönheit Hamburgs. Und doch erwischte ich mich bei dem Gedanken, wie es denn sein konnte, dass ich ein aufregendes Studentenleben in der quirligen Metropole führte, während sich meine Schwester durch den Verlust des Augenlichts zeitgleich aus der Welt der Bilder verabschieden musste.
Ich machte mir Vorwürfe, denn ich hätte helfen sollen, ja müssen! Aber vermochte ich das damals, kurz nach meinem Weggang wirklich?
Mein Neuanfang in Hamburg war mit erheblichen Problemen verbunden. Erst fanden Franziska, meine Freundin und spätere Ehefrau, und ich nur mit Mühe ein vierzehn Quadratmeter großes Zimmer in einer WG im Hafenviertel, dafür aber keine Arbeit. Auch an ein Studium war zunächst nicht zu denken, zumal Franziska wenige Monate nach meiner Ankunft im Westen schwanger wurde. Die WG mit partyverwöhnten Studenten aus dem deutschen Südwesten war für die junge Familie, die sich nach Ruhe sehnte, eine Zumutung. Dazu kam ein mysteriöser Einbruch, bei dem meine Studiennachweise aus Berlin verschwanden. Die DDR-Behörden weigerten sich beharrlich neue auszustellen. Der Ärger nahm kein Ende, Franziskas Schwangerschaft war mit Komplikationen und einem längeren Krankenhausaufenthalt verbunden und ich völlig ratlos, wie es weitergehen sollte.
Rehser war weit weg, auch wenn es mit dem Blick von heute keine Entschuldigung für mein Verhalten geben kann. Auch nicht als meine Briefe, die ich noch zu Mauerzeiten an meine Schwester versandt hatte, sich ungelesen im Hamburger Briefkasten wiederfanden. Wie ich später erfahren sollte, stand mein Schwager Harald dahinter. Der bangte um sein berufliches Fortkommen im Gesundheitswesen und vermied jeden Westkontakt. Im vorauseilenden Gehorsam schickte er die Briefe direkt wieder zurück. Die Stelle im Bezirkskrankenhaus bekam er trotzdem nicht.
Der Mauerfall änderte nichts Grundsätzliches. Da stand ich gerade in wichtigen Prüfungen meines Studiums in Hamburg und unsere Tochter machte uns neben viel Freude wegen einiger hartnäckiger Erkrankungen große Sorgen. Ich weiß, dass dies alles keine Begründung ist und auch später zu keiner ernsthaften Entschuldigung reichte. Und wohl auch damals nicht reichen konnte. Vielleicht hatte Lisa mit Blick auf die ärztliche Diagnose und die Folgen für meinen angeschlagenen Vater doch recht, dass ich ihn, aber eigentlich mehr sie, im Stich gelassen habe. Aber auch das gestand ich jetzt nicht meiner Schwester. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie es ohnehin spürte. So saßen wir schweigend auf der Bank. Erst nach einer ganzen Weile wagte ich einen neuen Anlauf und berichtete ausführlich von meinem Fund unter Vaters Sterbebett.
Ja, Vater, sagte meine Schwester nach einer ganzen Weile und atmete tief. Was für eine Geschichte!
Noch bevor sie ausführlicher werden konnte, erläuterte ich meine Absicht, mich näher mit Vaters Leben zu befassen. Allein das Lesen der ersten Aufzeichnungen aus seinem Schuhkarton hätte mich gefesselt. Und schließlich gab es diesen Satz auf der Rückseite des Fotos.
Noch in der Nacht, so gestand ich meiner Schwester, habe ich erste Notizen gemacht, die ich ihr gern vortragen würde. Am Ende sollte es eben eine lesbare Geschichte sein, die Vater gerecht würde. Allerdings, so gab ich gleich zu bedenken, dürfte die Niederschrift nur mit ihr gelingen. Ich brauchte ihre Hilfe, schließlich habe sie doch über fünfundzwanzig Jahre mit Vater unter einem Dach gelebt und kenne ihn besser als jeder andere.
Lisa überlegte eine Weile. Sie schien unsicher, ob sie sich darauf einlassen sollte. Das konnte ich gut verstehen, hatte sie doch Jahrzehnte nichts von mir gehört. Doch sie willigte ein. Inwiefern sie davon überzeugt war, vermochte ich nicht zu sagen. Ich blieb skeptisch, ob ich wirklich mit ihr rechnen konnte. Lisa galt trotz ihrer Hilfsbereitschaft früher als unberechenbar. Ich wusste oft nicht, woran ich bei ihr war. Sie war impulsiv und hatte ihren eigenen Kopf. Manchmal verließ sie eine Gesprächsrunde ohne erkennbaren Grund und kam einfach nicht zurück. Später erklärte sie, dass sie es sich anders überlegt habe. Eine Begründung gab es nicht. Mutter nannte sie deshalb sprunghaft, ein Wort, dass Vater nie verwendete.
Trotz aller Unsicherheit begann ich aus meinen Notizen zu lesen. Lisa, so hoffte ich, würde langsam Interesse und bald Gefallen an der Geschichte finden:
So sah ich ihn wieder, Helmuth Harder, fünfzehnjährig, im Februar 1945 in einem Viehwaggon zusammengepfercht mit anderen Männern und Jungen, auf dem Weg in ein unbekanntes Land. Sein Gesicht war rot und von Schlägen und Tränen aufgequollen. Er trug einen alten schmutzigen, viel zu großen Soldatenmantel. Seine Hände steckten in den Manteltaschen, in denen er auch das Messingetui mit dem Foto der Schwester vergraben hatte.
Im Waggon war es kalt und eng. Die Kälte des letzten Kriegswinters spürte der Junge vor allem nachts. Sie kroch aus dem harten Holzplankenboden über die Beine in den Rücken. Und lag wie ein Eisklotz im Nacken. Die Enge kannte keine Tageszeit. Sie machte die Gliedmaßen steif, ließ sie taub und unbeweglich werden. Den Schmerz konnte Helmuth Harder auch in den zerfurchten Gesichtern der Männer und in denen der Jungen sehen. Dann, wenn sie durch das wenige Licht, das ein eiskalter dunstiger Morgen durch die schmalen Schlitze der Waggontür schob, erhellt wurden. Blass und regungslos leuchteten sie in der Dunkelheit. Wie Totenmasken, dachte der Junge.
Dem Schmerz war es egal, ob einer Uniform oder Zivil trug. Die meisten Männer saßen dicht aneinandergedrängt. So schliefen sie auch. Zum Liegen war für keinen Platz. Einige mussten sogar stehen. Und sie schliefen im Stehen. Wie Vogelscheuchen schaukelten sie in ihren zerschlissenen Armeeuniformen als schwarze Schatten durch die Nacht.
Doch mehr als ich den Fünfzehnjährigen in dem Waggon auf einem Gleis irgendwo im deutschen Osten sehen konnte, hörte ich ihn. Es war ein Schluchzen, ein kindliches Schluchzen, von einem, dessen Kindheit so jäh endete. Dabei sah er in die Augen Hannahs, in die großen blauen Augen, in die er auch sah, als er mit der letzten Steinreihe die Mauer schloss. Dort im Keller des alten Bauernhauses von Sophienhof, Landkreis Brieg, keine fünf Kilometer ostwärts der Oder, die von dort weiter nach Breslau fließt. Doch Hannahs Augen und die zitternden Lippen der Schwester, als wollte sie noch etwas sagen, waren Einbildung, wie so vieles Einbildung ist, wenn einen die Erinnerungen überkommen. Da können die Erinnerungen nicht mal zwei Tage alt sein. Wie Wasser in einem sinkenden Kahn steigen sie zu Kopf und fluten jede Gehirnwindung. Salziges kaltes Meerwasser, das in jeder noch so kleinen Wunde brennt.
Die Männer im Waggon versuchten trotz der Enge und Kälte zu schlafen. Manchmal halfen ja schon einige Minuten. Doch Helmuth, der Sophienhofer Bauernjunge, konnte nicht schlafen, er dachte nur an seine Schwester. Die, die er mit ihren dreizehn Jahren lebendigen Leibes eingemauert hatte. Der 6. Februar war keine zwei Tage her. Und doch waren es zwei Tage, mit Stunden, Minuten und Sekunden der Angst und der Ungewissheit, in denen er langsam begriff, was passiert war. Zwei unendlich lange Tage, in denen er unablässig auf seine Armbanduhr schaute, jenem Konfirmationsgeschenk seiner Großmutter, das er jetzt verwünschen wollte, weil es unbeirrt das Voranschreiten der Zeit anzeigte. Und damit seine Not und Angst, die sich Minute um Minute vergrößerte.
Aber noch schlimmer mochte es für Hannah sein, die Schwester, die jetzt im Keller des alten Bauernhauses gegen die Zeit lebte. Und gegen den Tod.
Die schnaufende Eisenbahn schob sich langsam über ausgefahrene Gleise voran. Stoß um Stoß. Helmuth hatte keine Vorstellung, wie weit entfernt er jetzt von seiner Heimat war. Der Zug hatte sich in den letzten Stunden fast nicht vom Fleck bewegt. Und wenn, dann nur im Schritttempo. Nicht einmal den Namen des Verladebahnhofes hatte er am Vorabend lesen können. Wie auch, es war dunkel und seine Bewacher stießen ihn mit drei weiteren Gefangenen, zwei älteren Volkssturmmännern und einem vierzehnjährigen Hitlerjungen aus der Nachbarschaft, mit Fußtritten vom Lastwagen direkt in den Waggon.
Dawei, dawei!, hieß es nur immer. Unter Tritten und Kolbenschlägen der russischen Bewacher hatten sie sich in das Wageninnere verkrochen. Schon um vor den wütenden, nach Schnaps, Knoblauch und Maschinenöl stinkenden Soldaten sicher zu sein. Helmuth Harder hatte noch eine Ecke ergattert. Dort saß er seit gestern Abend vor Schmerzen gekrümmt, den Rücken gegen die abgenutzten Holzplanken gelehnt und den Kopf voller Gedanken. Dass er auch seit zwei Tagen weder gegessen noch getrunken hatte, berührte ihn nicht. Auch nicht, dass es inzwischen im Waggon fürchterlich stank. Nicht nach Schnaps, Altöl oder gar Knoblauch der russischen Bewacher. Das würde sogar noch gehen. Hier waren es Urin, Kot und Erbrochenes. Menschliche Exkremente, ausgeschieden von jämmerlichen Gestalten, die zu schwach waren, sie an sich zu halten. Wie auch, als Schatten ihrer selbst.
Der Gestank nahm zu. An eine Besserung war nicht zu denken, denn die Männer, seit über zwölf Stunden eingesperrt, machten unter sich. Nicht einmal die Geräusche ließen sich verbergen. Neben dem fünfzehnjährigen Jungen saß ein alter Landser mit einem eingefallenen unrasierten Gesicht. Sein Soldatenmantel war zerschlissen, der rechte Arm in einer blutdurchtränkten Binde. Haben sie dich auch am Arsch gekriegt, sagte der Mann, dessen Alter kaum zu schätzen war. Helmuth antwortete nicht. Denn alle Männer im Waggon schwiegen.
Nach einem kurzen Stillstand fuhr der Zug wieder an. Das Ziel: unbekannt. Vielleicht Sibirien, sagte jetzt einer der Männer leise. Da wären wir in vier Wochen. Und die Hälfte von uns tot.
Unsinn, sagte ein anderer mit piepsiger Stimme. Bestimmt erschießen sie uns noch in Deutschland. Wir hätten es auch nicht anders gemacht.
Nein, die erschießen keinen. Die brauchen Arbeiter, brummte der alte Landser mit der blutdurchtränkten Binde. Egal ob Bergwerk, Wald oder Steinbruch, Russland ist weit.
Ja, weit, nickte ein anderer. Ich habe drei Jahre da verbracht, drei Jahre Fronteinsatz. Und wie durch Wunderhand überlebt.
Also doch Sibirien, stöhnte jemand aus der anderen Ecke. Da kommen am Ende alle hin.
Helmuth konnte nicht nach Sibirien. Denn in Sophienhof, diesem hundert Seelen-Ort, wartete im Keller eines kleinen Bauernhauses seine eingemauerte Schwester. Die blonde Hannah mit dem schmalen hübschen Gesicht. Er wollte sie vor den Russen retten. Das hatte er der Mutter versprochen. Aber jetzt drohte er zu ihrem Mörder zu werden. Ausgerechnet er, der geschworen hatte, das Leben des Mädchens zu schützen. Aber was sollte er denn sonst tun? Was?
Helmuth Harders Gedanken zogen einen großen Bogen. So, wie es die Zugvögel im Herbst über der Oder tun. Seine Gedanken stiegen aus dem engen kalten Waggon in den klaren Himmel, der sich über den Zug wölbte. Sie umkreisten das im Schnee glänzende Feld und den dahinter hoch aufragenden Wald alter Buchen. Sogar die Sonne schien. Die, die eigentlich keinen Platz mehr auf der Welt hatte.
Hannah, schluchzte Helmuth im Dämmerzustand des Halbschlafes. Und dann waren sie schon da, die Erinnerungen. Erst an Hannah, aber auch an Karl Harder, seinen Vater, meinen Großvater. Der hatte alles vorausgesehen. Genützt hatte es auch nichts. Kennengelernt habe ich Karl Harder nie, denn er war lange vor meiner Geburt gestorben. An Krankheit und Entkräftung, wie Mutter später sagte. Wo, das wusste auch sie nicht.
3. Kapitel
Es war bereits dunkel als ich im Blindenheim aufbrach. Vorher brachte ich meine Schwester in ihr Zimmer, das merkwürdig altmodisch aussah. Ich glaubte sogar einige Möbel aus ihrem früheren Zimmer in Rehser entdeckt zu haben. Als ich schon gehen wollte, sah ich einen Stapel alter Kassetten und ein Abspielgerät aus den Siebzigerjahren. Das Gerät, so konnte ich mich erinnern, hatte sie zur Konfirmation erhalten. Ich wusste gar nicht, dass es noch Menschen gibt, die Kassetten besitzen, sagte ich.
Meine Schwester lächelte. Es funktioniert sogar noch, antwortete sie. Du kannst gern Musik hören.
Nein, das will ich wirklich nicht, erwiderte ich und schob dann trotzdem eine Kassette ein. Ich wusste noch nicht einmal warum. Vielleicht aus Neugier. Die Qualität der Wiedergabe war entsprechend schlecht und dass bei Chopins Präludien!
Meine Schwester freute sich. Ich fand es rührend und verkniff mir jede Bemerkung. Ich wusste, dass Lisa Musik liebte. Schon als Kind sang sie den ganzen Tag oder strapazierte die Nerven der Familie über Monate mit dem Abspielen von Tonleitern auf einer Blockflöte. Nicht umsonst fühlte sie sich im Kirchenchor so wohl. Dagegen hatte sie, auch später, mit moderner Popmusik nie etwas anzufangen gewusst. Während einige halbwüchsige Jungen und Mädchen davon nicht genug bekommen konnten und stundenlang mit einem Kofferradio auf dem Arm auf der staubigen Dorfstraße von Rehser hin- und herzogen, hielt sie sich fern. Weder bewunderte sie die Jungen, deren Haare sogar über die Ohren reichten, noch verstand sie, warum man ein Radio wie ein Kind im Arm wiegen und dabei den Kopf im Rhythmus schütteln sollte. Lisa hörte gern mit Mutter Operetten oder am Sonntagnachmittag, wenn sie sicher sein konnte, Vater nicht zu stören, klassische Musik. Aber auch beim Schlagerhören habe ich sie mal überrascht. Sie sang sogar mit, sodass ich mich erst recht über sie lustig machte. Lisa wurde daraufhin so wütend, dass sie mich aus ihrem Zimmer warf. Gern hätte ich sie jetzt daran erinnert, fand den Zeitpunkt aber unpassend. Dafür erlaubte ich mir beim Gehen die Frage, ob sie Klaviermusik möge.
Ja, antwortete sie. Sehr sogar. Orgel und Klavier.
Mehr wollte ich nicht fragen, dabei interessierte es mich brennend, wem das Klavier in Lisas früherem Zimmer in Rehser gehörte, das ich am Vortag entdeckte und das so gar nicht in das Haus passen wollte. Als ich das Vorwerk verließ, spielten weder Vater, Mutter noch Lisa Klavier, noch besaßen wir ein solches Instrument. Nur Vater hatte einmal angedeutet, in seiner Jugend eines besessen oder gar gespielt zu haben. Sogar von einer Orgel war die Rede. Aber nähere Ausführungen machte er trotz mehrfachen Drängens von uns Kindern nicht. Er schien es sogar zu bereuen, jemals eine derartige Andeutung gemacht zu haben. Aber jetzt, nach dem Bekenntnis Lisas, bekam die alte Geschichte mit dem Klavier und der Orgel wieder neue Nahrung. Vater hatte wirklich einmal gespielt, damals in seiner Jugend. Es war kaum vorstellbar. Noch immer sah ich den gebrochenen Mann vor mir, der jede Kirche mied und mit dem Alkohol seinem eigenen Gott verfallen war.
Ich war froh, endlich loszukommen. Der Tag war randvoll mit Eindrücken gefüllt, die ich zu verarbeiten hatte. Im Mittelpunkt stand meine blinde Schwester, an die ich mich erst gewöhnen musste. Es fiel mir nicht leicht, ganz im Gegenteil. Ich wollte ihre Blindheit nicht wahrhaben und hoffte noch während unseres Gespräches, dass es ein böser Traum sei, der sich schnell in Luft auflösen würde. Aber es geschah nichts dergleichen. Stattdessen durfte ich mir die eigene Hilflosigkeit nicht anmerken lassen und musste sie, so gut es ging, überspielen. Ich wusste auch, dass Mitleid der schlechteste Ratgeber wäre, den Lisa nun ganz und gar nicht brauchte. Am liebsten wäre ich davongelaufen, vor der Situation und mir selbst. Und das, obwohl ich mich nach der ersten Aufregung etwas beruhigt hatte, schließlich war auch die Arbeit produktiv. Anmerkungen Lisas ergänzten meine Texte, auch wenn sie sich oft in Nebensächlichkeiten verlor. Vielleicht war ich daran schuld, denn ich bat sie um eine ausführliche Darstellung ihrer Erinnerungen an Vater. Lisa fand bald Gefallen an meinen ersten Texten und lobte sogar meine Beschreibungen, die ihr, trotz fehlender Quellen und notwendiger Interpretationen, Vater noch einmal nah brachten. Auf der anderen Seite bremste sie mich, wenn ich im literarischen Eifer dazu neigte, Szenen zu sehr auszuschmücken. Auch manche der beschriebenen Charaktere gefielen ihr nicht oder sie bemängelte vorzeitige Schlussfolgerungen. Und das war am Ende gut, denn so bekamen Vaters Aufzeichnungen einen Sinn und fassten die Geschichte in ein festes Korsett. Vieles galt es noch am Abend schriftlich festzuhalten. Doch wollte ich meine neue Rolle als Chronist ernst nehmen und dazu möglichst viel Authentisches zusammentragen, bedurfte es noch umfangreicher Recherchen. Inwiefern ich, trotz des guten Anfangs, auf meine Schwester bauen konnte, blieb weiterhin fraglich. Manchmal war sie eben wie Vater.
Auf dem Heimweg nach Rehser hielt ich an einer abseits der Landstraße gelegenen Tankstelle. Ich war froh, in der Gegend überhaupt eine Möglichkeit gefunden zu haben, um etwas einzukaufen. In aller Eile erwarb ich beim Tankwart, einem rundlichen Mitfünfziger mit Glatze und Sommersprossen, ein abgepacktes Knäckebrot, ein paar Käsescheiben und einen Pack Bier. Das musste reichen.
Im Vorwerk von Rehser angekommen öffnete ich gleich zwei Flaschen, nahm meinen Laptop, einen Stapel Notizen, die ich im Blindenheim gemacht hatte, und setzte mich auf Vaters alte Holzbank. Er hatte sie aus ungehobelten Brettern selbst gezimmert. Sie stand noch immer zwischen den beiden Birken vor dem Haus. Die dunkelgrüne Farbe war nur noch in Ansätzen zu erkennen. An jener Stelle, an der Vater gewöhnlich saß, war das Holz besonders abgenutzt und speckig schwarz. Alles war wie früher. Neu war nur ein kleines, von Feldsteinen umrandetes Beet mit verwelkten Blumen, das sich unter einer der Birken befand.
Von der Bank aus konnte Vater die Dunkelheit ins Dorf kriechen sehen, dessen rote Dächer hinter einem Feld verschwanden. Gierig trank ich die erste Flasche und starrte in den Himmel. Es war jetzt Mitte September und noch ungewöhnlich warm. Ich stellte mir vor, wie Vater hier gesessen hatte. Mit grauem, fast weißem, nach hinten gekämmten Haar, sein Körper eingefallen. Den Kopf hatte er gefüllt mit schweren Gedanken. Vielleicht dachte er an Lisa, die langsam erblindete und der er nicht mehr helfen konnte, oder an den Zug mit den Gefangenen und die Beschriftung des Hannah-Fotos mit diesem magischen Satz.
Vielleicht aber waren seine Gedanken in Sophienhof und er fragte sich, warum es ihn ausgerechnet in das südliche Brandenburg verschlagen hatte. Denn er gehörte hier nicht her, sondern dorthin, wo die Harders nach ihrem Auszug aus Markt Einersheim im Steigerwald und einer beschwerlichen Reise durch Franken, Thüringen und Sachsen einen Ort gegründet und eine Kirche erbaut hatten. Und der lag mit dem Pferdewagen eine Tagesreise hinter Breslau im Schlesischen unweit der Oder.
Vielleicht hatte Vater noch die Geschichte im Ohr, wie sie sein Großvater Gustav schon erzählte und sein Vater Karl. Sie gehörte zum Selbstverständnis der Harders und jeder Nachgeborene trug seinen Teil dazu bei, damit sie nicht nur länger, sondern auch umfangreicher und bunter wurde. Die Geschichte hatten meine Vorfahren verinnerlicht, schon deshalb wurde sie von Generation zu Generation weitergetragen.
Sie begann im heißen Sommer des Jahres 1771, genau 158 Jahre bevor Vater das Licht der Sophienhofer Welt erblickte. Es war in den Abendstunden des 15. August als ein Treck mit zweiundfünfzig Siedlern, verteilt auf sieben Pferdefuhrwerke in der neuen Heimat ankam. Die Kolonisten hatten eine achtwöchige beschwerliche Reise, einen ersten gescheiterten Versuch der Landnahme und eine Trennung von einem Großteil ihrer einstigen Mitstreiter hinter sich. Aufgebrochen waren sie in Markt Einersheim, in der Helmitzheimer Bucht, einem fruchtbaren und seit Jahrhunderten bevölkerten Landstrich, der von den bewaldeten Höhen des Steigerwaldes eingerahmt ist. Der Treck der Bauern und Handwerker führte sie bis ins preußische Schlesien. Alois Harder, der über einhundert Jahre vor Gustav, meinem Ur-Großvater geboren wurde, saß auf dem ersten der Fuhrwerke und dirigierte den Zug der Einersheimer in das neue Land, das sie zukünftig Heimat nennen wollten. Ein Land, das erst seit acht Jahren dem preußischen König gehörte, der es in glorreichen Schlachten seiner österreichischen Widersacherin Maria Theresia abnehmen konnte. Friedrich II., den die Geschichte bald nur noch als Friedrich, den Großen kannte, vergab das Land an seine neuen preußischen Untertanen. Egal ob sie aus Hessen, Franken oder Thüringen kamen. Sie alle einte die Dankbarkeit für den Monarchen.
Dankbar waren die Kolonisten auch Gott. Er hatte sie erhört und ihnen den Weg gewiesen aus dem Jammertal. So erklärte es Alois Harder, der nur einen Teil seiner Familie aus Markt Einersheim ins gelobte Schlesierland brachte. Der größere Teil, zwei Buben und ein Mädchen, waren nach zwei Missernten an Hunger und Entkräftung und die Eltern an der Seuche gestorben. Diese hatte große Teile Frankens, aber auch angrenzende Gebiete seit Jahren fest im Griff. Allein in der Gegend um Limpurg, Rechteren, Speckfeld und Einersheim bis hin zum westlich fließenden Main hatte sie in den vergangenen zwanzig Monaten zweitausend Seelen dahingerafft.
Zum Glück fanden die Harders noch einen Platz auf dem schon überfüllten Gottesacker an der Evangelischen Kirchenburg in Markt Einersheim. Hier konnten nun die drei Kinder für immer ruhen. Trotzdem fiel der Abschied schwer. Gerade von Sophie, der einzigen, erst dreijährigen Tochter, die Alois Harder besonders ins Herz geschlossen hatte. Gott hatte sie zu sich genommen und er, Harder konnte nur beten, dass der Herr es da oben gut meinen würde mit der Kleinen.
Eine Woche später, zur Kirchweih am Sonntag vor St. Matthäi, bepackten Alois mit seiner Frau Berta und den verbliebenen zwei Buben den Leiterwagen mit ihrem Hab und Gut: zwei Schränken, einer Bauerntruhe, Betten und Kleidern, Ackergerät, Hämmern, Sägen, Äxten, Rechen, Mistgabeln, einer Sense, Tüchern, Geschirr, Gläsern und Eimern, einem gemalten holzgerahmten Bild, das einen Jüngling mit Schafherde vor einer romantischen Hügellandschaft zeigte, Saatgut, einem Sack Kartoffeln und einem halben Sack Roggenkorn. Und natürlich der Bibel, einem mächtigen, in Leder gefassten Buch, das nicht fehlen durfte. Bereits am nächsten Tag, noch vor Sonnenaufgang, spannten sie die Pferde an. Und dann zog der Treck, dem sich schnell weitere Fuhrwerke anschlossen, durch das Dorf Richtung Osten, der Sonne entgegen. Zuvor aber hielten die Gespanne an der Kirchenburg. Von den Kutschen und Wagen sprangen die Bauern und Handwerker mit ihren Weibern und Kindern, Knechten und Mägden und eilten durch die schmale Pforte auf den Kirchhof. Ein letztes stilles Gebet an den Gräbern der Ahnen und ein Vaterunser aus Dutzenden Kehlen im mächtigen Kirchenschiff folgten. Abschließend ein Lied, dass der Gottesfürchtigste unter ihnen, Alois Harder, anstimmte: Herr schenke Du uns neues Leben und lass uns nicht vergessen der Ahnen Haus … Schnell füllten sich viele Augen mit Tränen.
Dann zogen sie los und ließen die alte Heimat zurück. Mit ihr, so hofften sie, jenen Sensenmann, dessen knöcherne Hand fast jede Nacht an eine andere Holztür der niedrigen Katen in Einersheim geschlagen hatte. Ein Trugschuss, wie sich bald herausstellen sollte, denn der Mann mit dem breiten Lächeln im Totenschädel blieb ihr treuester Begleiter. Schon zwei Tage später trat er neben sie, als vom letzten Leiterwagen des Trecks eine entkräftete Frau in den Straßenstaub fiel und binnen weniger Minuten in den Armen der schreienden Tochter starb. Hilflos standen die Männer, Frauen und Kinder neben der Sterbenden und hoben die Augen gen Himmel. Das Schauspiel wiederholte sich noch einmal, als ein zehnjähriges Mädchen am Ende der ersten Woche von einem durchgegangenen Pferd regelrecht zertrampelt wurde. Es starb innerhalb weniger Tage an inneren Verletzungen. Ihr Leichnam fuhr noch eine Woche Richtung Osten, weil sich die Eltern nicht von der Tochter trennen wollten.
Drei weitere Wochen gingen ins Land, verbunden mit den üblichen Problemen einer beschwerlichen Reise, dem Bruch von Wagenrädern, der Erschöpfung von Mensch und Tier, dem Dauerregen, der drei Tage und Nächte alle und alles aufweichte, dem Streit zwischen Eheleuten und der Flucht eines jungen Mädchens, das bei einem viertägigen Aufenthalt im Thüringischen einem einheimischen Knecht verfallen war. Nur noch einmal kam der Sensenmann, da allerdings hatten sie schon die Elbe bei Meißen gen Osten überschritten. Ein fünfjähriger Bube von Harders Nachbarn rutschte auf einer holprigen Landstraße vom Kutschbock und wurde von den schweren eisenbeschlagenen Rädern des Wagens zerquetscht. Auch er fand seine letzte Ruhe. Diesmal auf einem provisorischen Gottesacker, der ein zerfallenes Kirchlein in der Oberlausitz umschloss, das seit Jahren nicht mehr benutzt wurde.
In der Woche nach diesem Vorfall trafen die Kolonisten auf eine Reihe weiterer Gespanne, die sich aus verschiedenen Gegenden Hessens, aber auch Thüringens aufgemacht hatten, das neue schlesische Land in Besitz zu nehmen. Schnell wuchs der Treck an, weil auch Alois Harder dazu einlud, sich dem Einersheimer Zug anzuschließen. Gott, so verkündete er, hat auf der Erde Platz für alle Menschen geschaffen. Und jede neue Siedlung könnte ein kraftvolles menschliches Zeichen sein, die Bibel richtig verstanden zu haben, in der es heißt: Macht Euch die Erde untertan.
Zwei Wochen später überquerte der vergrößerte Treck eine Oderbrücke bei Breslau und stand bereits am nächsten Sonntag in einer hügligen unwirklichen Landschaft, die ein dichter Wald überzog vor dem, was sie fortan Heimat nennen wollten. Der Name des Ortes, den die erschöpften Kolonisten gründeten, war schnell gefunden. Gegen Alois Harders Vorschlag ihn Neu Einersheim zu nennen, regte sich kein Widerspruch. Auch die Limpurger aus der alten Nachbarschaft des Steigerwaldes hatten ihren Ort, der jetzt fast zeitgleich in der Nähe gegründet wurde, Neu-Limpurg genannt. Die anderen Kolonisten, die immerhin fünf des inzwischen auf zwölf Gespanne angewachsenen Trecks stellten, brachten keine Einwände vor.
Vier Tage später begannen die Siedler mit dem Aufbau ihrer Häuser, die zunächst aus Holz errichtet wurden. Vorher aber holten Alois Harder und zwei weitere Männer, die sich allesamt in ihrem besten fränkischen Sonntagsstaat zeigten, vom Kreisamt in Brieg die Urkunden. In ihnen hatte der preußische König ihre Grundrechte verbrieft. Neu Einersheim war geboren.
Doch der Friede, für den die Harders den Grundstein gelegt hatten, währte nicht lange. Der erste Streit kam auf, als einige der hinzugekommenen Kolonisten für sich einen größeren Teil des neuen Landes beanspruchten. Als Begründung führten sie an, dass sie bereits in ihrer Heimat einen größeren Hof als andere hatten und sogar Wälder und Fischereirechte besaßen. Und dass sie schließlich nicht in die Ferne zogen, um dann auf die gleiche Stufe mit jenen gestellt zu werden. Wiederum andere machten geltend, dass ihre Familien mehr Söhne als andere Töchter hätten. Und Söhne bräuchten schon deshalb mehr Land, um ihre späteren Heiratschancen zu vergrößern. Schließlich führe die Aufteilung des Erbes zur steten Verkleinerung des Besitzes und einer voraussehbaren neuen Hungersnot. Das hatten sie doch schon in der alten Heimat gelernt.
Der Streit entzweite bald ganze Familien, die sich in dem einen oder anderen Lager wiederfanden. Vergeblich versuchte Alois Harder zu schlichten. Ohne Erfolg. Denn inzwischen hatte der Streit einen ersten Verletzten gefunden. Dem Einersheimer Knecht Baldur wurden beim Streit mit einem thüringischen Widersacher zwei Finger mit der Axt abgeschlagen. Zum Glück gelang es, die Wunde schnell zu schließen und mit Heilkräutern zu behandeln, doch für die schwere Aufbauarbeit fiel der Vater zweier Kleinkinder aus.
Geschockt von dem Vorkommnis machte Alois Harder den Vorschlag, eine kleine Kirche im Zentrum des Ortes zu errichten, schon um sich mit dem Herrn zu versöhnen. Dann, so Harder, würde Gott sehen, dass wir als seine Sünder Buße tun. Doch auch dieser Vorschlag führte nicht zum Frieden, sondern zu neuem Krach. Schließlich sah eine große Zahl von Kolonisten nicht ein, das wenige, dringend benötigte Baumaterial dem Kirchenbau zu opfern. Der Boykott der Sammlung von Steinen und Holz traf den frommen Mann hart. Wutentbrannt und laut fluchend verließ Alois Harder die Wagenburg, die einmal ein neues Dorf sein wollte.
Drei Tage verkroch sich Harder allein im nahen Wald. Die Kolonisten glaubten schon an seinen Tod, doch er kam aus dem Wald zurück und machte einen folgenschweren Vorschlag. Er, Alois Harder, wolle in einen Ort gehen, über den Gott seinen wahren Segen ausbreite, in dem Friede, Eintracht und Harmonie, vor allem aber Gottesfürchtigkeit herrsche. Einen Ort, in dem die Menschen von Geburt an gleich sind und nur der Fleiß sie zu kleinerem oder größeren Wohlstand führe. Aber vor allem solle es ein Ort sein, an dem zuerst dem Herrn durch den Bau eines Gotteshauses gedankt wird.
Ratlos schauten sich die Zuhörer an. Wie aber sollen wir noch ein Stück Land erwerben?, fragte einer der Einersheimer Bauern besorgt. Der König wird uns keine zweite Chance geben.
Harder ließ sich nicht beirren. Auch der König habe Interesse an folgsamen gottesfürchtigen Untertanen. Er selbst sei bereit, bei einem Provinzbeauftragten in Breslau oder wenn es sein müsse, beim König selbst um eine Genehmigung zu ersuchen.
Einwände und Bedenken der Kolonisten ließ Harder nicht gelten. Am kommenden Tag brach er nach Breslau in die zuständige Provinzverwaltung auf. Zwei Wochen später war er wieder zurück. In der Hand eine Urkunde zur Gründung einer neuen Niederlassung, der er, der Sicherheit halber, schon einen Namen gab: Sophienhof.
Damit hatte er seiner noch in Einersheim verstorbenen Tochter ein Denkmal gesetzt. Mit Jubel wurde er von den Kolonisten empfangen, auch von denen, die er zurücklassen musste und wollte. Denn nur die Frommsten und Gottesfürchtigsten unter ihnen sollten sich Alois Harder anschließen. Und so zog nicht einmal sechs Wochen nach der Ankunft ein neuer Treck von sieben Gespannen in die neue Heimat, die keine zwei Tagesreisen von Neu Einersheim entfernt lag. Diesmal allerdings unweit der Oder, in ein sumpfiges, aber fruchtbares Land. Bald schon wurde ein Gotteshaus aus Feldsteinen errichtet, genauso wie es sich Alois Harder immer wünschte. Als es fertig war, schlugen die Zimmerer einen Spruch in ein Brett des Kirchturms:
Den Meister kan das Werck nur loben. Doch aller Segen kommt von Oben. Beschütze Vater Kirch und Thurm, Vor Zwietracht, Feuer, Wettersturm, Gib, daß wir deinen Willen thun, So wird dein Segen auf uns ruhn!
An alles hatten die Zimmerer gedacht, nur nicht an den Krieg, der über hundertsiebzig Jahre später mit aller nur denkbaren Grausamkeit über den Ort kommen sollte. Er machte weder vor der Kirch noch vor dem Thurm halt. Und schon gar nicht vor den Sophienhofern, die glaubten, dass Gottes Segen auf ihnen ruhen würde.
Dass es mit dem Segen gar nicht so leicht war, zeigte schon die wechselvolle Geschichte des neuen Ortes. Für alle noch so frommen wie arbeitsamen Kolonisten galt der bekannte Satz: Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot. Und wirklich hatte es drei Generationen harter Arbeit bedurft, um die neue schlesische Heimat in einen blühenden Landstrich zu verwandeln. Seuchen und seltene Krankheiten spielten den Sophienhofern übel mit, ebenso wie die überaus kalten und zuweilen heimtückischen Winter. Solche Winter kannten sie aus ihrer früheren Heimat nicht. Es kam sogar vor, dass späte Frosteinbrüche bis in den Mai hinein Teile der Saat vernichteten. Doch die Sophienhofer lernten. Zwei Generationen später konnten selbst die strengsten Fröste die Bauern nicht mehr schrecken.
Vater hatte die Geschichte seines Dorfes, so gut es ging, weitergetragen. Allerdings hörte sich seine Geschichte immer wie ein Märchen an, jedenfalls für uns Kinder. Ohnehin musste er dafür einen guten Tag haben und ein wenig mehr Alkohol als sonst. Schwer vorstellbar, dass der Erzählung reale Begebenheiten zugrunde lagen. Ortsnamen vermied er weitestgehend. So konnten wir die Geschichte nirgends zuordnen. Nachfragen zu beantworten, lehnte Vater ab. Auch später, als ich schon studierte, ließ er sich nicht auf ein Gespräch ein. Was blieb, war der Bericht über eine entbehrungsreiche Reise und eine Frage, die sich Vater oft selbst stellte: Was wäre wenn?
Sophienhof, so hatte er es noch von seinem Vater gelernt, wird noch für viele Generationen der Harders Heimat sein. Doch Karl Harder, mein Großvater, irrte sich. Wer konnte auch glauben, dass einmal eine russische Armee bis in das schlesische Kernland vordringen würde:
Nicht einmal in der Mitte des fünften Kriegsjahres dachte im Dorf jemand daran, dass die Rote Armee Stalins in Sophienhof landen könnte. Schließlich war die Front noch weit weg. Auch wenn die Orte, die der tägliche Heeresbericht von den Schlachtplätzen im Osten nannte, immer bekannter wurden. Schon lange waren es nicht mehr russische oder ukrainische Städte, Flüsse und Landschaften. Jetzt, Ende 1944, waren es auch polnische und sogar deutsche. Die plärrten die Goebbelsschnauzen, wie man die neuen Volksempfänger in Sophienhof nannte, in jede Wohnstube, auch in die Poststelle und den Schankraum der Gastwirtschaft. Und schon das machte den Bauern Angst.
Karl Harder legte täglich eine große Karte auf den Küchentisch und versuchte die genannten Orte aus den Lageberichten zu finden. Bald hatte er, der ansonsten über keine großen geografischen Kenntnisse verfügte, Übung. Hier, schau nur, sagte er zu seinem Sohn und zog mit dem Zeigefinger große Kreise. Helmuth, der seit einem halben Jahr die Höhere Schule in Namslau besuchte und sich vor allem für Musik, Deutsch, aber auch Religion interessierte, las am liebsten in Notenblättern. Aber wie bei jedem Jungen in seinem Alter schlug auch sein Herz höher, wenn es um die täglichen Frontberichte ging und Heldengeschichten die Runde machten. In der Schule gab es bald kein anderes Thema. Wie gebannt starrte er auf die abgegriffene Karte, auf der Vater Karl mit Radiergummi und Bleistift den Frontverlauf korrigierte. Spannend war es schon zu sehen, wie ein Weltkrieg auf einem Küchentisch Platz fand. Wie Länder und Staaten zusammenschrumpften, sich andere ausdehnten. Wie Frontlinien verschwammen, Armeen sich in unbekannten Weiten verloren, um dann wieder an einer anderen Stelle aufzutauchen. Geradezu merkwürdig erschien die Neuordnung Europas, in der sich Landschaften und Orte ganz der Geschichte des Vergehens ergaben.
Helmuth sah die Spuren früherer Linien, die kein Radiergummi ungeschehen machen konnte. Eindrücke blieben. Ehemalige weit im Osten verlaufende Fronten, deren kleinste Verschiebung manchmal schon mit dem Tod Hunderter oder gar Tausender erkauft wurden. Und das auf jeder der beiden Seiten. Auch dort vor Moskau und Stalingrad, bei Leningrad, Kursk, Kiew und Minsk, ließen sich die früheren Bleistiftlinien genau verfolgen. Linien, die immer mehr nach Westen rutschten und ausschauten wie ein Bauch. Ein russischer Bauch, der dicker und doch nicht satt wurde. Gefüllt mit den Leichen und Krüppeln eines langen Krieges. Ab Sommer 1944 wurde der Bauch zur Bedrohung. Doch das große Fressen hatte noch gar nicht begonnen.
Nach unzähligen, wie es hieß, heldenhaften Abwehrschlachten und ebenso heldenhaften Frontbegradigungen hatte die russische Streitmacht längst die Weichsel erreicht. Die unbesiegbaren Helden waren gewichen. Der Heldenmut in Blut ertränkt. Es blieben Durchhalteparolen und Führerbefehle.
Auch Karl Harder und sein Sohn Helmuth hörten sie. Dort in ihrem Haus in Sophienhof, in dem auch Karl Harder geboren wurde. Es war im Jahr 1889, jenem Jahr als auch der Führer, 800 Kilometer entfernt, das Licht der Welt erblickte. Auf diese Gemeinsamkeit war Karl nie stolz, ganz im Gegenteil. Er mochte den Führer nicht, denn er war, wie er sich ausdrückte, nicht gottesfürchtig. Hitler, so sagte er zu seinem jüngsten Sohn, maße sich an, selbst eine Gottheit zu sein. Und das ist noch nie einem Menschen bekommen. Auch keinem Übermenschen. Da könne er noch so viele Siege erstreiten, am Ende seien auch diese nur Pyrrhussiege.
Daran schien viel wahr zu sein. Die Leute im Dorf lernten schnell, hinter die Wehrmachtsberichte zu schauen. Und sie hatten eigene Interpretationen, die sie nicht erst ab Dezember 1944 besser für sich behielten. Im Gegensatz zu den Hundertprozentigen. Für die stand der Endsieg fest, Zweifel wurden im Keim erstickt. Davon gab es in Sophienhof, abgesehen von den Jungen in der Schule, die allesamt ihrem Fronteinsatz für Führer, Volk und Vaterland entgegenfieberten, vor allem drei. Den Ortsgruppenführer Stolze, den Bürgermeister Lüder und den Geschichtslehrer Rautenberg. Rautenberg war es auch, der bei jeder passenden Gelegenheit historische Vergleiche bemühte, um die Gesetzmäßigkeit des deutschen Sieges zu begründen. Selbst die immer größere Zahl von Todesanzeigen schreckte ihn nicht. Man müsse nur an das leuchtende Vorbild Sparta denken!
An Sparta dachte außer ihm in Sophienhof keiner. Auch nicht an die Griechen oder gar Römer, denn das alles war weit weg.
Dennoch blieb Rautenberg nicht allein. Auch Bürgermeister Lüder sah ein untrügliches Zeichen, dass nunmehr der Endsieg bevorstünde. Dabei fielen seine zwei Söhne im kurzen Abstand von zehn Tagen. Doch Lüder war überzeugt, der Führer denke an alles und würde auch seine Söhne rächen. Dafür hatte die Vorsehung ihn, den größten Feldherrn aller Zeiten, vor dem Tod gerettet, damals im Sommer 44 in der Wolfsschanze. Das Schicksal musste es gut meinen mit dem Führer und seinem Volk.
Karl Harder, ein gelernter Tischler und seit drei Jahrzehnten Bauer auf dem elterlichen Hof, war anders. Und das nicht, weil er als Kirchenältester eine Verantwortung für die einhundertfünfzig Seelen der Gemeinde Sophienhof trug. Wohl eher hatte es damit zu tun, dass er die Berufung fühlte, den Harderschen Glauben der Vorfahren in die nächste Generation zu tragen. Gott war der Garant für die Gerechtigkeit, so hatte er es auch seinem Sohn Helmuth eingebläut, und Gottesfürchtigkeit der Maßstab allen Lebens. Kein Wunder, wenn er jeden Sonntag in die Kirche lief und den Herrgott um Vergebung bat. Wobei weder seine Frau noch die Kinder herausfinden konnten, welche Missetat einer Vergebung bedurfte.
Aber so ist der Harder, scherzte Ortsgruppenführer Stolze und wies auf den bärtigen kräftigen Mann, der nach seiner Meinung ganz aus der Zeit fiel: ein frömmelnder Zeit-, statt ein strammer Volksgenosse!
Karl Harders Vorsehung hing am schlichten Holzkreuz in der alten Feldsteinkirche vorn im Altarraum. Mehr brauchte er nicht. Da war für den Führer kein Platz. Aber darüber sprach er besser nicht. Vielmehr verwies er auf den Umstand, dass die Vorfahren erst die Kirche und später ihre Häuser errichtet hatten. Denn schon damals war ihnen Gott näher als die Obrigkeit und näher als ihr eigenes Wohl. Auch hundertsiebzig Jahre später sollte das für Karl Harder nicht anders sein.
Entsprechend missmutig schaute er, den kräftigen Oberkörper und das vom Bart fast zugewachsene Gesicht über den Tisch gebeugt, auf die Karte. Jede Frontbegradigung ist ein, wenn auch nur kleines, Eingeständnis eigener Schwäche, sagte er und runzelte die Stirn. Und dann sprach er aus, was bisher niemand zu sagen wagte: Irgendwann werden die Russen auch zur Oder oder gar nach Breslau vordringen.
Die Russen in Breslau! Für den Sohn eine absurde Vorstellung. Dass wäre ja so, als würde die Wehrmacht auf dem Mond landen, um dort einen Brückenkopf zu errichten. Breslau ist immerhin die größte schlesische Stadt, ein deutsches Bollwerk, waffenstarrend mit Armeen und Kasernen! Dazu altehrwürdig gefüllt mit Kirchen und Baudenkmalen, durchzogen von Flussarmen, bestückt mit Inseln und Hunderten Brücken, aber vor allem reich an Geschichte. Dazu kommt seine strategische Bedeutung, dort an der Oder, wo die Schifffahrtslinien und Eisenbahnkreuze zusammenlaufen. Nein, Breslau doch nicht! Oder?
Karl Harder strich sich mit der großen klobigen Hand durch den Bart.





























