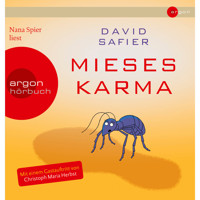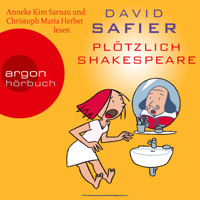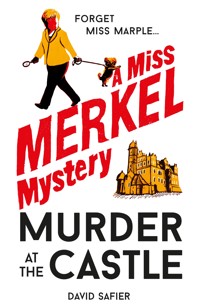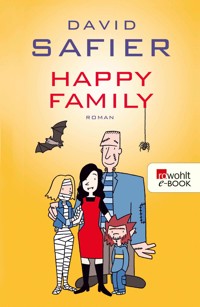
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vollblutmama Berufsstress, Ehe, Kinder – eine Mischung, die schon stärkere Frauen als Emma verzweifeln ließ. Wird sie als Vampirin endlich glücklich? Und falls ja, mit der Familie? Oder mit Graf Dracula? Emotionszwerg Der überarbeitete Frank singt den «Burnout-Blues». Als Frankensteins Monster muss er sein Herz wiederfinden, um die Familie zu retten. Pubertätsmonster Fee liebt Jannis, doch der liebt Mädchen mit mehr Bus... na ja, jedenfalls keine Mumien. Fee hat nur eine Chance, die wahre Liebe zu finden: endlich erwachsen zu werden. Intelligenzbestie Max ist der Einzige, der den Zauber super findet. Bissig zu sein ist besser als uncool, vor allem bei Mädchen. Wenn da nur nicht das Problem mit dem Gassi-Gehen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
David Safier
Happy Family
Roman
Über dieses Buch
Vollblutmama
Berufsstress, Ehe, Kinder – eine Mischung, die schon stärkere Frauen als Emma verzweifeln ließ. Wird sie als Vampirin endlich glücklich? Und falls ja, mit der Familie? Oder mit Graf Dracula?
Emotionszwerg
Der überarbeitete Frank singt den «Burnout-Blues». Als Frankensteins Monster muss er sein Herz wiederfinden, um die Familie zu retten.
Pubertätsmonster
Fee liebt Jannis, doch der liebt Mädchen mit mehr Bus... na ja, jedenfalls keine Mumien. Fee hat nur eine Chance, die wahre Liebe zu finden: endlich erwachsen zu werden.
Intelligenzbestie
Max ist der Einzige, der den Zauber super findet. Bissig zu sein ist besser als uncool, vor allem bei Mädchen. Wenn da nur nicht das Problem mit dem Gassi-Gehen wäre.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
(Umschlagillustration Ulf. K.)
ISBN 978-3-644-30671-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für Marion, Ben ...
EMMA
FEE
EMMA
FEE
EMMA
FRANK
BABA YAGA
EMMA
MAX
EMMA
FEE
MAX
EMMA
FEE
MAX
EMMA
FEE
EMMA
MAX
FEE
EMMA
FEE
EMMA
MAX
EMMA
DRACULA
EMMA
CHEYENNE
EMMA
FEE
MAX
EMMA
FEE
MAX
EMMA
MAX
EMMA
FEE
EMMA
FEE
EMMA
FRANK
EMMA
MAX
EMMA
FRANK
EMMA
MAX
FEE
EMMA
FEE
EMMA
FRANK
MAX
FEE
EMMA
DRACULA
EMMA
Danksagung
Gutes Karma Stiftung
Für Marion, Ben und Daniel – ihr macht mich happy!
(Du natürlich auch, Max)
EMMA
«Ein indianisches Sprichwort sagt: Je mehr man jemanden liebt, desto mehr möchte man ihn umbringen», erklärte meine Angestellte.
Und ich dachte mir: Mann, muss ich meine Familie lieben.
Schon zum x-ten Male klingelte während der Arbeit in meinem kleinen Kinderbuchladen das Handy. Zuerst hatte meine Teenagertochter Fee angerufen, um mich seelisch darauf vorzubereiten, dass sie sitzenbleibt (sie besaß nun mal leider die Mathe-Begabung eines Labradors).
Danach rief ihr kleiner Bruder Max an, um mir zu sagen, dass er nicht in die Wohnung reinkäme, weil er wieder einmal den Schlüssel vergessen hätte (ob es eigentlich so etwas wie Kinder-Alzheimer gab?).
Und diesmal war es laut Handy-Display mein Ehemann Frank. Höchstwahrscheinlich, um mir mitzuteilen, dass er – wie fast jeden Tag – später aus dem Büro nach Hause kommen würde. (Was nicht nur bedeutete, dass ich mich erst mal ganz allein mit Fee wegen ihrer geradezu olympischen schulischen Faulheit herumstreiten dürfte, sondern auch, dass ich wieder mal ohne jegliche Hilfe gegen das Chaos in unserer Wohnung ankämpfen müsste. Die sah an einigen Tagen so aus, als ob plündernde Hunnen durch sie gewandert waren. Begleitet von Elefanten. Und von Ogern. Und von Britney Spears.)
Ich beschloss, nicht ans Handy zu gehen, um mir ein Gespräch zu ersparen, bei dem ich mich nur wahnsinnig aufregen würde und an dessen Ende ich mich noch mehr darüber aufregen würde, dass ich mich so aufgeregt hatte.
Stattdessen starrte ich stumpf aus dem Fenster meines Buchladens namens Lemmi und die Schmöker. Dabei dachte ich traurig daran, dass es mal eine Zeit gegeben hatte, in der ich meine Familie ohne negative Gedanken geliebt hatte. Das war, bevor wir von diesen gemeinen Monstern heimgesucht worden waren, die da hießen: Berufsstress, Midlife-Crisis und Pubertät.
Ja, wir Wünschmanns waren mal eine glückliche Familie gewesen. Aber irgendetwas war uns in den letzten Jahren verloren gegangen. Bedauerlicherweise hatte ich keine Ahnung, um was genau es sich dabei handelte, und dementsprechend noch viel weniger Ahnung, wie ich dieses Etwas je wiederfinden konnte. Dabei wünschte ich es mir so sehr.
Während ich mich nach den alten Zeiten zurücksehnte, ging am Fenster meines Buchladens ein junger Mann mit einem faszinierenden Hintern vorbei. Ich rückte meine Brille zurecht und betrachtete ihn mir genauer.
«Knackiger Po, was?», bemerkte meine alte Angestellte Cheyenne, die eigentlich Renate hieß, aber auf diesen Namen nicht hörte und mit ihren Blumen im Haar und ihren wallenden Kleidern wohl die älteste Hippiefrau des uns bekannten Universums war.
«Ähem, ich hab keinen Po gesehen», flunkerte ich nicht sonderlich überzeugend. Cheyenne lächelte nur verschmitzt. Daher fügte ich schnell hinzu: «Abgesehen davon, war der ein bisschen zu knochig.»
«Du hast ihn also doch gesehen, Emma», grinste die alte Dame. Und während ich ertappt dreinblickte, stellte sie fest: «Der Junge könnte dein Sohn sein.»
Mein Gott, Cheyenne hatte recht. Ich war Ende dreißig, der Typ höchstens Anfang zwanzig. Und ich gaffte so einem jungen Mann hinterher. Wie beschämend.
«Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Sex, Emma?», fragte Cheyenne und nippte an ihrem Yogi-Tee, der roch, als hätte ein sehr alter Yogi seine Füße darin gebadet.
«Ähem …», zögerÍte ich mit der Antwort, weil ich Schwierigkeiten hatte, mich daran zu erinnern.
«Hab ich mir gedacht», grinste sie nun sehr breit.
Tatsächlich war bei all dem Stress, den Frank und ich mit unseren Berufen und Kindern hatten, regelmäßiger Sex für uns beide Science-Fiction.
«Ich hatte gestern das letzte Mal», teilte Cheyenne freudig mit.
Noch bevor ich sie darum bitten konnte, nicht ins Detail zu gehen, redete sie weiter: «Ich sag dir, Werner ist zwar etwas klapprig, aber er hat ein riesiges Dingeling …»
«Moment mal», fragte ich etwas irritiert, «du nennst sein Ding … ‹Dingeling›?»
«‹Dingeling› oder ‹Pipimann›.»
«Dann lieber Dingeling», befand ich.
«Das findet Werner auch.»
Sie nippte noch mal an dem Tee und fuhr genüsslich fort: «Werner ist fast so ein guter Liebhaber wie Carlos, damals im heißen Herbst.»
Cheyenne erzählte immer wieder gerne von all ihren verflossenen Liebhabern, die sie im Laufe der Jahrzehnte vernascht hatte, von Yussuf, Mumbato oder Mao … Und ich liebte es, ihren Geschichten aus all den fernen Ländern zu lauschen. Länder, die ich wohl nie sehen würde, obwohl ich als junges Mädchen immer davon geträumt hatte, die ganze Welt zu bereisen.
«Ich muss nach Hause, meinen Sohnemann in die Wohnung lassen …», erklärte ich seufzend und nahm meine abgewetzte Lederjacke von der Garderobe.
«Geh nur, Emma, wir haben ja eh kaum Kunden», lächelte die alte Hippiebraut.
«Oh, wir haben viele Kunden!», protestierte ich. Aber das stimmte nicht. Auch an diesem Vormittag waren es nur wenige gewesen: die Ärztin, die sich einmal die Woche stundenlang von mir beraten ließ und sich dann die Bücher immer auf Amazon bestellte. Eine Familie, deren Kinder sich einen Band vom Magischen Baumhaus kauften, dafür aber mit ihren Softeishänden zwölf teure Hardcoverbücher beim Durchblättern ruinierten. Und Cheyennes Lover Werner, der, nur um seine Liebste zu sehen, sich das Pixi-Buch Conny schläft im Kindergarten anschaffte.
«Wir sollten Erotikromane verkaufen», schlug Cheyenne vor.
«Wir sind ein Kinderbuchladen!»
«Es gibt da aber ganz viele interessante Titel im Erotikbereich», ließ sie nicht locker, «zum Beispiel Die Kosakensklavin …»
Ich verzog das Gesicht.
«Oder Bettenwechsel in Dänemark …»
Ich verzog noch mehr das Gesicht.
«Oder Drei Nüsse für Aschenbrödel …»
«Das ist eine Kindergeschichte», widersprach ich.
«Nicht in dieser Variante», grinste Cheyenne.
«Ich will nicht solche Bücher verkaufen!», protestierte ich und fügte noch schnell hinzu: «Und auch nicht genauer darüber nachdenken, warum es drei Nüsse sind.»
«Aber der Laden geht sonst den Bach runter!», insistierte Cheyenne. «Unser Lesesofa ist durchgesessen, die Spielecke für die Kinder fast so alt wie ich, und als ich neulich im Lager die Regale entstaubt habe, sah mich plötzlich eine Kakerlake an.»
Cheyenne sprach lauter ungeliebte Wahrheiten über meine Buchhandlung aus. Wahrheiten, die ich nicht hören wollte, weil ich sie selbst zu verantworten hatte. Wenn ich mehr Energie und Zeit für den Laden hätte, würde es hier besser aussehen und auch um den Umsatz besser stehen. Aber wer hatte schon Zeit und Energie, wenn er so eine kraftraubende Familie besaß wie ich?
Cheyenne sprach gleich noch eine weitere Wahrheit aus, eine sehr bittere: «Du hast nur eine Möglichkeit, den Gewinn zu steigern: Du musst mich entlassen.»
«Das kommt nicht in die Tüte», erwiderte ich.
«Du brauchst mich aber nicht», seufzte Cheyenne traurig und wirkte mit einem Male wirklich alt, «die paar Bücher kannst du auch selbst verkaufen.»
Das stimmt, dachte ich.
«Und ich verrechne mich andauernd», klagte sie leise.
«Das stimmt», sprach ich nun laut aus.
«Und ich hab letzte Woche das Klo verstopft.»
«Du warst das?!?», rief ich empört aus, denn das verstopfte Klo hatte eine extrem hohe Klempnerrechnung nach sich gezogen. «Wie hast du denn das hingekriegt?»
«Mir ist mein Hämorrhoidenpflaster reingefallen», gestand sie kleinlaut.
Cheyenne hatte mit allem recht: Wenn ich sie entlassen würde, wäre es besser für mein Konto und wohl auch für meinen Laden. Aber ohne Lohn würde sie in ihrem VW-Bus übernachten müssen, bezog sie doch kaum Rente, weil sie, anstatt zu arbeiten, ihr Leben lang durch die Welt gezogen war. Dabei hatte sie – wie ich immer wehmütig dachte – mehr erlebt und gelebt, als ich es in meinem kleinen, langweiligen Leben je tun würde.
«Ich werde dich nie entlassen», erklärte ich bestimmt.
Cheyenne lächelte mich zutiefst dankbar an und sagte: «Du bist eine Gute.»
Ich musste zurücklächeln. Aber mir war klar, dass ich mir irgendetwas einfallen lassen musste, wenn ich wollte, dass mein Laden überlebte. Denn ohne ihn würde ich nur noch Hausfrau und Mutter sein. Und das war mir viel zu wenig. Vor allem in dem Zustand, in dem sich diese Familie gerade befand.
Ich schickte einen Wunsch ins Universum, dass es eine Rettung für meinen Laden geben möge, nur um gleich darauf festzustellen: Das Universum besaß einen recht merkwürdigen Sinn für Humor.
Ich wollte gerade aus der Tür gehen, da betrat sie meinen Laden: Lena. Ausgerechnet Lena! Ich hatte sie seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen, und sie sah fast noch genauso aus wie damals: schlank und umwerfend. Nur hatte sie jetzt auch noch schicke, teure Klamotten an, die ich außerhalb von Lifestylemagazinen noch nie gesehen hatte.
Lena und ich hatten in grauer Vorzeit gemeinsam als junge motivierte Lektorinnen in der deutschen Filiale des Penguin-Buch-Verlags gearbeitet. Lena war ehrgeizig und neigte zu Ellenbogeneinsatz. Dennoch hatte ich die Nase immer leicht vorn. Schließlich bekam ich sogar eine Stelle in London angeboten, bei der es sich um einen absoluten Traumjob handelte, von dem aus ich – so wie ich es mir schon als Mädchen erträumt hatte – die Welt hätte erobern können. Als Lena von dem Angebot hörte, wurde sie grün vor Neid.
Allerdings hatte ich wenige Wochen zuvor Frank in einem Beach-Club an der Spree kennengelernt. Ich spielte mit Freunden Volleyball, er kam hinzu, erklärte, dass er als Jura-Student neu in der Stadt wäre, und fragte, ob er mitspielen könnte. Ich sah in seine tiefen blauen Augen, und mein Gehirn machte winke, winke. Es überließ meinen Hormonen die Schlüssel zu meinem Körper und verabschiedete sich in den Urlaub, um an irgendeinem Karibikstrand Caipirinhas zu trinken und sich beim Limbo-Tanz zu vergnügen.
Parallel dazu verabschiedete sich auch Franks Gehirn. Und wenn zwei Gehirne sich so verabschieden, dann kommt es schon mal nach einiger Zeit zu Situationen, in denen man liebestoll übereinander herfällt und sich vor lauter Leidenschaft nicht sonderlich dafür interessiert, dass das Kondom verrutscht ist. Mit der Folge, dass man ein paar Wochen später über Morgenübelkeit staunt.
Als wir den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten, freuten wir uns unheimlich. Dabei war mir schon klar, dass ich mit Kind den Traumjob in London nicht annehmen konnte. Aber ich liebte Frank, wie ich noch nie jemanden zuvor geliebt hatte. Und das Kind wegzumachen … allein bei dem Gedanken wurde mir gleich noch morgenübler.
Als ich dann beim Arzt das erste Mal auf dem Ultraschall das kleine schwimmende Etwas sah, das in mir heranwuchs, wurde mir ganz wohl ums Herz. Zutiefst beseelt, deutete ich auf das Ultraschallbild und flüsterte leise: «Es ist wunderschön.» Und es machte mir auch kaum etwas aus, als der Arzt anmerkte: «Das ist Ihre Blase.»
Ich entschied mich gegen London, für das Kind und für Frank. Lena konnte mich nicht verstehen, sie hätte sich für eine Abtreibung entschieden, erklärte sie mir. Aber sie freute sich, konnte sie doch statt meiner die Stelle in London antreten, was sie mit dem Satz kommentierte: «Dein verrutschtes Kondom ist mein Glück.»
Später hörte ich dann gelegentlich, dass Lena in London richtig Karriere gemacht hatte. Ich wollte aber nichts Genaueres über das Leben erfahren, das ich nicht gelebt hatte. Anfangs, weil ich mit meinem Familienleben so happy war, in den letzten Jahren hingegen eher, weil ich mich immer mal wieder bei Was-wäre-wenn-Gedanken ertappte, denen ich keinen Raum geben wollte. Doch jetzt stand dieses Leben direkt vor mir. In meiner kleinen Buchhandlung.
«Lena …?», fragte ich ungläubig.
«Wie ich leib und lebe», strahlte sie.
Was wollte sie hier? Nach all den Jahren?
«Du …», stammelte ich, «du siehst unglaublich aus, wie früher.»
«Du aber auch, Emma Wünschmann!», erwiderte sie, und wir wussten beide, dass das gelogen war. Ich besaß bereits so viele graue Haare, dass ich schon öfters unsicher im Bad vor dem roten Haarfärbemittel meiner Tochter stand. Außerdem, und eigentlich noch viel schlimmer, besaß ich einen von den Schwangerschaften mitgenommenen dicken Bauch (Cheyenne hatte mir sogar mal ein T-Shirt geschenkt mit der Aufschrift Ich habe meine Magersucht überwunden).
«Und du bist auch wieder schwanger!», freute sich Lena und deutete auf meinen Bauch.
Ich wurde hochrot.
Und Cheyenne musste vor sich hin prusten.
Lena sah in mein peinlich berührtes Gesicht und verstand: «Oh, tut mir leid …»
«Was … was führt dich hierher?», fragte ich, um von meinem Bauch abzulenken.
«Ich bin beruflich in Berlin. Und als ich von den Leuten aus unserer alten Abteilung erfahren habe, dass du eine kleine Buchhandlung hast, dachte ich mir, ich komm mal vorbei», strahlte sie.
«Und … wie läuft es so in London?», fragte ich und bereute die Frage schon, kaum hatte ich die Worte ausgesprochen.
«Sehr gut. Ich leite jetzt die Abteilung Internationale Bestseller und betreue Dan Brown, John Grisham oder Cornelia Funke …», schilderte sie in einem möglichst bescheidenen Tonfall, der ihre Lust am Angeben nur unzulänglich kaschierte. Jetzt war es klar, warum sie hier war: Sie wollte mir unter die Nase reiben, was für ein tolles Leben sie führte. Kleingeistig. Wirklich kleingeistig. Aber leider von Erfolg gekrönt. Ich hatte echt Mühe, vor Neid nicht grün anzulaufen.
«Man kommt viel in der Welt herum», erklärte Lena nonchalant lächelnd. «Erst letzte Woche war ich bei einem Literaturfestival auf Mauritius.»
Nun lief ich doch grün an und dachte: Wenn sie das noch steigert, dann schreie ich!
«Ich hab da Hugh Grant betreut.»
«AHHHH!!!», schrie ich nun laut.
«Alles in Ordnung?», fragte Lena besorgt.
«Ähem, ja, ja …», flunkerte ich hastig, «mich … mich hat nur eine Kakerlake gebissen.»
«Du hast Kakerlaken in deinem Laden?», fragte sie angewidert.
«Nur eine …», gab ich zurück und wollte am liebsten vor Scham im Boden versinken. Aber ich riss mich nach ein paar Sekunden wieder zusammen und versuchte mir einzureden, dass ich nicht neidisch auf Lena sein musste. Karrierefrauen hatten in der Regel keine funktionierenden Beziehungen und auch keine Kinder und waren daher – so kennt man es ja aus Filmen und Frauenzeitungen – hinter ihrer strahlenden Fassade unglücklich und leer.
«Und hast du eine Familie?», fragte ich daher.
«Nein», erwiderte sie, und ich freute mich in Gedanken: Wusste ich’s doch, unglücklich!
«Ich habe erst mal so richtig gelebt», erklärte Lena. «Und ich hatte richtig viele Liebhaber. Du weißt ja, wie das ist.»
«Nein, das weiß sie nicht», grinste Cheyenne breit, und ich hätte ihr gerne ein Buch an den Kopf geworfen. Oder zwanzig.
«Oh ja», korrigierte sich Lena, «du hast ja das große Glück, schon seit fünfzehn Jahren den gleichen Mann im Bett zu haben.»
Großes Glück, seufzte ich innerlich und dachte daran, dass Frank seit einiger Zeit nachts unter stressbedingten Blähungen litt.
«Jedenfalls bin ich jetzt mit Liam zusammen», strahlte Lena und wirkte dabei leider kein bisschen unglücklich und leer. «Er ist Investmentbanker, und wir wohnen in einem sehr schnuckeligen Landhäuschen in der Nähe von London.»
Sie ließ diesem Bild vom idyllischen Landleben etwas Zeit, sich vor meinem geistigen Auge zu formen, dann stellte sie die Frage, vor der ich am meisten Angst hatte: «Und, Emma, wie geht es bei dir so?»
Ich wollte mir keine Blöße geben und Lena demonstrieren, dass ich in meinem Leben auch alles richtig gemacht hatte. Daher erklärte ich: «Ich hab zwei ganz, ganz tolle Kinder!»
Cheyenne kicherte.
«Sag mal», fragte ich meine alte Angestellte, «hast du nicht ein paar Bücher, die du einsortieren musst?»
«Nö, hab ich nicht», grinste sie. Die Hippiedame wollte sich das Schauspiel nicht entgehen lassen.
Ich wandte mich wieder an Lena und erklärte mit gespieltem Lächeln: «Und Frank und ich führen schon seit fünfzehn Jahren eine richtig gute Ehe.»
Cheyenne kicherte erneut, und ich hätte sie am liebsten gefragt: Sag mal, hast du keine Wand, gegen die du laufen musst?
«Und», wollte Lena nun wissen, «wie läuft deine Buchhandlung so?»
«Ziemlich gut», erwiderte ich.
Cheyenne gackerte jetzt laut auf. Ich warf ihr einen bösen Blick zu. Sie verstand und erklärte: «Ich muss mal für kleine Mädchen», und verschwand.
Lena blickte der alten Dame irritiert nach und flüsterte: «So eine schräge Angestellte würde ich sofort entlassen.»
«Das würde ich nie tun», erklärte ich bestimmt. Lena war davon sichtlich verblüfft. Sie wechselte jedoch schnell das Thema: «Ich hoffe, ich werde irgendwann genauso eine glückliche Familie haben wie du.»
Man hörte lautes Gelächter vom Klo.
«Was hat die Frau die ganze Zeit?», wollte Lena wissen.
«Ach, ihre Inkontinenz-Tabletten haben Nebenwirkungen», sagte ich.
«Das habe ich gehört!», protestierte Cheyenne hinter der Toilettentür.
«Ich habe eine Idee für deinen Laden», erklärte Lena unvermittelt. Sie begriff ganz genau, dass das Geschäft nicht gut lief, und genoss es nun offensichtlich, mir gegenüber die Gönnerhafte zu geben. «Stephenie Meyer stellt heute Abend hier im Ritz-Carlton ihr neues Buch Biss zum Ende vor. Und dreimal darfst du raten, wer sie betreut?»
Ich brauchte nicht ein einziges Mal zu raten.
«Ich kann sie dir bei der Buchpremiere vorstellen, und vielleicht können wir dafür sorgen, dass sie in deinem Laden eine Lesung macht …»
Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So eine Veranstaltung würde meinen Laden stadtbekannt machen! Am liebsten wäre ich Lena in diesem Augenblick vor Dankbarkeit um den Hals gefallen, obwohl mir klar war, dass sie mich nur einlud, damit ich aus nächster Nähe sehen konnte, was für eine traumhafte Karriere sie gemacht hatte.
«Die Buchpremiere wird ein ganz großes Event», erklärte Lena begeistert. «Mit tollem Essen. Und wilden Monster-Kostümen. Weißt du was, bring doch deine Familie mit! Dann kann ich sie mal kennenlernen.»
«Das mache ich!», antwortete ich lachend. Zum einen freute ich mich wegen der großen Chance. Zum anderen dachte ich mir: Wenn Lena meine Familie sieht, würde sie vielleicht neidisch auf mich werden. Schließlich war eine Familie das Einzige, was ich hatte und sie nicht! Und wenn Lena neidisch war … na ja, dann müsste ich nicht mehr so neidisch auf sie sein.
Lena verabschiedete sich mit zwei angedeuteten Wangenküsschen und rauschte aus meinem Laden raus. Kaum war sie draußen, hörte ich die Spülung. Cheyenne kehrte von der Toilette zurück und stellte fest: «Vergiss es, die Tussi ist glücklicher als du.»
Doch ich erwiderte entschlossen: «Das wollen wir doch mal sehen!»
FEE
Ich wäre so gerne ein Hohltier gewesen.
Seit Wochen langweilte unser bescheuerter Biolehrer uns mit Meeresquallen und anderen Hohltieren und versuchte dabei verzweifelt, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es irgendwie wichtig wäre, über diese Lebewesen Bescheid zu wissen. Was für eine verschwendete Zeit für uns alle! Denn selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass man mal in ferner Zukunft als Erwachsene in einem Sessel sitzt und tatsächlich denken sollte: Mann, ich würde jetzt aber wirklich zu gerne wissen, wie diese blöden Hohltiere sich vermehren!, könnte man dann ja immer noch bei Wikipedia nachschlagen oder auf irgendeiner hundertmal besseren Internetnachschlageseite, die es bis dahin garantiert gab.
Heute aber dachte ich das erste Mal richtig über die Hohltiere nach. Die hatten es eigentlich tierisch gut. So ein Hohltier hatte keine nölende Mutter, keinen gestressten Vater, keinen abnervenden Bruder und keinen Unterricht, in dem es mit Hohltieren angeödet wird.
Vor allen Dingen aber konnte so ein Hohltier nicht sitzenbleiben, nur weil es keine Ahnung von Hohltieren hatte.
Papa würde auf meine Ehrenrunde wohl eher desinteressiert reagieren, er war ja in seinem Bankjob so überarbeitet, dass er vermutlich noch nicht mal wusste, in welcher Klasse ich war. Mama aber würde sicherlich zur «Psycho-Mum» mutieren. Ständig hing sie mir in den Ohren damit, dass ich an meine Zukunft denken solle. Natürlich meinte sie es damit nur gut, das war mir schon klar, ich war ja nicht völlig verblödet. Aber je mehr sie die Dinge in ihrem Nölton vortrug, desto weniger Bock hatte ich, auf sie zu hören. Wenn man bei Wiki den Begriff «kontraproduktiv» eingeben würde, käme als Ergebnis bestimmt ein Foto meiner Mutter. Und überhaupt, wie sollte ich an meine Zukunft denken, wenn ich kaum die Gegenwart geregelt bekam?
Die Gegenwart saß zwei Reihen vor mir, hieß Jannis, war ein ziemlich guter Gitarrist und sah aus wie Pete Doherty, nur deutlich gesünder. Mit Jannis hatte ich gestern nicht nur gekifft, sondern auch in seinem Übungsraum auf dem Sofa herumgeknutscht. Allerdings bin ich nicht die volle Distanz mit ihm gegangen. Zum einen, weil ich noch nie mit einem Typen geschlafen hatte, und zum anderen, weil ich nicht wusste, wie ernst es Jannis mit mir überhaupt meinte.
Dabei wäre es ziemlich schön gewesen, wenn er was von mir gewollt hätte, denn er war echt zärtlich, besonders in dem Augenblick, als er sanft meine beiden Schmetterlings-Tattoos auf den Schultern geküsst hatte. (Die Jungs, die ich davor hatte, waren nicht ansatzweise so geschickt gewesen wie Jannis. Die einen hatten sich nicht getraut, mich anzufassen, andere wiederum hatten meine Brüste mit Knetgummi verwechselt.)
Leider war Jannis dafür berühmt, es mit Frauen so ernst zu meinen wie Dracula. Und selbst wenn er jemals eine aufrichtig lieben sollte, dann war das bestimmt nicht ich. Die Kerle, in die ich mich verknallte, ließen mich gerne mal sitzen.
Mit dieser Jannis-Geschichte war ich also auf dem besten Wege, unglücklich zu werden. Aber obwohl ich das wusste, konnte ich nicht gegen meine Gefühle ankämpfen. Die Hohltiere hatten es auch in einer anderen Hinsicht gut: Sie hatten keine Hormone.
Hormone sind doof.
Man sollte sie abschaffen.
Oder ins Gefängnis sperren.
Da gehören sie hin, diese beknackten Hormone. Wären sie hinter Gitter, müsste ich mich nicht andauernd mit der Gegenwart rumschlagen, sondern könnte mich tatsächlich, wie von Mama gewünscht, mal um meine Zukunft kümmern.
Meine ebenso dicke wie gute Freundin Jenny merkte, dass ich Jannis anstarrte, und flüsterte mir zu: «Bist du scharf auf ihn, Fee?»
«Red keinen Schwachsinn», zischelte ich zurück.
«Das heißt also ‹ja›.»
«Nein, das heißt ‹Red keinen Schwachsinn›!»
«Und das heißt: ‹Au Mann, fühl ich mich ertappt›», grinste Jenny. Sie war immer total selbstsicher. Dabei war sie so dick, dass sie in jeder High-School-Komödie das Mädchen spielen konnte, das bei der Jungensmannschaft der Ringer mitmacht. Aber Jenny hatte die Einstellung: Ich werde nie einen perfekten Körper haben, also ist es besser, sich jetzt damit abzufinden, als die nächsten siebzig Jahre unglücklich auf dem Erdball herumzulaufen.
Ich selber war schlank und haderte dennoch ständig mit meinem flachbusigen Körper, mit dem ich die nächsten siebzig Jahre auf dem Erdball herumlaufen würde. Denn wenn der Körper meiner Mutter ein Indikator für meine Gene sein sollte, war klar, dass bei mir vornerum nichts mehr wachsen würde.
Endlich klingelte es zur Pause, der Biolehrer beendete den Hohltiermonolog, bei dem er selber fast eingepennt wäre. Wir standen auf, und Jenny sagte: «Ich verzieh mich dann mal, Fee.»
«Wieso?», fragte ich.
«Weil Jannis sich nähert.»
Jannis kam wirklich auf uns zu!
Meine Knie begannen zu zittern.
«Hi, Fee», sagte er bemüht lässig.
Jetzt steckten meine Knie mit dem Zittern auch noch meine Unterlippe an, und ich antwortete: «Hhhhh.»
Mein Gott, so hatte ich mich ja noch bei keinem Jungen benommen. Ich kam mir vor, als sei ich Hannah Montana entsprungen.
«Ähem, was?», fragte Jannis nett.
Ich versuchte es nochmal, mit wenig Erfolg: «Hihhjjjanns.»
Er schaute mich an, als ob ich von gestern noch bekifft wäre.
Wir schwiegen etwas peinlich berührt. Erst als der Klassenraum leer war, begann er zu reden: «Du, wegen gestern …»
Es war klar, was jetzt kommen würde: Er würde sagen, dass er gestern zugedröhnt gewesen wäre, es nicht ernst gemeint hätte und sich das nächste Mädchen anschaffen wollte. Na ja, Letzteres würde er wohl nicht zugeben, er würde stattdessen irgendetwas von mangelnder Zeit labern. Aber im Prinzip würde es heißen: Die Nächste bitte.
Um der Abfuhr zuvorzukommen, plapperte ich hastig drauflos: «Du, das war gestern alles ein Fehler. Ich hätte gar nicht erst mit dir rumgemacht, hätten wir das Gras nicht geraucht, denn mal im Ernst, du bist nicht gerade mein Typ, und gestern hättest du auch ruhig etwas mehr Deo vertragen können …»
Er schwieg, sah betreten zu Boden und sah dabei aus wie ein Hund, dem man über den Schwanz gefahren war.
«Ist was?», fragte ich daher unsicher.
«Nein, wieso?», erwiderte er bemüht cool.
«Na ja, du siehst aus, als ob dir jemand über den Schwanz gefahren ist.»
«WAS?»
«Ich meine … wenn du ein Hund wärst …», erwiderte ich hastig. Ich benahm mich von Sekunde zu Sekunde durchgeknallter.
«Na ja …», sagte er, «es ist nur so … das gestern mit dir … das fand ich gut. Und du … du hast auch gut gerochen.»
Er meinte es aufrichtig, das spürte ich genau.
«Iiiii …», stammelte ich daher. Unterlippe und Oberlippe zitterten nun im Duett.
«Was?», fragte er.
«Iiii», stammelte ich weiter und motzte innerlich: Ihr beknackten Körperteile, könnt ihr euch mal zusammenreißen?
Sie taten es tatsächlich. Etwas. Zumindest so, dass ich wieder halbwegs verständlich reden konnte: «Ich … ich fand das gestern auch gut.»
«Aber warum hast du dann eben gesagt, alles wäre ein Fehler gewesen?», wollte Jannis wissen.
«Weil ich manchmal ein Hohltier bin.»
«Das sind wir alle mal», antwortete er mit einem super Lächeln. Und wäre ich nicht schon längst in ihn verknallt gewesen, hätte ich mich spätestens in diesem Augenblick in ihn verliebt.
Dann fragte er: «Hast du Lust, heute Abend was mit mir zu unternehmen? Mit Gras, ohne, ganz egal?»
«Ja, das habe ich», erwiderte ich überglücklich und dachte bei mir: Nichts, nichts auf der Welt wird mich davon abhalten können, mich heute Abend mit Jannis zu treffen!
EMMA
Meine Familie war von der Stephenie-Meyer-Idee ziemlich unterwältigt.
«Ich bin verabredet», motzte Fee, noch heftiger als sonst.
«Ich hab zu arbeiten», sagte Frank, noch deprimierter als sonst.
«Ich will lesen», flüsterte Max, genauso leise wie sonst. Er war für seine zwölf Jahre etwas zu klein geraten, auch etwas zu dick. Er war hochbegabt, was seine Popularitätswerte in seiner Klasse nicht gerade hochschnellen ließ. Max war daher in den letzten Jahren zu einem extrem schüchternen Bücherwurm geworden, der es liebte, in Phantasiewelten abzutauchen. Die Realität war ihm eindeutig zu realistisch. Einerseits konnte ich das verstehen, andererseits konnte ich das nicht zulassen. Zuerst hatte ich versucht, ihn dazu zu bringen, Musik zu machen, aber seine Chorleiterin nahm mich zur Seite: «Tut mir leid, das sagen zu müssen: Aber Ihr Sohn trifft einen Ton nicht mal, wenn er vor ihm steht.» Daraufhin hatte ich ihn beim Fußball angemeldet, aber sein Trainer erinnerte in seinen Methoden der Teamführung an Saddam Hussein. Beim letzten Spiel, bevor Max aufhörte, ranzte Saddam mich an: «So wie Ihr Sohn spielt, sollten Sie mal nachprüfen, ob er nicht schwul ist.» Jetzt suchte ich nach einem neuen Ort, an dem Max die Realität genießen konnte, ohne bisher einen solchen gefunden zu haben.
Ich blickte meine Familie an, die am Küchentisch in unserer Altbauwohnung saß, und erklärte entschlossen: «Wir machen das heute Abend als Familie!»
«Ich mach, was ich will», erwiderte Fee.
Es war einer ihrer Standardsätze. So wie: «Ich räume später auf», «Ich schaff das schon noch pünktlich zur Schule» oder «Mama, ich würde doch nie kiffen». (Mir war es schon immer schleierhaft gewesen, warum einige Teenager in der Pubertät anfingen, Gras zu rauchen. Eigentlich müssten das doch die Eltern tun, um diese Phase des Lebens durchzustehen.)
Fees Lieblingsstandardsatz aber war: «Mama, du bist peinlich.» Wenn ich sang, war ich peinlich. Wenn ich mich schminkte, war ich peinlich. Wenn ich mich nicht schminkte, war ich noch peinlicher. Nur einmal, als ich im Badeanzug mit ihr ins Freibad ging, war ich nicht peinlich gewesen. Sondern todpeinlich.
Normalerweise versuchte ich ja, meine Kinder ohne allzu viele Drohungen zu erziehen, aber mir war es nun mal unglaublich wichtig, dass wir als Familie zu Stephenie Meyer gingen, damit ich vor Lena angeben konnte, und so erklärte ich bestimmt: «Wenn du nicht mitkommst, Fee, gibt es Stubenarrest!»
Sie sah mich zornesrot an, wütender als sonst, es handelte sich anscheinend um eine besonders wichtige Verabredung. Bestimmt mit einem Jungen. Aber wenn ich das ansprechen würde, oder gar die Tatsache, dass sie sitzenblieb, dann würde sie garantiert gleich explodieren. Und wenn sie explodierte, würde ich auch explodieren. Und während wir fröhlich vor uns hin detonierten, würde Frank sich zu seinem Laptop verkrümeln und Max zu seinem aktuellen Buch. Daher erwiderte ich gar nichts und ließ ihre Wut im Raum hängen, bis Fee zischelte: «Es ist immer toll, was mit der Familie zu machen. Besonders wenn man es so freiwillig tun darf.»
Frank nahm mich darauf beiseite und fragte leise: «Aber mir wirst du doch keinen Stubenarrest geben, wenn ich nicht mitkomme, Emma? Ich muss mir überlegen, wie ich den Mitarbeitern in der Bank die Einsparungen verkaufe.»
Frank war eigentlich mal Anwalt geworden, um den Armen zu helfen. Doch nach dem Jurastudium stellte er fest, dass Leute, die den Armen helfen, selber arm bleiben. Und da er eine Familie ernähren wollte, nahm er eine Stelle in der Rechtsabteilung einer Bank an und war jetzt dort für Restrukturierungen und das Zeichnen von Organigrammen zuständig. Er litt sehr unter seiner Aufgabe. Es war ja auch schwer, den Menschen zu sagen, dass sie entlassen werden sollten. Wie sollte man so eine Rede überhaupt einleiten? Wohl kaum mit: «Dreimal dürfen Sie raten, wessen Chefs sich völlig verspekuliert haben», oder mit: «Ab jetzt müssen Sie sich nicht mehr über Ihren Abteilungsleiter aufregen», oder mit: «An Ihrer Stelle würde ich in Zukunft mein Essen im Garten anbauen»?
Ich versuchte seine Anspannung mit einem Scherz aufzulockern: «Stubenarrest gibt es nicht, dafür aber Sexentzug.»
«Wie bitte?» Er verstand nicht ganz.
«Du musst dich entscheiden: deine Arbeit oder Sex mit mir heute Nacht. Was soll es sein?»
«Na ja …», überlegte er.
Er überlegte tatsächlich!
Au Mann, ich hatte ja immer gedacht, dass meine eigenen Eltern früher kaum Leidenschaft hatten. Aber auch wenn sie kaum zärtlich miteinander waren, hatten sie mit über fünfzig immer noch Sex, wie ich einmal leidvoll feststellen musste, als ich als Teenager aus Versehen in ihr Schlafzimmer kam – es sah aus, als ob zwei Walrösser miteinander Wrestling machten.
«Das ist mir heute Abend sehr wichtig!», erklärte ich Frank unmissverständlich.
«Na gut, dann arbeite ich an dem Konzept, wenn wir nach Hause kommen. Schlaf ist was für Amateure», lächelte er müde.
Ich war immer wieder überrascht, wie sehr mich sein Lächeln noch bezaubern konnte, selbst wenn es noch so müde war. Jedes Mal, wenn er lächelte, überlegte sich mein Gehirn, dass es doch schön wäre, mal wieder in die Karibik zu reisen und Limbo zu tanzen. Dabei sah Frank ganz anders aus als früher. Sein Haar lichtete sich sehr, sein Gesicht war fahl und eingefallen. Er gehörte zu jenen Menschen, die bei Stress abnahmen, was ich als Stress-Esserin manchmal für eine beneidenswerte Eigenschaft hielt.
Ich gab Frank einen Kuss auf die Wange, ging zu dem widerwilligen Max und erklärte ihm: «Wenn du nicht mitkommst, melde ich dich wieder beim Fußball an.»
Danach hatte ich alle drei an Bord und zeigte ihnen die Kostüme, die ich am Nachmittag für teures Geld bei einem Verleih geholt hatte. Schließlich war die Buchpremiere eine Monster-Kostümparty, und ich wollte, dass wir dort Eindruck schindeten. Ich hatte klassische Verkleidungen der berühmtesten Filmmonster aus der guten alten Zeit des Kinos gewählt.
«Frankensteins Monster», seufzte Frank müde, als ich ihm sein Kostüm gab, mit dem er rumlaufen sollte wie einst Boris Karloff: mit zerrissener grauer Hose, brauner Fellweste und einem grünen Quadratschädel, der mit Schrauben besetzt war.
«Und was sind das für Bandagen?», fragte Fee, extrem genervt, als sie ihr Kostüm von mir in die Hand gedrückt bekam. «Bin ich das Mullbindenmonster?»
«Nein, du bist die Mumie», erklärte ich begeistert. «Dreitausend Jahre hast du im Sarkophag in einer Pyramide gelegen, bis du von Grabräubern befreit wurdest.»
«Na super! Ich gehe also als dreitausend Jahre altes Gammelfleisch», schnaubte sie. «Das passt besser zu dir, Mama.»
Reizend. Das war mal wieder eine Bemerkung, die meine These bestätigte, dass die Geburtswehen nur ein Vorgeschmack der Natur auf die Pubertät waren.
«Wir können uns ja gerne mal über deine gammeligen Schulleistungen unterhalten», erwiderte ich gereizt.
«Das wäre bestimmt ein super Thema», erwiderte sie, und ihre Augen funkelten dabei.
«Nun streitet euch doch nicht wieder», versuchte Frank zu schlichten. Fee und ich herrschten ihn im Chor an: «Halt du dich da raus!»
Erschrocken davon, schüttelte er nur den Kopf und sagte den Satz, den wir beide am meisten hassten: «Ihr seid euch echt ähnlich.»
Wir wollten ihm gerade für diese Bemerkung gemeinsam an die Gurgel gehen, da meinte Max leise: «Ich wäre gerne ein Zombie.»
«So wie du lebst, bist du schon einer», stellte Fee fest.
Ich beschloss, sie fürs Erste zu ignorieren, wandte mich dem Kleinen zu und erklärte ihm: «Wir gehen alle als klassische Filmmonster. Deswegen bist du ein Werwolf.»
Als ich ihm sein haariges Wolfskostüm gab, blickte er recht enttäuscht drein. Auch darauf ging ich nicht ein und verkündete: «Ich gehe als Vampir. Im stilvollen alten Dracula-Look.»
Enthusiastisch zeigte ich mein gefälschtes Gebiss mit spitzen Zähnen und das schwarze Kostüm mit einem samtenen roten Umhang.
«Darin siehst du eher aus wie Graf Zahl», kommentierte Fee.
«Früher hast du Graf Zahl sehr gemocht», antwortete ich und erinnerte mich wehmütig an die schöne Zeit, wie sie als kleines Mädchen frisch gebadet und nach Bübchen-Shampoo duftend im Schlafanzug auf meinem Schoß saß und wir uns gemeinsam die Sesamstraße ansahen. Sie wurden einfach viel zu schnell groß. Je älter man selber wird, desto mehr bekommt man den Eindruck, dass irgendjemand beim Leben auf schnellen Vorlauf gedrückt hat.
«Graf Zahl kann maximal bis zehn zählen», erwiderte Fee. «Außerdem hat er ADHS.»
«Immerhin ist er damit formidabler in der Arithmetik als du», sagte Max leise. Er sprach sonst nicht viel, aber wenn, dann ärgerte er gerne seine große Schwester.
«Halt den Mund, oder ich verkaufe dich als Robbe an den Zirkus.»
«Irgendwann gibt es für all deine Gemeinheiten eine Revanche!», drohte Max, vor Wut bebend, traf es ihn doch immer sehr, wenn sie sein Übergewicht ansprach.
«Mein Herz zittert vor Angst, Robbi!», grinste sie.
Fee bereitete es ebenfalls große Freude, ihn mit Sprüchen ins Mark zu treffen. Sie war davon überzeugt, dass Max unser Liebling war und sie so etwas wie die unverstandene Cinderella, die nur von einem Prinzen aus ihrem schlimmen Schicksal befreit werden konnte. Oder von der Volljährigkeit.
Dabei liebte ich beide Kinder, auch wenn ich sie manchmal gerne gegen zwei Wellness-Massagen eintauschen wollte. Manchmal, in den wenigen und immer seltener werdenden harmonischen Momenten, die ich mit ihnen hatte, liebte ich sie sogar so sehr, dass es wehtat. Es war der schönste Schmerz in meinem Leben.
Ich vermutete, oder besser gesagt, ich hoffte, dass die beiden Geschwister sich insgeheim ebenfalls liebten. Auch hoffte ich, dass Frank und ich uns immer noch – unter all dem Alltagsstress – so liebten wie früher. Aber wenn das alles wirklich so war, wenn wir uns alle liebten, warum war es dann nicht wie früher? Warum mussten wir uns fast jeden Tag streiten? Warum musste ich sie alle dazu zwingen, dass wir gemeinsam etwas unternahmen? Wann hatten wir überhaupt das letzte Mal als Familie etwas miteinander unternommen?
Während ich mich dies fragte, erkannte ich, dass es an diesem Abend nicht nur darum gehen würde, Lena zu beeindrucken oder meinen Laden zu retten: Wir Wünschmanns würden auch das erste Mal seit langem wieder etwas als Familie machen. Womöglich würden sie sehen, wie viel Spaß wir zusammen haben. Schließlich machten wir mit dem Besuch der Buchpremiere etwas ganz Außergewöhnliches. Und vielleicht, ganz vielleicht, würden wir an diesem Abend sogar wiederfinden, was wir als Familie verloren hatten.
Als wir alle mit den Kostümen in unserem alten Ford saßen, war ich schon ein bisschen stolz auf uns, denn wir sahen imposant aus: Papa, das Frankensteinmonster, meine Tochter, die Mumie, mein Sohn, der Werwolf, und ich, der unglaubliche Vampir mit Brille. Vier Monster auf dem Weg in die große weite Welt!
Die Stimmung bei den anderen war nicht ansatzweise so gut wie meine: Max las eins seiner Bücher, Frank beschwerte sich, weil er mit seinem riesigen Frankensteinkopf bei jedem Schlagloch gegen das Autodach stieß, und Fee simste in einer Tour. Ich verstand einfach nicht, warum sie andauernd simste oder chattete. Ich verstand so vieles nicht bei ihr: warum sie sich ständig Kopfhörer in die Ohren stopfte, warum sie ihren jungen, schönen Körper mit Tattoos verunstaltet hatte oder warum es eine solch unüberwindliche, herkuleshafte Aufgabe sein sollte, mal die Spülmaschine auszuräumen.
Andererseits, meine Mutter hatte früher auch nicht alles bei mir verstanden: warum ich wie Material Girl Madonna rumgelaufen war, warum ich so laut Duran, Duran hörte und schon gar nicht, warum ich auf Don Johnson stand (zugegeben, wenn ich heute zufällig eine Wiederholung von Miami Vice sah, fragte ich mich das auch: Don trug Pastellanzüge, einen Vohukila und war schätzungsweise 1,23 Meter groß).
Womöglich stimmte es, was mir Fees Klassenlehrerin gesagt hatte: Die Synapsen im Gehirn des Teenagers werden in der Pubertät neu verdrahtet. Übersetzt hieß das dann wohl, man konnte an das Teenagerhirn ein Schild hängen mit der Aufschrift: Wegen Umbau geschlossen.
Ich beschloss daher, mir von Fees Synapsen nicht den Abend verderben zu lassen. Je ruhiger ich blieb, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute alle miteinander Spaß haben konnten. Im Radio lief gerade Rastaman Vibration von Bob Marley. Ein Lied, das ich früher geliebt hatte, so machte ich lauter und sang mit: «It’s a new day, a new time and a new feeling …»
Dabei wurde mir warm ums Herz in der Hoffnung, dass es heute Abend vielleicht wirklich ein neuer Tag für unsere Familie werden würde, der eine neue Zeit einläutete, mit einem neuen Gefühl.
Ich sang so lange, bis Fee maulte: «Muss das sein, Mama?»
«Ach, ist das jetzt wieder peinlich?», fragte ich pikiert.
«Nein, ist es nicht», erwiderte Fee.
«Ist es nicht?», fragte ich freudig überrascht.
«Nein», lächelte sie, «das ist einfach nur Scheiße.»
Es würde sicherlich nicht einfach werden, sich den Abend von ihren Synapsen nicht verderben zu lassen.
Kurz darauf fuhren wir vor dem edlen Ritz-Carlton-Hotel vor, und ich verkündete: «Gleich sehen wir Stephenie Meyer.» Wohl wissend, dass keiner von meiner Familie ein Fan der Autorin war. Fee las außer SMS eigentlich gar nichts, Frank hatte ohnehin keine Zeit zum Lesen, und Max waren Meyers Vampire zu «kindisch», er stand mehr auf Zombies, Orks und Barbaren.
Wir gingen über einen roten Teppich in das Hotel und wurden in einen herrschaftlichen Saal geleitet, in dem sich weit über zweihundert Gäste tummelten. Sie hatten Champagnergläser in der Hand, und wir hätten sicherlich diese wundervolle, festliche Stimmung genießen können, wäre da nicht eine Kleinigkeit an den Gästen gewesen, die uns alle arg stutzen ließ. Nach einer Weile des gemeinschaftlichen entsetzten Schweigens sprach Max das Offensichtliche aus: «Mama … hier hat keiner ein Kostüm an.»
Und Fee ergänzte: «Außer uns vier Volldeppen.»
Es war einer jener Augenblicke, in denen man gerne etwas anderes hätte sagen können als: «Tjahaha …»
Fee reagierte am schnellsten und lächelte zufrieden: «Dann können wir ja wieder abhauen.»
Das war ein durchaus verständlicher Fluchtreflex, besonders wenn man bedachte, dass die ersten Gäste zu uns sahen.
«Gute Idee», fand Frank, den es zu seiner Arbeit zurückzog.
«Nein, wir bleiben und nehmen das Ganze humorvoll», munterte ich meine Familie auf.
«Ich befürchte», gab Frank zu bedenken, «die Einzigen, die das hier humorvoll nehmen, sind die anderen Gäste.»
Ich blickte in seine Richtung und sah, dass sie bei unserem Anblick schmunzelten oder lachten, einige zeigten sogar mit dem Finger auf uns. Bevor ich etwas antworten konnte, meldete sich Frank wieder zu Wort: «Ist das da nicht deine Lena?»
Tatsächlich, Lena schlenderte elegant auf uns zu, und Frank gaffte sie aus seinem Frankensteinkopf fasziniert an. Er hatte es noch nie verstanden, unauffällig auf attraktive Frauen zu schauen. Immer wenn ich es merkte, versetzte es mir einen Stich. Ich hatte ihn jedoch nie darauf aufmerksam gemacht, um weder ihn noch mich zu demütigen.
Lena begrüßte mich überrascht: «Ihr seid ja kostümiert!»
«Ach nee», kommentierte Fee.
«Du hast gesagt, es gibt wilde Monster-Kostüme …», versuchte ich zu erklären.
«Ja», lachte Lena, «aber die tragen doch nicht die Gäste. Nur die Band, die nachher spielt.»
Meine Familie warf mir einen entsprechenden Blick zu.
«Hast du das nicht begriffen?», fragte Lena.
«Nein, hat sie nicht!», antworteten meine Kinder im Chor.
Lena wandte sich nun an Fee und fragte: «Und, wie findet ihr Stephenie Meyer so?»
Ich betete, dass meine Tochter jetzt nicht irgendwie provozieren würde, nur um mir zu demonstrieren, wie wenig Lust sie auf die ganze Veranstaltung hatte.
Fee antwortete: «Ich finde Stephenie Meyer ganz, ganz toll.»
Ich war ungeheuer erleichtert, das zu hören.
«Sie ist meine absolute Lieblingsautorin!», legte Fee nach.
Es war kaum zu fassen, Fee wollte einen guten Eindruck machen.
«Ich liebe Stephenie Meyer!»
Auch wenn sie jetzt vielleicht etwas dick auftrug, war ich dankbar: Ich hatte wohl doch nicht alles in meiner Erziehung falsch gemacht, wenn Fee sich in Anwesenheit anderer benehmen konnte.
«Ich liebe Stephenie Meyer so sehr», plapperte sie weiter, «am liebsten würde ich mich von ihr entjungfern lassen.»
Mir fiel alles aus dem Gesicht.
Lena auch.
Und Fee grinste mich feist an. Das konnte ich, obwohl ihr Mund von den Mumien-Bandagen verdeckt war, genau erkennen.
Ich wollte die Situation entschärfen und überlegte krampfhaft, wie ich Lena klarmachen konnte, dass meine Tochter ein liebenswerter, lustiger kleiner Scherzkeks war. Doch bevor ich irgendetwas sagen konnte, hörten wir eine flötende Stimme: «What did this nice girl say about me?»
Es war Stephenie Meyer.
Sie trug einen schicken Hosenanzug, stand direkt hinter uns und lächelte freundlich, nichts ahnend. Wir waren alle sprachlos. Schon bei jeder anderen Star-Autorin wäre Fees Ausspruch extrem peinlich gewesen. Aber Frau Meyer war zu allem Überfluss auch noch Mormonin, fiel mir gerade siedend heiß ein.
Sie ging zu Fee und fragte sie lächelnd: «Come on, you can tell me.»
Ich sah in Fees entsetztes Gesicht und war mir sicher: Sie würde mich nicht noch mehr blamieren. Sie ging zwar manchmal zu weit. Aber so weit? Das würde nicht mal sie bringen.
Dummerweise hatte sie einen Bruder. Und der hatte ja zu Hause angekündigt, dass er sich für Fees gesammelte Gemeinheiten irgendwann mal revanchieren würde. So übersetzte er Frau Meyer freundlich, was Fee gesagt hatte: «She wants to be deflowered by you.»
Nun fiel auch Stephenie Meyer alles aus dem Gesicht.
Dies wiederum war einer jener Augenblicke, in denen man gerne sagen würde: «Ich sehe diese Kinder zum ersten Mal.»
Stattdessen versuchte ich, mich aus der Nummer rauszuwinden, und erklärte: «She said, she wants to give flowers to you.»
Stephenie Meyer erkannte, dass Fee keine «flowers» dabeihatte, und sah mich mit einem Blick an, der besagte: «I can verarsch me myself.»
Dann ging sie zutiefst beleidigt weiter, um mit anderen Gästen zu plaudern. Ich sah zu Frank, doch der wusste nicht, wie er mich trösten sollte. Männer sind beim Trösten nun mal unwesentlich begabter als Orang-Utans. Nach einer Weile sagte er nur leise: «Ich … ich glaub, ich geh mal zum Buffet.»
«Ich komme mit», ergänzte Fee hastig.
«Ich habe einen enormen Werwolfshunger», stimmte Max schnell mit ein. Meine Familie dampfte ab. Nach einer Weile des betretenen Schweigens meinte Lena zögerlich zu mir: «Deine Kinder sind nicht ganz so perfekt, oder?»
Ich nickte bestätigend mit dem Kopf.
«Mit deinem Mann läuft es auch nicht so gut, nicht wahr?», fragte sie vorsichtig.
«Wieso?», fragte ich unsicher. Wie kam sie darauf? Frank hatte sich ja bisher nicht allzu danebenbenommen.
«Er starrt unentwegt auf den Hintern von Stephenie Meyer.»
Tatsächlich: Frank, der am Buffet stand, gaffte aus seinem grünen Frankensteinschädel direkt auf den Po von Frau Meyer, die sich ein paar Meter hinter uns unterhielt. Das tat weh. Noch mehr als der Auftritt der Kinder. Und der hatte auch schon ziemlich wehgetan.
«Wir kriegen das mit der Lesung noch hin», tröstete Lena.
Ausgerechnet sie tröstete mich! Dabei hatte sie mich doch eingeladen, um anzugeben. Eines war jetzt schon klar: Ich würde Lena nicht zeigen können, dass ich glücklicher war als sie, was hauptsächlich daran lag, dass ich nicht glücklicher war. In etwa so, wie der junge Werther nicht glücklicher war als Gustav Gans.
Ich sah von ihr weg, wieder zu Frank, der sich mit dem Meerrettich eines Lachsschnittchens auf die Fellweste kleckerte, dies aber nicht mitbekam, weil er weiter seine Hinterteilbetrachtung vornahm.
«Dabei hat die Meyer doch einen Breiarsch …», fluchte ich traurig.
Da fragte Stephenie Meyer hinter mir: «What did she say?»
Am liebsten hätte ich mich wie ein Vampir in eine Fledermaus verwandelt und wäre aus dem Saal geflogen.
Die Meyer kam auf uns zu und fragte mich: «What exactly is a ‹Breiarsch›?»
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, und stammelte nur: «Sólo hablo español.»
«Qué es un Breiarsch?», fragte sie.
Die blöde Kuh konnte auch noch Spanisch.
Obwohl ich in der Oberstufe mal ein Jahr Spanisch hatte, konnte ich eigentlich nicht viel mehr sagen als: «Hey Macarena.» Aber dies schien mir als Antwort in dieser Situation etwas unpassend.
Völlig verzweifelt fragte ich daher verquer lächelnd: «Czi mowi Polski?»
Stephenie Meyer machte nur eine abfällige Handbewegung und ging. Jemand Irres im Monsterkostüm, die sie auch noch beleidigte, war ihre Zeit nicht wert. Lena legte den Arm sanft um mich und seufzte: «Ich glaube, wir kriegen das mit der Lesung doch nicht mehr hin.»
Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie der Insolvenzverwalter bald in meinen Laden spazierte, sich über meine Buchhaltung königlich amüsierte und über die Kakerlake und das verstopfte Klo wunderte.