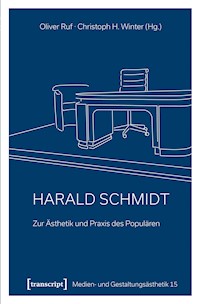
Harald Schmidt – Zur Ästhetik und Praxis des Populären E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Medien- und Gestaltungsästhetik
- Sprache: Deutsch
Als Medien- und insbesondere Fernsehphänomen hat Harald Schmidt die TV-Kultur im deutschsprachigen Raum maßgeblich beeinflusst. So ist es der Harald Schmidt Show gelungen, halbironische Sprechweisen diskursfähig zu machen, die bis heute Teil populärkultureller Unterhaltung sind. Die Beiträgerinnen und Beiträger des Bandes untersuchen vor diesem Hintergrund die ›Methode Harald Schmidt‹, d.h. die Unterminierung gängiger Norm- und Wertvorstellungen bei gleichzeitiger Affirmation derselben. Die zentrale These lautet: Harald Schmidt hat grundlegende Voraussetzungen dafür geschaffen, im deutschsprachigen Raum eine weitestgehend neuartige Populärkultur ästhetisch und kulturpraktisch zu etablieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Diese Publikation wurde im Rahmen des Fördervorhabens 16TOA002 mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie mit Mitteln der Open Library Community Medienwissenschaft 2022 im Open Access bereitgestellt.
Die Open Library Community Medienwissenschaft 2022 ist ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Humboldt-Universität zu Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | Technische Universität Berlin / Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Bochum | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – KIT-Bibliothek | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek in Landau | Universität zu Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitätsbibliothek Mannheim | Universitätsbibliothek Marburg | Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München | Fachhochschule Münster | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg | Universitätsbibliothek Siegen | Universitätsbibliothek Vechta | Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Zürcher Hochschule der Künste | Zentralbibliothek Zürich
Sponsoring Light: Universität der Künste – Universitätsbibliothek | Freie Universität Berlin | Fachhochschule Bielefeld, Hochschulbibliothek | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Fachhochschule Dortmund, Hochschulbibliothek | Technische Universität Dortmund / Universitätsbibliothek | Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg | Hochschule Hannover – Bibliothek | Landesbibliothek Oldenburg | Akademie der bildenden Künste Wien, Universitätsbibliothek | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Hochschulbibliothek
Mikrosponsoring: Filmmuseum Düsseldorf | Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater Hamburg | Hochschule Hamm-Lippstadt | Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Bibliothek | Hochschule Fresenius | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF – Universitätsbibliothek | Bibliothek der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS)
Mediale Produktionen und gestalterische Diskurse bilden ein vehement zu beforschendes ästhetisches Dispositiv: Medien nehmen nicht nur wahr, sondern werden selbst wahrgenommen und wahrnehmbar(er) – insbesondere durch die Grundkonstellationen ihrer oft technischen Artefakte und der diesen voran gehenden Entwürfe, mithin vor der Folie des dabei entstehenden Designs. Die Reihe MEDIEN- UND GESTALTUNGSÄSTHETIK versammelt dazu sowohl theoretische Arbeiten als auch historische Rekapitulationen und prognostizierende Essays.
Die Reihe wird herausgegeben von Oliver Ruf.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.
(Lizenz-Text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de)
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2022 im transcript Verlag, Bielefeld
© Oliver Ruf, Christoph H. Winter (Hg.)
Umschlagkonzept: Natalie Herrmann, Theresa Annika Kiefer, Lena Sauerborn, Elisa Siedler, Meyrem Yücel
Designkonzeption & Umschlagabbildung: Andreas Sieß
Gestaltung & Satz: Andreas Sieß
Abbildungen vorne und hinten: United Archives GmbH / Alamy Stock Foto. Fotograf: Frank Hempel (Aufnahmedatum: 5.12.1995) sowie IMAGO / teutopress (Aufnahmedatum: 1.12.1995)
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
ISBN Print: 978-3-8376-6109-5
ISBN PDF: 978-3-8394-6109-9
ISBN EPUB: 978-3-7328-6109-5
Buchreihen-ISSN: 2569-1767
Buchreihen-eISSN: 2703-0849
DOI: https://doi.org/10.14361/9783839461099
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung»Ich bin einfach elitär«: Zum ›Werk‹ Harald Schmidts
Christoph H. WinterLate Night FeuilletonKulturjournalistische Strategien bei Harald Schmidt
Oliver RufMedienästhetische PopularisierungZur Prozessualität von ›Harald Schmidt‹
Thomas HeckenDie Late-Night-Show
Barbara HornbergerDer UneigentlicheHarald Schmidt als Meister der Distanz
Kay KirchmannDie Dinge des täglichen GebrauchsDer Entertainer als Produkttester, Designkritiker und Alltagssoziologe
Kyra Alena MevertAlltag als SpektakelDer Charme von Studioaktionen wie Wochenendeinkauf, Kinderspielplatz oder Essen im Zug
Gregor BalkeDie Show als Hinterbühne, Rollenspiel und RahmenbruchHarald Schmidt und die selbstreflexiv-ironische Inszenierung des Fernsehens
Felix HaenleinHarald Schmidts inszenierte EreignislosigkeitFernsehen als Ereignis
Torsten Hoffmann»Fass mal drüber.«Schriftsteller·innen-Gespräche in der Harald Schmidt Show
Christoph H. Winter»[...] der bessere Claus Peymann!«Transmediale Netzwerke um das Dramolett »Claus Peymann kauft sich keine Hose, geht aber mit essen«
Christoph JürgensenDer Kälte- und der WärmetechnikerZum Verhältnis von Welt und Werk bei Harald Schmidt und Benjamin von Stuckrad-Barre
Frauke DomgörgenUnwahrscheinliche FreundeZum geteilten Habitus bei Harald Schmidt und Gregor Gysi
Oliver Ruf / Christoph H. WinterHerr Schmidt, wie haben Sie das gemacht?Ein Werkstattgespräch
Stefan KrankenhagenOld School, Baby
Beiträgerinnen & Beiträger
»Lieber Harald Schmidt,
Schmidt wer? Ja, den jüngeren Lesern muss man erklären, wer Harald Schmidt ist. […] Harald Schmidt ist ein abgedackelter Late-Night-Talker. In den 90er-Jahren war er Kult. Als die Einschaltquoten sanken, verschwand er. Harald Schmidt war ein Star. [...]
Immer weniger Einschaltquoten hatte er. Ich vergaß ihn. Ich dachte, er ist auf dem Weg ins Seniorenheim. […]
Harald Schmidt wer? Ich denke, dass sich niemand mehr an ihn erinnern wird.
Herzlichst
F. J. Wagner«
Bild vom 08.12.2015
Vorwort
Gehen wir davon aus, dass dieses Buch noch Generationen später von Studenten und Studentinnen gelesen werden will. Man wird ihnen Harald Schmidt erklären müssen. Man muss ihn ja schon der heutigen akademischen Jugend erklären. Versuchen wir es. Was mir zuerst auffiel, als er im Fernsehen auftauchte, war seine verblüffende Ähnlichkeit mit dem damaligen Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, einem Zyniker vor dem Herrn. Auch Harald Schmidt galt als ›Chef-Zyniker‹. Zyniker halten die Welt für unvollkommen, aber sie wollen sie nicht aktiv verbessern. Zum Beispiel: Zyniker sehen sehr genau, wie Frauen strukturell benachteiligt werden, aber sie sehen auch, dass Frauen perfide Waffen haben, um das Defizit auszugleichen. Sie konzentrieren sich auf letzteres. Leider, sagten manche.
Beim Spott über Frauen hielt sich Harald Schmidt allerdings zurück. Das hängt damit zusammen, dass er nicht gegen unten trat. Und oben waren damals vor allem noch Männer. Auch wenn die erste Schmidt-Biographie von einer Frau geschrieben wurde, Mariam Lau, war Harald Schmidt ein Mann, der Männer beschäftigte. Wir wollten wie er in Gesellschaft sein, so gebildet, so schlagfertig, so unabhängig. ›Wir‹ das meint, die, die ›etwas mit Medien‹ machten, wie das hieß, als noch nicht alle Menschen mit den Medien verschmolzen waren. Oft beschäftigte sich Harald Schmidt in seiner Late Night Show mit der moralischen Verkommenheit der deutschen Medienlandschaft. Besonders gerne machte sich er über seinen Arbeitgeber, das damals noch existierende ›öffentlich-rechtliche Fernsehen‹ lustig. Er war eine Art Hofnarr geworden. Er durfte das.
Schmidt verachtete das Fernsehen und zeigte, wie man es besser machen konnte, indem er seinen ›Bildungsauftrag‹ ernst nahm. So spielte er mit kleinen Plastikfiguren das in Vergessenheit geraten Romanepos Auf der Suche nach der verlorenen Zeit eines asthmatischen homosexuellen Juden aus Paris nach. Schmidt war ein Meister im Parodieren. Unvergesslich, wie er die letzten Tage von Adolf Hitler im Führerbunker spielte. Genauer: Er parodierte den Schauspieler Bruno Ganz, der den Hitler im Kinofilm Der Untergang spielte. Bei Schmidt wurden die Medien endgültig selbstreflexiv, ich denke, was das bedeutet, muss ich nicht erklären.
Dass Harald Schmidt den Bruno Ganz so gut parodieren konnte, hing mit seiner Liebe zum Theater zusammen. Das Theater war noch bis zu Beginn des 21. Jahrhundert als »Erziehungsanstalt« (Friedrich Schiller) im Gespräch. Für Schmidt stand es turmhoch über der Fernsehunterhaltung. Er war einer der letzten Katholiken in der Öffentlichkeit, Theater war für ihn etwas Transzendentes.
Dennoch: Es kam die Zeit, als es mit seinen Shows abwärts ging. Er wechselt ständig die Sender, die Quoten sanken immer tiefer, das Feuilleton, bitte auch das notfalls googeln, wandte sich von ihm ab. Es schien ihn nicht zu stören. Denn Harald Schmidt machte etwas, was vollkommen unverständlich sein dürfte: Er zerstörte sein eigenes Bild. Dass machte ihn für mich und andere endgültig zum Künstler. Ich empfehle zum besseren Verständnis, die Folge seiner Late Night Show mit der Performancekünstlerin Anne Tisma zu schauen. Anne Tisma hatte ein leichtes Asperger-Syndrom, Schmidt fühlte sich ihr nahe. Zusammen proben sie für das Stück Hitlerine. Sie waren sich für nichts zu blöde und bis zum Anschlag ›politisch unkorrekt‹ (ehrlich, man wurde damals noch nicht dafür bestraft).
Aber irgendwie wurde Harald Schmidt so ab 2010 auch etwas uninteressant, er schrieb überflüssige Bücher, die er selbst überflüssig fand, solche Dinge. Seine Zeit sei halt vorbei, hieß es abermals in den Feuilletons. Dumm nur: Irgendwie kam nichts Besseres. Zu seinem Nachfolger wurde von der Öffentlichkeit Jan Böhmermann bestimmt. Ein Polizistensohn, der zwischen Unterhaltung und Politik nicht mehr zu unterscheiden schien, und Menschen, die in seinen Augen etwas Verwerfliches getan hatten, zum Ziel von Kampagnen machte, die seinem Publikum das Gefühl gaben, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber wem erkläre ich das, nach ihm werden sicher bald Straßen benannt. Jedenfalls hielt Harald Schmidt den Böhmermann für »weit unter seiner Wahrnehmungsschwelle«. Und weil Schmidt leider auch aus unserer Wahrnehmungsschwelle zunehmend verschwand, freuten wir uns, wenn er mal ein schönes Interview gab, etwa als er 65 wurde, und schauten ab und zu alte Schnipsel auf Youtube. Wobei: Man muss die Schnipsel gar nicht schauen. Denn für uns, die wir ihn begleitet haben, wird nicht seine Ähnlichkeit mit Donald Rumsfeld bleiben. Bleiben wird seine Stimme. Sein schwäbischer Dialekt. Manche Medientheoretiker nennen das: Heimat.
Michael Angele
Einleitung
»Ich bin einfach elitär«: Zum ›Werk‹ Harald Schmidts
1988 strahlt der Sender freies Berlin erstmalig ein Sendungsformat aus, das von Harald Schmidt, der zuvor bereits mit mäßigem Erfolg auf verschiedenen deutschen Bühnen reüssiert hatte, moderiert wird. Die Sendung MAZ ab!, eigentlich ein Werbeformat für ARD-Programme, erfreut sich nach kurzer Zeit derart großer Beliebtheit, dass diese ins Hauptprogramm der ARD aufgenommen wird. Ab 1990 moderiert Schmidt gemeinsam mit Herbert Feuerstein die Comedy-Show Schmidteinander und allein die Rate-Show Pssst...; der endgültige Durchbruch erfolgt 1992, als Schmidt die Nachfolge von Paola und Kurt Felix antritt, um Verstehen Sie Spaß? zu moderieren, woran er auf nahezu grandiose Weise scheitert. Schnell stellt sich nämlich heraus, dass Schmidt kein Typ für’s Massenpublikum ist, kein Hans-Joachim Kuhlenkampff, kein Kurt Felix und erst recht kein Thomas Gottschalk. Schmidt ist anders und findet seine Bestimmung in einem Format, das er aus den USA importiert: der Late Night Show.1 Formate wie die bereits seit 1954 ausgestrahlte Tonight Show oder die jüngere, aber nicht minder einflussreiche Late Show with David Letterman dienen als Orientierungspunkte, an denen Schmidt seine Show ausrichtet. Die Harald Schmidt Show geht 1995 auf Sendung und wird fast 20 Jahre lang unter variierendem Namen in verschiedener Besetzung auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt, ehe die letzte Sendung am 13. März 2014 auf Sky zu sehen ist.
Danach ist Harald Schmidt Videokolumnist für den Spiegel, spielt eine wiederkehrende Rolle auf dem Traumschiff und ist gern gesehener Interviewgast in verschiedenen TV-, Rundfunk- und Zeitungsformaten. Insbesondere aber durch seine Late Night Show wird Schmidt regelrecht zu einer Ikone der deutschen Fernsehunterhaltung. Die Harald Schmidt Show findet ihr Publikum weniger in der breiten Bevölkerung als in einem kreativen, häufig selbst publizierenden, medienaffinen Milieu. Schmidt wird zum »Liebling des Feuilletons«,2 weil er im Grunde selbst Feuilleton betreibt; er reenactet mit Playmobil-Figuren die griechische Sagenwelt,3 begreift Waschbecken4 und Briefkästen5 als Symptome der Konsumkultur und weist ihnen eine semiotische Qualität zu. Er inszeniert Gemeinde-Nachmittage,6 bekennt sich dazu, Bücher wegzuwerfen und kritisiert so en passant den etablierten Kanon bildungsbürgerlicher Hochkultur-Milieus: »Goethe ist überschätzt.«7 Darüber hinaus sind regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter der (deutschsprachigen) Gegenwartsliteratur zu Gast in der Show: So attestiert Schmidt beispielsweise Christian Kracht während eines Interviews: »Ich glaube, Sie drücken vieles aus, was ich nur dumpf empfinde.«8 Mit dem manischen Feuilleton-Leser und Schmidt-Verehrer Rainald Goetz, der sich für seine Heute Morgen-Reihe Schmidts Stand-up-Opener »Heute morgen, um 4 Uhr 11, als ich von den Wiesen zurückkam, wo ich den Tau aufgelesen habe« zum Motto genommen hat, spricht Schmidt über die deutsche Feuilletonlandschaft.9 Benjamin von Stuckrad-Barre arbeitet von 1998 bis 1999 als Autor für die Harald Schmidt Show10 und ist dort später mehrmals Gast. Unter anderem führt er mit Schmidt das an Thomas Bernhards Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen angelehnte und von Stuckrad-Barre aktualisierte Stück Claus Peymann kauft sich keine Hose, geht aber mit essen in der Harald Schmidt Show auf. Aber auch internationale Stars geben sich bei Schmidt die Klinke in die Hand: Falco, Helmut Berger, David Bowie, Dennis Rodman oder Samantha Fox und Gerard Depardieu.
Harald Schmidt tritt schließlich immer wieder auch als Autor in Erscheinung: Einerseits als Verfasser zweier im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienener Erzählbände – Tränen im Aquarium und Mulatten in gelben Sesseln sowie Die Tagebücher 1945-1952 –, andererseits als Kolumnist für den Focus (wobei seine Kolumnen im Nachhinein gesammelt ebenfalls im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen).11
Vor diesem Hintergrund lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt schließlich drei Schaffensphasen Schmidts identifizieren:
Erstens: Vom Schauspieler zum Entertainer
Schmidts Anfänge liegen im Theater. Nach der Ausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart führt ihn sein erstes Engagement ins Staatstheater Augsburg und von dort ins Düsseldorfer Kom(m)ödchen, wo er nicht nur als Darsteller, sondern auch als Textschreiber und bald als Solo-Kabarettist reüssiert und damit den Grundstein für seine spätere Karriere im TV legt.12 Die Harald Schmidt Show, so lautet eine These, ist auch deshalb so erfolgreich, weil Schmidt mittels des Methodenkatalogs des Humoristischen gesellschaftliche Zusammenhänge durchschaut und mit den Fähigkeiten des Schauspielers vorführt. Neben seinen schauspielerischen Wurzeln prägen Schmidt dessen Anfänge im TV, die Sendungen MAZ ab!, Pssst ..., vor allem aber Verstehen Sie Spaß? und Schmidteinander.
Zweitens: Der Conférencier im TV
Die Jahre, in denen auf verschiedenen Fernsehsendern und unter leicht variierendem Namen Harald Schmidts Late Night Show auf Sendung ist, bilden die Hochphase seines Schaffens. Nicht nur die mehrmals wöchentlich ausgestrahlte Show, sondern auch verschiedene Haupt- und Nebenrollen in Film- und TV-Produktionen kennzeichnen diese Phase. Hinzu kommen die Kolumnen für den Focus, zahlreiche Interviews im TV und in Zeitungen oder das Format Olympia mit Waldi & Harry, in dem er gemeinsam mit Waldemar Hartmann die Geschehnisse der Olympischen Spiele 2006 in Turin und 2008 in Peking kommentierte.
Drittens: Der öffentliche Privatier
Nachdem die Harald Schmidt Show 2014 zum letzten Mal ausgestrahlt worden ist, kommentiert Schmidt die Einstellung der Show in verschiedenen Interviews und ist bis in die Gegenwart immer wieder Interviewgast in Zeitungen und TV- oder Rundfunkformaten, in denen er betont, dass er als Privatier nur mehr Familien-Chauffeur sei;13 gleichzeitig bleibt er dem TV-Publikum in einer wiederkehrenden Rolle in der ZDF-Produktion Das Traumschiff erhalten. Darüber hinaus meldet er sich eine Zeitlang Montag bis Freitag mit einer kurzen Videokolumne für Spiegel Plus zu Wort. Die jeweils wenige Minuten umfassenden Videosequenzen nimmt Schmidt mit der Kamera seines Smartphones am Flughafen, auf dem Weg ins Hotel oder in seinem Garten auf, kommentiert – wiederum ironisch, sarkastisch und zynisch – das aktuelle Zeitgeschehen und produziert damit eine Harald Schmidt Showen miniature. Zuletzt macht Schmidt durch die Herausgabe des Bandes In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe über die Kantinen Thomas Bernhards14 und seinen Auftritt als Comedy-Coach in der Amazon Prime-Show One Mic Stand auf sich aufmerksam.
Inzwischen hat eine neue ›Generation‹ das Late-Night-Format übernommen: Jan Böhmermann moderiert eine Satire-Show für das ZDF, Klaas Häufer-Umlauf moderiert eine Late Night Show auf ProSieben, Katrin Bauerfeind produziert einen Podcast und eine Talkshow usw. Das verbindende Element der divergierenden Formate bleibt dabei jedoch deren jeweilige Beziehung zu und ihr entsprechender Zusammenhang mit Harald Schmidt. Denn Böhmermann, Häufer-Umlauf und Bauerfeind waren einst Teil der so genannten ›Harald Schmidt Show-Showfamilie‹. Im Umkreis der Letztgenannten formiert sich darüber hinaus eine Szene von vor allem Bloggerinnen wie Sophie Passmann oder Schauspielerinnen wie Palina Rojinski, deren ›Schreibweisen‹ und Inszenierungen ebenfalls von Schmidt und dessen Show auf die eine oder andere Art beeinflusst worden sind. Das Nachwirken Harald Schmidts reicht dadurch schließlich über dessen eigenes Schaffen hinaus und schlägt sich auf vielfältige Weise in den unterschiedlichsten Versionen gegenwärtiger Unterhaltungsformate nieder: als Elemente einer sich stets neu schreibenden Populärkultur, die am Beispiel von Harald Schmidt erforscht werden kann.
Ganz besonders freuen wir uns, einen Blick in die Werkstatt von Harald Schmidt bieten zu können. Dieser stand beiden Herausgebern zu einem umfangreichen Gespräch zur Verfügung, das ebenfalls in diesem Band abgedruckt ist. Unser Dank gilt daher ganz ausdrücklich Harald Schmidt selbst – für seine Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen, für seine Offenheit, sich auf dieses Experiment einzulassen und für seine Großzügigkeit, unser Vorhaben zu goutieren. Für Redigat und Lektorat danken wir darüber hinaus Aleksandra Vujadinovic und für Buchdesign wie -umsetzung Andreas Sieß. Ausdrücklicher Dank gilt darüber hinaus dem YouTube- und Internet Archive-Usern weitze45 und Anonymous Nostradamus und allen anderen, ohne deren archivarische Tätigkeit der überwiegende Teil des Wirkens Harald Schmidts für die Öffentlichkeit verloren wäre.15
Bonn und Potsdam, im September 2022
Oliver Ruf und Christoph H. Winter
1 Vgl. Oliver Ruf u. Christoph H. Winter: »›Herr Schmidt, wie haben Sie das gemacht?‹. Ein Werkstattgespräch«, im vorliegenden Band, S. 251–290; Thomas Hecken: »Die Late-Night-Show«, im vorliegenden Band, S. 85–98.
2 Hanns-Bruno Kammertöns: »›Gefühl ekelt mich an‹: Harald Schmidt hasst Sentimentalitäten, trotzdem spricht er über die Geburt seiner Kinder und den größten Rollenwechsel seines Lebens: Von Peymanns Theaterbühne auf die Planken des Traumschiffs.« Auf: https://www.zeit.de/2006/48/Harald-Schmidt/komplettansicht, dort datiert am 23.11.2006, zul. abgeruf. am 17.06.2020. Der Begriff ›Liebling des Feuilletons‹ ist jedoch bereits vor diesem Interview im Umlauf.
3 Die Harald Schmidt Show vom 09.10.2002. Auf: https://archive.org/details/87443344/Die+Harald+Schmidt+Show+-+1147+-+2002-10-09+-+Andrea+Fischer%2C+Die+Heldentaten+des+Herakles.avi, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
4 Die Harald Schmidt Show vom 13.03.2002. Auf: https://archive.org/details/87443344/Die+Harald+Schmidt+Show+-+1055+-+2002-03-13+-+Tom+Tykwer%2C+Sesamstra%C3%9Fe+op+K%C3%B6lsch%2C+Waschbecken-Test.avi, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
5 Die Harald Schmidt Show vom 28.11.2001. Auf: https://archive.org/details/82762114/Die+Harald+Schmidt+Show+-+1006+-+2001-11-28+-+Ewa+Zieniewicz%2C+Dr+Br%C3%B6mme+in+Rostock.avi, zul. abgeruf. am 17.96.2020.
6 Die Harald Schmidt Show vom 14.06.2001. Auf: https://archive.org/details/82762114/Die+Harald+Schmidt+Show+-+0940+-+2001-06-14+-+Gemeinde+Nachmittag%2C+Thomas+Hermanns.avi, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
7 Die Harald Schmidt Show vom 11.10.2001. Auf: https://archive.org/details/82762114/Die+Harald+Schmidt+Show+-+0983+-+2001-10-11+-+Yasmina+Filali%2C+Emmanuel+Peterfalvi.avi, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
8 Die Harald Schmidt Show vom 12.10.2001. Auf: https://archive.org/details/82762114/Die+Harald+Schmidt+Show+-+0983+-+2001-10-11+-+Yasmina+Filali%2C+Emmanuel+Peterfalvi.avi, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
9 Harald Schmidt vom 08.04.2010. Auf: https://www.youtube.com/watch?v=BqDv6F9eTHA, zul. abgeruf. am 17.06.2020.
10 Benjamin v. Stuckrad-Barre: »Biografie«. Auf: https://www.stuckradbarre.de/biografie/, dort undatiert, zul. abgeruf. 17.06.2020.
11 Vgl. Harald Schmidt: Tränen im Aquarium. Ein Kurzausflug ans Ende des Verstandes. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1993; ders.: Wohin? Allerneueste Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1999; ders.: Quadrupelfue. Variationen über 4 Themen auf 240 Seiten. Die Focus-Kolumnen. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2002; ders.: Mulatten in gelben Sesseln. Die Tagebücher 1945-1952. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005.
12 Vgl. Katrin Heise: »Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt: ›Ich wollte im System an die Spitze.‹« Auf: https://www.deutschlandfunkkultur.de/entertainer-und-schauspieler-harald-schmidt-ich-wollte-im.970.de.html?dram:article_id=466858, dort datiert am 01.01.2020, zul. abgeruf. am 23.06.2020.
13 Vgl. N.N.: »Harald Schmidt ist jetzt Familien-Chauffeur«. Auf: https://www.welt.de/regionales/nrw/article177995246/Harald-Schmidt-ist-jetzt-Familien-Chauffeur.html, dort datiert am 21.06.2018, zul. abgeruf. am 23.06.2020.
14 Vgl. Harald Schmidt (Hg.): Thomas Bernhard – In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Eine kulinarische Spurensuche. Wien u. München: Brandstätter, 2022.
15 Sollten Sie diese Zeilen lesen, würden wir uns darüber freuen, wenn Sie mit uns in Kontakt treten würden.
Christoph H. Winter
Late Night Feuilleton
Kulturjournalistische Strategien bei Harald Schmidt
»Ich kann ja gar nicht anders als Feuilleton.«
Harald Schmidt
1
»Dass die F.A.Z. – wie wohl andere Qualitätszeitungen auch – Harald Schmidt immer als inoffiziellen Mitarbeiter betrachtet hat, ist kein Geheimnis«,1 schreibt Oliver Jungen anlässlich der letzten Ausgabe der Harald Schmidt Show, die am 13. März 2014 auf dem Pay TV-Sender Sky und parallel dazu kostenfrei auf YouTube ausgestrahlt wird. Schmidt sei, so Jungen weiter, »unser bester Mann an der kaputtesten aller Fronten, der bewaffnet mit den Feuilletons dieser Republik dem alles verschlingenden, schleimigen, pickeligen, brabbelnden Monstrum namens Fernsehunterhaltung seit Jahrzehnten Paroli bietet.«2 Aufgrund der Schmidt eigenen »totale[n] Geistesgegenwart eines blitzgescheiten Ironikers« sei er, urteilt Jungen, »das eingebaute Korrektiv unserer Mediengegenwart«.3 Dass Schmidt hingegen – zumindest von der ›Operativen Personenkontrolle‹ des F.A.Z.-Feuilletons – nicht von Beginn an als »inoffizieller Mitarbeiter«, sondern zuerst als ›Beobachtungs-‹, wenn nicht ›Verdachtsobjekt‹ geführt wird, demonstriert eine Kritik, die anlässlich der ersten Ausgabe der Harald Schmidt Show vom 6. Dezember 1995 am darauffolgenden Tag in der F.A.Z. erscheint. Bei der Schmidt-Show handele es sich um eine Kopie des amerikanischen Originals von David Letterman, schreibt Michael Allmaier darin, und dass Erfolg oder Misserfolg der Show über die »Zukunft des Sujets in Deutschland«4 entscheiden wird. Die Gags des Anfangsmonologes eigneten sich bisher jedoch »eher zum Lächeln als zum Lachen«; Schmidt spräche seinen Text, »als habe er ein Röhrchen Muntermacher mit einer Thermoskanne Kaffee heruntergespült«, und auch, wenn »noch längst kein abschließendes Urteil über Late Night in Deutschland oder auch nur über die Harald Schmidt Show gefällt werden« kann, so konstatiert der Rezensent abschließend, benötige Subversion einen »festen Boden«; dieser werde sich »hoffentlich bald einstellen, diesmal galt noch: schwache Stunde – schwaches Programm.«5
Zwischen beiden Feuilleton-Artikeln liegen knapp 20 Jahre. Im vorliegenden Aufsatz zeichne ich erstens den Weg und die Stationen der Amour fou zwischen Harald Schmidt und dem Feuilleton-Ressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach und entwerfe anhand der kulturjournalistischen Berichterstattung im F.A.Z.-Feuilleton einen historisierenden Überblick über die wesentlichen Entwicklungsstationen der Harald Schmidt Show. Im zweiten Teil widme ich mich der Frage nach den Ursachen und Dynamiken dieser leidenschaftlichen Beziehung und exemplifiziere die These, dass die Harald Schmidt Show deshalb so großen Anklang in der Feuilleton-Berichterstattung findet, weil sie selbst mit Schreibweisen des Feuilletons arbeitet.
2
Bereits ehe die erste Ausgabe der Harald Schmidt Show besprochen werden kann, wird im F.A.Z.-Feuilleton eine Meldung kolportiert, nach welcher Thomas Gottschalk im Jahr »1996 bei SAT.1 eine große Samstagabendshow [...] und Harald Schmidt eine tägliche Nachtsendung [moderieren]«6 soll. Drei Monate nach dieser Ankündigung erscheint eine Kritik der ARD-Rateshow Pssst..., die Schmidt vor seinem Wechsel zu SAT.1 moderierte. »Etwas von Warhol«, schreibt wiederum Michael Allmaier,
lebt in Schmidt weiter. Auch er liebt das Artifizielle und seine grundehrliche Unehrlichkeit, was mit Zynismus nichts zu tun hat. [...] Wo Warhol schwieg, weil er nichts zu sagen hatte, redet er, wie man es von ihm erwartet, und erzeugt damit dasselbe quälende Vakuum. Schmidt macht die Satire nicht, er vollzieht sie. Sein Material sind die Versatzstücke der Fernsehkultur; und alles, was populär ist, eignet sich.7
Jedoch gerate die aus den Versatzstücken der Populärkultur montierte Collage zum Stückwerk, da Schmidt die strikt voneinander getrennten Sphären von Show und Kabarett miteinander vermische. »Das alles«, so Allmaier abschließend,
mag man einwenden, sei Realsatire [...] Aber Harald Schmidt läge es fern, den Pfusch als subversiven Akt zu feiern; wenn er in seinem Element ist, führt die Ironisierung der Ironie zum Gegenstand zurück und vertieft ihn durch Hintersinn. Hier jedoch löst sie als Laufmasche der Kreativität das Konzept der Sendung auf und hinterläßt nur fadenscheinigen Klamauk. »Pssst...« ist der Kitsch der Postmoderne.8
Die Kriterien, an denen sich Schmidt noch vor Beginn seiner Late Night Show messen lassen muss, könnten höher kaum sein: Warhol, Subversion, »Ironisierung der Ironie« – man mag fast meinen, Schmidt solle die Spex-Redaktion übernehmen, statt eine Unterhaltungsshow zu moderieren. Die Zeit, die vergeht, bis Schmidt diese Erwartungen unterläuft, fällt entsprechend kurz aus: Bereits in der sechsten Ausgabe der Harald Schmidt Show vom 12. Dezember 1995 leistet Schmidt sich den ersten Fauxpas. Auf die ans Publikum gerichtete Frage, was eine Ausgabe des Magazins Emma, eine Flasche Eierlikör, ein Toilettendeckel und die Moderatorin Bettina Böttinger gemein haben, antwortet er: »Die würde kein Mann je freiwillig anfassen!« Bereits in den 1990-er schlägt diese Bemerkung hohe Wellen, vor allem, weil außer Acht gelassen wird, dass Schmidt dieses Rätsel mit einer Anekdote einleitet, deren Wahrheitsgehalt freilich nicht überprüft werden kann. Der Vollständigkeit halber sei sie dennoch kurz erwähnt: Schmidt erzählt im Vorfeld, dass er tags zuvor Bettina Böttinger getroffen und diese ihm mitgeteilt habe, dass er »mit der Show härter werden« müsse; als Reaktion auf diese Aufforderung gestaltet die Redaktion der Schmidt-Show das besagte Rätsel, das Schmidt mit den Worten »Na, hart genug?«9 abmoderiert. Im F.A.Z.-Feuilleton urteilt Michael Hanfeld dennoch: »Geschmacklos.«10
Es dauert jedoch keinen Monat, bis Hanfeld sich schützend vor Schmidt stellt, als dieser im Zuge der massiven Kritik am damaligen SAT.1-Programmgeschäftsführer und späteren Co-Produzenten der Harald Schmidt Show, Fred Kogel, ebenfalls ins Fadenkreuz der Presse gerät:
Doch gerade Schmidt hat die Kritik sich zu Kogels Stellvertreter erkoren. Ihm sitzen mittlerweile nicht mehr nur die Quotenzähler auf den Fersen, sondern auch die politisch Korrekten, die jeden seiner Witze wägen und den anarchischen Fernseh-Conferencier einem Humor-Reinheitsgebot unterwerfen möchten, das sie merkwürdigerweise von anderen nicht einfordern. [...] Es scheint fast so, als ginge es nur noch darum, Schmidt vom Bildschirm und mit ihm Kogel aus dem Geschäft zu verbannen, getreu der alten Faustregel, daß jene, die einmal ganz nach oben geschrieben wurden, nun partout nach ganz unten befördert werden müssen.11
Es bleibt kompliziert. Das mag auch daran liegen, dass Harald Schmidt in der Anfangszeit seiner Show die Grenzen zwischen Klamauk und Satire, zwischen ›Spaßgesellschaft‹ und medienreflexiver Beobachtung austestet und sich im Zweifel – vielleicht aus Unsicherheit über die eigene Rolle und deren Wahrnehmung durch TV-Publikum und Feuilleton – zu Gunsten von Klamauk und Spaß entscheidet. Es dauert jedoch nicht lange, bis der Moderator sich der anderen Seite, der Seite von Satire, Medienreflexion und humoristischer Gesellschaftskritik zuwendet – bis Dirty Harry zu His Schmidtness wird. Im Jahr 1997 werden Harald Schmidt und dessen Show erst durch den Grimme-Preis (moderiert von Bettina Böttinger!) und später durch den BAMBI nobilitiert; 1999 erhält die Show den Bayrischen Fernsehpreis und die Goldene Romy. Im Jahr 2000 schließlich genügen die Leistungen Schmidts auch der Feuilleton-Redaktion der F.A.Z.: Schmidt wird zum »Zeremonienmeister des ironisch gebrochenen Entertainments« erhoben. Er sei, lobt die Zeitung, »kein Parodist, sondern ein Gebärdensammler: Er karikiert seine Vorbilder nicht, er präpariert einzelne charakteristische Bewegungen, Merkwürdigkeiten der Mimik oder der Ausdrucksweise heraus und präsentiert sie wie ein Schauspieler der Barockzeit, der auf Szenenapplaus hin die schönsten Gesten noch einmal wiederholt [...].«12
Jedoch laufe die »Perfektion von Ironie und Inszenierung durch Zitat und Selbstzitat, die Harald Schmidt wohl am weitesten vorangetrieben hat«13 inzwischen Gefahr, zur inflationär gebrauchten Geste zu werden. Inwiefern Schmidt selbst für diese Inflation verantwortlich zeichnet oder lediglich in Popkultur und -literatur bereits bestehende Ironie-Konzepte aufgreift, für das Unterhaltungsfernsehen adaptiert und ausbaut, lässt der Artikel jedoch offen.
In einer Besprechung der Mainzer Tage der Fernsehkritik des Jahres 2001 zeichnet Sandra Kegel die »zahlreiche[n] Häutungen« Schmidts und damit dessen Weg vom Spaßmacher zum Feuilleton-Liebling nach: »Vom ›Langweiler‹ hat er es über ›Dirty Harry‹ zum ›letzten Moralisten im deutschen Fernsehen‹ gebracht«.14 Allerdings, so Kegel weiter, »klingt [das] gefährlich nach Endstation.« Gleichwohl liege im Umgang mit den Kritikern, wie auch in seinem »apokalyptischen Humor [...] Schmidts Genie. Er ist der wahre Teflon-Mann.«15 Im Anschluss daran zitiert die Journalistin zwei Aussagen, die Schmidts Anspruch an sich selbst und sein Publikum zusammenfassen: »›Mir ist es lieber, es lachen fünf Feuilletonchefs als ein Fußballstadion‹« und »›Ich bin einfach elitär.‹«16 Dass Schmidt zumindest die erste Aussage im Gespräch mit Roger Willemsen während der Mainzer Tagen der Fernsehkritik relativiert, schreibt Kegel nicht. Er brauche, so Schmidt zu Willemsen, »zumindest eine gewisse Masse an Zuschauern«,17 schließlich gehe es auch im Zusammenhang mit seiner Show um Quoten und um Werbeanzeigen, die verkauft werden müssen. Popularität ist auch für Harald Schmidt nicht ohne Publikum zu haben.
Mit der Jahrtausendwende gelingt es Schmidt, die Feuilletonberichterstattung nahezu gänzlich auf seine Seite zu ziehen. Das mag auch daran liegen, dass am 30. August 2000 mit dem Redaktionsleiter, studiertem Germanisten und Kunsthistoriker, Manuel Andrack, ein kongenialer Sidekick auf der Show-Bühne Platz nimmt, der selbst insgeheim zum ›Liebling des Feuilletons‹ wird. Andrack ist auskunftsfreudiger, in manchen Dingen versierter als der bisherige alleinige Sidekick und Bandleader Helmut Zerlett und scheut sich nicht davor, in den Ablauf der Show einzugreifen. Dies mag auch an der Rolle liegen, die Andrack bereits zu Beginn seiner Zeit bei der Schmidt-Show hinter der Kamera eingenommen hat bzw. einnehmen muss. Nachdem er 1995 als »professioneller Beobachter zur eben gegründeten ›Harald Schmidt Show‹« gekommen war, die damals noch von der Firma Brainpool produziert wurde, berichtet Andreas Rosenfelder in einem umfangreichen Porträt Andracks im F.A.Z.-Feuilleton, war Andrack »als ›der Mann von Sat.1‹ dafür zuständig, die Sendung abzunehmen und anstößiges Material – ›Geschmacklosigkeiten über Behinderte‹ zum Beispiel – herausschneiden zu lassen. Sogar den Spitznamen ›IM Andrack‹ führte er damals [...].«18
1998 trennen sich die Wege von Brainpool und Harald Schmidt, der die Show fortan von seiner eigenen Firma Bonito TV produzieren lässt. Brainpool hingegen widmet sich ›seichteren‹, wenn auch quotenträchtigeren Formaten wie etwa TV total.19 ›IM Andrack‹ hingegen bleibt bei der Show, wird deren Redaktionsleiter und stellt schließlich auf der Bühne einen Ruhepol zum üblicherweise nervösen und sprunghaften Schmidt dar, ohne dabei naiv zu wirken. Während der nachmittäglichen Show-Probe, berichtet Harald Schmidt im Interview, das Oliver Ruf und ich mit ihm für diesen Band geführt haben, nahm Andrack sogar die Rolle Schmidts ein, während Schmidt selbst am Bildschirm verfolgte, »was funktioniert und was nicht funktioniert [...]«.20
Mit Manuel Andrack auf der Bühne werden bildungsbürgerliche Themen, Sujets und Formate in der Show präsenter – die Sendung wird ernster, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen.
So etwa am 3. Mai 2001, als Schmidt und dessen Team eine Episode der Sendung Das Literarische Quartett simulieren – einen Tag bevor selbiges im TV ausgestrahlt wird.21 Die Pointe: Es werden dabei jene Bücher besprochen, die auch das Literarische Quartett um Marcel Reich-Ranicki besprechen wird. »Das komische Potential der Idee«, schreibt dazu Eckhard Schumacher,
einen Tag vor der Ausstrahlung des Literarischen Quartetts in der Harald Schmidt Show eben diese Sendung komplett vorwegzunehmen, entfaltete sich nicht, weil Schmidt mit seiner nur leicht überzeichneten Imitation Marcel Reich-Ranickis zu überzeugen wußte. Entscheidend war vielmehr, daß die Imitation Bestandteil einer Sendung war, die sich auch im Aufbau an ihrem Vorbild orientierte, es aber letztlich ernster nahm als dieses sich selbst.22
Schmidt macht seine Sache scheinbar so gut, dass der damalige Hanser-Verleger Michael Krüger in einem Feuilleton-Beitrag in der F.A.Z. zum (vorläufigen) Ende des Literarischen Quartetts fordert: »Harald Schmidt sollte es aufgeben, irgendwelche unbegabten kichernden Sternchen zu befragen, und statt dessen ein ›Literarisches Kaffee‹ aufmachen. Dort dürften dann auch Dichter verkehren, Essayisten, Historiker und andere Geistesmenschen – und selbstverständlich auch die Mitglieder des ›Literarischen Quartetts‹«.23
Einen eigenen Literarischen Salon etabliert Schmidt zwar (bisher) nicht, war aber knapp zwei Jahre später der erste Gast in der von Elke Heidenreich moderierten Sendung Lesen! – »vermutlich«, kommentiert der Spiegel, »weil man mit ihm nie etwas falsch macht.«24
Am 16. November 2001 läuft die 1.000 Ausgabe der Harald Schmidt Show über die Bildschirme. Am darauffolgenden Sonntag widmet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung diesem Jubiläum eine ganze Seite, auf der verschiedene deutsche Intellektuelle ihre Eindrücke von der Schmidt-Show im Allgemeinen und der Jubiläumssendung im Besonderen wiedergeben. Alexander Kluge beispielsweise begreift Schmidt und dessen Show als »unverdiente[n] Luxus«.25 Hans Magnus Enzensberger konstatiert: »Keine Randgruppe, die in diesen Sendungen nicht beleidigt und verklärt würde, keine Partei- oder Gürtellinie, unter die er nicht gezielt hätte. Alles in allem eine staatsbürgerliche Integrationsleistung an der sich unsere Politiker und unsere Intellektuellen ein Beispiel nehmen sollten.«26 Benjamin von Stuckrad-Barre, ehemaliger Gagschreiber für Schmidt, hebt dagegen den praktischen Nutzen der Show hervor: »Schmidt ist der Vertrauensmann der Deutschen«, der »zuverlässig und geschmackssicher die Ereignisse und Meldungen aussiebt, referiert und bewertet«,27 die von Belang für das Verständnis der Gegenwart sind. Frank Schirrmacher, damaliger Mitherausgeber und ehemaliger Feuilleton-Chef der F.A.Z. wiederum denkt – Schirrmacher-typisch – in größeren Zusammenhängen: »Schmidt, intellektuell und sozial durch den atheistischen Koran der 70er Jahre erregt, nämlich durch die regenbogenfarbenen Bände der ›edition suhrkamp«‹, überbrückt altes und neues Deutschland wie kein anderer es vermag. [...] Ihm wird alles zum Kanon einer wohlfeilen Universalbibliothek, das heißt: billig. Aber auch: klassisch.«28 Martin Walser schließlich erkennt in Schmidt den »Chefdissident[en] der Fernsehnation« und widmet ihm folgenden Vierzeiler:
Harald Schmidt,er lebe hoch und höcherund schieß‘ noch 1000 geile Pfeileaus seinem heißen Köcher.29
Nun ja – man kann Schmidt seine Gratulanten schwerlich zum Vorwurf machen. Deutlich wird indes, dass Schmidt längst in den Kreis der public intellectuals aufgenommen wurde, ganz egal, ob er sich selbst zu diesem Zirkel zählen würde oder nicht. Mit Beginn der 2000-er Jahre wird er zur intellektuellen Leitfigur. Dabei ist es gleichgültig, ob er nach intersubjektiv nachvollziehbaren Kriterien tatsächlich zum Intellektuellen taugt; viel wichtiger ist, dass er von einer ganzen Reihe ›Geistesmenschen‹ als solcher rezipiert und mit Deutungs- und Diskursmacht ausgestattet wird.
Dem kommt auch zu Gute, dass Schmidt Stil, Pietät und Parkettsicherheit beweist, wenn es darauf ankommt. Als Schmidt und Andrack im Jahr 2002 mit dem Medienpreis DieGoldene Feder des Bauer-Verlags ausgezeichnet werden sollen, lehnen diese die Teilnahme an der von Johannes B. Kerner moderierten Veranstaltung mit der folgenden Begründung ab: »Angesichts der jüngsten medialen Außenwirkungen von Herrn Kerner können wir uns unter keinen Umständen vorstellen, einen Preis in seiner Anwesenheit entgegenzunehmen.«30 Was war geschehen? Am Tag des Amoklaufs von Erfurt, als ein ehemaliger Schüler des dortigen Gutenberg-Gymnasiums 16 Menschen und sich selbst erschoss, sendete das ZDF noch am selben Abend eine Sondersendung aus Erfurt, die von Kerner moderiert wurde. Im Verlauf der Sendung interviewte Kerner den damaligen Ministerpräsidenten Thüringens, einen Psychologen und einen elfjährigen Schüler.31 Auf die Frage, ob die Ablehnung von Kerners geschmackloser ›Witwenschüttelei‹ irgendetwas gebracht habe, äußert sich Schmidt später im Interview mit Frank Schirrmacher:
Ich glaube, es wird gar nicht wahrgenommen, daß ich da meiner eigenen Glaubwürdigkeit gedient habe. Daß ich sage, es gibt eine Grenze, und die überschreite ich nicht. [...] Schon allein nach Erfurt zu fahren, kann ich mir als Moderator nicht vorstellen. Dann die Aufregung in der Redaktion, der Griff zum Handy, sich überschlagen vor Wichtigtuerei. Wir haben den Ministerpräsidenten, rennen zum Hubschrauber, der ganze Ablauf. Warum macht man so etwas. Angesichts des unvorstellbaren Elends, das an diesem Tag über die Menschen in Erfurt hereingebrochen ist. Ich würde empfehlen, zu schweigen. Schlicht und einfach schweigen.32
Mit Schweigen hatte Schmidt sich bereits im Jahr zuvor den Respekt der Medienbranche verdient. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 pausiert die Harald Schmidt Show für zwei Wochen und erhält für diese Pause im darauffolgenden Jahr zum zweiten Mal den Grimme-Preis, den Schmidt mit einem angemessenen und schlichten ›Danke‹ entgegennimmt.33 Auf die Frage, weshalb Schmidt nicht wie Letterman mit der Show weitergemacht hat, antwortet Schmidt im Interview salopp:
Der Führer war schuld. Die Late Night Show von Letterman begann damals ohne Musik, aber mit amerikanischer Flagge. Im Anschluss an den Monolog saß die Elite der Nachrichtensprecher bei ihm und hat geweint. Da haben wir gesagt: »Klar können wir das auch machen: Wir fangen an mit der deutschen Flagge und dann kommt Uli Wickert und weint. Was haltet ihr davon?« Das klappt bei den Amis einfach viel besser.34
Richtig ist sicherlich, dass bestimmte Spielarten pathetisch-patriotischer Kommunikation und Inszenierung in Deutschland schlichtweg nicht funktionieren, ohne zumindest – nicht zu Unrecht – ein befremdliches Gefühl zu hinterlassen. Richtig ist auch, dass es im deutschen Medienumfeld nur außerordentlich wenig Personal gibt, das angesichts eines Terroranschlags wie dem des 11. September 2001 den richtigen Ton treffen würde. Was Schmidt – vermutlich aus Bescheidenheit und um nicht betulich zu wirken – nicht sagt, was jedoch anhand seines Verhaltens angesichts des Amoklaufs von Erfurt und der Anschläge vom 11. September deutlich wird: Er vertritt konservative Werte. Und mit diesen Werten geht es schlichtweg nicht einher, aus dem menschlichen Elend Anderer Kapital zu schlagen. In der legendären Interview-Reihe Zur Person äußert sich Schmidt zu seinem Wertekanon folgendermaßen:
GAUS: Wollen Sie [...] sagen, Sie seien in Ihrer Grundhaltung konservativ?
SCHMIDT: Ja.
GAUS: Beschreiben Sie bitte, was konservativ ist.
SCHMIDT: Ein kleines Wertesystem. Ein Mißtrauen allem neuen gegenüber. Den Satz »Früher war alles wesentlich besser«, sage ich nur deshalb nicht, weil ich weiß, daß man dadurch so alt wirkt. [...]
GAUS: Nennen Sie mal ein, zwei oder drei Werte, von denen Sie sagen: »An denen werde ich nicht rütteln lassen. Da relativiere ich nicht. Das sind meine konservativen Grundwerte.«
SCHMIDT: Eine intakte Familie. [...] Eine klassische Ausbildung der Kinder, überhaupt eine optimale Ausbildung. Dazu gehört das Erlernen eines Instruments und im Groben auch die Orientierung an Werten, wie sie ...
GAUS: ... das Christentum ...
SCHMIDT: ... das Christentum, nicht unbedingt die katholische Kirche, sondern das Christentum, vorgibt.35
Es ist mutmaßlich zu großen Teilen diesem unterschiedlich offen zur Schau gestellten Wertegerüst geschuldet, dass insbesondere das Feuilleton der konservativen F.A.Z. Gefallen an Schmidt findet. Aufgrund der Tatsache, dass Schmidts moralische Indifferenz stets nur simuliert wird, kann sich dessen Publikum sicher sein, gefahrlos mitlachen zu können. Schmidts Witze, Polemiken, Invektiven und Pointen sind nicht selten sarkastisch, boshaft und hämisch, aber sie überschreiten nicht die Grenze des Justiziablen. Sein Spott verteilt sich demokratisch auf alle Personen ab einem Einkommen von 10.000 Euro netto.36 Anders als etwa Jan Böhmermann, der seine ersten Late Night-Gehversuche in der Harald Schmidt Show unternahm, verfolgt Schmidt keine Agenda und betreibt keinen politischen Aktivismus. Auch bezieht Schmidt nie öffentlich Position für diese oder jene Seite oder gar politischen Partei. Darin besteht der Reiz der Show auch für die Berichterstattung des Feuilletons: Schmidt wirkt nicht belehrend oder parteiisch; sein Wertekanon ist spürbar vorhanden, wird aber nicht offen zur Schau gestellt. Er bleibt strategisch indifferent und hält sich damit die Möglichkeit offen, in alle Richtungen ausholen zu können. Selbst dann, wenn es scheinbar eindeutig wird – etwa bei den regelmäßig provokant vorgetragenen sexistisch-misogynen Witzen, mit denen er sich immer wieder für den Negativpreis Saure Gurke bewirbt, der besonders frauenfeindliche Beiträge im TV ›auszeichnet‹ – ist offensichtlich, dass Schmidt die jeweils angenommene Haltung lediglich probeweise annimmt, sie auf diese Art und Weise ausstellt und vorführt, um sie so zu desavouieren.
Dass Schmidt kein Scheibenwischer-Kabarettist ist, dem es etwa darum geht, die Zustände im Land zu kritisieren, um dadurch Impulse in diese oder jene Richtung zu setzen, scheinen indessen nicht alle Feuilleton-Redakteure der F.A.Z. zu begreifen. »Man kann doch sagen, was man will:«, beginnt Christian Geyer seinen Besinnungsaufsatz zur Rolle Harald Schmidts in den Schröder-Jahren, der hier ob seiner opaleszenten Rhetorik und inhaltlichen Widersinnigkeit umfangreich zitiert werden soll:
Selbst der dröge Jaspers mit seinen Stichworten zur geistigen Situation unserer Zeit wäre in den Zeiten wie diesen ein erträglicherer Satiriker als Harald Schmidt. So wie der Kanzler derzeit ein Heer von Renegaten hervorbringt [...], so ergeht es auch denjenigen aus den Kohorten seiner Hofnarren, die einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen [sic!], als sei das Land noch immer das alte, als würde Deutschland nicht soeben kaputtregiert, als könne man die ökonomische Unvernunft nach wie vor als ein Feld der Kulturkritik unter anderen behandeln, sie nach den eingespielten Präferenzen von links und rechts bedienen, ohne zu sehen, daß inzwischen nicht nur irgendwelche Luxusartikel, auf die sich weiß Gott getrost verzichten ließe, sondern die Instanzen der Kritik selbst auf dem wirtschaftlichen Spiele stehen.
Wer das nicht begreift, obwohl er es um unserer Freiheit und unseres Lachens willen doch bitte umgehend begreifen sollte, ist Harald Schmidt. Seine Show, bislang die gültige Instanz der Bundesrepublik zur satirischen Begleitung des Zeitgeschehens, hat vermutlich als allerletzte von den Deutungsmächten unseres Landes zu befürchten in die Milliardenlöcher des wackeren Hans Eichel zu plumpsen. Aber sie ist im Moment die erste, dies ich als ernstzunehmende Instanz der Kritik, die sie einmal war, selbst demontiert. Natürlich steht nirgendwo geschrieben, daß sich Satire nicht auch am Genre des nationalen Notstands abarbeiten dürfe, also durch Spott, Ironie, Übertreibung die Protagonisten des politischen Abrißkommandos kritisieren und verächtlich machen. [...] Aber um die Phänomene des nationalen Notstands wirkungsvoll unterlaufen und aufspießen zu können, muß man ihn als solchen erst einmal erkannt haben, sich also genau wie bei anderen Stoffen auch auf der Höhe des Ereignisses zeigen, sonst laufen die Gags – wie derzeit bei Harald Schmidt – reihenweise ins Leere, nerven, nerven, nerven [sic!] und wirken nur noch läppisch, flau und gut gemeint.37
Der Jaspers-Vergleich wird Schmidt sicher geschmeichelt haben, aber dem Entertainer die Gesamtverantwortung für die Regierungs- und Elitenkritik der frühen Nullerjahre überhelfen zu wollen, scheint einerseits übertrieben und marginalisiert anderseits die Rolle der F.A.Z. im Allgemeinen und deren Feuilleton im Besonderen. Anhand der überzogenen Erwartungen, die Geyer an die Harald Schmidt Show richtet, wird hingegen deutlich, welchen Rang Schmidt inzwischen innerhalb des intellektuellen Milieus der Bundesrepublik einnimmt. Von ihm wird – folgt man Christian Geyer – nicht Unterhaltung erwartet, sondern Diskurs, satirisch-ernsthafte Auseinandersetzung, zumindest ein entschlossen der Fernsehkamera entgegengeschleudertes ›J’accuse…!‹
Als Harald Schmidt im Jahr 2003 eine ›Kreativpause‹ ankündigt, scheint für die F.A.Z. eine kleine Welt zusammenzubrechen. Insgesamt 123 Beiträge widmen in diesem Jahr die F.A.Z., die F.A.S. und auf FAZ.net dem Moderator.38 Am 9. Dezember erscheint ein von Michael Hanfeld verfasster Beitrag zu den Verwerfungen zwischen Schmidt und dem neuen SAT.1-Chef Roger Schawinski, die mutmaßlich zur ›Kreativpause‹ und der Trennung von Sender und Moderator geführt haben.39 In selbiger Ausgabe erscheint unter dem Titel Statt Blumen ein Epitaph auf die Schmidt-Show, der einprägsame Momente der Show – etwa die legendäre Show en française – in Erinnerung ruft und darüber hinaus urteilt:
Sosehr das Feuilleton ihn ver- und er es bisweilen in seiner Show durch den Vortrag einzelner Artikel zurückkehrte, so unabhängig blieb er doch. Wie auch gegenüber Stars, Sternchen und Schnuppen, die er in seiner Sendung empfing. Seine journalistische Methode ist ein einfach und ohne falsche Subtilität: ablauschen, anmerken, aufbauschen. Immer dasselbe, aber reichlich doppeltönig.40
Über die journalistischen, insbesondere feuilletonistischen Methoden Harald Schmidts wird später noch zu reden sein. Zwischen die Absätze des Artikels von Andreas Platthaus ist noch ein kleiner Gruß von Robert Gernhardt gesetzt, den Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule, von der Kay Sokolowsky behauptet, sie sei konstituierendes Element, wenn nicht Bedingung für das Entstehen der Harald Schmidt Show.41 Gernhardt schreibt:
Ich habe Harald Schmidt nichtimmer gesehen, aber immerwieder und immer lieber, je mehr Zeit er sich für seine immerabwegigeren Vorhaben nahm. Indieser Welt des Wandels tat esgut zu wissen, daß es ihn gab undwo er in schöner Regelmäßigkeitzu finden war – nun hat er den Bettel hingeworfen, und wir allesind um eine Gewißheit ärmer.42
Am darauffolgenden Tag findet sich im F.A.Z.-Feuilleton eine ganze Seite, die – ähnlich wie zur tausendsensten Show – verschiedene Prominente zu Wort kommen lässt. In dem kurzen Text, den die F.A.Z. dem Potpourri voranstellt, heißt es: »Mit Harald Schmidt verliert das deutsche Feuilleton seinen größten Verbündeten. [...] Während er fürs Denken pausiert, pausiert für uns das Denken.«43 Zu jenen, die sich äußern, gehört Günther Jauch. Er schreibt: »Der Mann ist einer der letzten freien Geister in einem Medium, das immer wie ein Automat funktionieren soll.«44 Als Schmidts »wirksamstes Hausmittel« identifiziert der ehemalige F.A.Z.-Redakteur und Bestseller-Autor Florian Illies, Schmidts Methode »Erwartungen zu unterlaufen und die Pointe genau dann nicht zu setzen, wenn alle anderen darauf warten.«45 Der damalige Tagesthemen-Moderator Ullrich Wickert weiß über Harald Schmidt das Folgende zu berichten:
In der politischen Kultur Deutschlands spielt Harald Schmidt eine unersetzbare Rolle: er bricht alle Tabus, aber mit solch einem Charme, daß es ihm kaum jemand übelnimmt. Er erinnert mich an den leider viel zu früh verstorbenen französischen Komiker Coluche, der kein Blatt vor den Mund nahm, Stammtischparolen benutzte, um ihre Gräßlichkeit zu entlarven.46
Der TV-Produzent Oliver Mielke sieht in Schmidt einen »kleine[n] Fernseh-Gott«,47 der damalige stellv. Programmdirektor des ZDF, Hans Janke bewundert hingegen Schmidts Bildung:
Harald Schmidt ist dem Medium mit Bildung begegnet und mit einem beachtlichen Spektrum, mit Musik, Unterhaltung und Politik. Seine Sendung war universell. Sie hat es sogar ausgehalten, daß sie über und über bewundert wurde. Das hat mir immer besonders imponiert, dieser Stil, diese Noblesse und vor allem – diese Bildung. Literatur, Kunst, Theater, es war alles da.48
Der Schriftsteller Stephan Wackwitz erkennt in Schmidt einen »große[n] komische[n] Sprechliterat[en]«49 und Anke Engelke, designierte Nachfolgerin auf Schmidts Sendeplatz bei SAT.1, schwärmt: »Und kein Wort mehr über die schönen Hände! Am Ende bin ich schuld, und er war genervt von den ewigen Huldigungen, und wenn wir Weiber [sic!] mal mehr von seinen schönen Füßen geschwärmt hätten: Er wäre geblieben!«50
In einem weiteren Nachruf, der ebenfalls im F.A.Z.-Feuilleton des 10. Dezembers 2003 erscheint, schreibt Gisa Funck über den »letzten Mohikaner der ironischen Distanzierung im deutschen Fernsehen«, der »schon immer Dinge sagen [konnte], die bei anderen Fernsehmoderatoren sofort zu einem Quotenknick führen würden. Schmidt verzeiht man sogar sexistische Sprüche.«51 Am darauffolgenden Tag beschreibt wiederum Michael Hanfeld die Misere des Senders SAT.1, für die Schmidts Weggang symptomatisch sei.52 Daneben finden sich weitere Stimmen zum (vorläufigen) Aus der Schmidt-Show. Der Schauspieler Jürgen Tarrach schreibt über Schmidt: »In Wahrheit ist er jedoch ein großer Moralist, wie jeder große Spaßmacher – Spaßmacher im Sinne eines shakespearschen Narren.«53 Und schließlich konstatiert der Schriftsteller Burkhard Spinnen: »Schmidt hat, nachdem er aus dem Rattenrennen um die Quote sanft ausgestiegen war, das Medium nach Kräften gegen den Strich der Erwartung gebürstet.«54 Die Website der F.A.Z. initiiert ab dem 11. Dezember 2003 eine eigene, mit Countdown betitelte Serie, welche die letzten zehn Sendungen der Show begleitet.55 Es mischen sich indes auch kritische Stimmen in die Lobesfanfaren auf die Harald Schmidt Show: Zur (vorerst) letzten Show bei SAT.1 schreibt Stefan Niggemeier, sie sei »die leichteste von allen«, denn egal, wie Schmidt die Show gestalten würde, der »Heiligsprechungsprozess« sei längst abgeschlossen.56 Gerade deshalb zeigt sich Niggemeier enttäuscht, denn Schmidt gab sich wenig Mühe. Als krönender Abschluss von acht Jahren TV-Geschichte sei die letzte Show zu unspektakulär gewesen, so der Tenor seiner Kritik, die mit der Feststellung endet: »Er wird uns fehlen. Aber es ist gut, daß es endlich vorbei ist.«57
Das deutsche Feuilleton und mit ihm das Milieu der Intellektuellen und Medienschaffenden muss jedoch nicht lange auf die Wiederkehr Harald Schmidts warten. Kein Jahr nach den zitierten Lobeshymnen und Beileidsbekundungen kündigt Schmidt sein Comeback an – allerdings in der ARD und mit deutlich verringerter Sendezeit.58 Am 24. Dezember liefert Jörg Thomann auf F.A.Z. die erste Kritik zur neuen Schmidt-Show, darin heißt es verhalten: »Selbstverständlich ist Harald Schmidt grotesk überbezahlt, und als Gebührenzahler sind wir entrüstet. Als Zuschauer haben wir uns über das Wiedersehen gefreut, uns alles in allem gut unterhalten und ein paarmal sehr herzhaft gelacht. So kann es weitergehen.«59 Wenige Wochen später fällt Thomanns Urteil jedoch bereits deutlich negativer aus: »Schmidt kam mit kurzem Haar, ohne Bart und – ohne Pointen. Es war deprimierend. Kaum ein Satz von ihm, der befreites Gelächter hervorrief, kaum ein Spruch, den die ›ARD-Showband‹ wagte mit einem Tusch zu adeln. Dabei redete sich Schmidt den Mund schier fusselig. […] Aber komisch war das alles nicht. Es war quälend.«60
Langsam wird es im F.A.Z.-Feuilleton stiller um Schmidt. Zwar findet er immer wieder Erwähnung, häufig jedoch nur im Nebensatz, als Referenz oder Gast bei Preisverleihungen. 2007 kritisiert Jörg Thomann: »Was hat der Mann bei Sat.1 für Glanzvorstellungen geliefert, wie matt zeigt er sich bei der ARD. Schmidt, der mal für Kopfschmerzmittel warb, müsste schnellstmöglich für eine Viagra-Reklame verpflichtet werden, so häufig hat man ihm Lustlosigkeit vorgeworfen.«61 Rückwirkend betrachtet scheint jedoch ein anderer Absatz dieser Kritik von nahezu hellseherischer Weitsichtigkeit zu zeugen: »Selbst ein lustloser Harald Schmidt«, schreibt Thomann, »ist in der der Regel erträglicher als ein sich redlich mühender Oliver Pocher.«62 Noch im selben Jahr wird Oliver Pocher zu jenem Fehler Harald Schmidts werden, den ihm die Feuilletonberichterstattung lange nicht verzeihen wird. Dass neben dem über Jahre hinweg in den höchsten Tönen gelobten Schmidt, neben der intellektuellen Instanz, die Schmidt inzwischen zweifelsohne darstellt, ein ›Fäkalkomiker‹ wie Oliver Pocher platznehmen darf, werten viele Kommentatoren – nicht zu Unrecht – als Sakrileg. Bereits mit der Ankündigung der gemeinsamen Show Schmidt & Pocher sucht man bei der F.A.Z. nach Erklärungen, die rechtfertigen, weshalb man zukünftig, wenn man Schmidt sehen wolle, Pocher in Kauf nehmen muss: »Nachdem die ARD Anfang April entschieden hatte, die Zahl seiner Shows im Ersten zu halbieren – weil mittwochs künftig Frank Plasberg mit »Hart aber fair« läuft –, sich die Länge der Sendung aber auf eine Stunde verdoppelt, stand Schmidt vor der Frage, ob er künftig sechzig Minuten lang allein Stand-up-Kabarett oder etwas anderes bieten will.«63
Etwaiger vorauseilender Wertungen oder Vorverurteilungen enthält sich Hanfelds Beitrag jedoch. Noch bevor die neue Show in der ARD anläuft, gratuliert die F.A.Z. Harald Schmidt zum 50. Geburtstag, nicht ohne Pathos, und wagt den ganz großen Vergleich:
Harald Schmidt, den sogar die Regenbogenpresse »Chefzyniker des deutschen Fernsehens« nennt, ist einem Millionenpublikum gewesen, was vor hundert Jahren Karl Kraus der Wiener und Berliner Hautevolee war – eine Mischung aus Prophet, Klassenclown, notorischem Spielverderber und pathologischem Nörgler, den man, je dreister seine Späße werden und je hartnäckiger er einem die Leviten liest, umso mehr bewundert. [...]Harald Schmidts Auftritte sind die Ausbrüche eines von übersteigertem Geltungsbedürfnis enthemmten Moralisten. Womit wir wieder beim Karl Kraus des Bildschirms wären.64
So überspitzt die Vossianische Antonomasie des »Karl Kraus des Bildschirms« auf den ersten Blick auch sein mag, so lassen sich aber gleichzeitig auch einige Gemeinsamkeiten von Kraus und Schmidt finden: Zu beider präferierten Gestaltungsmitteln gehören Provokation, Polemik und Invektive. Beide stellen ihr sezierend-analytisches Denken offen zur Schau, sudeln, beide zeigen mit dem Finger auf ethisch-moralische Inkonsistenzen des Medienbetriebs ihrer jeweiligen Zeit, beide verstehen sich implizit als »Beobachter der Beobachter« (Luhmann), als medienreflexive Instanzen, insbesondere aber verfügen beide über ein präzises Sprachgefühl, das mit einer nahezu manischen Lust an der Sprache selbst einhergeht. Und: beide sind eitel. Schon wegen dieser Eitelkeit hatte man es Schmidt seitens des Feuilletons nicht zugetraut, eine »kleine miese Type«65 wie Oliver Pocher zum – zumindest in Bezug auf die Moderationssituation – gleichberechtigten Partner zu machen. Wo der allseits geschätzte Andrack noch am Katzentisch platznehmen muss, wird Pocher an Schmidts Seite am Schreibtisch platziert. So bleibt Bartetzkos Geburtstagsgruß auch die vorerst letzte positiv zu wertende Berichterstattung über Schmidt im F.A.Z.-Feuilleton.
Am 18. Oktober kündet bereits der Teaser eines longreads zu Schmidt & Pocher von der Enttäuschung innerhalb des F.A.Z.-Feuilletons: »Wie hat Oliver Pocher es bloß geschafft, dass Harald Schmidt ihn zum Nachfolger erkor? Und warum dürfen wir Manuel Andrack nicht mehr sehen? Wichtige Fragen zum Start von ›Schmidt & Pocher‹.«66 Der Beitrag zeichnet im Folgenden ›wichtige‹ Lebens- und Karrierestationen (»Schmidt Abiturnote: 3,2; einmal sitzengeblieben, Pocher mittlere Reife mit 2,9«)67 der beiden nach, findet elementare Gemeinsamkeiten (etwa, dass beide sich von Alkohol und Drogen fernhalten), aber keine Erklärung für Pochers Aufstieg an die Seite Schmidts. Den einzigen Erklärungsversuch unternimmt die im Beitrag zitierte Elke Heidenreich. Sie erklärt »sich das Ganze beziehungspsychologisch: Wie so mancher ältere Herr habe sich Schmidt ›plötzlich noch mal was zwanzig Jahre jüngeres, was ganz Doofes, was ganz Blondes‹ zugelegt«68 und hofft im Übrigen, dass diese Phase möglichst schnell vorübergeht. Nach den ersten vier Sendungen von Schmidt & Pocher, zieht die F.A.S. ein erstes, vernichtendes Resümee:
Wenn man diesen beiden donnerstags eine Stunde lang beim Bösesein zugeschaut hat, wenn man ihre meckernde Schadenfreude, ihre zur Schau gestellte Arroganz, ihr komplettes Desinteresse an allem außer sich selbst gesehen hat, möchte man sich eigentlich nur noch waschen. Es ist einziges Missverständnis Oliver Pocher im Fernsehen eine Bühne zu geben. Er ist nicht lustig. Er ist schlagfertig und dreist. Er bringt das Schlechteste in Harald Schmidt hervor.69
Der Weg vom »Karl Kraus des Bildschirms« hin zur vernichtenden Kritik ist nicht weit; zwischen beiden Artikeln liegen exakt drei Monate. Zeitungsberichterstattung, insbesondere Feuilletonberichterstattung ist zwar nicht auf kontinuierliche Wertungen angelegt – wenn ein Sachverhalt sich aus diesem oder jenem Grund plötzlich anders darstellt, ändert sich auch die Berichterstattung –, zudem schreiben unterschiedliche Autoren, aber eine derartige Wendung um 180 Grad, in so kurzer Zeit ist dennoch ungewöhnlich. Es bedarf jedoch nicht des Feuilletons der F.A.Z. und F.A.S., sondern eines Studiogasts, um Harald Schmidt die Misere vor Augen zu führen, in die er sich mit Oliver Pocher manövriert hat. Am 24. April 2008 ist die Linguistin, Moderatorin, Autorin und Rapperin Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray zu Gast im Studio und irritiert durch ihre Performance, die sich zwischen linguistischem Oberseminar zu den Theorien de Saussures, radikalfeministischer Ermächtigung und Fäkalhumor bewegt, insbesondere Oliver Pocher. Dieser bekommt von ihr zum Abschied eine Dose »Fotzensekret« geschenkt, was ihm vollends die Sprache verschlägt.70 Zum Ende der Show hin, dreht Pocher jedoch wieder hoch und fertigt »eine junge Sängerin [...] mit einer Tirade ab, wie sie sich sonst Dieter Bohlen bei RTL leistet«.71 Daraufhin platzt Schmidt der Kragen. Es ist »völlig uncharmant« wettert er gegen Pocher, »für so eine kleine miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht kriegt, so klein mit Hut ist und dann einem ausländischen Gast so reinsemmelt, der kein Deutsch versteht. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen.«72 »Daran glauben wir nicht.«, kommentiert Michael Hanfeld und mahnt: »Harald Schmidt sollte sich aber auf jeden Fall überlegen, welche Bodenlosigkeiten er sich und seinen Zuschauern noch zumuten will.«73 Auffällig ist, dass nicht etwa Pocher als Schuldiger identifiziert wird, sondern Schmidt, der sich während der Sendung ungleich besser geschlagen hat und dem gerade deshalb die Alleinverantwortung für die Show zugeschrieben wird. Jahre später wird das Hip-Hop-Kollektiv Antilopen Gang jene Sequenz, in der Schmidt Pocher als »kleine miese Type«74 bezeichnet, für einen Diss-Track gegen Pocher verwenden.
Wenige Tage nach dem Auftritt Lady Bitch Rays in der Show legt die F.A.Z. nach. Es ist wiederum Hanfeld, der hart mit Schmidt und Pocher ins Gericht geht:
Harald Schmidt ist am Ende. Sollte er noch irgendeinen Anspruch an sich selbst stellen, müsste er jetzt vors Publikum treten und sagen: hier stehe ich und kann nicht anders, als zu sagen: ich habe mich geirrt. Geirrt hat sich Schmidt vor allem in seinem Möchtegern-Nachfolger Oliver Pocher, der nicht nur eine unheimliche Vorliebe fürs Herbe hat, sondern gar nicht anders kann, als Zoten zu reißen und eine Unterleibsgroteske an die nächste zu reihen. Kein Esprit, nirgends. Kein Feingefühl für die Pointe und – mehr noch – keines für den Umgang mit anderen, mit Gästen zumal. [...] Oder aber er [Pocher] kapituliert vor jemandem wie der in der vergangenen Woche geladenen »Lady Bitch Ray«, die munter aus der Gosse bramarbasieren durfte, bis Harald Schmidt auf die Idee kam, den sittlichen Sinn und Zweck des Ganzen aufscheinen zu lassen. Pocher blieb aber stumm, hinterließ, wie sonst auch, verbrannte Erde, aber keine Lacher.75
Indirekt macht Hanfeld, der häufiger als alle anderen Autoren in der F.A.Z. über Schmidt berichtet, deutlich, was der wesentliche Kritikpunkt am Sendekonzept von Schmidt & Pocher ist: Es geht nicht nur um zweifelhafte Gags und einen fragwürdigen Umgang mit Gästen, es geht vielmehr um das drastisch abgesunkene intellektuelle Niveau. Die Rezeption der Show stellt für das Feuilleton-Publikum keinen Distinktionsgewinn mehr dar. Es fehlen die versteckten Anspielungen auf historische Ereignisse, die subtilen Seitenhiebe gegen diesen oder jene, der Sprachwitz (»bramarbasieren«!) sowie die Popularisierung von Themen aus dem Bereich der Hochkultur (bspw. durch die legendären Playmobil





























