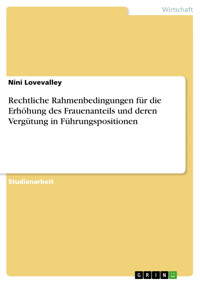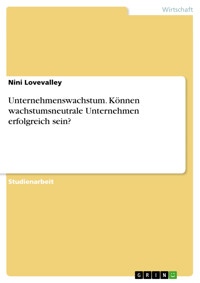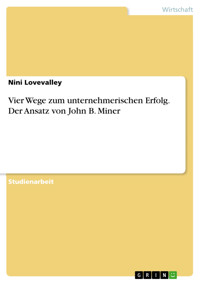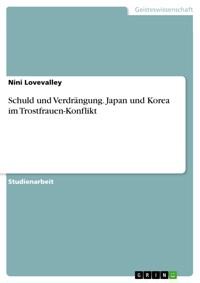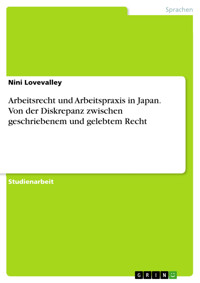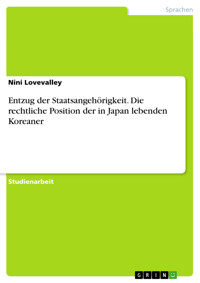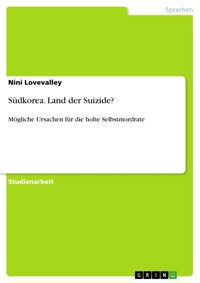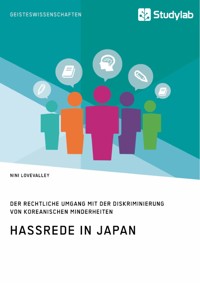
Hassrede in Japan. Der rechtliche Umgang mit der Diskriminierung von koreanischen Minderheiten E-Book
Nini Lovevalley
18,99 €
Mehr erfahren.
Hassrede, Hetze und Diskriminierung von Minderheiten – auch in Japan bilden diese Phänomene ein zunehmendes gesellschaftliches Problem. Nicht nur im Internet, sondern auch bei Demonstrationen attackieren rechtsorientierte Gruppierungen wie "Zaitokukai" in Japan ansässige Koreaner. Diese als "Zainichi" bezeichnete Minderheit wird oft das Opfer von Übergriffen. Lange blieben diese Hassreden frei von einer rechtlichen Beurteilung und wurden kaum geahndet, was einen weiteren Nährboden schuf. Nach anhaltendem Drängen internationaler Verbände sowie von Stimmen aus dem eigenen Volk hat Japan nun das Gesetz zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung und Hassrede beschlossen. Nini Lovevalley gibt in ihrer Publikation einen Einblick in die diskriminierenden Handlungen gegenüber der koreanischen Minderheit in Japan. Vor diesem Hintergrund untersucht sie die Effektivität des neuen Gesetzes. Lovevalley beleuchtet damit ein Thema, das im Westen bisher kaum Beachtung fand, in Zeiten eines umgreifenden Rechtsrucks jedoch umso wichtiger ist. Aus dem Inhalt: - Zainichi; - Japan; - koreanische Minderheit; - Diskriminierung; - Hassrede
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Rassismus in Japan
2.1 Der Homogenitätsgedanke
2.2 „Embedded Racism“
2.3 Direkter Rassismus
2.3.1 Zainichi, Koreaphobie und Zaitokukai
2.3.2 Hassrede gegenüber der koreanischen Minderheit
3 Rechtliche Rahmenbedingungen bis 2016
3.1 Nationale Gesetzgebung
3.2 Internationale Konventionen
3.3 Rechtsanwendung zwischen Verfassung und Konventionen
4 Hassrede als gesellschaftliches und rechtliches Problem unterinternationaler Beobachtung
5 Die Anti-Hate Speech Kampagne
5.1 Das japanische Antidiskriminierungsgesetz von 2016
5.2 Problematik, Kritik, Potential
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Anlage A: Das japanische Antidiskriminierungsgesetz
Anlage B: Ergänzende Beschlüsse des Oberhauses
Anlage C: Ergänzende Beschlüsse des Unterhauses
Anlage D: CERD-Indikatoren für Verhaltensmuster systematischer und massiver Rassendiskriminierung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Seit einigen Jahren verdeutlicht sich in Japan zunehmend ein für die Gesellschaft bedrohliches Problem. Diese Gefahr hat sich nicht erst in den letzten Jahren entwickelt, vielmehr besteht sie schon seit langer Zeit und hat nach und nach besorgte Beobachter auf den Plan gerufen und Reaktionen veranlasst.
Die Rede ist von der sogenannten Hate Speech (Hassrede), welche ethnische Minderheiten im Lande denunziert und beleidigt. Hassrede wird meist von Mitgliedern rechtsorientierter Gruppierungen, insbesondere der so genannten Zaitokukai, als Mittel zur Hetze und Diffamierung von Minderheiten gehalten. Nicht nur im Internet, auch auf der Straße werden die Betroffenen im Rahmen von Demonstrationen attackiert und Zuhörer zur Teilnahme an solchen Angriffen aufgefordert. Nicht selten kommt es hierbei zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Vertretern rechtsorientierter Gruppen und den Betroffenen und deren Unterstützern.
Hauptziel der Angriffe sind in Japan ansässige ethnische Minderheiten, vornehmlich dauerhaft in Japan ansässige Koreaner, welche als Zainichi[1] bezeichnet werden, selbst wenn sie bereits naturalisierte Japaner im rechtlichen Sinne sind.
In der Vergangenheit kam es bereits zu rechtlichen Auseinandersetzungen, welche zugunsten der Angegriffenen entschieden wurden. Dennoch verbreiten Gruppen wie die Zaitokukai weiterhin ihr Gedankengut in Form von Demonstrationen, Reden und Internetseiten. Die rechtliche Beurteilung des Problems der Hate Speech in Japan ist seit langem unklar und hat dazu beigetragen, dass hassschürende Reden eine lange Zeit ungestraft gehalten und verbreitet werden konnten.
Die Problematik ruft auch Fragen zu einem generellen Rassismusproblem im Lande hervor. Die jahrelange Zurückhaltung des japanischen Staates gegenüber demokratiefeindlichen Gruppen und deren Aktivitäten und Hassreden hat dazu beigetragen, dass Individuen ihren Hass gegenüber einer bestimmten Ethnie ungehindert verbreiten konnten.
In der Diskussion um ein Verbot von Hassreden verdeutlichte sich ein fundamentaler Streit um die Abwägung freier Meinungsäußerung gegenüber dem Wohl und der Menschenwürde der betroffenen Personen.
Nach wiederkehrendem Drängen internationaler Verbindungen und Stimmen aus dem eigenen Volk hat Japan nun damit begonnen, das Problem der Hate Speech überhaupt als solches zu akzeptieren und eingesehen, dass Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund wurde zuletzt das Gesetz zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung und Hassrede beschlossen. Inhaltlich wurde das Gesetz jedoch bereits von vielen Seiten kritisiert, nicht nur von rechten Gruppen, die sich in ihrer Meinungsfreiheit beschränkt fühlen, sondern auch von der Bevölkerung und Vereinigungen, welche aufgrund eines unkonkret verfassten Textes und fehlender Strafbestimmungen das Gesetz für unzureichend halten.
Im Folgenden soll ein Einblick in die diskriminierenden Handlungen gegenüber der koreanischen Minderheit in Japan durch rechtsorientierte Gruppen wie die Zaitokukai
2 Rassismus in Japan
Der japanische Staat und ein nicht unerheblicher Teil seiner Bevölkerung standen fremden Ländern, deren Bewohnern und Kulturen schon in der Vergangenheit häufig mit Skepsis gegenüber. Die Bereicherung durch ausländisches Wissen, Kultur und zwischenstaatlichen Handel wurde zwar befürwortet, doch die Angst vor einem Übergriff durch das Fremde ist auch bis heute nicht vergangen. Die japanische Gesellschaft befand und befindet sich somit auch heute noch in einem Zwiespalt zwischen dem Streben nach Verbesserung und Bereicherung durch äußeren Einfluss und gleichzeitiger Furcht vor dessen Überfluss.[2]
2.1 Der Homogenitätsgedanke
Aufgrund seiner Insellage und der weitgehenden Abschottung des Landes von der Außenwelt im handelswirtschaftlichen, politischen und kulturellen Sinne während der Tokugawa-Zeit zwischen 1603 und 1868 konnte sich das Bild Japans als rein homogene Gesellschaft festigen.[3] Das Konzept eines homogenen und außerordentlich einzigartigen Staates trägt immer noch zum weit verbreiteten Eindruck bei, man habe es mit einem Land zu tun, welches ausschließlich aus japanischen Staatsbürgern und einem nicht erwähnenswerten Ausländeranteil bestünde. Nihonjinron, sogenannte „Japaner-Diskurse“, welche sich mit der Einzigartigkeit japanischer Identität und Kultur beschäftigten, scheinen daher auch in der heutigen Zeit noch ihren Beitrag zum Bild des einzigartigen, homogenen japanischen Staates beizutragen. Im Rahmen dieser Diskurse kam es auch zur Untersuchung des japanischen Begriffs kokutai (etwa „Nationalwesen“), welcher für eine Ideologie steht die Japan als biologisch homogene Gesellschaft bezeichnete. Mit dem Beginn der japanischen Kolonialherrschaft über Korea und Taiwan begann das Gerüst der Homogenität im japanischen Staat jedoch zusammenzufallen – die Ideologie von kokutai im Sinne einer einzigartigen, blutsabhängigen „Japanität“ verlor somit einen Teil ihrer Begründetheit. Mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg, der hieraus resultierenden Souveränität ehemaliger Kolonialgebiete und der Rückkehr eines Großteils der Taiwanesen und Koreaner in ihre Heimat jedoch trat das Bild japanischer Rassenhomogenität erneut in Erscheinung.[4]
Selbst japanische Intellektuelle und politische Amtsträger haben in der Vergangenheit durch diverse Aussagen zu einer Festigung dieses Selbstbildes beigetragen.[5] So wurde der damalige Außenminister Asō im Jahre 2005 aufgrund einer Rede kritisiert, in welcher er Japan als einen nur aus einer einzigen Kultur und Rasse bestehenden Staat beschrieb und behauptete, dass kein anderer Staat diese außergewöhnliche Eigenschaft vorweisen könne. Bereits zwei Jahrzehnte zuvor, im Jahre 1986, hatte der damalige Premierminister Nakasone durch eine ähnliche Bemerkung für Aufsehen gesorgt, in welcher Japan von ihm als „homogener Staat“ bezeichnet worden war.[6] Forscher zeigen sich besorgt über den Einfluss des Konzepts mono-rassischer „Japanität“ auf das Selbstbild der japanischen Allgemeinheit. Als ausgrenzendes Konzept kann dieses Selbstbild zum einen zur Diskriminierung von Minderheiten beitragen und zum anderen zu einem als selbstverständlich akzeptiertem Desinteresse an der Auseinandersetzung mit Multikulturalismus führen.[7]
Diese Abgrenzung von Japanern gegenüber Ausländern findet sich unter anderem auch in der Tendenz begründet, die „In-Group“ von der „Out-Group“ abgrenzen zu wollen. Das Konzept von uchi und soto,[8] mit kokutai und nihonjinron zusammenhängend, findet im vorliegenden Fall Anwendung auf ethnische Minderheiten, welchen als soto eher mit Gleichgültigkeit als Interesse begegnet wird.[9] Diese Sichtweise auf Ausländer, welche deren Zugehörigkeit zur „Out-Group“ wie selbstverständlich akzeptiert, bestärkt die Annahme, dass eine Akzeptanz von Personen fremder Länder überhaupt angestrebt wird.[10] Aus diesem Grund scheint es auch nicht überraschend, dass sich Japan in der Vergangenheit trotz des Beitritts zu internationalen Menschenrechtsverträgen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt und diese Weigerung mit seiner unzureichenden Erfahrung in solchen Angelegenheiten begründet hat. Nicht selten kam es zur Ablehnung von Anträgen auf die Anerkennung des Flüchtlingsstatus, obwohl betreffende Personen von internationalen Organisationen den Status anerkannt bekommen hatten.[11]
Zwar kann Japan im Vergleich zu anderen OECD-Staaten viel weniger Rassenvielfalt vorweisen,[12] als „reinrassige“ Nation ist es jedoch auf keinen Fall zu bezeichnen. Laut einer Statistik des japanischen Innenministeriums waren im Jahr 2014 etwa zwei Millionen ausländische Staatsangehörige in Japan ansässig.[13] Die Anzahl von den zu ethnischen Minderheiten gehörenden Personen – welche nach einem Naturalisierungsprozess theoretisch auch japanische Staatsangehörige sein können – kann sogar auf drei bis sechs Millionen geschätzt werden. Oftmals sind die Angehörigen solcher Minderheiten aufgrund ihrer kulturellen, sprachlichen und physischen Ähnlichkeit kaum von Japanern zu unterscheiden.[14] Dieser Zustand bewahrt sie allerdings nicht davor, Opfer von Diskriminierung verschiedensten Ausmaßes zu werden.[15]