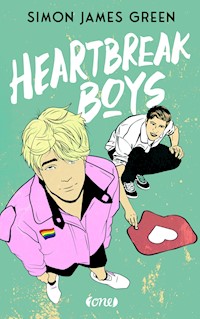
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine locker-leichte LGBTQIA+ Geschichte über gebrochene Herzen, einen verrückten Roadtrip, Social Media und die große Liebe
Für Jack und Nate sollte der Prom ganz besonders werden, doch was die beiden nicht wissen: Ihre festen Freunde haben eine Affäre. Am Ende des Abends sind Nate und Jack Single - und ihre Ex-Freunde offiziell zusammen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, zelebrieren die frisch Verliebten ihre Beziehung auf Instagram. Also beschließen Jack und Nate auf ihrem eigenen Account @TheHeartbreakBoys zum Gegenangriff überzugehen. Dabei schlittern sie von einer kuriosen Situation in die nächste. Ob sie gemeinsam ihren Herzschmerz überwinden können?
"Simon James Green ist witzig und romantisch und schreibt mit charmanter Beobachtungsgabe” Becky Albertalli
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Spoiler
Widmung
1. Kapitel Jack
2. Kapitel Nate
3. Kapitel Jack
4. Kapitel Nate
5. Kapitel Jack
6. Kapitel Nate
7. Kapitel Jack
8. Kapitel Nate
9. Kapitel Jack
10. Kapitel Nate
11. Kapitel Jack
12. Kapitel Nate
13. Kapitel Jack
14. Kapitel Nate
15. Kapitel Jack
16. Kapitel Nate
17. Kapitel Jack
18. Kapitel Nate
19. Kapitel Jack
20. Kapitel Nate
21. Kapitel Jack
22. Kapitel Nate
23. Kapitel Jack
24. Kapitel Nate
25. Kapitel Jack
26. Kapitel Nate
27. Kapitel Jack
28. Kapitel Nate
29. Kapitel Jack
30. Kapitel Nate
31. Kapitel Jack
32. Kapitel Nate
33. Kapitel Jack
34. Kapitel Nate
35. Kapitel Jack
36. Kapitel Nate
37. Kapitel Jack
38. Kapitel Nate
39. Kapitel Jack
40. Kapitel Nate
41. Kapitel Jack
42. Kapitel Nate
43. Kapitel Jack
44. Kapitel Nate
45. Kapitel Jack
46. Kapitel Nate
47. Kapitel Jack
48. Kapitel Nate
49. Kapitel Jack
50. Kapitel Jack & Nate
51. Kapitel Nate
Danksagung
Trigger
Simon James Green
Heartbreak Boys
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen.
Originalausgabe
Corinna Wieja wird vertreten von der Agentur Brauer.
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Sandra Taufer, München, unter Verwendung von Motiven von © Alona_S / shutterstock; Klavdiya Krinichnaya / shutterstock; boroboro / shutterstock; Olha Yefimova / shutterstock; Kira Mika / shutterstock; tomertu / shutterstock; Avesun / shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplus.de)
ISBN 978-3-7517-0959-0
one-verlag.de
luebbe.de
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Dazu findet ihr eine Triggerwarnung auf S. 416.
ACHTUNG: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Für alle, die versuchen, den Mut zu finden,
sich selbst treu zu sein
1. Kapitel Jack
»Soll das ein Witz sein?«
Okay, das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte, aber für Dylans Verhältnisse ist sie praktisch ein Kompliment. Ich fahre mit den Händen an meinem Smoking auf und ab. »Italienischer Schnitt, hundert Prozent reine Wolle und mit Satin-Besätzen.«
Dylan verschränkt die Arme und mustert mich unbeeindruckt.
»Sind es die Schuhe?«, frage ich.
»Es sind nicht die Schuhe.«
»Dolce & Gabbana.«
Er schüttelt den Kopf, kommt ins Haus, als wären diese Schuhe nichts, und schließt die Tür hinter sich.
Ich blase meine Wangen auf und denke wirklich ernsthaft nach. »Oh!«, sage ich und tue so, als falle es mir gerade erst auf. »Meinst du etwa ...« Ich drehe mich auf der Stelle, sodass sich mein Regenbogenflaggen-Umhang um meine Schultern bläht wie ein fantastischer schwuler Tornado. »DAS HIER?«
Dylan lächelt immer noch nicht, was komisch ist, weil mein Outfit garantiert das Spektakulärste aller Zeiten ist. »Sehr witzig.« Er zieht eine Grimasse.
»Danke – oder so. Aber das ist nun mal mein Outfit. Also ...«
Dylan starrt mich finster an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Abend dazu bestimmt ist, einer der romantischsten meines Lebens zu werden. Ein Abend von der Art, auf die man seufzend zurückblickt, wenn man das Glück hat, achtzig zu werden, und sich in wunderbaren Sepia-Tönen daran erinnert. Aber mein Freund sieht buchstäblich aus, als wolle er mich ermorden – und zwar nicht raffiniert und glamourös mit Zyankali in Champagner (was ja wohl für jeden Homosexuellen mit einem Hauch Selbstachtung die Waffe erster Wahl wäre, oder?), sondern gewalttätig. Mit einer Axt. »Ich dachte, wir waren uns einig ...«
»Ich weiß, aber ich wollte ...«
»Es kann sich nicht immer alles um dich drehen, Jack.« Er marschiert in die Küche. »Kann ich ein Glas Wasser haben?«
»Klar«, murmele ich und bleibe in der Diele stehen, während Dylan verschwindet.
Das läuft ja schon mal gut.
»Du siehst toll aus!«, rufe ich ihm nach. Und das stimmt. Er sieht verdammt umwerfend aus.
Ich höre einen Wasserhahn laufen.
»Im Kühlschrank steht eine Flasche Evian, falls du lieber kein Pisswasser trinken willst. Ich weiß, dass es weniger umweltfreundlich ist, aber da wir ohnehin alle bei der Apokalypse sterben werden, sage ich: TRINK DAS GUTE ZEUG, BABY!«
Schweigen.
Er ist sauer auf mich, aber der Abschlussball der elften Klasse ist – ganz ehrlich gesagt – das Ende von fünf Jahren fast kompletter Hölle in der Mittelstufe, und ich habe nicht vor, diesen Anlass sang- und klanglos vorbeigehen zu lassen. Nein, verdammt. Diese Shitshow wird mit einem Knall zu Ende gehen. Und in dem gleichen glänzenden Polyester-Anzug aufzukreuzen wie alle anderen Elftklässler ist nicht annähernd ein »Knall«. Scheiß drauf. Wenn ich schon ein Außenseiter bin, wenn ich schon anders sein muss, dann habe ich vor, mich richtig abzuheben.
Und da wir gerade davon reden: Dylan hat mein glitzerndes Augen-Make-up nicht mal erwähnt. Soll ich es noch dicker auftragen? Ich gehe in die Küche, wo er gerade ein Glas Schokoladenmilch austrinkt.
»Tut mir leid«, sagt er und wischt sich den Mund mit dem Handrücken ab. Er weiß, dass die Schokoladenmilch mir gehört und ich großen Wert darauf lege.
»Der Lidschatten ...«, beginne ich.
Er leckt sich die letzten Spuren der Milch von den Lippen und sieht mich an. »Äh ... ja?«
»Gefällt er dir?«
Er starrt mich an und verzieht dann das Gesicht zu einem Lächeln. »Na ja, du ... ich meine, du siehst ziemlich schwul aus.«
»Ich bin schwul!«, erwidere ich. »Und du auch!«
Er streitet es nicht ab, zuckt aber kaum wahrnehmbar zusammen, und ich weiß, dass ich das Falsche gesagt habe.
»Außerdem«, fahre ich fort, »wird man nicht Ballkönig oder Ballkönigin, ohne sich wenigstens etwas Mühe zu geben.«
Dylan fährt sich durch das dunkle, strubblige Haar. »Du glaubst wirklich, sie wählen ein schwules Paar? Echt jetzt? Unsere Schule?« Da hat er natürlich nicht unrecht, aber ihm entgeht meine enttäuschte Miene nicht, denn er spricht schnell weiter: »Hey, wer weiß? Vielleicht ändert sich da gerade etwas.«
Ich nicke ihm lächelnd zu, obwohl mir klar ist, dass es stimmt, was er grade gesagt hat.
»Ich möchte einen schönen Abend haben, und es tut mir leid, dass ich so blöd auf dein Outfit reagiert habe«, sagt Dylan.
»Ist schon gut.«
»Ich bin ein bisschen angespannt.«
»Warum? Bist du verspannt? Brauchst du eine Massage?«
»Nein. Ich meine ja, aber ...« Er zeigt auf seine Fliege. »Die ist echt. Wenn ich die aufmache, weiß ich nicht, wie ich sie wieder binden soll.«
Ich lache. »Hat deine Mum dich angezogen?«
»So gut wie.«
Ich weiß, was ihn so nervös macht. Ihm ist es lieber, wenn ich mich hetero benehme. Das hat er mir gesagt, als ich bei einem seiner Spiele mit einem T-Shirt aufgekreuzt bin, auf dem Some people are gay. Get over it! stand. Ich habe nur versucht, meinen Beitrag gegen die Homophobie im Fußball zu leisten, aber anscheinend fühlten sich ein paar der anderen Jungs abgelenkt und haben deswegen das Spiel verloren. Tja, manche Leute haben eben für alles eine lahme Entschuldigung.
Ich seufze. »Soll ich das Regenbogencape weglassen?«
»Nein.«
»Ich möchte, dass alle es sehen, Dylan. Ich will, dass alle, die mir in den letzten drei Jahren das Leben zur Hölle gemacht haben, sehen, dass sie nicht gewonnen haben. Ich bin hier, und ich werde so strahlen, dass die Mistkerle geblendet sind.«
»Ich weiß.«
»Uuund ich habe mir den heißesten Typen der Schule geangelt. Auch ein Grund zum Feiern.«
Er schaut zu Boden; verlegen, glaube ich.
»Du siehst wirklich gut aus, Jack. Hat was von einem schwulen Vampir, aber passt.« Er wirft mir ein Grinsen zu. »Jetzt mach schon einen Witz darüber, wo schwule Vampire beißen.«
Ich verdrehe die Augen. »Dazu habe ich zu viel Klasse.«
Er breitet die Arme aus. »Komm her.«
Und ich lasse mich umarmen.
Dylan.
Hundertprozentig, wahrhaftig, wahnsinnig, vorbehaltlos und aus der Tiefe meines großen, schwulen Herzens liebe ich diesen Kerl. Und okay, okay, ich weiß schon, was die Leute sagen. Ich weiß, dass ich angeblich nicht wirklich verstehen kann, was Liebe bedeutet, weil ich »erst sechzehn« bin. Wie könnte ich mir also in meinem unschuldigen kleinen Kopf einen Reim auf so etwas Komplexes machen? Andererseits sehe ich, dass auch Ältere in dieser Hinsicht ihr Leben nicht im Griff haben. Ich erinnere mich sogar lebhaft an den lauten Streit zwischen Mum und Dad, bevor Dad gegangen ist, als ich zehn war. »Ich liebe dich doch!«, hatte Dad gefleht und gleichzeitig seinen Kopf vor den Schuhen geschützt, mit denen Mum durch das Fenster nach ihm warf. »Du weißt ja gar nicht, was Liebe bedeutet!«, hatte Mum zurückgeschimpft.
Daher bin ich nicht davon überzeugt, dass es etwas mit dem Alter zu tun hat.
Und ich weiß wirklich, was Liebe bedeutet.
Jetzt gerade steht der Grund dafür in meiner Küche: mein Abschlussball-Date, in Smoking und Fliege, mit diesem strubbligen dunkelbraunen Haar und diesen verdammten tiefbraunen Augen und dem verspielten leisen Lächeln, das er immer aufsetzt, wenn er weiß, dass ich ihn gleich küssen werde. Und ich denke, ja, das ist Liebe, denn wenn nicht, was zum Teufel soll es sonst sein?
Okay, vielleicht ist es in diesem Moment hauptsächlich Lust. Sagen wir, ich bin siebzig Prozent horny, und der Rest – ich kann nicht einmal rechnen, so viel Lust habe ich auf ihn – ist Liebe.
Dreißig Prozent. Dreißig Prozent Liebe.
Aber normalerweise ist es eher fünfzig zu fünfzig.
Es ist nur ..., wenn er sich ein bisschen aufbrezelt, sieht er einfach noch heißer aus als sonst ...
Ich hole mir einen Kuss.
»Du riechst toll«, murmle ich.
»Das ist eigentlich von meinem Dad«, erklärt Dylan. »Ich hab's nur mal ausprobiert.«
»Jedenfalls viel besser als Axe.«
»Daran ist auch nichts verkehrt.«
»Wenn man riechen will wie die Jungsumkleide nach dem Sportunterricht in der achten Klasse.«
Er lacht leise, lässt die Hände um meine Mitte und in meine Smokingjacke gleiten und zieht mich an sich. Es ist neu, dass er so die Initiative ergreift.
Dylan hat sich am Anfang des elften Schuljahrs geoutet, was zu einem kleinen Skandal führte, weil er nicht einfach nur Fußball spielt, sondern sogar der Kapitän der verdammten Fußballmannschaft ist. Daher war er auch die erste Person an der Schule, die sich geoutet hat und nicht sofort gehasst und gemobbt wurde, denn Dylan wird als Sportler geradezu verehrt. Er ist wie ein Held, den sogar die Heteros abchecken – zugegeben, er sieht in seiner Fußballmontur auch so heiß aus, dass jeder den Verstand verliert –, und auf einmal war Schwulsein cool. Das ärgert mich natürlich, denn jeder sollte sich outen können, ohne dafür beschimpft zu werden. Aber das Positive daran war, dass so noch einige andere den Mut gefunden haben, ihr Coming-out zu haben, und darüber bin ich froh. Und der LGBTQIA+-Club ist von fünf Mitgliedern auf fünfzehn angewachsen. Nächstes Jahr werde ich Vorsitzender und habe vor, die Zahl zu verdoppeln. Das nächste Jahr wird so was von queer. Das wird Mrs Nunn, unsere fanatische Religionslehrerin, total auf die Palme bringen.
Aber ich schweife ab.
Eines Tages saß ich wie immer in der Mittagspause allein da, als Dylan so zielbewusst auf mich zukam, dass ich ernsthaft dachte, er wollte mich schlagen.
»Was machst du da?«, fragte er, als ich hinter der Bank in Deckung ging.
Ich starrte ihn bloß an.
Er seufzte. »Ich wollte mich entschuldigen.« Er sah zu Boden und dann wieder auf zu mir. »Wegen der Sache im neunten Schuljahr. Im Sportunterricht.«
Als er das erwähnte, spürte ich ein Bleigewicht im Magen. Diese Geschichte war zwei Jahre her, warum entschuldigte er sich jetzt? Die Sache war die: Ich hatte mich gerade geoutet, und ein paar Jungs aus meinem Jahrgang reagierten darauf, indem sie sich weigerten, sich beim Sport zusammen mit mir umzuziehen. Sie behaupteten, dass ihnen dabei »unwohl« wäre. Dann mischten sich ihre ignoranten Eltern ein und stärkten ihren dummen Kids noch den Rücken, wie das die Eltern dieser Art Kids immer tun. Nach viel Hin und Her schlug die Schule vor, ich könnte mich vielleicht in der Behindertentoilette umziehen – sie stellten es als Privileg dar, meine eigene Umkleidekabine zu haben. Dabei hatten sie in Wirklichkeit nur diesen bigotten Leuten nachgegeben, weil das einfacher war.
»Das war wirklich mies«, sagte Dylan.
Ich zuckte die Achseln. »Du hast dabei nicht mitgemacht.«
»Aber ich bin nicht für dich eingetreten. Keiner von uns hat sich für dich stark gemacht.«
»Tja, wenn man als Einziger im Jahrgang schwul ist, gehört das eben dazu.«
Dann sah er mir direkt in die Augen, und seine Unterlippe zitterte leicht. »Du bist nicht der Einzige.«
Offensichtlich konnte ich das zuerst kaum glauben. Dylan Hooper. Schwul. In unserem Jahrgang waren wir anfangs nur zu zweit. Nachher kam dank dem Seit-Dylan-ist-Schwulsein-okay-Faktor noch Theo hinzu, der bi ist und etwas mit einem Mädchen aus dem Jahr über uns hat. Und dann noch Tariq.
Tariq ist total lieb und super-nerdig und hat einen reichen Vater, der Apps verkauft. Er sitzt jetzt zusammen mit mir im Vorstand des LGBTQIA+-Clubs, und nächstes Jahr soll er mein Stellvertreter werden. Ehrlich, er ist so ein lieber Kerl.
Ich schätze aber, Tariq ist einfach nicht Dylans Typ. Irgendwann habe ich mich von der Vorstellung gelöst, Dylan würde nur mit mir abhängen, weil er keine anderen Optionen hatte, und begann in Betracht zu ziehen, dass er mich vielleicht wirklich mochte. Da habe ich den Stier bei den Hörnern gepackt und ihn gefragt, ob er mit zu mir kommen will, um zusammen mit der Hausarbeit für Geschichte anzufangen.
»Ähm, hmm, ja. Okay, glaub ich?«, stotterte er.
»Du weißt schon, dass ich Geschichte gar nicht habe, oder?«, setzte er noch hinzu, als wir bei mir ankamen.
»Ich weiß das, Dylan, ja«, gab ich grinsend zurück.
Zu Anfang war ich immer derjenige, der vorschlug »zusammen für Geschichte zu lernen«. Aber nach einer Weile ergriff er die Initiative. Wir trafen uns immer hinter verschlossenen Türen, meist in seinem Zimmer, das mit seiner einfachen, funktionalen Einrichtung und dem durchdringenden Geruch nach Sportlersalbe geradezu ein Monument trostloser Männlichkeit ist und so ganz anders wirkt als mein Reich mit seinen Lichterketten, Zierkissen und dem Lavendel-Kissenspray.
Jetzt kommt es mir so vor, als fühle er sich inzwischen ein wenig wohler in seiner eigenen Haut. Schön ist das.
Wir lösen uns aus dem Kuss. »Wir sollten ein paar Fotos machen«, sage ich.
»Für Instagram.« Dylan hält nichts von Instagram. Er lässt mich Fotos von uns posten – wenn auch nur widerwillig –, doch er will nichts damit zu tun haben. Er hat nicht einmal einen eigenen Account. Deshalb habe ich ihm auch nicht verraten, dass Bilder von ihm immer bedeutend mehr Likes bekommen als alles, was ich ohne ihn poste. Und die Kommentare sind unbeschreiblich. Aber ich will nicht, dass er sich etwas darauf einbildet, daher lasse ich ihn in seliger Unwissenheit.
Ich mache ein paar Selfies von uns, dann noch ein paar Bilder, auf denen er wie ein ziemlich heißer James Bond aussieht, und danach filme ich, wie ich mit meinem fabulösen Cape im Garten herumtobe.
Irgendwann sieht Dylan nach der Uhrzeit und schlägt vor, dass wir uns in Bewegung setzen, denn Gott weiß, was es für eine Katastrophe wäre, wenn wir so spät ankämen, dass der alkoholfreie Punsch schon aus wäre.
Aber das ist auch der Teil, auf den ich mich am meisten freue. Dylan hat ein Motorrad. Und nicht nur das: Er hat seine Prüfung bestanden und darf ganz legal einen Beifahrer mitnehmen – in anderen Worten mich. Was heißt, dass ich zum Abschlussball der elften Klasse auf einem Motorrad auf den Schulhof donnern werde, das von einem Traumtyp gelenkt wird, so wie auf dem Höhepunkt eines amerikanischen Coming-of-Age-Films von ungefähr 1985. Wenn er mich auch noch hochhebt wie in dieser Szene aus Dirty Dancing, was er mir versprechen musste, dann wird der Abend so kitschig, dass es bestimmt auch noch glitzerndes Konfetti regnen wird.
Wir gehen zur Haustür. »Müssten wir nicht streng genommen Motorradkombis aus Leder tragen?«, frage ich.
»Du weißt aber schon, dass ich ein Moped habe, oder? Kein Motorrad«, gibt Dylan zurück.
»Gibt es da wirklich einen Unterschied?«
Dann öffnet er die Tür, und ich trete hinaus und sehe das Teil.
2. Kapitel Nate
Ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Abschlussball etwas ist, auf das man sich freuen sollte, aber irgendwie habe ich dafür gesorgt, dass es nicht so ist. Was typisch für mich ist. Ich bin wirklich gut darin, alles so zu drehen, dass ich keinen Spaß habe.
Elemente des Grauensgeordnet nach Level der Grausamkeit
1.
Mein Outfit. Mein Smoking ist gemietet, weil das Geld knapp ist und wir es uns nicht leisten konnten, einen zu kaufen, den man ändern lassen kann. Daran ist niemand schuld, aber es ist klassisches Pech, dass der Verleih nichts mehr in meiner Größe hatte. Daher sehe ich jetzt aus wie ein Siebtklässler am ersten Schultag in seiner Uniform – bestehend aus einem zu großen Blazer und einer etwas zu langen Hose.
2.
Die Rede. Oh Gott, die Rede. »Jemand muss sie schließlich halten, Nate!«, hatte der Direktor fröhlich zu mir gemeint. »Und du bist der Sprecher deines Jahrgangs!« Na ja, in Wirklichkeit bin ich das nicht. Ich bin zwar zum Sprecher gewählt worden, aber nicht, weil ich beliebt wäre oder aus Respekt – sondern aus Bosheit. Der Titel hat keinerlei Vorteile, sondern nur bergeweise grauenhafte Pflichten, zum Beispiel mittags die Essensschlange zu beaufsichtigen, nach einer Versammlung die Stühle wegzuräumen oder Reden vor Leuten zu halten, die nur darauf warten, dass man einen – am besten oberpeinlichen – Fehler macht, damit sie das filmen und das Video irgendwo hochladen können.
3.
DIE GROSSE SACHE. Super, und schon bausche ich dieses Thema wieder auf, indem ich es »groß« nenne, obwohl ich dazu einfach sagen könnte: »die wirklich dumme Sache, bei der ich keine Ahnung habe, warum ich sie tue, und vielleicht lasse ich es auch bleiben«. Das Ding ist nur: Dank einem gewissen Jemand habe ich endlich das Gefühl, dass ich es tun will. So viel dazu. Ja, ich werde mich vor allen outen. Und zwar mit einer großen Geste, weil ich ein Idiot bin das (a) eine besondere Abschlussball-Überraschung für Tariq sein soll, und ich weiß, dass es ihn stolz und glücklich machen wird – und was könnte ich mir mehr wünschen? Und weil ich (b) nicht will, dass alle darüber tratschen. Ich will es ganz offen sagen, alles auf einmal, laut und deutlich, einen Neuanfang machen, neues Kapitel, der ganze Kram. Außerdem erspare ich es mir so, ungefähr hundert Mal das gleiche Gespräch zu führen; es ist genauso effektiv wie eine Anzeige im Newsletter der Schule zum Schuljahresabschluss: Nate Harrison möchte stolz verkünden, dass er offiziell schwul ist – Blumen sind nicht nötig, aber schickt etwaige Spenden auf sein PayPal-Konto, damit er seine Garderobe seinem neuen Status anpassen kann.
Genau, das werde ich natürlich nicht tun.
Aber zuerst muss ich DIE GROSSE SACHE (ich muss wirklich aufhören, es so zu nennen) bei meinen Eltern ansprechen, denn wenn nicht, hören sie es von einer dritten Partei (wahrscheinlich von Linda aus der Nachbarschaft). Dann wird Mum sich aufregen, weil ich es ihr nicht zuerst gesagt habe und glauben, unsere Mutter-Sohn-Beziehung sei am Ende und dass ich noch andere Geheimnisse hätte. Zum Beispiel, dass ich süchtig nach Meth wäre. Oder dass ich unter meiner Matratze ein Album mit meinen liebsten K-Pop-Bildern und Fan-Fictions hätte, in denen ich selbst mitspiele – inklusive einer Liste aller Jungs, die ich danach geordnet habe, wie attraktiv sie sind. Zum Beispiel.
Wie auch immer.
Ich hole tief Luft und trete ins Wohnzimmer, wo meine Eltern auf mich warten, und wo ich mir strategisch geschickt ungefähr fünf Minuten Zeit lassen kann, um alles offenzulegen, bevor ich gehen muss, weil Mr Walker gesagt hat, ich müsse einen »Soundcheck« machen, bevor alle in die Turnhalle kommen.
»Oh, Nate, gut siehst du aus!«, flötet Mum und tritt auf mich zu, um unnötig an meiner Fliege zu zupfen.
»Hey.«
»Wer ist hier ein hübscher Junge?«
Ich verziehe das Gesicht. »Du machst das schon wieder, Mum!«
»Hmm?« Sie hört nur halb zu und fährt mit den Händen über die Schultern meines Jacketts, woraufhin ich Paranoia kriege, ich könnte Schuppen haben.
»Du redest mit mir wie mit einem Hund«, fahre ich fort. »Willst du etwa, dass ich auf den Teppich pinkle?«
Sie runzelt die Stirn. »Du wirst nicht auf den Teppich machen, Nate.«
»Nein, ich weiß, aber Hunde ... Ach, egal.«
»Und?«, sagt Mum und präsentiert mich meinem Dad.
Verlegen stehe ich da und weiß nicht wirklich, was ich mit meinen Händen anfangen soll. Schließlich entscheide ich mich dafür, sie in die Hosentaschen zu stecken, wobei sich herausstellt, dass die kleiner sind und höher sitzen, als ich es gewöhnt bin – was heißt, dass meine Hände nicht richtig hineinpassen.
»Hände aus den Taschen«, sagt Mum lächelnd und mit ihrer Grundschullehrerinnen-Stimme – fest, ruhig und leicht enttäuscht. »Du willst doch nicht schlampig aussehen.«
Ich räuspere mich und nehme meine Hände heraus.
Dad wirkt beeindruckt. »Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre ...«, sagt er.
»Was wäre, wenn du dreißig Jahre jünger wärst?«, unterbreche ich ihn.
Dad sieht perplex aus.
»So etwas sagen Eltern nicht zu ihren Kindern!«, erkläre ich ihm. »Und überhaupt zu niemandem«, setze ich hinzu.
Dad zieht die Augenbrauen hoch. »Nicht? Bedeutet das nicht einfach, dass man den guten alten Zeiten nachtrauert?«
Mum schnalzt missbilligend mit der Zunge. »Nein, Mick. Es ist wirklich unangemessen.«
Ich schüttle den Kopf. »Oh Mann, okay, jetzt hört mal zu ...«
»Rose? Komm und schau deinen wunderschönen Bruder an!«, schreit Mum in Richtung Küche.
»Mum, nein ...«
Aber meine sechsjährige Schwester kommt schon angerannt; blondes Haar und engelhaftes Lächeln, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Man käme nie auf die Idee, dass sie in Wirklichkeit vom Teufel besessen ist.
»Okay, ich bin hier, danke, geh bitte zurück in die Küche«, sage ich zu ihr.
Rose mustert mich von oben bis unten und verrät nicht, ob sie mein Äußeres okay findet oder nicht. »Dreh dich mal«, befiehlt sie.
Ich knirsche mit den Zähnen, denn wenn ich ihr nicht gehorche, dauert das hier bloß länger, und ich habe wirklich keine Zeit. Also drehe ich mich auf der Stelle. »Ta-da. Bitte schön. Und nun ...« Ich zeige zur Tür.
Rose setzt sich aufs Sofa.
»Oh mein Gott«, murmle ich. »Okay, also ...«
»Zeit für ein Foto«, erklärt Mum, mustert blinzelnd ihr Handy und versucht, die Kamera einzuschalten.
»Nein, aber ...«
»Ich will eins von dir allein, eins mit Dad und eins mit Rose, und dann brauchen wir noch eins von dir vor der Haustür ...«
Von jedem großen Ereignis meines sechzehnjährigen Lebens – und auch von vielen kleineren – existiert ein Bild von mir, das mich vor der Haustür zeigt. Von jedem ersten Tag des Schuljahrs. Von jedem letzten Tag des Schuljahrs. Von meiner Aufnahme bei den Pfadfindern. Von der Premiere des Schultheaterstücks. Von Grandpa Henrys Beerdigung. Von dem Tag, an dem Mum entschieden hat, dass ich im verdammten Stimmbruch bin!
»Ich poste sie auf Facebook und maile sie an die Familie – alle wollen sie sehen!«, fährt sie fort.
»Okay, aber ...«
Es ist sinnlos. Mum treibt uns zusammen, rückt im Hintergrund Sofakissen zurecht, »damit die Familie nicht denkt, bei uns wäre es unordentlich«, und sagt zu Dad, er solle »mehr lächeln«, damit »niemand denkt, er wäre allzu deprimiert, nachdem er seinen Job verloren hat«. Als sie fertig ist, schaut sie die Bilder durch, und dann geht es wieder los mit: »Wie hängt man noch mal ein Foto an eine E-Mail an?«
Dabei wünsche ich mir doch einfach nur, das zu sagen, was ich sagen möchte, um dann schnell von hier zu verschwinden.
»Du wirkst angespannt«, sagt Mum und blickt von ihrem Handy auf. »Denk bei deiner wichtigen Rede daran, tief zu atmen, und fang nicht an zu plappern. Du weißt genau, dass du dich immer überschlägst, wenn du nervös wirst.«
Oh mein Gott.
»Und wer weiß«, fährt sie fort, »vielleicht ergibt sich aus diesem Abschlussball ja eine kleine Romanze?«
Ich reiße die Augen auf.
»Vielleicht siehst du ja von der anderen Seite der überfüllten Tanzfläche aus plötzlich jemand Besonderem in die Augen ...«
»Okay«, sage ich. »Also, hört mal, deswegen, was ist, wenn ... ihr wisst schon, ich schon jemanden habe, der etwas Besonderes ist?«
Mums Augen leuchten auf und füllen sich dann mit leichter Panik. »Benutzt ihr Kondome?«
»Mum! Wir ... Wir haben nicht ... Das ist nicht ...«
»Aber ihr würdet?«
»Ich meine ja, aber ...«
Sie atmet doch tatsächlich erleichtert auf. »Also, dann sag es uns!«
»Ja, erzähl uns alles über ihn!«, sagt Dad.
»Ja, ihn, das ist richtig, weil ich ... Moment mal, was?«
Alle sehen mich nur erwartungsvoll an. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Mindestens eine Person hätte inzwischen heulen müssen.
»Wie heißt er denn?«, fragt Mum jetzt.
»Okay, er heißt Tariq, aber können wir mal ein bisschen zurückspulen?« Ich sehe meine Eltern an, die mich bloß dümmlich angrinsen. »Okay, also ich bin ...« – ich lege eine dramatische Pause ein –, »... schwuuuul.«
»Ja«, sagt Mum mit diesem manischen, starren Grinsen im Gesicht.
»Ich mag Jungs.«
»Ich mag Jungs auch«, setzt Rose hinzu.
»Nein, also ... aber ich mag sie wirklich«, erkläre ich ihr. »Ich stehe nicht auf Mädchen, sondern auf Jungs.«
Sie sieht mich stirnrunzelnd an. »Ich bin ein Mädchen.«
»Schon, aber ...« Ich werfe Mum einen hilfesuchenden Blick zu, doch sie scheint kein Problem zu sehen. »Ich mag Mädchen, aber nicht so, Rose. Nicht auf diese Weise, okay? Macht das Sinn? Gut.«
»Nein.«
»Okay. Mum?« Ich schaue sie flehentlich an.
»Na, das hast du aber auch nicht besonders gut erklärt, Nate«, sagt sie.
Ich hole tief Luft. »Also, sagen wir, Cinderella verliebt sich in den Prinzen, aber sie ist nicht Cinderella, sondern ... Colin.« Das ist der erste Name, der mir einfällt. Ein beschissenes Beispiel ...
Rose schüttelt den Kopf. »Ich nehme dich nur auf den Arm, du Doofkopf. Jemand mag dich? Wow!« Sie marschiert aus dem Zimmer.
Dieses Mädchen.
Ich drehe mich wieder zu meinen Eltern um. »Wie kommt's, dass ihr gar nicht überrascht seid? Ich habe euch nie ein Wort davon erzählt.«
Dad runzelt die Stirn. »Doch, ich glaube schon.«
Mum nickt. »Ganz bestimmt.«
»Ganz bestimmt nicht.«
»Doch, du bist in der neunten Klasse mal mit Nagellack zur Schule gegangen.«
Ich blinzle irritiert. »Mum! Dass ich mit Nagellack zur Schule gegangen bin, war kein Coming-out!« Ich starre die beiden an. Ist das wirklich ihr Ernst? »Was habt ihr denn gedacht, was ich an diesem Abend nach der Schule vorhatte, was Nagellack verlangt hätte?«
»In eine Schwulenbar gehen?« Dad zuckt die Achseln.
»Schwulenbar? Schwulenbar?«, kiekse ich. »Das war der Ausflug der Theater-AG zur Rocky Horror Show!«
»Oh«, meint Mum matt. »Sollte man dazu nicht lange Strümpfe und Strapse tragen?«
»Hat die Schule nicht erlaubt, damit keine Klagen kommen. Ich weiß nicht, Nagellack haben sie gerade noch zugelassen. Vielleicht ein bisschen Eyeliner.« Ich sehe die beiden an und schüttle den Kopf. Seit Monaten mache ich mir Gedanken wegen dieses Moments, aber anscheinend haben sie die ganze Zeit Bescheid gewusst – oder das wenigstens geglaubt.
Dad hat sich inzwischen den Bilderrahmen mit dem Gruppenfoto der elften Klasse, das wir am letzten Schultag vor Prüfungsbeginn aufgenommen haben, vom Kaminsims geschnappt und mustert es. »Welcher ist Tariq?«
»Der neben mir.«
»Rechts von dir?«, fragt Mum.
»Tja, die einzige andere Option ist ein Mädchen namens Lucy auf meiner anderen Seite, also ratet mal.«
»Oooh, er sieht gut aus! Sieht er nicht gut aus, Mick?«, fragt Mum.
»Hmm«, gibt Dad zurück. »Gut gemacht, Nate.«
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll. Ich glaube, er will andeuten, dass er nicht meine Liga ist – und okay, das stimmt auch. Aber das so direkt zu sagen? Mein eigener Vater?
»Egal«, sage ich, »ich sollte wirklich ...«
»Oha, warte mal eine Sekunde, Nate!«, meint Dad, steht auf und greift hinter die Sofalehne. Er zieht eine Flasche hervor und dreht mit einem »Plopp« den Korken heraus.
»Ist nur Prosecco, kein Champagner«, erklärt er und schenkt Gläser ein.
»Wieso?«, frage ich.
»Na ja, weil Champagner ungefähr dreißig oder vierzig Öcken ...«
»Nein«, unterbreche ich ihn. »Warum stoßen wir mit Sekt an?«
Dad lächelt mir zu. »Das Ende einer Ära, oder? Du hast die Mittelstufenprüfung bestanden, heute ist dein Abschlussball, und du hast dein ganzes Leben vor dir ...« Er drückt mir ein Glas in die Hand. Ich darf das nicht trinken, schließlich muss ich gleich eine Rede halten, aber andererseits entspannt es mich vielleicht.
»Ich sollte auch davon ein Foto machen, um es zu mailen. Ach, vergesst es, wahrscheinlich findet Mum, dass es unverantwortlich ist, ihm in seinem Alter Alkohol anzubieten.« Sie sieht meinen Dad an. »Sie glaubt sowieso schon, dass du ein Alkoholproblem hast.«
Dad verzieht fragend das Gesicht.
»Na ja«, meint Mum. »Du hast letzte Weihnachten vor ihr wirklich viel Bier getrunken.«
»Das würde jeder, der drei Tage mit ihr verbringen muss.«
»Mick«, sagt Mum warnend.
Dad lächelt, reicht Mum ein Glas und schenkt sich auch eines ein. »Das Leben ist hart, also genieß es, solange du kannst«, erklärt Dad und prostet uns zu.
Tja, das ist mal ein erbaulicher Spruch. Aber ich nehme es ihm nicht übel. Dad ist vor drei Monaten in der Joghurtfabrik entlassen worden, und dann ist sein bester Freund mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Bisher hatte er ein ziemlich beschissenes Jahr.
»Toll!«, sage ich. »Hurra.«
Mum kichert nur leise und sieht aus, als wäre sie in ihrer eigenen Welt. »Unrecht hat er jedenfalls nicht! Als ich jünger war, dachte ich, ich könnte im Leben alles haben – heutzutage würden mir schon Vorhänge mit Verdunklungsbeschichtung reichen, um glücklich zu sein.«
Ungefähr dreißig Sekunden lang, die sich wie dreißig Minuten anfühlen, nippen wir an unseren Sektgläsern, während ich darauf warte, dass Mum und Dad sich noch mehr Depri-Sprüche einfallen lassen.
»Die Schule ist doch die beste Zeit des Lebens«, sagt Dad.
Yay, auf geht's!
»Ab zwanzig zieht einen das Leben nur noch runter.« (Mum)
»Geldverdienen, Rechnungen bezahlen, Stress, Stress.« (Dad)
»Jo Carters Mann war so gestresst, dass er einen Schlaganfall gekriegt hat!«
»... wie Hamster im Laufrad, bloß um die Steuern zu bezahlen ...«
»Er ist jetzt linksseitig gelähmt ...«
Ich puste die Wangen auf. »JEDENFALLS, ein Hoch auf das Leben!«, rufe ich dazwischen. »Ich kann es kaum abwarten, mich auf all das zu freuen.«
»Na ja, manches ist auch schön«, murmelt Mum vollkommen unüberzeugend.
Wieder verlegenes Schweigen. »Ich muss wirklich los«, erkläre ich, kippe den Rest meines Glases hinunter und stelle es auf den Couchtisch.
»Einen wunderbaren Abend, Nate«, sagt Dad. »Mach jede Menge Fotos!«
»Und komm bei deiner Rede nicht ins Plappern!«, bläut Mum mir noch einmal ein.
»Mum«, gebe ich zurück, »ich habe schon mal auf der Bühne gestanden, das wird schon. Wisst ihr noch, wie ich den Blechmann in Der Zauberer von Oz gespielt habe?«
Beide sehen mich mit einer Miene an, die Besorgnis und leises Entsetzen ausdrückt.
»Oh mein Gott, bis später dann.«
3. Kapitel Jack
Das läuft nicht ganz so, wie ich gehofft habe.
Ich hatte mir ausgemalt, wie wir auf dieser mächtigen, wummernden Maschine auf den Schulhof röhren und schlitternd zum Halten kommen würden. Dann wäre Dylan in seiner schwarzen Lederjacke abgestiegen und hätte mir vom Motorrad geholfen. Zum krönenden Abschluss hätte ich meinen Helm abgenommen und mein Haar ausgeschüttelt – in Zeitlupe und mit schmeichelndem Weichzeichner, versteht sich.
Das erste Problem ist jedoch, dass ich kein langes Haar zum Ausschütteln habe. Es ist kurz. Und eine meiner Sorgen ist, dass der Helm mir womöglich das ganze Haarzeugs ruiniert, das ich mindestens zwanzig Minuten lang sorgfältig aufgetragen habe.
Das andere Problem ist, dass Dylan keine Lederjacke hat, sondern einen Anorak. Seine Mum hat ihn gezwungen, ihn mitzunehmen, »falls es regnet«. Ich bin jetzt kein stumpfsinniger, von meinem Image besessener Schwachkopf, aber bei dem Anorak musste ich eine Grenze ziehen und habe ihn überredet, ihn bei mir zu lassen – es ist ein schöner Sommerabend ohne eine Wolke am Himmel. Es wird nicht regnen.
Wie Dylan mir geradezu lächerlich stolz erklärt, hat das Moped eine Höchstgeschwindigkeit von – unglaublich, aber wahr – fünfundvierzig Stundenkilometern. Aber wenn man erst darauf sitzt und losfährt, fühlt es sich schneller an. Der Wind weht mir ins Gesicht, und es ist wirklich ziemlich laut und beeindruckend. Mein Regenbogencape bläht sich hinter mir, und in diesem Moment bin ich einfach nur stolz darauf, nicht in einer dieser gemieteten Limousinen zu sitzen oder in dem Doppeldecker-Partybus, weil ich endlich glücklich damit bin, mein eigenes Ding zu machen – obwohl mir das in der neunten Klasse aufgezwungen wurde. Damals ging es ums Überleben, wenn ich den Flur entlanglief und sich offenbar fast alle in meinem Jahrgang abgesprochen hatten, halblaut »schwul« zu murmeln, wenn ich vorbeikam. Irgendwann hat es mir gereicht, und ich habe reagiert, indem ich mir mein Queersein erst recht auf die Fahnen geschrieben habe. »Bin ich!«, »Ohne Scheiß?« oder »Ich bin hier, und ich bin queer, Baby!«, trällerte ich dann und machte hocherhobenen Kopfes eine Show daraus. Die Inspiration dafür holte ich mir bei den lauten, stolzen Queens aus RuPaul's Drag Race, doch innerlich wäre ich am liebsten gestorben. Aber inzwischen will ich absolut diese Person sein, denn warum sollte ich es verstecken? Leckt mich, jeder Einzelne von euch, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben. Und heute Abend werden Dylan und ich zum Königspaar des Balls gekrönt, und DER SIEG WIRD UNSER SEIN!
Die Bilder werden auf Instagram wie ein Blitz einschlagen – ich bin ehrlich überzeugt, dass das unser bisher beliebtester Upload werden wird. Ich kann es kaum erwarten, dass alle Marken Kontakt für Kooperationsangebote aufnehmen.
Außerdem habe ich noch eine kleine Überraschung für Dylan, die wirklich das Sahnehäubchen auf diesem wunderbar schwulen Kuchen sein wird!
4. Kapitel Nate
Vor dem Haupteingang versammeln sich Menschen auf dem Hof, um beim Hineingehen Gruppenfotos zu machen. Deswegen warten alle, um sicherzugehen, dass sämtliche ihrer Freunde da sind. Ich stehe mit Tariq, Alfie, Connie und Luke zusammen – man könnte uns auch »die Kids, die fünf Jahre Mittelstufe überlebt haben, indem sie jede Mittagspause in der Bibliothek verbracht haben« nennen. Während des Mittagessens ist die Bücherei der einzige Ort, der garantiert von Erwachsenen beaufsichtigt wird – der Rest der Schule ist mehr oder weniger Kriegsgebiet.
In der Bibliothek habe ich auch zum ersten Mal mit Tariq gesprochen. Im zweiten Halbjahr der zehnten Klasse hatte Mrs Davidson diesen großen Tisch mit einer riesigen Regenbogenflagge, jeder Menge bunter Wimpelketten, einem Schild mit Read with Pride und all diesen Büchern über LGBTQIA+-Themen dekoriert. Ich ging drei- oder viermal betont beiläufig vorbei und tat so, als wäre ich unterwegs zu etwas ganz anderem, das rein gar nichts mit dem Büchertisch zu tun hatte. Ich hätte mir gewünscht, ein paar davon in die Hand zu nehmen, aber ich traute mich nicht. Dann probierte ich es mit der Masche, meinen Stift fallen zu lassen, obwohl ich ihn buchstäblich werfen musste, damit er zu dem Tisch rollte. Anschließend gab ich ziemlich überzeugend vor, nach ihm zu suchen. »Du meine Güte, wo könnte mein Stift geblieben sein?«, seufzte ich, während ich mich näher an die Bücher heranschob und versuchte, mir die Titel einzuprägen, damit ich sie später online nachschlagen konnte.
»Das hier ist wirklich gut«, sagte da plötzlich jemand.
Ich blickte auf, und da stand Tariq und zeigte auf ein Buch mit einer großen Banane auf dem Einband.
Meine Wangen liefen rot an. »Oh, kann schon sein, aber ich bin nicht ...«
»Man braucht nicht schwul zu sein, um ein Buch mit queeren Charakteren zu lesen«, erklärte er. Dann lächelte er und ging davon, und ich huschte schwitzend, verlegen und beschämt zurück zu meinem Platz.
Ich wagte nicht mehr, diesem Büchertisch auch nur einen Blick zuzuwerfen.
Am nächsten Tag nach der Schule fand ich ein eingewickeltes Päckchen in meiner Tasche – braunes Papier, Schnur und keine Nachricht oder so etwas. Ich packte es aus, und darin war das Bananenbuch, zusammen mit einer kleinen Karte.
Hab's auf mein Konto ausgeliehen,
also bring es bitte zurück!
Tariq
Damit sammelte Tariq so einige Punkte bei mir.
Punkte fürs aufmerksam sein.
Punkte dafür, mich besser zu kennen als ich mich selbst.
Punkte für den Gedanken an eventuelle Verspätungsgebühren.
Ich glaube, ich habe mich auf der Stelle ein wenig in ihn verliebt.
Danach tauchte ungefähr alle paar Wochen wie durch Zauberei ein neues Buch in meiner Tasche auf. Keine Ahnung, wie er sie hineinschmuggelte – ich habe ihn kein einziges Mal dabei erwischt –, aber wir machten Fortschritte. Statt peinlich berührt kaum zu würdigen, was er getan hatte, führten wir kurze, einsilbige Gespräche.
»Hat's dir gefallen?«
»Jepp.«
Und dann längere Unterhaltungen in ruhigen Ecken, bei denen ich zugab, wie toll ich die zwei Jungs in dem Buch, das er mir gerade gegeben hatte, fand. »Nicht wahr!«, sagte Tariq dann. »Süüüß!« Und ich musste lächeln und wurde wieder rot. »Ja, süß.«
Eines Nachmittags saß ich im Unterricht neben ihm, und die Jalousien waren geschlossen, weil wir gerade ein Video über Küstenlandschaften ansahen. Da bewegte Tariq sein linkes Bein so, dass es gegen mein rechtes drückte. Und so ließen wir unsere Beine die ganze Stunde lang. Ich glaube, das war so ziemlich das Aufregendste und Erotischste, was ich je erlebt habe. Ich konnte mich nicht auf das Video konzentrieren und hörte nur seinen rhythmischen Atem. Spürte die Wärme seines Beins an meinem und das Prickeln dieser Berührung im ganzen Körper.
In der Schule war ich vorsichtig. Ich achtete darauf, nicht zu oft mit Tariq gesehen zu werden. Ich passte auf, ihn nicht zu häufig anzuschauen. Schließlich hatte ich schon erlebt, was passiert, wenn die Leute zu dem Schluss kommen, dass du nicht wie sie bist, und das hätte ich nicht ertragen.
Ein paar Wochen später steckte das Schicksal uns bei einem Englischprojekt zusammen, sodass es einen Grund gab, warum Tariq nach der Schule mit zu mir nach Hause kommen musste.
»Sind deine Eltern bei der Arbeit?«, fragte er.
»Ja. MÖCHTEST DU LIMO?«, brüllte ich völlig zusammenhangslos zurück und versagte somit komplett dabei, cool zu spielen.
Er nickte. Ich kippte Wasser und Sirup zusammen. Wir tranken. Dann stellten wir gleichzeitig die Gläser ab und kamen uns dabei echt nahe.
»Sorry!«, sagten wir beide.
Und das war es, bis er zwei Tage später wieder wegen desselben Projekts vorbeikommen musste.
»Sind deine Eltern da?«, fragte er.
»Nein. WILLST DU EINEN COOKIE?«, antwortete ich.
Er nickte. Wir aßen Cookies. Dann standen wir gleichzeitig auf, um nach oben und an die Arbeit zu gehen, und blieben prompt zusammen in der Küchentür stecken.
»Sorry!«, sagten wir beide und liefen rot an.
Zwei Tage später tauchte Tariq wieder bei mir zu Hause auf.
»Aber unser Projekt ist doch abgeschlossen, und meine Eltern sind da!«, begrüßte ich ihn verdutzt an der Haustür.
»Sorry«, murmelte er und wandte sich sofort zum Gehen.
»Warte!«, rief ich, und Tariq drehte sich wieder um.
Ich starrte ihn nur an, und als mir das bewusst wurde, sagte ich schnell: »Wir sehen uns in der Schule.«
Er lächelte leicht. »Bis dann in der Schule.«
Versteht ihr, ich mag Tariq, weil er genauso tollpatschig ist wie ich. Aber das Problem mit zwei unbeholfenen Jungs ist, dass der Weg bis zu dem Punkt, an dem wirklich etwas passiert, voller ... na ja, Unbeholfenheit ist.
Und so kam es erst am Anfang des elften Schuljahrs bei einer Klassenfahrt, auf der das Schicksal wollte, dass ich ein Hostel-Zimmer mit Tariq teilte, dazu, dass er mich zum ersten Mal küsste.
»Oh Gott, sorry«, sagte er gleich danach.
»Ist schon gut«, erwiderte ich. »Aber ich glaube nicht, dass ich schwul bin. Sorry.«
»Oh Gott, sorry. Es tut mir so leid.«
Ich nickte. Dann küsste ich ihn einfach noch einmal. Wir küssten uns die ganze Nacht, und am nächsten Morgen beim Frühstück hätte ich es am liebsten herausgeschrien. Seht her! Ich bin super selbstbewusst und stolz, denn ich, Nate Harrison, habe jetzt offiziell einen anderen Menschen geküsst, und ich bin begehrenswert und werde begehrt. Ich bin ein Traumtyp! Aber das alles spielte sich offensichtlich nur in meinem Kopf ab, denn ich wollte auf keinen Fall, dass jemand in der Schule erfuhr, was wir getan hatten. Und auf keinen Fall wollte ich, dass jemand auf die Idee kam, ich könnte schwul sein, weil ich mir das nicht einmal selbst eingestehen konnte. Dabei hatte ich gerade die ganze Nacht mit einem anderen Kerl geknutscht.
Ich war einfach noch nicht bereit – und finde das auch total okay. So etwas braucht eben Zeit. Tariq war geduldig – er hat sich tatsächlich kurz nach Dylan Hooper, dem Kapitän der Fußballmannschaft, geoutet, aber meinte, es wäre schon in Ordnung, wenn ich noch nicht so weit wäre. Trotzdem ist mir seine enttäuschte Miene nicht entgangen, als er mich vor ein paar Wochen gefragt hat, ob wir als Paar zum Abschlussball gehen wollen. »Wahrscheinlich nicht«, habe ich gesagt, denn damals fühlte es sich noch nicht richtig an. Außerdem steckte ich mitten in den Mittelstufenprüfungen und hatte keinen Kopf dafür. Aber ich habe viel nachgedacht – und nun fühlt es sich richtig an; wie etwas, das ich tun will, und ich finde, ich bin es Tariq schuldig, das in großem Stil zu tun. Er soll wissen, dass ich stolz bin. Auf ihn. Auf mich. Auf uns.
Mir fällt auf, wie Luke sich verkrampft, als eine weiße Limousine auf den Hof gleitet. Heraus springen die Jungs, die im Laufe der Jahre hinter dem Löwenanteil der Mobbingattacken gesteckt haben: Jordan, Mason, Brandon und Tyler. In ihren eng anliegenden Anzügen und den Slippern ohne Socken sehen sie aus wie Reality-TV-Stars, und ich komme mir mit meiner zu großen Smokingjacke und Fliege wie ein Idiot vor.
Die Jungs helfen vier Mädchen aus dem Wagen, die allesamt enorm teuer aussehende Ballkleider tragen. Chloe, Megan, Jas und Amanda – die Clique, die meine Tanzkünste bei der Disco-Party in der siebten Klasse so gnadenlos auseinandergenommen hat, dass ich seitdem nie wieder getanzt habe. Bemerkenswert, dass Luke und ich uns beide so genau daran erinnern, was diese Menschen uns angetan haben, während sie nicht einmal Notiz von uns nehmen. Sie lachen ausgelassen, umarmen einander und nennen sich gegenseitig »Babe«. Es ist, als existierten wir gar nicht.
Alle posieren in unterschiedlichen Kombinationen vor der Limousine. Für solche Leute scheint das Leben immer einfach zu sein.
Glücklicherweise ertönt, bevor ich noch in einen Strudel der Verzweiflung gerate, ein leises Summen, das mich aus meinen Gedanken reißt. Es klingt wie dieses hohe Sirren, das man hört, wenn eine Fliege in einem Spinnennetz gefangen ist. Während ich mich noch frage, was das sein könnte, fährt langsam Jack Parker, der hinter Dylan Hooper auf dessen Roller sitzt, vor. Ehrlich gesagt hätten sie ebenso gut auf einer Nähmaschine mit Rädern auftauchen können. Gleichzeitig mit Jacks Eintreffen dreht Theo Appleby, der Schriftführer des LGBTQIA+-Clubs, auf einem tragbaren Lautsprechersystem diesen St. Elmo's Fire-Song auf.
Uuuum-werfend.
Ich muss grinsen. Jack und ich sind in den letzten Jahren zwar getrennte Wege gegangen, aber was ich immer an ihm bewundert habe (natürlich würde ich ihm das nie sagen ... und es ist ja nicht so, dass Jack überhaupt mit mir reden würde ...) ist sein trockener Humor. Er schafft es, alles so oft zu verdrehen, bis man gar nicht mehr weiß, wo die Wahrheit aufhört und der Sarkasmus anfängt. Niemand schenkt den Leuten mit der Limousine noch einen Blick, was sie wirklich ärgern muss, nachdem sie so viel Geld ausgegeben haben, um sie auszuleihen. Und so, wie ich Jack kenne, war es wahrscheinlich kein Zufall, dass er nur Sekunden nach ihnen angekommen ist und ihnen jetzt die Show stiehlt.
Der Roller kommt sanft zum Halten, und Jack steigt ab. Ein paar Elftklässler, die herumstehen und auf den Einlass warten, applaudieren und jubeln tatsächlich. Jack saugt den Beifall auf wie ein Schwamm, dreht sich mit seinem Regenbogencape im Kreis und verbeugt sich dann theatralisch. Mir ist sehr bewusst, dass Jack es in den letzten paar Jahren auch nicht leicht hatte. Woher nimmt er bloß dieses Selbstbewusstsein? Es ist, als wäre bei ihm irgendwann ein Schalter umgelegt worden, und ab diesem Moment sagte seine Ausstrahlung: So bin ich nun einmal, und mir ist egal, was ihr davon haltet. Und weil es ihm gleichgültig war, machten sich auch die Mobber irgendwann weniger aus ihm. Die Sache bei Jack ist, dass er wirklich gut aussieht. Er ist ungefähr eins achtzig – also groß, aber nicht zu groß. Er hat eine gute Figur – definiert, aber nicht zu muskulös. Seine Haare liegen immer perfekt (wuschelig, blond), und seine Haut ist total rein und strahlend. Und als wäre das noch nicht genug, ist er auch noch klug – also wirklich super klug, aber trotzdem kein Nerd. Er ist witzig, er ist intelligent, er ist einfach eine schillernde Persönlichkeit – und er fühlt sich wohl mit sich selbst.
Im Grunde ist er ein A-Promi unter den Schwulen. Glück für ihn, denn ich habe das Gefühl, das hilft. Ich hatte noch nicht einmal mein Coming-out und weiß jetzt schon, dass ich dazu bestimmt bin, der allerchaotischste Desaster-Schwule zu werden, den die Welt je gesehen hat. Das hat diverse Gründe: 1.) meine erstaunliche Gabe, mich in jeder sozialen Situation peinlich anzustellen, 2.) mein fehlendes Gespür für Mode, 3.) eine himmelschreiende Wissenslücke über a) die schwule »Szene« und b) über Sex, 4.) eine leichte Angststörung und Paranoia. Wahrscheinlich wird das auf meinem Grabstein eingemeißelt stehen, den alle nur zu bald sehen werden, weil ich heute Abend bei meiner Rede auf der Bühne sterben werde, im metaphorischen und wörtlichen Sinn:
Nate Harrison
2004 – 2020
Schwules Desaster
Wieso denke ich an den Tod? Warum kann ich nicht einfach glücklich sein?
Jack fängt meinen Blick auf und nickt mir zu.
Ich nicke zurück und schaue dann schnell weg. Ein Teil von mir wünscht sich, wir könnten wieder zwölf sein und in meinem Zimmer herumalbern, bevor alles sonderbar wurde und wir nie wieder miteinander geredet haben. Ich frage mich, was er heute Abend denken wird, wenn ich mich oute.
Ich sehe zu, wie Jack Dylan einen Kuss gibt, dann gehen die beiden Hand in Hand zum Eingang. Kurz werfe ich Tariq einen Blick zu, und er lächelt leicht. Ich weiß, Tariq wäre begeistert, wenn wir uns vor allen küssen und an den Händen halten würden. Und das werden wir auch – früher, als er glaubt.
Dieser Gedanke macht mich plötzlich sehr, sehr glücklich.
5. Kapitel Jack
Ich will ja nicht gemein klingen, aber große Erwartungen hatte ich ehrlich gesagt nicht. Seien wir doch mal ehrlich: Das hier ist eine britische Schule. Verglichen damit, wie so etwas in den USA abläuft – wenn man davon ausgeht, dass Filme und Serien das korrekt darstellen –, wird unser Abschlussball das Äquivalent zu amerikanischem Käse sein: eine Abscheulichkeit. Jedes Land hat eben so seine Spezialitäten.
Als ich die Turnhalle betrete, staune ich allerdings nicht schlecht. Hut ab vor Maddie Maddison (ja, ihre Eltern haben sie wirklich so genannt) und ihrem Abschlussball-Komitee, denn die Dekoration sieht wirklich fantastisch aus.
Nachdem das Komitee die Schulleitung davon überzeugt hatte, dass Netflix wahrscheinlich keine Klage wegen Verletzung des Urheberrechts anstrengen würde, wurde das Thema bekanntgegeben: Stranger Things. Die ganze Halle ist als Schattenwelt dekoriert; die Decken und Wände sind mit weißem und grauem Stoff verhängt, Trockeneiswolken wälzen sich über den Boden, überall tanzen die glitzernden Lichtpunkte einer Discokugel umher, und alles ist von diesen Spinnennetzen aus der Sprühdose überzogen. Der DJ spielt Songs aus den Achtzigern, und Miss Munroe und Mr Walker, unsere Stufenleiter, tragen Scoops-Ahoy-Kostüme und teilen Eis aus. Aber die Hauptattraktion ist dieser riesige, ungefähr sechs Meter hohe Demogorgon, für dessen Bau das Komitee Monate gebraucht haben muss. Er ist beeindruckend, aber ein wenig wacklig und mit ziemlicher Sicherheit ein Brandrisiko. Aber hey, hier sind ja bloß hundertfünfzig Fünfzehn- und Sechzehnjährige in einem geschlossenen Raum, von denen die Hälfte vom heimlich reingeschmuggelten Alkohol schon ziemlich betrunken ist. Was soll da schon schiefgehen?
Ich ziehe Dylan in den Fotobereich, wo ein cooles rotes Neonschild in der Stranger Things-Schrift Class of 2020 verkündet. Wir legen die Arme umeinander und posieren für ein paar »offizielle« Bilder, und dann schießen wir noch einige mit offenen Mündern, auf denen wir wie wild gewordene Vollidioten aussehen, ein paar, auf denen ich ihn küsse, und dann versuche ich mich scherzhaft an ihn zu schmiegen. Er hat genug und schiebt mich weg, und der Fotograf sagt, das letzte Bild werde er löschen.
Kids in America von der Ikone Kim Wilde wird gespielt. »Lass uns tanzen!«, rufe ich Dylan zu.
»Holen wir uns was zu trinken«, gibt er zurück.
»Und dann tanzen wir?«
»Wir sollten uns auch was zu essen besorgen.«
»Und dann tanzen?«
»Vielleicht«, sagt er.
Er macht sich in Richtung Punsch davon. Heute ist er noch viel launischer als sonst. Dylan ist immer ziemlich unnahbar und mürrisch – klar, das war einer der Hauptgründe, warum ich ihn attraktiv fand –, aber heute Abend übertreibt er es. Ich wette, das liegt an dem schwulen Cape. Er ist immer noch sauer auf mich. Chloe Kendall wittert zweifellos eine Gelegenheit, Salz in die Wunde zu streuen, denn sie taucht plötzlich mit ihrem schwachsinnigen Freund Brandon neben mir auf. Die letzten Jahre, jedenfalls bis ich mit Dylan zusammenkam, hat er zu denen gehört, die mich gemobbt haben. Sein eng geschnittener Anzug sieht mehrere Größen zu klein aus und kann seine lächerlichen Muskeln kaum in Schach halten, sodass er alles in allem an das Michelin-Männchen erinnert. Sie trägt eine regelrechte Ballrobe, und das hellblonde Haar fällt ihr über die Schultern wie bei einer dieser Disney-Prinzessinnen, die niemand mehr sehen kann. »Dir ist klar, dass er dich betrügen wird, oder?«, fragt sie und wirft Dylan, der am Punschtisch steht, einen Blick zu. »Die Heißen machen das immer.«
Brandon lacht und runzelt dann die Stirn. »Nicht immer, Babe«, meint er. Ich mustere ihn von oben bis unten. Erstaunlich, wie unterschiedlich Sechzehnjährige aussehen können. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er ein bisschen nachgeholfen hat. Ich meine, ich will nicht behaupten, dass er was einnimmt, aber ich habe ihn einmal nach dem Sport unter der Dusche gesehen, und seine Eier sind so klein wie Erdnuss-M&Ms.
Jedenfalls habe ich nicht vor, auf Chloes Provokation einzugehen. »Wann wird eigentlich verkündet, wer Ballkönigin und Ballkönig wird?«
»In ungefähr zwanzig Minuten, wenn alle drin sind. Wieso?«, fragt sie und verschränkt die Arme. »Glaubst du, du hast eine Chance?«
»Und du?«, frage ich, obwohl sie mich gar nicht mehr ansieht.
Nachdem Chloe einem anderen der beliebten Kids auf der gegenüberliegenden Seite der Halle lange genug zugewinkt hat, schenkt sie mir und meiner unbeantworteten Frage erneut ihre Aufmerksamkeit. »Du könntest tatsächlich gewinnen, Jack« – sie wirft einen Blick auf mein Cape –, »falls du die LGBT-Sympathiestimmen abräumst.«
»Was zur Hölle soll das sein?«
»Du weißt schon, Sympathiepunkte sammeln, indem man für LGBT stimmt.« Sie wirft mir ein kaltes Lächeln zu.
»Chloe, zuerst einmal heißt es allerwenigstens ›LGBTQ+‹. Zweitens, wenn du LGBT als Adjektiv benutzt, braucht es ein nachgestelltes Nomen, zum Beispiel LGBTQ+-Person; drittens verwendet man die Pluralform, heißt es also LGBTQ+-Personen; und viertens, verzieh dich.« Ich schlage mit meinem Regenbogen-Cape nach ihr, und sie tritt einen Schritt zurück.
»Gott, seid ihr empfindlich. Heutzutage ist es richtig hart, normal zu sein«, erklärt Chloe vollkommen ernst.
Ich verschränke die Arme, lege den Kopf schief und mache mich bereit, mir den Schwachsinn anzuhören.
»Ja, wirklich hart«, wiederholt Brandon.
»Ganz bestimmt, Schnuckelchen. Versuch einfach, an irgendeinen alten Politiker zu denken, oder an Mathe«, schlage ich vor und zwinkere ihm zu.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















