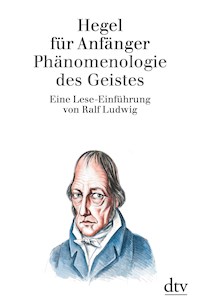
Hegel für Anfänger E-Book
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durch das Labyrinth des Hegelschen Geistes Friedrich Hegel (1770-1831) gilt als der deutsche Philosoph, dessen Werk am stärksten die Weltgeschichte beeinflusste. Er vollendete den Deutschen Idealismus und entwarf das umfassendste und einheitlichste System der deutschen Philosophie. Sein prominentester Schüler war Karl Marx. Doch die berühmte »Phänomenologie« bleibt mitunter selbst Fachgelehrten dunkel. Dieses Buch bietet sich als Wegbegleiter an und führt Schritt für Schritt durch das Labyrinth des Hegelschen Geistes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Hegel für Anfänger
Phänomenologie des Geistes
Eine Lese-Einführung von Ralf Ludwig
Deutscher Taschenbuch Verlag
OriginalausgabeDeutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München© 2008 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40168-5 (epub) ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-30125-1
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Das Buch – Schwierigkeiten, Anliegen und Entstehung
Hegels gedankliche Voraussetzungen oder Der Idealismus
Der letzte Philosoph oder Der Lebensweg eines großen Schwaben
Der Motor der Wirklichkeit oder Die Dialektik
Teil 1: Bewußtsein
Ärmster Reichtum oder Die sinnliche Gewißheit
Das Spiel der Abstraktionen oder Die Wahrnehmung
Der Blick hinter den Vorhang oder Kraft und Verstand
Wo die Wahrheit wohnt oder Das Selbstbewußtsein
Ein Maskenspiel als Meisterstück oder Herrschaft und Knechtschaft
Die Kontrahenten
Die Anerkennung
Der Kampf auf Leben und Tod
Vae victis oder Wehe den Siegern?
Herr und Knecht
Die Umkehrung: Knecht und Herr
Todesfurcht und Arbeit
Düstere Aussichten oder Das unglückliche Bewußtsein
Happy End für das Selbstbewußtsein oder Die Vernunft
Teil 2: Vernunft
Der große Anspruch oder Gewißheit und Wahrheit der Vernunft
Aufbruch zu einer neuen Expedition oder Die beobachtende Vernunft
Der Schritt in die Sittlichkeit oder Die Verwirklichung des Selbstbewußtseins
Voreilige Freude oder Die reelle Individualität
Teil 3: Geist
Der Schritt in die Geschichte oder Der Geist
Die Entfremdung vor dem Ende oder Die Aufklärung
Vorletzte Station oder Moralität und Gewissen
Der Geist vor der Vollendung oder Die Religion
Der Vorhang fällt oder Das absolute Wissen
Schluß
Im Labyrinth der Wirkungsgeschichte oder Von Hegel zu Marx
Kleine Wortkunde
Hausapotheke für Angeschlagene oder Der absolute Stiefel
Literatur-Verzeichnis oder Eine Art Danksagung
Gewidmet meinen früheren Schülern
Vorwort
»Wer Hegel verstehen will, ist noch immer mit sich allein.« Dieser Satz von Dieter Henrich macht traurig, aber er stimmt, denn die Phänomenologie des Geistes zieht wirklich entlegen ihre Straße. Dabei muß es aber nicht bleiben. Und wenn einem beim ersten Blick in dieses Werk Hören und Sehen vergeht, so können wir uns mit Ernst Bloch trösten: »Dunkles, das exakt als solches ausgedrückt wird, ist ein ganz Anderes wie Klares, das dunkel ausgedrückt ist; das Erste ist wie Greco oder Gewitterlicht, das Zweite ist Stümperei.«
Dennoch muß ich gestehen, daß ich mich beim Lesen von Hegels schwerer, dunkler Sprache oft nach der schweren, aber klaren Sprache Kants zurückgesehnt habe. Um dieses Buch schreiben zu können, begann ich, viele Bücher über Hegel zu lesen, und ich habe dabei nicht selten über die unterschiedlichsten Gedanken gestaunt, obwohl die Ausleger das gleiche Kapitel der Phänomenologie behandelten. Staunen kann man auch über den eitlen Stolz, der das Herz manches nicht ganz so bekannten Mannes wie Hegel erfüllt, wenn er glaubt, dem großen Denker einen Fehler nachweisen zu können. Ob dies dann wirklich erfolgreich war, ist eine andere Frage. Wie dem auch sei: Sich mit Hegel auseinandersetzen zu können, ist eine feine Sache. Aber dazu muß man ihn erst einmal verstehen. Das ist der Zweck unseres Buches.
Gründe, Hegel zu lesen, gibt es viele. Einige meinen, er sei der Stammvater der Marxisten. Andere, er sei der Wegbereiter für die verhängnsivolle Verherrlichung des Staates gewesen. Aber auch dazu muß man Hegel verstanden haben, um so etwas behaupten zu können.
Hegel für Anfänger – das heißt ehrlicherweise nicht, daß nach der Lektüre jeder auf Anhieb Hegel verstanden hat. Der Autor will daher dem geschätzten Leser die Worte von E.Fink ans Herz legen: »Es gehört eine große Geduld dazu, Hegels Gedankenspur zu folgen. Es war aber eine weitaus größere Leidenschaft, vielleicht die größte Denkleidenschaft der menschlichen Geschichte, die diese Spur aufriß.«
An dieser Denkleidenschaft ein klein wenig Anteil zu haben oder zu naschen, dazu sei der Leser eingeladen.
München, im Frühjahr 1997
Ralf Ludwig
Titelblatt von ›System der Wissenschaft‹
Das Buch
Schwierigkeiten, Anliegen und Entstehung
Der aus Rußland stammende französische Philosoph Alexandre Kojève (1902-68) war der festen Überzeugung, daß in Jena, der Stadt, in der die Phänomenologie des Geistes abgefaßt wurde, das Ende der Geschichte begonnen habe. Mit dem Ende der Geschichte war für Kojève auch die menschliche Rede zu Ende. So soll er, einigermaßen glaubhaft überliefert, nach einer Vorlesung auf Hegels Phänomenologie gedeutet und seinen Studenten beteuert haben, hier stünde alles drinnen, mehr gäbe es nicht zu sagen. Daraufhin zog er sich von seiner Vorlesungstätigkeit zurück und schwieg.
Die Schwierigkeiten
Eine ganz andere Erfahrung mit Hegel machte 130Jahre früher der Baron Boris d'Uxkull aus Estland, ein Garderittmeister im Dienste Rußlands. Dieser kam 1817 nach Heidelberg, um von dem berühmten Hegel eine etwas »tiefere Erfrischung seines Geistes« zu erhoffen, wie uns der Hegel-Biograph Karl Rosenkranz berichtet. Der bildungshungrige Baron ging zum nächsten Buchhändler und kaufte sich Hegels bislang veröffentlichte Schriften. Am Abend setzte er sich bequem in eine Sofaecke, schlug das erste Buch auf und wollte es »durchlesen«. Ob es wirklich diese Stelle war oder eine andere, ist uninteressant. Auf jeden Fall las er Sätze von diesem Kaliber:
Die lebendige Substanz ist ferner das Sein, welches in Wahrheit Subjekt oder, was dasselbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des Sichselbstsetzens oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst ist. Sie ist als Subjekt die reine einfache Negativität, eben dadurch die Entzweiung des Einfachen; oder die entgegengesetzte Verdopplung…
Seufzend gab er zu: »Allein je mehr ich las, und je aufmerksamer ich beim Lesen zu werden mich bemühete, je weniger verstand ich das Gelesene, so daß ich, nachdem ich mich ein paar Stunden mit einem Satze abgequält hatte, ohne etwas davon verstehen zu können, das Buch verstimmt weglegte…« Der unglückliche Boris d'Uxkull, der in seiner Ehrlichkeit zugab, auch seine Heft-Nachschriften mit den Hegel-Vorlesungen nicht verstanden zu haben, bekommt vom Meister ein paar Hilfestellungen und darf ihn später auf einigen Spaziergängen begleiten.
Da der Leser nicht mehr das Glück hat, von Hegel begleitet zu werden, wird diese Aufgabe unser ›Hegel für Anfänger‹ übernehmen. Unser Ausflug wird sicher nicht so gefährlich werden wie die Irrfahrt des Odysseus (D.Fr. Strauß), aber es kann uns in der Tat ebenso ergehen wie dem armen Baron d'Uxkull. Wenn schon ein Hegel-Kenner wie H.Althaus warnt, daß der Versuch einer Interpretation uns sehr bald auflaufen läßt wie ein Schiff auf felsiger Klippe, sollte uns das zwar nicht abschrecken, aber doch nachdenklich stimmen. Das Wagnis Geist einzugehen, ist ein schön klingender Satz, der einem recht schnell verleidet wird.
Nehmen wir »Vorrede« und »Einleitung«. Normalerweise helfen Einleitungen, ein Buch zu verstehen. Hegels Einleitungen in die Phänomenologie sind indes so komprimiert, daß bereits sie abschreckend sind. So grotesk es klingt, aber es ist einfacher, erst das Ganze zu lesen, um die beiden Einleitungen verstehen zu können.
Mancher Dozent preist sich glücklich, in einem Semester die »Vorrede« abhandeln zu können. Meist bleiben die Seminare darin stecken oder begnügen sich mit der kürzeren Einleitung. Was aber ist mit den 500Seiten, die darauf erst folgen?
So zieht die Phänomenologie entlegen ihre Straße (Bloch), und es wird auf der Wanderung oft dunkel werden.
Deshalb begleiten wir den Leser und begeben uns mit ihm auf die entlegene Straße.
Das Anliegen
Phänomenologie des Geistes, so ist zu lesen, ist die »Darstellung des erscheinenden Wissens«. Der Autor muß gestehen, daß er als Student bei dem erstmaligen Hören dieses Stichwortes weniger an Hegels Buch gedacht hat, als vielmehr an den kleinen Fritz, der vor den strengen Augen des Lehrers an der Tafel steht und mit zitternder Kreide die Rechenaufgabe zu lösen versucht. Und trotzdem ist der Unterschied zwischen Fritzchen und Hegel gar nicht so groß: So wie Fritz sein Wissen erscheinen lassen und den Augen und Ohren des Lehrers darstellen will, versucht Hegel das Wissen von dem, was allem zu Grunde liegt, in die sichtbare Erscheinung zu überführen und darzustellen.
Den letzten Halbsatz wollen wir umformulieren, um den Gedanken voranzutreiben: Das Wesen der Dinge, die uns bekannt sind, ist ja nicht nur in den Dingen verschlossen, sondern hat eine Erscheinung, einen Schein. Wir sollten uns ab jetzt daran gewöhnen, das Wort Schein ohne jeden negativen Beigeschmack wahrzunehmen!
Einer, der ehrlicherweise zugegeben hatte, Hegels Phänomenologie nie verstanden zu haben, hat doch von dem Anliegen etwas gespürt, das der ganzen Philosophie zu eigen ist, wenn er schreibt:
Der Schein, was ist er, dem das Wesen fehlt?
Das Wesen, wär’ es, wenn es nicht erschiene?
Der Mann, der Hegel nie verstanden hatte, aber diese Zeilen schreiben konnte, war Goethe.
Wesen und Schein sind nicht nur Begriffe der Philosophie. Der Alltag ist voll von der Wechselwirkung beider. Beispiel: Güte, Nachsicht, Sorge und Strenge können als Wesen einer Mutter erscheinen. Auch das Wesen der Liebe hat mancherlei Erscheinungen: es kann als Vertrauen, Gefühlsrausch, Zuneigung, Zärtlichkeit oder Begierde erscheinen, wobei jeder für sich prüfen kann, ob die Erscheinung, ob der Schein dem Wesen mehr oder weniger entspricht.
Den Grundgedanken dieser Beispiele können wir ausweiten.
Nicht nur dem Sein als Mutter oder dem Sein der Liebe liegt ein Wesen zu Grunde, sondern auch dem gesamten Sein, und vor allem dem Wissen davon.
Alles Sein hat ein Wesen, und wir können nur von ihm wissen, wenn wir den Schein, die Erscheinung des Wesens betrachten.
Dies macht Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes: Das Buch untersucht das Wissen vom Wesen der Dinge. Zuerst erscheint es als sinnliches Wissen, dann als Wahrnehmung, dann als Verstand bis hin zur Vernunft. – In einem zweiten Teil werden die Erscheinungen der Vernunft untersucht, die sich zum Geist aufschwingt, bis das Wissen zu seinem Ziel kommt: dem absoluten Wissen. Aber das Ziel liegt noch weit.
Die Entstehung
Die vielen Spekulationen über die Entstehungsgeschichte der Phänomenologie sind interessant, aber widersprüchlich. Fangen wir mit den Tatsachen an.
Fest steht, daß Hegel im Mai 1805 zum ersten Mal erwähnt, daß er an einer Phänomenologie des Geistes schreibt. Zu dieser Zeit, der große Kant ist gerade ein Jahr tot, ist er Professor in Jena. Im Februar 1806 wird ein Teil zu seinem Verleger nach Bamberg geschickt, der Verfasser möchte eine Abschlagszahlung. In der Nacht zum 14.Oktober 1806 schreibt er die letzten Seiten. Daß dies unter dem Kanonendonner der Schlacht von Jena und Auerstedt vonstatten geht, ist erwiesen. Allerdings fehlt die ca. 50-seitige »Vorrede«. Sie wird später geschrieben und wird eine Einführung in die Gesamtphilosophie Hegels werden.
Schließlich erscheint die Phänomenologie im Handel (mit Vorrede), es ist Frühjahr 1807.In dieser Zeit spekuliert er mit einer 2.Auflage, da er selbst dem Werk letzte Klarheit abspricht. In einem Brief drückt er den Wunsch aus, »das Schiff hier und da noch vom Ballaste säubern und flotter machen zu können«.
Jetzt beginnen die Rätsel. Noch Mitte 1829 hält er eine Umarbeitung für geboten, dagegen meint er im Herbst 1831, seine »frühe Arbeit« sei nicht umzuarbeiten. Trotzdem geht er zwei Wochen vor seinem Tod noch zum Berliner Buchhändler Duncker, um einen Vertrag über eine Neuausgabe abzuschließen (Althaus).
Es gibt weitere Rätsel: Ohne seine Phänomenologie je zu verleugnen, legt er sie in Heidelberg und Berlin nie seinen Vorlesungen zugrunde, obwohl sie – nach David Friedrich Strauß – das A und O der Hegelschen Werke ist. Auch verwegene Theorien sind zu lesen: Hegel habe seit der Enzyklopädie die Phänomenologie des Geistes als »unhaltbares Werk aufgeben müssen.« So einer seiner ersten Schüler, C.F.Bachmann.
Ein weiteres Rätsel gibt das Original-Titelblatt auf (siehe Seite 10). Dort ist zu lesen, sie sei »Erster Theil« des »Systems der Wissenschaft«. Wo aber ist der zweite Teil? Es gibt keinen.
Mit einer auf Indizien gestützten Mutmaßung wollen wir dem Leser eine Theorie anbieten, die sich an Th. Haering anlehnt und die größte Wahrscheinlichkeit besitzt.
Schon in Jena war es Hegels erklärte Absicht, mit einem Gesamtentwurf seiner Philosophie, einem System, an die akademische Öffentlichkeit zu treten. Bis jetzt war er nur mit der kleineren ›Differenzschrift‹ (auf die wir noch zu sprechen kommen) über den Unterschied zwischen Fichte und Schelling in Erscheinung getreten. Als er merkte, daß der Plan für ein Gesamtsystem mehr Zeit beanspruchte als ihm lieb war und er aus Gründen der Karriere eine weitere Veröffentlichung brauchte, schrieb er eine »Einleitung« in das geplante System. Diese Einschätzung als Einleitung behielt er noch nach der Herausgabe in einem Brief an Schelling bei, obwohl die »Einleitung« jetzt bereits »Erster Theil« des Systems hieß.
So weitete sich die Einleitung »unter der Hand« und aufgrund des inneren und äußeren Druckes »in fast unglaublich kurzer Zeit« (Haering), »auf dem Höhepunkt seiner Jenaer Lebenskrise« (Althaus) zu dem jetzigen Umfang aus und bekam, inzwischen zum Selbstzweck geworden, den Namen Phänomenologie des Geistes. Die Monstrosität des Umfangs läßt sich damit erklären, daß Hegel im Überschwang des Schreibens wie in einen Strudel gerissen wurde und nicht mehr aufhören konnte. Ein Forscher behauptete sogar, im Sommer 1806 hätte Hegel die Herrschaft über seine Arbeit verloren (O.Pöggeler).
Hegel konnte zu dem Zeitpunkt nicht wissen, daß spätere Generationen ausgerechnet dieses Werk als »Geburtsstätte« seiner Philosophie betrachteten (Marx) und es zum berühmtesten und wirkungsmächtigsten seiner Bücher erklärten. So war er nach der Fertigstellung recht hilflos, denn er konnte seiner Phänomenologie keinen geeigneten Ort in seinem System zuweisen.
Diese Hilflosigkeit muß geblieben sein, selbst als sein Hauptwerk, die Nürnberger Logik, erschienen und die Heidelberger Enzyklopädie abzusehen war.
So läßt sich zusammenfassend die Theorie vertreten, daß die Phänomenologie eine unfreiwillige Vorwegnahme seines Systems ist, die später von Hegel deshalb stiefmütterlich behandelt wurde, weil seine ganze Vorliebe den späteren systematischen Gesamtdarstellungen galt.
Hegel. Lithographie von C.Mittag, 1842
Der letzte Philosoph
oder Der Lebensweg eines großen Schwaben
»Nach Hegel wird es keine Philosophie mehr geben« ist ein häufig kolportierter Satz des letzten Jahrhunderts. Richtig daran ist, daß nach den Weltentwürfen eines Aristoteles, Thomas von Aquin oder Kant Hegels philosophisches System der letzte geschlossene Philosophieentwurf war, der unserer Welt präsentiert wurde und der als weitgehend geglückt angesehen wurde. Nach Hegel hat kein Denker mehr ein derart geschlossenes System geliefert, das einen nennenswerten Einfluß auf den Gang der Welt gehabt hätte.
Insofern ist Hegel wirklich der »letzte Philosoph«.
Dieses Etikett hat natürlich einen doppelten Boden, wenn man erfährt, daß die Mädchen die Nase gerümpft haben, als sie des unscheinbaren Studenten ansichtig wurden, der meist nachlässig und altmodisch gekleidet war. Der letzte Philosoph mußte sich auch anhören, wie nach durchzechter Nacht ein Stubengenosse jammerte: »O Hegel, du saufscht dir gewiß no dei bißle Verstand vollends ab!«
Nun, der Gescholtene hat sich seinen Verstand schließlich doch nicht »abgesoffen«, sondern wurde zu einem Titan des Geistes, der wie kein anderer vor ihm seine folgenschwere Handschrift in der Geschichte hinterlassen hat.
»Vom Hegel hätten wir das nimmer gedacht«, staunten frühere Freunde. Wer kann ihnen das verübeln?
Die Familie
Die Ursprünge der Hegels lassen sich bis nach Kärnten zurückverfolgen, von wo sie aus Glaubensgründen vertrieben wurden und sich anschließend im lutherischen Württemberg ansiedelten. Einer der Vorfahren war ein Pfarrer Hegel, der 1759 ein Kind namens Friedrich Schiller taufte.
Im selben Jahr, als der 46jährige Kant den Lehrstuhl für Philosophie in Königsberg als ersehnte Lebensstellung bekommt, erblickt Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Stuttgart das Licht der Welt. Es ist der 27.August 1770.Der Vater, der Herzögliche Rentkammersekretär Georg Ludwig Hegel, hatte ein Jahr zuvor Maria Magdalena Fromme geheiratet. Der Ehe entstammen ferner Sohn Georg Ludwig, der Offizier wird und recht bald stirbt, und Schwester Christiane, die ihren berühmten Bruder um ein Jahr überleben wird, bevor sie im Jahre 1832 durch Selbstmord aus dem Leben scheidet.
Der Schüler
Der kleine G.W.F. kommt mit drei Jahren in die Schule, mit fünf in die Lateinschule und mit sieben Jahren ins Stuttgarter Gymnasium. Dieses Gymnasium war nur zweite Wahl, der erste Rang gebührte der Karlsschule, die Schiller und Bruder Georg Ludwig besuchten. Sein Lieblingslehrer wurde der Präzeptor Löffler, der dem Achtjährigen Wielands Shakespeare-Übersetzung schenkte. Der junge Hegel war ein Musterschüler und durfte auch später als einer von fünf die Schulabschlußrede halten.
Er hatte aber auch einen Hang zur Trivialliteratur. Mit 16 konnte er sich kaum von dem sechsbändigen Roman von J.T.Hermes losreißen, ›Sophiens Reise von Memel nach Sachsen‹, eines »der elendesten und langweiligsten Machwerke unserer damaligen Literatur« (Kuno Fischer). Für den späteren Erzrivalen Schopenhauer war dies ein gefundenes Fressen, er höhnte bei dieser höchst willkommenen Information: »Mein Leibbuch ist Homer, Hegels Leibbuch ist Sophiens Reise von Memel nach Sachsen.«
Das Tübinger Stift
Das legendäre Tübinger Stift ist bis heute eine angesehene theologische Einrichtung für besonders begabte Stipendiaten, untergebracht in einem ehemaligen Augustiner-Kloster. Im Herbst 1788 bekam Hegel dort einen Platz. Die fünf Jahre im Stift prägten sein Leben, es war die Zeit der Französischen Revolution und die Zeit der Freundschaft mit Hölderlin und Schelling, dem fünf Jahre jüngeren Genie, dem Hegel noch sehr viel verdanken wird. Es war die Zeit intensiver Studien, aber auch die Zeit durchzechter Nächte bei Schach und Kartenspiel, verschlafener Vorlesungen, Abwesenheiten beim Gebet und erster Leidenschaft.
An Kant hatte er damals wenig Interesse, und seine Probepredigten ragten nicht über den Durchschnitt hinaus. Auf der Promotionsliste, eine Art Rangliste hinsichtlich der halbjährlichen Leistungen, erreichte er häufig nur den zweiten Platz, hinter einem Studenten namens Märklin. Einmal rutschte er sogar auf den vierten Rang, wieder hinter Märklin. Für Hegel eine offene Wunde, die nie heilte.
Sein Abgangszeugnis nach dem Kandidatenexamen 1793 weist Formulierungen auf, die nicht unbedingt auf eine glänzende Laufbahn schließen lassen: Das Studium der Theologie habe er nicht vernachlässigt, im Rezitieren sei er als kein großer Redner in Erscheinung getreten (»non magnus orator visus«), in den Sprachen sei er nicht unwissend (»non ignarus«) und in der Philosophie hätte er viel Fleiß gezeigt (»multam operam impendit«).
Die Laufbahn (1)
Sie fängt nicht gerade erfolgversprechend an. Während das Genie Schelling in Kürze als 23jähriger Professor werden wird, verbringt Hegel von 1793 an ein eintöniges Leben als Hauslehrer in Bern/Schweiz und ab 1797 in Frankfurt. Kontakte nach Jena werden geknüpft, wo Schelling seit 1798 lehrt und ihm auch den Weg dorthin ebnen wird.
Anfang 1801 trifft Hegel in Jena ein, wo er fast ein Jahr bei Schelling wohnt, der gerade in eine schicksalsschwere Affäre mit Caroline Schlegel verwickelt war. Schelling verfiel der 12Jahre älteren Frau, die der strahlende Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens von Jena war. Sie war gebildet und respektlos, angeblich hat sie sich über Schillers Gedicht von der Glocke schier totgelacht. Als sie als Schellings Frau frühzeitig starb, brach für diesen eine Welt zusammen.
Für Hegel wurde Jena die Schicksalsstadt. Er habilitiert sich mit einer Arbeit über die Planetenlaufbahnen, seine berühmte ›Differenzschrift‹ entsteht, sie steht am Anfang einer Serie beispielloser Veröffentlichungen. Das erste Treffen mit Goethe in Weimar kommt am 20.Oktober 1801 zustande, der fortan seine schützende Hand über ihn hält und bei Karriereproblemen, auch finanzieller Art, oft eingreift; 1805 erhält Hegel eine (unbesoldete) Professur, sein Einkommen bezieht er aus Hörergeldern.





























