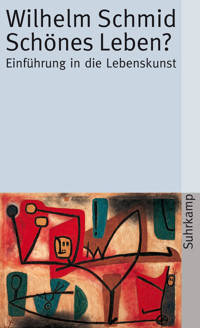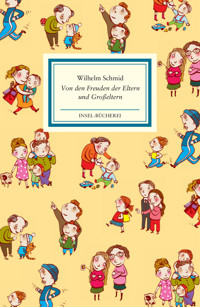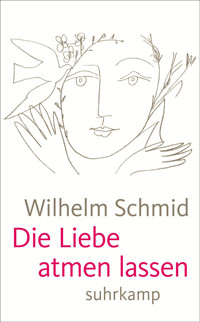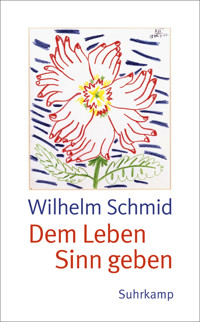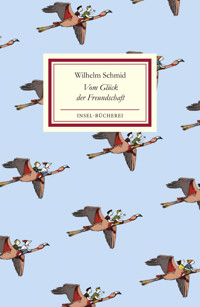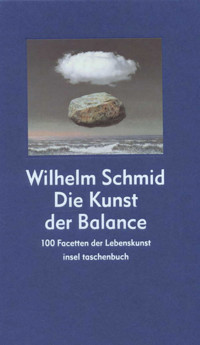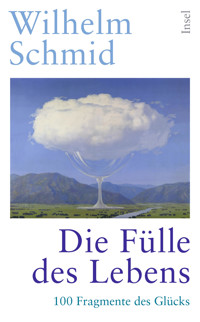13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Menschen suchen vermehrt nach Heimat in einer Welt, die ungewiss erscheint, und in einem Leben, das sich schneller ändert, als es zu verstehen ist. Mehr als je zuvor sehen sich auch diejenigen mit Heimatlosigkeit konfrontiert, die eigentlich wohlbeheimatet sind. Heimat wird zum flüchtigen Gut in der Epoche des Globalwerdens von Menschen und Dingen. Im permanenten Hin und Her zwischen den Welten werden die Menschen selbst flüchtig und beginnen sich zu fragen: Wo bin ich wirklich daheim? Wo war ich es? Wo wird Heimat künftig möglich sein?
Die Heimat hat eine große Zukunft, aber nicht mit dem Modell der Vergangenheit. Eine Erweiterung des Heimatbegriffs ist nötig, denn Heimat ist mehr als nur ein Ort. Sie kann als Basislager des Lebens gelten, von dem aus Erkundungen ins Ungewisse möglich sind. Anders als es zunächst den Anschein hat, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Heimat zu finden. Die Vielfalt wird in der Diskussion über »die Heimat« oft aus den Augen verloren. Sie wird im Fokus dieses Buches stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Wilhelm Schmid
Heimat finden
Vom Leben in einer ungewissen Welt
Suhrkamp Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
Heimat ist überall, wo Beziehung ist
Wie die Liebe jeden Ort zur Heimat macht
Von der Schönheit der Heimat in den Augen ihrer Betrachter
Wohnheimat: Vertraute Welten zwischen vier Wänden
Körperliche Heimat: Vom Leben in Sinneswelten
Seelische Heimat: Vom Leben in Gefühlswelten
Geistige Heimat: Vom Leben in Gedankenwelten
Perspektive: Wie der Blick in die Welt zur Heimat in ihr wird
Können Menschen auch im Reich der Schatten beheimatet sein?
Heimat fühlen Menschen in der Natur
Wohnen im Gewächshaus: Ökologische Heimat
Heimat unter einem Himmel: Wolkenlandschaften
Wolkenloser Himmel: Nietzsches Suche nach Heimat
Frühlingsglück: Niemand ist eine Insel, aber alle wollen dorthin
Sommerhitze: Heimat im Strandkorb und unter Platanen
Herbstmelancholie: Wenn die Welt im Nebel verschwindet
Winterlandschaft: Warum die Welt im Schnee so anheimelnd ist
Rund um den Vulkan: Heimat im Garten am Rande des Abgrunds
Heimat wird geschaffen mit Kunst und Kultur
Außer mir: Heimat in Menschenlandschaften
Durch mich hindurch: Heimat in Klanglandschaften
Heimat im Bild: Die lodernden Landschaften Vincent van Goghs
Bücherlandschaften: Heimat in den Katakomben des Geistes
Eine Handvoll Heimat: Von der Telefonzelle zum Smartphone
Aufbruch ins Neuland: Auf Bildschirmen beheimatet
Abschied von der Zeitung: Wo ist meine mediale Heimat?
Meinungen und Parteien: Heimat in politischen Landschaften
Was tun, wenn die vertraute Heimat fremd wird?
Zerstörung von Heimat: Landschaften in Zeiten des Krieges
Menschen auf der Flucht: Heimat und Menschenwürde
Heimat ist das ruhige Leben auf dem Land
Heimat in Raum und Zeit: Ruralität und Urbanität
Raus aufs Land, wo die Heimat der Heimat ist
Heimatgefühle? Wanderungen durch die Marke Brandenburg
Wahres Leben auf dem Land und kulturelle Unterschiede
Die Neuordnung der Idylle, die es nie gab: Landschaftspflege
Meine Heimat: Unterwegs in idyllischer Landschaft
Heimat pflanzen, den Garten bestellen: Land in der Stadt
Warum immer mehr Menschen sich in Bienenkästen einnisten
Heimat ist das vibrierende Leben in der Stadt
Stelldichein am Tempel der Glücksgöttin des heutigen Tages
Eine Heimat in der Stadt finden: Urbane Lebenskunst
Eine neue Heimat bauen: Sonnenstadt in smartem Grün
Zauber der Stille in der Stadt und eine Heimat im Lärm
Geborgenheit am Platz: Wo die Stadt zum Dorf wird
Lieblingsplatz: Auf einen Kaffee mit Walter Benjamin
Heimat to go or to stay? Das Café als Basislager
Im Orbit. In 60 Minuten um die Stadt, in 6 Stunden um die Welt
Heimat entsteht beim Unterwegssein in Raum und Zeit
Euphorie des Aufbruchs, Tristesse der Ankunft
Heimat am Tor zur Welt: Die Sehnsucht nach Ferne
Heimat im Transitraum: Abheben und ganz woanders sein
Heimat aus dem Koffer: Einsam und gemeinsam im Hotel
Planetares Driften: Die globale Heimat digitaler Nomaden
Museale Heimat: Die Aufbewahrung der Zeit im Raum
Woher kommen wir? Vertraut werden mit der Geschichte
Wohin gehen wir? Heimatgefühle in Gräberlandschaften
Unsterblichkeit? Vom Verschwinden der Heimat in der Zeit
Nicht in Raum und Zeit: Wo sind Menschen mit Demenz daheim?
Heimat ist erfahrbar in Phantasie, Utopie und Transzendenz
Phantastische Heimat: Traumlandschaften
Heimat im verzauberten Raum: Christo in Italien
Utopie: Heimweh nach dem, was nirgendwo ist
Heimat im Wesentlichen: Warum jeder Mensch religiös ist
Jenseitige Heimat in diesseitigen Räumen: Gotteshäuser
Himmlische Landschaften: Absolute Heimat im Paradies
Unheimlichkeit: Was ist aus der Hölle geworden?
Unendlichkeit: Ein Heimweh über alle Horizonte hinaus
Zum Autor
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort
»Es ist schwer, den Anfang zu machen.«
»Ist es nicht schön, wenn alles noch so offen ist?«
»Nein, es ist ein Stochern im Nebel, alles noch so ungewiss. Schön ist es erst im Rückblick, wenn alles seinen Platz gefunden hat.«
»Aber ist es dann noch spannend?«
Mein kleines Dorf wollte ich nie verlassen und tat es dann doch, die Pubertät hatte meine Meinung geändert. Ich wollte die große weite Welt erobern, egal wie und warum. In der Stadt war ich erst einmal einsam. Ich verstand das Leben nicht, das so anders war als das ländliche, das ich kannte. Einen verlässlichen Rahmen und zeitlichen Rhythmus bot mir die Arbeit, die ich als Schriftsetzerlehrling zu tun hatte. Aber wo in dieser Welt, die mir fremd vorkam, war Vertrautheit zu finden? In einer Künstlergruppe, der ich mich anschloss, fühlte ich mich auf Anhieb wohl und besser verstanden als je zuvor. Fern der Heimat gab es eine andere Art von Heimat, von der ich nicht einmal gewusst hatte, wie sehr sie mir fehlte.
Heimat war damals kein Gegenstand des Nachdenkens. Das hat sich geändert, auch für mich.* Menschen suchen vermehrt nach Heimat in einer Welt, die ungewiss erscheint, und in einem Leben, das sich schneller ändert, als es verstanden werden kann. Mehr als je zuvor sehen sich selbst diejenigen mit Heimatlosigkeit konfrontiert, die eigentlich wohlbeheimatet sind. Die unheimliche Erfahrung, dass jede Gewissheit über Nacht wegbrechen kann, streute noch dazu 2020 das Coronavirus Sars-CoV-2 über den gesamten Planeten. Aus aller Welt wollten alle mit einem Mal nachhause. Heimat wird zum flüchtigen Gut in der Epoche des Globalwerdens von Menschen und Dingen, das zur Ausbreitung des Virus beigetragen hat. Im permanenten Hin und Her zwischen den Welten werden die Menschen selbst flüchtig und beginnen sich zu fragen: Wo bin ich wirklich daheim? Wo war ich es? Wo wird Heimat künftig möglich sein?
Heimatlosigkeit entsteht durch die Erschütterung, dass etwas nicht mehr so ist, wie es vertraut war, nicht nur in Bezug auf das Leben an einem Ort, sondern auch auf das Lebensverständnis, die Weltsicht, die Verbundenheit mit Anderen. Die Welt, die gewiss erschien, wird ungewiss, wenn Beziehungen zerbrechen, Grenzen fallen, neue Techniken verunsichern, Arbeitsplätze in Frage stehen. Parallel zu aufbrechenden Ungewissheiten wächst das Bedürfnis nach einer verlässlichen, eingespielten Wirklichkeit, auf die gebaut und vertraut werden kann. Heimat ist ein Wort dafür. Einmal fraglich geworden, ist das Leben in unverbrüchlichen Beziehungen an einem festen Ort, in gewohnter Ordnung und fragloser Rollenverteilung jedoch nicht einfach wiederherstellbar. Und diese Erfahrung machen nicht nur Einzelne hier und da.
Für alle bleibt kein Stein mehr auf dem anderen im 21. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Disruption, des Bruchs und Umbruchs in allen Bereichen, in der Virtualisierung des Lebens, in den Beziehungen zwischen Geschlechtern und Kulturen, in Wissenschaft und Technik, in der Politik und Weltpolitik, im Verhältnis zur Natur. Rund um den Planeten wecken klimatische Veränderungen existenzielle Ängste, weltweit scheint es keinerlei Verlässlichkeit mehr zu geben. Es ist nicht das erste Mal, dass die Welt aus den Fugen gerät, aber es ist jedes Mal zutiefst beunruhigend für die, die das in ihrer Zeit erleben. Wie tief dieses Mal der Bruch reicht, wird daran deutlich, wie rasch selbst das Neueste veraltet. Wer Heimat sucht, will in einer festen Wirklichkeit verankert sein, statt sich in uferlosen Möglichkeiten zu verlieren. Nun aber fließt alles, auch die Flussufer zerfließen. Wo in einer Welt, die so unbeständig, ungewiss, ungemütlich erscheint, kann noch Beständigkeit, Gewissheit, Geborgenheit sein?
Seit im 19. und 20. Jahrhundert unter dem Titel Moderne eine Befreiung von alten Ordnungen ins Werk gesetzt wurde, beschleunigt sich der Prozess. Begleitet wird er ausgerechnet in der Geburtsheimat der Moderne, dem westlichen Kulturraum, von einem schwierigen Verhältnis zur Heimat. Aus der einstigen Verpflichtung, sie zu bewahren, wurde die moderne Norm, sich von ihr zu befreien. Um sie dann zu vermissen. Systematisch produziert die heimatferne Moderne ein Gefühl von Heimatlosigkeit, das aber schwer auszuhalten ist, sodass auf jeden Modernisierungsschub ein Heimat-Hype antwortet. Der fortschreitenden Globalisierung wird mit einer neuen Lokalisierung zu begegnen versucht, einer Rückbesinnung auf überschaubare Orte. Die Neuerungswut hoffen viele mit Traditionalisierung ausbalancieren zu können, mit der Pflege überlieferter Gebräuche vor Ort. Auf die Digitalisierung antwortet eine neuerliche Analogisierung, eine Wiederentdeckung des anfassbaren, realen Lebens.
Aber selbst das politische Versprechen, die Heimat gegen ihre Infragestellung zu schützen, kommt gegen die moderne Dynamik nicht an, die sie gefährdet. Gefährdet wird sie etwa von wirtschaftlichen Zwängen, die erfordern, die Heimat zu verlassen, um dorthin zu gehen, wo Arbeitsplätze sind. Gefährdet wird sie andernorts davon, dass Menschen sie zurücklassen müssen, um sich von unerträglichen Macht- und Lebensverhältnissen zu befreien. In der Kultur der Moderne selbst wird sie noch dazu von den Möglichkeiten der Freiheit gefährdet, denen kaum zu widerstehen ist: Immerzu lockt etwas Anderes, Attraktiveres, das ein Bleiben und Verweilen untergräbt. Eine ständige Unruhe treibt Menschen an, sich ins Unbestimmte vorzuwagen und jede bestimmte Wirklichkeit für neue Möglichkeiten aufzugeben.
Was kommt, wenn die Heimat geht, ist die Sehnsucht nach ihr. Das ist die Not der Zeit, in der nichts mehr feststeht. Die Heimat verspricht Wärme in einer kälter werdenden sozialen Welt. Sie weckt die Hoffnung auf Vertrautheit und Geborgenheit anstelle von Fremdheit und Verlorenheit, auf eine Fülle von Sinn anstelle von Sinnlosigkeit. Sehr viel Selbstvertrauen geht mit der Selbstverständlichkeit einer Heimat einher, in der ich meinen Platz kenne und einfach nur da sein kann: »Hier bin ich richtig.« Umstandslos kann ich mich an den Tisch setzen, nicht nur zuhause, sondern auch bei vertrauten Menschen sonst wo. Ich muss keine Energie aufwenden, um mich erst neu zu orientieren, Leute kennenzulernen und die Sprache zu verstehen. Die Heimat passt zu mir und ich zu ihr, in ihr finde ich mich zurecht, sie ermöglicht mir das Leben und sogar ein anderes, gesteigertes, erfülltes Leben, zumindest für eine Weile, am besten für immer, mit großer Gewissheit, Beständigkeit und Verlässlichkeit.
Der Versuch, sich erneut auf Heimat zu besinnen, ist eine Antwort auf die Sehnsucht nach ihr. Heimat kann als Basislager des Lebens verstanden werden, von dem aus Erkundungen ins Ungewisse möglich sind. Die Welt ist groß und unübersichtlich, jeder Mensch braucht eine kleine Ecke, welcher Art auch immer, die er überblickt, die ihm vertraut ist, in die er sich zurückziehen und ganz bei sich sein kann. Niemand kann in völliger Fremdheit leben, jeder bedarf irgendeiner Heimat, besser aber mehrerer Heimaten (oder auf Englisch heimats), um nicht vor dem Nichts zu stehen, wenn eine verlorengeht. Und wo ist noch Heimat möglich? Eigentlich überall, wo die Welt in Ordnung ist – und selbst dort, wo sie es nicht ist, sofern ein Mensch sich mit dieser Welt vertraut macht und sich darin einrichtet, etwa mit einer inneren Heimat auch in äußerer Heimatlosigkeit. Sogar die Ungewissheit kann zu einem Element der Vertrautheit und insofern zur Heimat werden. Restlos aufzuheben ist sie ohnehin nie.
Im Grunde herrscht kein Mangel an Heimat. Anders als es zunächst den Anschein hat, gibt es viele Möglichkeiten, Heimat zu finden, in abgeschwächter Form ein Zuhause. Aus Haupt- und Nebenheimaten kann sie zusammengesetzt werden wie ein Mosaik, dessen Teile im Laufe des Lebens immer wieder neu zu sortieren sind. Dazu zählen Räume, denen ein Mensch sich zugehörig fühlt und die am ehesten die Gewissheit bieten, die er von einer Heimat erwartet: Vorzugsweise die Wohnung, dann das Dorf, die Stadt, die Region, das Land. Von großer Bedeutung, schicksalhaft von Eltern und dem Zufall festgelegt, ist der Ort der Geburt, die Landschaft der Kindheit und Jugend. Heimat ist dort, wo die eigene Geschichte ihren Lauf nimmt. Diesem Anfang wohnt ein Zauber inne, der das ganze Leben vorhält. Oft erfährt ein Mensch, was ihm die Heimat bedeutet, wenn er sie verlässt. Nie erkennt er den Wert der vertrauten Nähe besser als in der fremden Ferne, auch wenn es ihm sonst an nichts fehlt.
Heimat ist jedoch viel mehr als ein Ort. Sie entsteht auch durch die Beziehung zu sich selbst und Anderen, zu einer Familie, einem Freundeskreis und einer Gruppe, ebenso im Ambiente einer Sprache, einer geistigen Verbundenheit, im Rahmen vertrauter Werte und bevorzugter Künste, insbesondere in Musikrichtungen, Lebensstilen und Moden, Meinungen und Denk-Gewissheiten, Gewohnheiten, Eigenheiten, Tätigkeiten, Phantasien und Erinnerungen. In neuen Formen lebt sie etwa in digitalen Welten wieder auf, und vor allem in der portablen Handyheimat, die für viele so unverzichtbar ist, dass sie das Gerät ständig mit sich tragen. Über das Ich hinaus wollen die meisten Menschen noch dazu in einem größeren Ganzen, einer Gemeinschaft, einer Kultur, in der Natur, im Kosmos, in Gott geborgen sein.
Das Wesentliche, das allen Heimaten eigen ist, dürfte die Bedeutung sein, die ein Mensch allem und jedem geben kann. Was nichts bedeutet, kann keine Heimat sein. Nur das, was wichtig ist und wertvoll erscheint, stellt eine Basis für das Entstehen von Vertrautheit und Geborgenheit dar. Heimat ist das, was nicht egal ist. Sorge wäre jedoch dafür zu tragen, dass der Begriff von Heimat nicht so eng gefasst wird, dass der Wunsch nach einer »Deheimatisierung« entsteht (Bilgin Ayata, 2019). Eine Heimaterweiterung ist nötig, auch wenn das wie eine Hyperheimatisierung erscheint: Alles kann Heimat sein. Statt das Leben auf eine einzige Haupt- und Herzensheimat zu reduzieren, käme es darauf an, auch andere soziale, mentale, räumliche und temporäre Heimaten zu gründen und zu pflegen. Die mögliche Vielfalt wird in der Diskussion über »die Heimat« oft aus den Augen verloren.
Die Heimat braucht einen neuen Twist, einen Dreh, eine tänzerische Wendung, die sie davor bewahrt, in Unbeweglichkeit zurückzufallen. Lange war sie ein Fall fürs Museum, aber das Verschwinden dieser alten Heimat zu beklagen, bringt sie nicht zurück. Die Heimat hat eine große Zukunft vor sich, aber nicht mit dem Modell der Vergangenheit. Sie stand für das Gleichbleiben einer Identität. Beständig kann sie aber nur sein, wenn sie auch Veränderung zu integrieren vermag. Eine Heimat, die nichts integrieren kann, ist in ihrer Existenz bedroht, da keine Weiterentwicklung in ihr mehr möglich ist. Von der Veränderung, die sie ausschließen will, wird sie überrollt.
Die erneuerte Heimat steht daher für die Arbeit an einer Integrität, die relativ beständig und zugleich veränderlich ist, offen für Andere und Anderes. Eine so verstandene Heimat erleichtert auch die Integration derer, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Vor Ort treffen sie auf Menschen, von denen einige um ihre Identität bangen, da ihre Heimat mit Fremden nicht dieselbe bleibt. Andere aber sehen in ihnen eine Bereicherung der Heimat. Grenzen ziehen höchstens die verfügbaren Ressourcen, denn es wäre sinnlos, eine Heimat so zu überfordern, dass sie für niemanden mehr Heimat sein kann.
Sich um Heimat zu kümmern, ist Sache jedes Einzelnen. Nur er (oder sie oder divers) kann wissen, was für ihn solche Bedeutung hat. Im Zweifelsfall ist es eine Frage der Definition. Wer Festigkeit will, sollte sich festlegen und attraktivere Alternativen außer Acht lassen. Wer Vertrautheit will, sollte Fremdes immer wieder in Bekanntes verwandeln. Heimatpflege ist ein Carework, eine Sorgearbeit, mit der ein Ich sich nicht nur passiv am Gegebenen erfreut, sondern aktiv um sein Heimatmosaik bemüht. Auch so ist ein farbenfrohes Leben möglich.
Wo und wie Heimat unter modernen Bedingungen des Lebens gefunden, geschaffen und gepflegt werden kann, ist das Thema dieses Buches, das selbst ein Mosaik aus lose verbundenen Episoden und Aspekten mit vielen Farben und Facetten ist. Die Zusammenschau all dessen, was Heimat sein kann, soll dazu anregen, sich erstmals oder von Neuem Gedanken über die Bedeutung der Heimat für das eigene Leben zu machen: »Brauche ich Heimat? Wo sind meine Heimaten? Was kann ich dafür tun, mich zu beheimaten? Worin sehe ich meine Kernheimat, was halte ich für peripher?«
Auch für mich selbst will ich Antworten auf diese Fragen finden, insofern ist es zugleich ein persönliches Buch. Das Leben so zu gestalten, dass bei aller Erfahrung von Fremdheit und Befremdung Vertrautheit und Geborgenheit entstehen kann, ist ein Element der Lebenskunst. Und der Kunst des Liebens, die ihre eigenen Arten der Beheimatung kennt. Daher widme ich dieses Buch meiner Frau Astrid, mit der ich seit vielen Jahren überall dort Heimat finde, wo wir gerade sind. Ich hätte sie nie kennengelernt, wäre ich nicht aus meinem kleinen Dorf in die Welt hinausgezogen. Einige Momentaufnahmen aus unseren Gesprächen, die das Werden des Buches über lange Zeit hinweg begleiteten, sind hier und da wiedergegeben. Sie haben das Buch bereits eingeleitet, und sie werden es auch abschließen.
Heimat ist überall, wo Beziehung ist
Wie die Liebe jeden Ort zur Heimat macht
Wir liefen etwas planlos umher, es war nicht wichtig wo, wir kannten die Umgebung ohnehin nicht. Wichtig war nur, diesen Sommersonntagnachmittag gemeinsam zu genießen, denn wochentags war wenig Gelegenheit für solche Unternehmungen. Am Ufer eines kleinen Sees tauchten wir in einen Mischwald ein, der schmale Schotterweg führte leicht aufwärts. Bald gaben die Bäume eine Lichtung frei und wir tapsten über eine wildwüchsige Wiese. Nach wenigen Metern schauten wir uns an und wussten, dass wir denselben Gedanken hatten. Aber wo? Wir suchten nach einer Senke, die uns verbergen könnte, oder einer Stelle mit höheren Halmen, zwischen denen wir verschwinden würden. Erst später registrierten wir die Schnakenstiche, die wir abbekommen hatten, und waren stolz darauf. Sie machten fühlbar, dass wir bereit waren, einiges dafür zu tun, in einer immer ungewisser erscheinenden Welt die Gewissheit zwischen uns zu bewahren und zu stärken.
Alle Liebenden kennen Landschaften, die unauflöslich mit ihrer Geschichte verquickt sind. Lebhaft erinnern sie sich an laue Sommernächte in Grünanlagen der Stadt oder eine sattgrüne Wiese am Meer, auf der mitten am Tag lediglich das Knattern des Hubschraubers störte, der gerade über ihnen eine Schleife ziehen musste. Sie schätzen den Schutz vor Blicken in den Mulden von Dünen und kennen den Blick übers Meer von hochgelegenen Küstenpfaden. In Landschaften, in denen es auch Vögeln gefällt, erfreuen sie sich an deren Begleitmusik und werden zuverlässig von ihnen vor Störenfrieden gewarnt, sollten die Ohren noch dafür offen sein. Vor allem verwilderte Orte reizen zu ebensolchen Aktionen. Der Boden ist unbequem, das Gras zu narbig, die Moosmatte nicht weich genug? Eine Jacke genügt.
Jeden Ort macht die Liebe zur Heimat. Schon die Wange findet Heimat in der Wölbung der Handinnenfläche, in die sie sich schmiegt. Die Liebenden, die sich für einen Moment so nahe sind, dass jede Distanz nichtig wird, erfahren die tiefste Vertrautheit und Geborgenheit. Was sie beieinander und ineinander beheimatet, erscheint ihnen wichtig, alles Andere unwichtig. Was kümmert sie die Welt! In der Momentheimat, die durch das intensive Erleben entsteht, vergessen sie die Zeit und interessieren sich nicht mehr dafür, wo sie sind. Just die Erfahrung der Zeitlosigkeit markiert jedoch einen Einschnitt in der Zeit, den sie nicht mehr vergessen werden. Es ist wie ein Gongschlag, der noch lange nachklingt. Die Erfahrung stellt eine Beziehung zum Ort her und hebt seine Fremdheit auf, sodass Vertrautheit entsteht. Fast so schön wie die Erfahrung ist die spätere Reflexion, um das Erlebte länger auszukosten, ihm nachzusinnen und gewonnene Erkenntnisse auch künftig für die Kunst des Liebens zu nutzen.
Heimat ist überall, wo die Liebe zur Erfahrung wird. Die Erinnerung daran heftet sich an den Ort und verblasst nie. Auch die Umgebung, die zunächst unbekannt und unwichtig war, prägt sich nachdrücklich ein und begründet eine Heimat im Raum, mit der der Moment in der Zeit für immer verbunden bleibt. Jede weitere Erfahrung der Liebenden an diesem Ort bestätigt die Vertrautheit damit. Dabei können die Erfahrungen von sehr unterschiedlicher Art sein: »Hier haben wir gesessen, geschaut, gegessen, gestritten, geliebt.«
Was den Ort aus der Unzahl möglicher Orte hervorhebt, ist die gefühlte und gedachte Bedeutung, die er durch die Liebe erhält. Mit dieser Ausstattung bleibt er für die Liebenden der besondere Ort, an dem sich ein Teil ihrer Geschichte abgespielt hat. Mit einer Flagge der Inbesitznahme, die nur für sie selbst weht, eignen sie sich den Ort an, ohne dass er ihnen gehören würde. In ihrem Fühlen und Denken gewinnt er die Konturen, die unsichtbar für Andere durch seine reale Sichtbarkeit hindurchschimmern. Danach ist er für alle Zeiten verwandelt, ein Vorgang, der auch schon zu anderen Zeiten ins Bewusstsein von Liebenden rückte: »Immer war mir das Feld und der Wald und der Fels und die Gärten / Nur ein Raum, und du machst sie, Geliebte, zum Ort« (Johann Wolfgang von Goethe, Gedichte, Vier Jahreszeiten, Sommer, 1827).
Was die Bedeutung erzeugt und Heimat begründet, ist die Intensität der Erfahrung. Das ist auch in anderen Kontexten so, aber vor allem für die Liebenden kann die Erfahrung »himmlisch« sein, nicht nur im metaphysischen, sondern auch im physischen und psychischen Sinne, insofern Energien dabei frei werden, die als Urgrund allen Seins empfunden werden können. Die äußere Umgebung regt das innere Geschehen an, synchronisiert die Stimmungen der Liebenden und umrahmt ihr Zusammensein. Im Setting »szenischer« Natur- oder Kulturlandschaften fällt es leichter als in der gewohnten Umgebung, sich intensiv miteinander zu befassen und vieles gemeinsam zu erkunden, auf diese Weise die Beziehung zu vertiefen und sich in ihr heimisch zu fühlen.
Daher wandeln so viele Paare etwa unter den Pinien und Palmen in Montreux am Ufer des Genfer Sees entlang, wo schon Véra und Vladimir Nabokov glückliche Zeiten verbrachten und Freddie Mercury mit seinen Aufenthalten dazu beitrug, dass eine Pilgerstätte für Fans und Liebende jeder Couleur daraus wurde.
Liebe und Landschaft – eine magische Verbindung. Von ihr zeugt auch die Literatur, in der die Schilderung von Beziehungen oft mit dem Ausmalen von Umgebungen einhergeht. Hanns-Josef Ortheil erzählt Die große Liebe (2003) als eine Geschichte, die mit dem Blick auf den offenen Horizont am Meeresufer der Adria zwischen Ancona und Pescara ihren Anfang nimmt. Dann steigt die Liaison zu den nahe gelegenen Höhen empor, wo die Gefühle prompt ebenso kulminieren. In den hinreißenden äußeren Landschaften erkennen die Liebenden die inneren ihrer Leidenschaften wieder. Gleichermaßen berauscht sind sie von der Weite des Blicks übers Meer wie von der Tiefe ihrer Seelen in der Empfindung füreinander. Für immer wird ihre Liebe in diesen Landschaften, in denen sie sich einander zuwandten und zugetan waren, beheimatet sein. Sogar von größerer Beständigkeit als die Liebe selbst kann die Beziehung zu den Landschaften sein. Jede Erinnerung daran ruft die Gefühle wieder wach, was auch immer aus der Liebe zwischenzeitlich geworden sein wird.
Davon, wie mit dem nötigen Narzissmus zu zweit eine Momentheimat an den Orten der Liebe zustande kommt und durch wachsende Intensität Bedeutung erlangt, berichtet Max Frisch 1975 in Montauk (und der Regisseur Volker Schlöndorff mochte für die Verfilmung der Erzählung 2017 nicht auf eigene Erfahrungen am selben Ort verzichten). Eigentlich hatte sich Frisch nach der gescheiterten Beziehung zu Ingeborg Bachmann mit seiner zweiten Ehefrau Marianne Oellers in Berlin bereits häuslich eingerichtet. »Noch vorgestern haben wir gesagt: Ich gehe jetzt in die Wohnung. Heute sagen wir: Ich geh nach Haus (sic!).« Aber dann stürzt er sich in Montauk an der nordamerikanischen Atlantikküste in eine Affäre mit der sehr viel jüngeren Lynn. Die Liebe liebt Unendlichkeitshorizonte, aber am endlosen Strand, an dem die hereinbrechenden Wellen ihre Schaumzungen ausrollen, fremdeln beide noch miteinander. Erst spätabends, als im Lärm der Brandung keine Unterhaltung mehr möglich ist und sie sich im Hotelzimmer der Sprache der Lüste bedienen, kommen heimelige Gefühle auf.
Wie die Literatur und der Film stellt außerdem die Malerei gerne die Liebe dar, die Orte zur Heimat macht. Die New Yorker Malerin Cecily Brown hat diesem Sujet viele ihrer Werke gewidmet, aber die Tradition geht zurück bis zu Édouard Manets Frühstück im Grünen (Le Déjeuner sur l'herbe, 1863). Das Bild löste einen Skandal aus, da nicht Phantasiewesen, sondern bürgerliche Menschen im Freien dem Eros frönten, dem zur Zeit der Entstehung des Bildes allenfalls ein Schattendasein hinter Mauern zugestanden wurde. Manet bezog sich seinerseits auf die Malerei der Renaissance. Er blickte auf die Kupferstich-Kopie einer verschollenen Zeichnung Raffaels aus dem frühen 16. Jahrhundert, Das Urteil des Paris. Eine Gruppe rechts unten am Bildrand regte ihn zu seinem Frühstück an. Raffael wiederum hatte in der Villa Farnesina, die ein humanistisch gesinnter Bankier auf dem Land vor den Toren Roms bauen ließ, mit dem Deckengemälde Hochzeitsmahl der Götter die pralle Sinnlichkeit gefeiert. Für die Arbeit daran war ihm erlaubt worden, seine Geliebte bei sich zu haben. Das frivole Bild wirkt wie eine Antwort auf das keusche Abendmahl, das Leonardo da Vinci 20 Jahre zuvor im Mailänder Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie geschaffen hatte.
Dass die Liebe auch unter religiösen Vorzeichen jeden Ort zur Heimat zu machen vermag, geht aus einer alten jüdischen Schrift hervor: »Komm, mein Geliebter, wandern wir auf das Land, schlafen wir in den Dörfern. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock schon treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben«, heißt es im Hohenlied, das von der göttlichen Energie erzählt, die dem menschlichen Leben Bedeutung verleiht. Die Geliebte selbst wird als Landschaft besungen: »Ein Lustgarten sprosst aus dir, Granatbäume mit köstlichen Früchten.« Ebenso ungeniert wird der Geliebte mit einem Apfelbaum verglichen: »In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süß schmeckt seine Frucht meinem Gaumen.«
Aus vorchristlichen Jahrhunderten stammt im Übrigen das erste große Nachdenken über die Liebe, das offenkundig eines besonderen Ortes bedurfte. Sokrates, der seine Heimatstadt Athen sonst nie verließ, steuert außerhalb der Mauern mit seinem Gesprächspartner Phaidros eine ausladende Platane am plätschernden Bach in felsigem Gelände an: »Dort ist sowohl Schatten als auch ein mäßiger Luftzug, auch Rasen, um uns niederzusetzen oder, wenn wir wollen, uns niederzulegen.« Über der Landschaft liegt ein Zauber, der dem Leser bildhaft vor Augen steht. Das Wasser kühlt die Füße, im Hintergrund zirpen Zikaden. Nymphen könnten hier anwesend sein, meint Sokrates. Das ist für ihn der geeignete Ort, um über die Begeisterung zu sprechen, die die Liebe auslöst, die Manía, in der die unsterbliche Seele nach wahrer Schönheit strebt. Die Intensität, die dabei erfahrbar wird, zeichnet auch das Gespräch darüber aus und ist für Sokrates überhaupt die Stärke jeder beseelten, lebendigen Rede. Die Hochschätzung des gesprochenen Worts im Unterschied zum geschriebenen, die Platon im Dialog Phaidros seinem Lehrer Sokrates in den Mund legt, hat in dieser Intensität ihren Grund.
Wie die intensive Erfahrung der Liebe begründet auch die des Gesprächs eine Heimat in diesem Moment an diesem Ort. Die Erfahrung ist erneuerbar, auch in ein und derselben Beziehung, sofern zwei sich darum bemühen. Soll aus der Liebe eine Dauerheimat werden, kann sie allerdings nicht nur aus einer Abfolge intensiver Momente bestehen. Nachhaltigkeit gewinnt sie Platon zufolge am ehesten durch die Besonnenheit, die die Manie austariert. Mit ihrer Hilfe kann die Beziehung zwischen begeisterten Aufwallungen und pragmatischer Alltagsbewältigung changieren. Auf den Rausch der Intensität folgt die Ausnüchterung, die eine Zeit der Erholung ist, ein Kräftesammeln für kommende intensive Begegnungen. Das oft ungeliebte gewöhnliche Leben, in dem sich die Differenzen der Ichs bemerkbar machen, übernimmt vorübergehend die Regie. In ähnlicher Form gilt das auch für andere Beziehungen, familiäre, freundschaftliche, kollegiale. In allen Fällen kann der Alltag auch Heimat sein, und auch er kann schön sein, wie jede Landschaft, die in den Augen ihrer Betrachter so erscheint.
Von der Schönheit der Heimat in den Augen ihrer Betrachter
Liebende, die in einer Waldwiese versinken, folgen der Logik der Gefühle, die sie in sich verspüren. Vielleicht folgen sie jedoch auch der Logik der Landschaft, die sie zu Gefühlen ermuntert. Entgegen dem äußeren Anschein ist eine Umgebung nicht einfach nur da, sie ruft auch Gedanken und Gefühle wach, regt etwa ein Verweilen an oder hält davon ab. Sie kann befremden oder die Geborgenheit einer Heimat vermitteln, sei es für die Liebe oder andere Tätigkeiten und Seinsweisen, momentan oder anhaltend. Manche halten Landschaft für völlig überwertet, nichts als Kulisse, aber es gibt kein Entrinnen: Leben ist immer Leben in einer Landschaft. Heimat ebenso. Die jeweilige Umgebung zu ignorieren dient allenfalls dazu, eine eventuelle Belastung durch sie abzumildern. Sie zu affirmieren, also willentlich zu bejahen, erleichtert die Beheimatung in ihr. Heimat kann die Bedeutung sein, die einer Landschaft gegeben wird, sei es aufgrund einer Erfahrung von Liebe in ihr oder auch zu ihr selbst.
Ursprünglich waren mit Landschaft (im Deutschen) die Bewohner eines Landes gemeint, bevor ein geographischer Begriff daraus wurde, der ein Stück Land, eine Gegend und Umgebung bezeichnet. Eine Landschaft kann die Gewissheit bieten, die sich viele von einer Heimat erhoffen, um mit Blick darauf ihr Leben einrichten zu können, und sei es nur für einen Moment, zunächst in Bezug auf natürliche Landschaften: Ein Gewässer bleibt noch für lange Zeit Bach, Fluss, See und Meer. In endlosen Zeiten aufgetürmte Berge flachen sich in unvorstellbaren Zeiten wieder ab. Ein Wald mag von Menschenhand gepflanzt worden sein, markiert dann jedoch über Generationen hinweg den Horizont. Auch kulturelle Landschaften bleiben für längere Zeit erhalten. Eine Stadtlandschaft wird für Jahrzehnte und Jahrhunderte zum vertrauten Bild. Häuser, die gebaut werden, stehen nicht morgen schon an einem anderen Ort.
All diese Landschaften verkörpern die Wirklichkeit, in deren Rahmen Menschen die Möglichkeiten ihres Lebens durchwandern. In ihnen können sie sich mit traumwandlerischer Sicherheit bewegen, wenn sie mit den Gegebenheiten vertraut sind und sich auskennen. Der Traum vieler ist, dass das auch mit Beziehungslandschaften so sein möge.
Einzelne Elemente fügen sich zum Gesamtbild der Landschaft, in der Heimat zu finden ist. Zu diesem Bild wird eine Umgebung, die als Komposition erscheint, als Zusammensetzung von Komponenten. Die Zusammenhänge der Teile geben dem Ganzen Sinn, zumindest aus subjektiver Sicht. Wo nur Fragmentierung vorherrscht, stellen sich schwerlich Heimatgefühle ein. Zur Grundkonstellation der Landschaft, in der Menschen sich auf Anhieb heimisch fühlen, fügen sich in der Natur Bäume, ein Gewässer, ein Fleckchen Grün wie in Manets Bild, im Hintergrund Berge oder Felsgestein wie in Platons Erzählung, sowie der Himmel, der sich darüber wölbt. Schon auf den ersten Blick kann alles stimmig erscheinen, oder die Komponenten werden nach und nach als stimmiges Ensemble wahrgenommen. Für den Blick des Einzelnen kann auch dort alles zusammenstimmen, wo für Andere nichts zusammenpasst. Was aber subjektiv zusammenstimmt, kann auch objektive Gründe haben: Stimmig ist die Landschaft, die alles fürs Leben bietet. In der Natur ist das oft dort, wo Wasser ist. Das fließt dort, wo Hügel, Berge, Felsen sind. Energie für alle Prozesse liefert der Himmel aus Sonnenlicht.
Für sich genommen kann jede Landschaft ein zufälliges Nebeneinander einzelner Bestandteile sein. Erst Menschen machen daraus das bedeutungsvolle Bild, zu dem sie sich in Beziehung setzen. Räume in ihrem Sein für sich zu sehen, ist schwierig, meist werden sie bereits mit der Bedeutung wahrgenommen, die ihnen individuell (»idyllisches Fleckchen«), auch kulturell (»romantischer Rhein«), zugeschrieben wird. Die Wahrnehmung kann sich im Laufe der Zeiten verändern. Schöne und in diesem Sinne bejahenswerte Erfahrungen hellen eine Landschaft auf, nicht bejahenswerte verdunkeln sie. Einzelheiten, die zu anderer Zeit nicht wahrgenommen wurden, stehen plötzlich klar vor Augen. Was aus der Sicht des Kindes riesig erschien, schrumpft für den Erwachsenen zum kleinen Winkel. Was unerreichbar fern war, rückt nahe. Eine Idylle zu sehen heißt, womöglich etwas zu übersehen, das nicht ins Bild passt, bei anderer Gelegenheit aber bemerkt wird und zu Enttäuschungen führt. Tätigkeiten und Interessen beeinflussen das Bild: Geologen nehmen Naturlandschaften anders wahr als Wanderer. Makler sehen Stadtlandschaften mit anderen Augen als die Bewohner. Menschen mit gewissen Bedürfnissen haben einen Blick für noch ganz andere Details.
Der stimmige Gesamteindruck, zu dem einzelne Elemente sich fügen, ist von Bedeutung, da schon der bloße Anblick das Leben schöner machen kann. Die Landschaft erscheint einem Menschen schön im Sinne von bejahenswert, wenn sie ihm etwas bedeutet. Vielleicht kann er sie mit einem Erlebnis oder einem Traum verknüpfen oder jetzt etwas in ihr fühlen, etwa ein Entzücken oder eine Ehrfurcht. »Schön« ist eine menschliche Bewertung, die außerhalb der menschlichen Sphäre wahrscheinlich bedeutungslos ist. Was die Erfahrung des Schönen jedoch in Menschen auslöst, brachten Studien des Neuroästhetikers Semir Zeki 2011 zum Vorschein: Eine Aktivierung des medialen orbitofrontalen Kortex im Großhirn. Damit geht eine Freisetzung von Energien einher, die brachliegen müssten, wenn diese Seite des Menschseins keine Anregung fände. Der Eindruck des Schönen kann sich aber wieder verlieren und weckt schon aus diesem Grund den Impuls, ihn zu verstetigen. Nichts soll ihm in die Quere kommen, nichts ihn stören oder gar zerstören, keine äußeren Eingriffe und auch keine inneren Stimmen, die beispielsweise auf eine Idealisierung aufmerksam machen.
Was ein Mensch schön findet, färbt auf ihn selbst ab. Er fühlt sich bejahenswerter in einer schönen Umgebung als in einer unschönen, gegen die er anleben müsste, wofür er Energie aufzuwenden hätte, statt welche aufnehmen zu können. Die Landschaft steht ihm nicht nur vor Augen, sondern schlüpft gleichsam durch diese in ihn hinein. Vermittelt vermutlich von Spiegelneuronen des Gehirns, nehmen Gefühle und Gedanken das Gleichmaß dessen an, was aus subjektiver Sicht objektiv zu sehen ist. Eine schöne Landschaft, die einen Menschen mit ihrer Stimmigkeit umfängt, kann daher ein apollinisches Leben inspirieren. Anders jedoch als bei Rainer Maria Rilke, der sich vom Gott der Schönheit auf eine Weise angesprochen fühlte, die ihn in existenzielle Unruhe versetzte (»Du musst dein Leben ändern«, Archaïscher Torso Apolls), beruhigt die schöne Landschaft als Tempel Apolls den Einzelnen: »Du musst dein Leben nicht ändern.« Denn es genügt, sie zu betrachten, um von ihr verändert zu werden.
So kann die Wahrnehmung des Schönen zu einer indirekten Selbstgestaltung werden. Das Zusammenstimmen der einzelnen Elemente im Ensemble der Landschaft inspiriert ein neues Zusammenstimmen auch im Ich. Die ordnende Kraft, die im Äußeren vermutet wird, wird im Inneren des Menschen wirksam und ermöglicht ihm ein bejahenswerteres Leben. Er (oder sie oder divers) schöpft daraus neue Energie und spürt erstmals oder endlich wieder Sinn in sich, der das Leben lebenswert macht. Aus guten Gründen vertrat Albert Camus die Auffassung, dass ein Mensch »allein durch die eingehende Betrachtung einer Landschaft von seiner Zerrissenheit geheilt wird« (Robert Macfarlane, Alte Wege, 2016, 271, mit Bezug auf Albert Camus, Tagebücher 1935-1951, 1961).
Die Schönheit der Landschaft wird aber nicht nur in den Augen ihrer Betrachter geformt. Sie kann auch dafür modelliert werden, Heimatgefühle hervorzurufen. In der fortschreitenden Moderne gewinnt das Metier der Landschaftsgestaltung in dem Maße an Bedeutung, in dem die Landschaftszerstörung durch menschliche Eingriffe um sich greift. Bei der Gestaltung kommt es zusehends darauf an, nicht nur auf das subjektiv ästhetische, sondern auch auf das objektiv ökologische Zusammenstimmen der Komponenten zu achten, damit die Landschaft nicht weiter in zusammenhanglose Fragmente zerfällt. Die inszenierte Landschaft setzt dabei vorzugsweise die Grundkonstellation in Szene: Bäume oder Büsche am Wasser, eingefasst von Gestein, perfekt realisiert im »Wassergarten« von Junya Ishigami in der Nähe der Nasu-Berge nördlich von Tokio, 2019 preisgekrönt. Die Betrachter wissen von der aufwändigen Gestaltung womöglich nichts, nehmen das fertige Kunstwerk der Landschaft aber gerne in Anspruch, spazieren darin herum und richten sich im Umfeld ein: »Schön ist es hier!«
Schön ist die Landschaft in den Augen des Menschen, wenn er sich in ihr geborgen fühlt. Mehr als für die Momentheimat eines Zufallsortes, eines Unterschlupfs, eines Urlaubsortes oder Unterwegsstopps gilt das für die Dauerheimat, die meist die Landschaft ist, die ein Mensch von klein auf vorgefunden hat und in der er aufgewachsen ist. Die Herkunftsheimat im räumlichen und zeitlichen, sozialen und kulturellen Sinne ist ihm vollkommen vertraut. Mit fragloser Selbstverständlichkeit gehört er ihr zu und sie ist in seinen Augen schön, egal, wie es dort aussieht. So groß kann die Liebe zu ihr sein, dass die Kritikfähigkeit verlorengeht, die die Voraussetzung für erforderliche Verbesserungen wäre. Überall ist eine solche Heimat möglich, auch in Gegenden, die Andere für gottverlassen halten, während die Menschen, die dort leben, sie als ihr zutiefst geliebtes Zuhause betrachten. »Ich liebe diesen Ort«, bekannte der Stammesführer Hadschi Ghusa Gul in einem abgelegenen afghanischen Dorf 2018 im Gespräch mit westlichen Besuchern (zeit-Magazin). Es könnte sein, dass er eines Tages fliehen müsste, aber »mein Herz wird immer hier bleiben. Jedes Feld hier hat seinen Namen, ich kenne sie alle. Die Luft riecht hier anders. Auch die Erde hat ihren eigenen Geschmack.«
Und doch kann die Herkunftsheimat dem, der ihr entstammt, auch hässlich erscheinen, und er kann sie hassen, etwa weil sie ihm zusetzt und seiner Entfaltung im Weg steht. Aus diesen oder anderen Gründen entschließt er sich womöglich, sie zugunsten einer Wahlheimat zu verlassen. Anders als eine Pflanze kann ein Mensch sich selbst verpflanzen. Wie eine Pflanze kann er an einem anderen Ort, in einer anderen Landschaft Wurzeln schlagen. Zusätzlich zum Ort der Herkunft, der ersten Heimat, vermag der andere Ort zur zweiten Heimat zu werden. Für immer mehr Menschen werden zweite Heimaten im Laufe der Moderne zur Realität, getrieben von mehr oder weniger zwingenden Notwendigkeiten etwa der Arbeit oder der Liebe, aber auch aus politischen Zwängen oder um überhaupt überleben zu können. Anders, als es der Begriff suggeriert, beruht die Wahlheimat nicht immer auf einer völlig freien Wahl.
Heimat ist sogar dort möglich, wo Menschen nie hinwollten, dann aber Gefallen an dieser Verlegenheitsheimat finden, von der sie nicht mehr wegwollen. Viele derer, die beim Umzug der deutschen Hauptstadt von Bonn nach Berlin gegen Ende des 20. Jahrhunderts ihre erste oder zweite Heimat verlagern mussten, waren darüber nicht sonderlich erfreut. Bis sie bemerkten, dass es sich im damaligen Aschenputtel an der Spree (»arm, aber sexy«) gut leben lässt. Das ist wohl das entscheidende Kriterium für viele: Heimat ist der Ort, an dem es sich gut leben lässt. Oft erst dann, wenn ein Mensch angekommen ist, zeigen sich die Vorzüge des Lebens in der neuen Umgebung, die der Schönheit der Heimat konkrete Konturen verleihen: Ruhe, Ungestörtheit und tolle Freizeitmöglichkeiten auf dem Land, Vielfalt, Abwechslung und verlockende Kulturangebote in der Stadt. Und in jeder Umgebung werden häufig die Lage der Wohnung und ihre Ausstattung, die Freunde im privaten Umfeld und die Kollegen am Arbeitsplatz zu den Vorzügen gezählt. Nicht zuletzt der Arbeitsplatz selbst.
Heimat kann überall dort sein, wo ein Mensch seine Tätigkeit ausübt, mit deren Details er so vertraut wird, dass er seine Arbeitsheimat nebst der zugehörigen Umgebung geradezu liebt und mit niemandem tauschen möchte. Der Arzt fühlt sich zuhause in seiner Praxis, die Lehrerin im Klassenzimmer oder im virtuellen Classroom, der Zimmermann im entstehenden Dachstuhl, die Mechatronikerin in der Werkstatt, der IT-Spezialist am Computer, die Pilotin im Cockpit, der Clickworker auf der Terrasse unter südlicher Sonne, der oder die Barista hinter dem Cafétresen. Und nicht allein die Erwerbsarbeit, sondern alle Arten von Tätigkeit, Muße, Sorge, Hobby und Sport begründen eine Heimat am Lieblingsplatz, sei es im Haus, etwa im eigens installierten Bastelkeller, oder irgendwo draußen, etwa auf dem Fußballplatz.
So sehr verschmelzen Menschen mit ihrer Tätigkeitsheimat, dass sie sich kaum noch ein Leben ohne sie vorstellen können. Wer seine Arbeit liebt, empfindet sie nicht mehr als Last, fürchtet aber womöglich ihren Verlust, wie bei anderen Spielarten der Liebe. Bedrohlich ist ein möglicher Arbeitsplatzverlust wegen materieller Einbußen, noch mehr jedoch, weil das vertraute Umfeld verlassen werden müsste, das so viel Sinn verbürgt. Es wäre daher wichtig, auch der Arbeitsheimat nicht die alleinige Sinngebung im Leben anzuvertrauen, sondern sich daran zu erinnern, dass Heimat in vielen Umgebungen und Landschaften möglich ist. Mehr Bedeutung als äußeren Natur-, Kultur-, Stadt- und Soziallandschaften messen viele ohnehin ihren inneren Wohnlandschaften zu. In allen möglichen Umgebungen brauchen sie vor allem diese innig geliebte intime Welt um sich herum, in der sie ihr Leben einrichten und den Alltag bewältigen können, ein wahres Basislager des Lebens.
Wohnheimat: Vertraute Welten zwischen vier Wänden
Der Rückzug von draußen nach drinnen, von der Welt in die Höhle, ist so alt wie die Menschheit. Das Verlassen der vertrauten Baumkronen erzwang die Suche nach einem Schutzraum im Gelände, um nicht wilden Tieren oder feindlich gesinnten Artgenossen ausgeliefert zu sein. Vertrauensselig unter Sternen zu schlummern, ist eine moderne Idee, die archaische Menschen das Leben gekostet hätte, Romantik konnten sie sich nicht leisten. Sich auszuruhen war von Anfang an eine gefährliche Angelegenheit, daher der Rückzug in jede Art von natürlichem Gewölbe, das Schutz bieten konnte. Heimat ist Schutz, safe space, welcher Art auch immer. Als Menschen begannen, aus Erde, Gräsern, Stroh, Lehm, Holz und Steinen künstliche Höhlen zu bauen, bildete sich die Form des Hauses heraus. Parzellen in immer größeren Häusern wurden schließlich für einige oder einen Einzigen zur Heimat.
Wohnlicher werden Wohnungen, wenn die Wände nicht nackt sind. Bereits in urzeitlichen Höhlen wurden sie dekoriert, anders als in den meisten neuzeitlichen Wohnungen jedoch mit Bildern von eigener Hand. Zur Wohnlichkeit tragen außerdem Gewohnheiten bei, die den Rückzug von den kräftezehrenden Erfordernissen der äußeren Welt erlauben. Rituale des Aufstehens, Essens, Arbeitens, Vergnügens und Zubettgehens gliedern die Zeit, Möbel strukturieren den Raum. Die Bilder an der Wand, der Lieblingsplatz im Wohnzimmer, die üblichen Handlungen in Küche und Bad, ihre Abfolge, auch das Ambiente, das sich dem Geruch verdankt, der in der Luft liegt, sowie dem Arrangement der Lichter am Abend, die Behaglichkeit verströmen: Die Wohnlandschaft ist den Bewohnern vollkommen vertraut. Alle Elemente sind so arrangiert, wie es ihnen gefällt, mag es Anderen auch skurril erscheinen. Mit dem persönlichen Stil des Wohnens entsteht Heimat. Ganz nach den eigenen Vorstellungen leben zu können, macht diesen Ort so angenehm, home sweet home.
Aus dem Schutzraum für den Körper wurde im Laufe langer Zeiten ein Wohnraum für die Seele, in dem Menschen sein können, wie sie wollen, unverstellt und ungehemmt, Lara Wilde durfte einige mit deren Einwilligung in ihrem Habitat fotografieren: Exposed Landscapes (2016-2018). Wenn die Welt da draußen schon kein gemütlicher Ort ist, soll sie es wenigstens hier drinnen sein, wo die Normalität herrscht, die subjektiv als solche empfunden wird. Sie mag langweilig sein, aber sie gewährt die Geborgenheit, nach der diejenigen sich sehnen, die sie etwa bei Krankheit oder in der Fremde entbehren müssen. Nach einem Wohnungseinbruch ist das größte Problem der Verlust des Geborgenheitsgefühls. Weil der schützende Raum so bedeutsam ist, genießt er selbst besonderen Schutz: Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Grundrecht. Auch »Entmietungen« sind keine Bagatelle, daher bewahrt der Mieterschutz davor, ständig um das Dach über dem Kopf fürchten zu müssen.
Wo ist meine Heimat? Inmitten der Dinge, mit denen ich lebe, die zu mir gehören und die ich mitnehme, wenn ich umziehe. Mein altes Sofa ist ein Teil meines Selbst, es hat so viel erlebt und die Kinder sind darauf herumgehüpft. Der schwere Teppich, ein Erbstück, trägt viel zur Atmosphäre bei. Jeder nennt Dinge sein Eigen, die für ihn zur natürlichen Ordnung der Welt gehören, manchmal von Kindheit an. Sollte sich die Ordnung in den Irrungen und Wirrungen des Lebens auflösen, können die vertrauten Dinge die idyllische frühere Welt repräsentieren. Sie sorgen für eine Heimat im Raum, auch wenn sie dem Fortgang in der Zeit unterworfen sind. Manche versuchen, sie vor der Vergänglichkeit zu bewahren, indem sie beispielsweise Vorräte von Glühbirnen anlegen, bevor deren Produktion eingestellt wird. Prompt verstauben die alten Leuchten im Keller, sobald die neuen sich als praktikabler im Einsatz und preiswerter im Unterhalt erweisen. Bis die Enkel eine Entdeckung machen: »Opa, was ist das?« Wahrheitsgemäß kann er antworten: »Das ist der Friedhof meiner Lieblingsdinge.«
In Abstellkammern und auf Trödelmärkten sind all die Dinge zu finden, die von Menschen erzählen können, denen sie etwas bedeutet haben, bevor die Dinge oder sie selbst zu Grabe getragen wurden. Beispielsweise das Tonbandgerät, in das man ein Magnetband einlegen und die Abspieltaste drücken musste, bevor man zu den von einem Radiosender überspielten Popsongs die langen Haare schütteln konnte. Ging etwas schief, gab es »Bandsalat«, einst so verbreitet wie Hawaii-Toasts, die wenige Jahrzehnte später bereits wieder zur kulinarischen Köstlichkeit werden. Dass vorübergehend per Playlistdie Lieblingsmusik gestreamt werden kann, ist auch nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Grab, das der implantierte Chip im Kopf den alten Techniken schaufeln wird, sobald er es ermöglicht, per Gedankenbefehl Musikstücke abzurufen und sie ohne Umwege ins Hörzentrum des Gehirns einzuspeisen.
Im 21. Jahrhundert mutiert Sweet home zum Smart home. Lange war das Zuhause dort, wo der Schlüssel passte. Nun eher dort, wo der Code parat ist, der den Zugang zur Wohnung und umgekehrt aus ihr heraus zur Welt, zu Datenbanken, Bildern und Informationen in digitalen Räumen aufschließt. Benutzeroberflächen, Interfaces, ergänzen Tür und Fenster, um in die digitale Welt hinauszublicken und in sie hineinzugehen. Daten strömen in die Wohnung, mit denen gearbeitet werden kann. Daten strömen aus der Wohnung, mit denen Andere arbeiten können, auch ohne Erlaubnis. Kann der Kaffeemaschine vertraut werden oder ist sie avancierte Abhörtechnik? Wird mit ihrer Hilfe digital, dann real die Wohnung aufgebrochen?
Außer vertrauten Menschen sind auch Quasi-Personen anwesend, die nicht mehr wie früher einfach nur Haustiere sind, die wie Personen betrachtet und behandelt werden. Es handelt sich vielmehr um Hausdiener in Form von lautlosen oder sprechenden Robotern und unsichtbaren Regelsystemen. Niemand muss sich weiter allein fühlen. Verborgene Stimmen, die so vertraut werden wie die der Moderatoren im Lieblingsradiosender, vermögen wie diese eine heimelige Stimmung zu erzeugen. Servicedisplays beanspruchen nicht dieselbe aufdringliche Aufmerksamkeit wie die zuckenden Bilder auf diversen Bildschirmen. Der Kühlschrank bestellt selbstständig die Eier nach, die zum Frühstück verzehrt worden sind, die Drohne des Online-Lebensmittelhändlers setzt sie auf dem Balkon ab, der Hausroboter räumt sie ein, lästige Hausarbeit war gestern: »Dein Zuhause. Neu erfunden.«
Viele finden es gut, wieder Befehle erteilen zu können: »Siri, mach das Licht an!« Oder Befehle zu befolgen, wenn Alexa verkündet: »Heute ist ein Spaziergang-im-Park-Tag!« Nur ein paar Fragen stellen sich noch: Wer ist hier wessen Sklave? Lebe ich noch selbst oder werde ich schon gelebt? Will ich das? Wie kann meine Wohnung weiterhin Heimat, heimelig und behaglich sein, hygge mit einem dänischen Wort, das nicht zufällig in der Zeit der Digitalisierung zum Modewort geworden ist? Vieles spricht dafür, einiges buchstäblich in der Hand zu behalten: Nur der eigene Umgang mit Dingen stellt einen Bezug zu ihnen her und erzeugt Vertrautheit. Je digitaler die Welt, desto wichtiger werden analoge Dinge, auch aus Vorsicht, um nicht vor dem Nichts zu stehen, wenn unfreundliche Menschen die Wohnung hacken oder die Energiezufuhr für den Roboter abreißt und die smarte Schaltzentrale versagt. Bricht das stolze »Internet der Dinge« zusammen, funktioniert nichts mehr.
Begrenzt virtualisierbar ist ohnehin der weiter hinten liegende Höhlenbereich. Zwar können Quasi-Personen auch in den Betten liegen. Wer Störungen des Intimlebens etwa durch Missstimmigkeiten ausschließen will, ist mit Humanoiden gut bedient, die nach Belieben verfügbar sind. Das fehlende Seelenleben ist durch eine intelligente Programmierung sicherlich perfekt zu simulieren. Die Heimat zwischen echten Kissen aber ist für immer unersetzlich. So sehr können Kissen Heimat sein, dass manche die Hohlräume im Koffer damit ausstopfen, um auch unterwegs ihr Zuhause nicht entbehren zu müssen. Intimität mag eine Idee der Vergangenheit sein, im Schlafzimmer aber ist sie der Genuss einer Gegenwart.
Im Grunde ist es unwichtig, was Menschen in den Betten machen, Hauptsache, sie legen sich hinein. So ist der Wechsel von der anstrengenden Vertikalen zur erholsamen Horizontalen zu vollziehen. Die Welt sieht anders aus, wenn sie liegend von unten statt aufrecht von oben betrachtet wird. Alle schätzen die Liegelandschaft als Rückzugsort, der der zeitweiligen Ruhe gewidmet ist. Wonach sonst niemand sucht, wird hier ersehnt: Die geistige Umnachtung, das wirkliche Umgebensein des Geistes von Nacht. Der Geist braucht Erholung, der Schlaf gewährt sie. Das Schlafzimmer stellt Menschen eine Nische zur Verfügung, wenn sie »nicht bei sich« sind, und schützt sie im Schlaf, der sie wehrlos macht. Die Wonne des Zubettgehens wird von diesem Raum ummantelt und ebenso, wenn es denn sein muss, der Schmerz, die Krankheit, letztlich der Tod. Ganz nebenbei sichert das Bett als meistfrequentierter Ort der Liebe die Fortpflanzung, auch unbeabsichtigt, damit das Leben in jedem Fall weitergeht.
Sich zu vergessen und zu verlieren in den Betten, um sich im Schweigen der Nacht vom Lärm des Tages zu erholen – nach dieser Heimat sehnen sich Menschen, wenn sie müde sind. Ja, draußen toben Krisen und Kriege, aber ich kann jetzt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das Bett ist mein Bollwerk gegen alles, was die Welt mir antut, gegen ihre Widersprüche, die schwer auszuhalten sind, gegen ihre Komplexität, die mich zur Verzweiflung treibt. An den Bettpfosten prallt selbst die Dummheit der Vollpfosten ab. Ich bin für das Gute und gegen das Böse, aber im Moment ist mir alles egal, tut mir leid. Morgen werde ich mich wieder sorgen und ärgern, werde zweifeln und verzweifelt sein. Morgen gehe ich mit frischen Kräften in die Welt hinaus und finde sie mit voller Überzeugung frühmorgens schon für einen unschuldigen Augenblick bezaubernd. Jetzt aber liegt aller Zauber in den Kissen, die mich zärtlich umfangen. »Viel schlafen«, riet Friedrich Nietzsche im Buch mit dem trefflichen Titel Morgenröthe (Aphorismus 376): »So wird man auch seinen Morgen wieder haben!«
Körperliche Heimat: Vom Leben in Sinneswelten
Morgens produziert das wohltemperierte Wasser zumindest in der Wohlstandswohnung einen metaphysischen Nebel, der die verträumte innere Welt umhüllt und die wache äußere noch für einen Moment gnädig verbirgt. Die Hände gleiten beim Einseifen wie von selbst über den Körper und ertasten die Konturen seiner Landschaft. Der Schmutz des alten Menschen von gestern wird abgewaschen, Sünden werden fortgespült, die er törichterweise begangen oder bedauerlicherweise unterlassen hat. Während er sich im Wasserstrahl hin- und herwendet wie ein Aal, vollzieht sich eine Verwandlung: Aus dem Vagabunden phantastischer Welten der Nacht wird der neue Mensch des heutigen Tages, der mehr oder weniger frohgemut seinen Geschäften nachgeht. Allmorgendlich beheimatet er sich von Neuem in seinem Körper, den er nachts sich selbst überließ, um in Träumen auf sonderbare Weise außer sich zu sein.
Die morgendliche Waschung ist mehr als eine lästige Verrichtung, bei der Wasser am Körper herabrinnt. Heimat ist dort, wo die Fülle des Sinns ist. Die Sinnlichkeit ist dafür der Anfang. Wer sich zerschlagen und niedergeschlagen fühlte, kehrt erhobenen Hauptes in die Welt zurück. Wer am Boden zerstört war, wird von neuer Lebenslust durchpulst. Die eben noch schmerzenden Glieder erleben eine wundersame Verjüngung, jede Zelle wirkt wie neu geboren. Die Haut, die wie ein frisch gesprengter Rasen duftet, ruft erotische Anwandlungen wach. Nicht von ungefähr wurden in der Antike überall dort, wo Wasser sprudelte, Nymphen vermutet, denen Satyrn nachstellten. Die Dusche könnte der Brunnen sein, der die Fabelwesen birgt, das Badezimmer ein Tempel wohlgesinnter Götter und das herabstürzende Wasser eine Taufe, um für die Wirklichkeit des beginnenden Tages gerüstet zu sein. Mit dem Reset wird die Existenz gemäß dem griechischen Ursprung des Wortes zu einem wahren eksisto: Ich komme aus dem Verborgenen und erhebe mich wie eine Stimme aus dem Schweigen.
Vermutlich erinnert die Momentheimat in der Dusche an die eigentliche Herkunftsheimat, der jeder Mensch entstammt: In der Gebärmutter erlebte er die vollständige Geborgenheit, umgeben von Wärme, ringsum glucksendes Wasser, gedämpfte Stimmen im Hintergrund. Wird alle Sehnsucht nach Heimat von der Erinnerung an diese Erfahrung gespeist? Geboren zu werden heißt, die paradiesische Welt selig schlummernder Möglichkeiten zu verlassen und in die kühle, nüchterne Welt der Wirklichkeit hinaus zu müssen, weil der zeitliche Ablaufplan das so vorgibt, ganz wie unter der Dusche, wo ein ewiges Verweilen ebenfalls nicht vorgesehen ist. Zwar wäre es wünschenswert, ewig drin zu bleiben, wie bei anderen orgiastischen Erlebnissen. Aber shower forever liefe auf die totale Erschöpfung hinaus, wo es doch nur um relative Regeneration geht. Jeden Morgen zeigt sich aufs Neue, was bei der Geburt erstmals erfahren worden ist: Dass trotz aller Widrigkeiten der Welt da draußen eine Heimat in ihr möglich ist, sobald die Angst vor dem Neuen und Fremden überwunden wird.
Das Badezimmer ist ein Ort des Übergangs, räumlich zwischen Wohn- und Schlafzimmer gelegen, zeitlich zwischen Tag und Nacht. Übergänge erweisen sich häufig als schwierig, erleichtert werden sie von Gewohnheiten und Ritualen, daher ist das Badezimmer voll davon. Ist hier etwas nicht am Platz, ist der Morgen schon verdorben. Das Leben braucht diesen minimalen Rahmen, in dem es eingerichtet werden kann, vor allem so früh am Tag, wenn der Mensch noch nicht weiß, wohin mit sich. Niemand will frühmorgens darüber nachdenken, was zu tun ist, alle vertrauen sich lieber den gewohnten Abläufen an. Es gibt Menschen, die völlig frei von Gewohnheiten leben? Dann haben sie kein Badezimmer.
Es ist der Raum für die Pflege des Körpers. Die Heimat muss kein Ort außerhalb des Ich sein. Auch im eigenen Körper kann ich daheim sein, wenn ich mich bemühe, ihn so zu umsorgen, zu pflegen und auszustatten, dass ich mich in ihm wohlfühle. Schon seit Sokrates und Platon gilt der Körper als Wohnung der Seele, als Hülle für den Wesenskern des Lebens. Weil er so nahe ist, kann er jedoch leicht übersehen werden, und so fühlen sich manche fremd in ihm, obwohl er ihnen so vertraut sein könnte wie nichts sonst. Oder er ist ihnen fremd, weil er nicht der Idee entspricht, die sie von ihm haben. Die realen Gegebenheiten können, wie bei anderen Arten von Heimat, auch beim Körper zwar womöglich modifiziert, aber nicht jederzeit beliebig verändert werden. Vielfach gelingt es mit ein wenig Anstrengung, eine Beziehung zu ihm zu begründen, die lebenslang nicht mehr in Frage steht. Erforderlich ist dafür auch, Nachsicht mit ihm zu üben, wenn er schmerzt und kränkelt und überhaupt anders ist, als er sein soll.
Befreunden sollte sich das Ich auch mit befremdlichen Lebewesen, die im Verborgenen in den Landschaften des Körpers gedeihen. Auch wenn ich davon nichts wissen will, weil es unappetitlich erscheint, leben auf meinem Körper, in ihm und um ihn herum Keime, Bakterien, Pilze, Viren, die mit der Umwelt interagieren, in der ich mich bewege (Ed Yong, Winzige Gefährten, 2018). Sie führen ein Eigenleben und haben ihren Anteil an der Gesundheit wie auch an Krankheiten, beeinflussbar immerhin durch mein Verhalten und meine Art der Ernährung. Einige Heimatpflege gilt daher meinem persönlichen Mikrobiom, der Gesamtheit kleinster Organismen, die von größter Bedeutung sind, da sie über das Wohlergehen des Körpers entscheiden. Mikroben der Hautflora wehren schädliche Bakterien ab, ohne zugleich nützliche Keime zu schädigen, wie Antibiotika es tun. Ein keimfreies Leben wäre kein besseres, eher ein bedrohteres, denn Herausforderungen zu meiden, schwächt die Widerstandskräfte. Ein Teil der Lebenskunst besteht darin, das im Blick zu behalten. Verlasse ich meine vertraute Heimat, bin ich fremden Bakterien- und Virenkulturen ausgesetzt, die das Immunsystem unmittelbar irritieren können, mittelbar aber stärken.
Um den Körper zur Wohnung zu machen, in der das Ich ganz und gar daheim ist, lässt sich einiges an ihm gestalten, mit unterschiedlichen Mitteln. Möglich ist auch hier, die Wände zu bemalen, nicht von innen, aber von außen, mit der Folge, sei es erwünscht oder nicht, auch Andere am Anblick der Kunstwerke, Tattoos genannt, teilhaben zu lassen. Im Schwimmbad oder in der öffentlichen Sauna fallen Gemälde, Zeichnungen und Kritzeleien ins Auge, die dem Betrachter ein Rätsel bleiben, wie bei so mancher Kunstausstellung. Zuweilen sind auf einem Rücken Texte zu lesen, die unmöglich für den Besitzer des Körpers selbst geschrieben sein können. Es könnten poetische Botschaften oder auch prosaische Gebrauchsanweisungen für vertraute Andere sein, die sich von dieser Seite her willkommen fühlen dürfen.
Weitergehende Gestaltungen sind mit chirurgischen Eingriffen oder mit einem Bio-Hacking möglich, einer Optimierung des Körpers durch den Einbruch in die eigene Biologie wie in ein Computersystem. Von Eingriffen ins Genom wird erhofft, dass es nicht mehr dem genetischen Zufall überlassen bleibt, welche Eigenschaften ein Ich hat und mit welchem Risiko für Krankheiten es leben muss.
Mit einfacheren Mitteln kann das Gesicht als sichtbarste Partie der Körperlandschaft gestaltet werden, ausgehend vom Blick in den Spiegel, der Fragen aufwirft: Ist es okay, was ich sehe, oder befremdet es mich? Will ich etwas daran ändern? In welchen Gesichtszügen fühle ich mich heimisch, wenn nicht in den gegebenen? Will ich anziehend auf Andere wirken oder mich mit einer Maske den Blicken entziehen?
Die Gesichtszüge sind stumm und sagen doch sehr viel. Mit Mimik und Kosmetik kann ihre Landschaft gestaltet, aber auch verunstaltet werden. Außer von der individuellen Lebensauffassung werden sie von unausgesprochenen Regeln der Kultur, sozialen Schicht oder Gruppe, in deren Rahmen das Ich lebt, geformt und transformiert. Schon aus diesem Grund hat das Gesicht eine eigene Geschichte. Abhängig von der Art und Weise, wie Emotionen ausgedrückt oder unterdrückt werden, verändert es sich im Laufe der Zeit. Eine Station auf diesem Weg sind Emojis, um Gesichtszüge zu repräsentieren, die aber erneut sowohl Wahrheit als auch Maske sein können.
Im 21. Jahrhundert ermöglichen digitale Techniken, vieles auszuprobieren, ohne real etwas zu verändern. Kaum waren Facefilter für die Inszenierung des Ich verfügbar, machten Millionen weltweit davon Gebrauch, bestärkt von der Meinung: »Dein digitales Selbst hat den gleichen Wert wie dein physisches.« Es handelt sich um das nächste Kapitel der immerwährenden Suche eines Ich nach sich. Mit erweiterter Realität, Augmented Reality, kann nun aber endlich jedes Ich aussehen, wie es will, und die Schönheit erlangen, die ihm eine Heimat in sich selbst erlaubt. Die neuen Ideen, was es alles aus sich machen kann, werfen freilich die alten Fragen wieder auf: Was davon ist mein wahres Ich? Oder ist dies das Ende jeder Wahrhaftigkeit? Bei wem darf im sozialen Umgang noch mit einem ungekünstelten Ich gerechnet werden?
Den erweiterten technischen Möglichkeiten ging, wie so oft, die Kunst voraus. Unermüdlich dokumentierte die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman seit 1975 in fotografischen Selbstporträts, wie Gesichtszüge vielfach variiert werden können. Als Darstellerin vor der eigenen Kamera versuchte sie herauszufinden (und die Betrachter konnten ihr dabei folgen), wie es ist, in den jeweiligen Gesichtszügen glücklich beheimatet oder unglücklich eingesperrt zu sein, gebunden an die Rollen etwa als Sekretärin, Hausfrau, Unwissende, Intellektuelle, Gelangweilte, Unbedarfte, Durchtriebene, Wartende, Zweifelnde, Verzweifelte, Enttäuschte, Entsetzte, Verführerische, Verruchte, Verlorene, Braut, Mutter, Hure, Opfer, Mörderin, Junge, Mädchen, Puppe, Clown, alternder Vamp, gläubige Jüngerin, Transvestit, Schüchterne, Abgestürzte, Reiche, Arme, Arrogante, Gleichgültige, Kätzchen, Monster, Magierin, Heilige, Vergewaltigte, Kranke, ja, auch als Tote und Verweste.
Aber nicht nur das eigene Gesicht kann Heimat sein. Mehr noch als beim Blick auf ihr Selfie empfinden Menschen Heimatgefühle beim Blick in das Gesicht eines vertrauten Anderen. Insbesondere die Augenpartie ist die Mikrolandschaft, die das Innenleben so unverstellt nach außen trägt, dass es gegebenenfalls mit einer Brille abgeschottet werden muss. Falten und Fältchen oder deren Fehlen erzählen von freudigen und befremdlichen Erfahrungen, von Träumen, Enttäuschungen, Erwartungen, Wünschen und Sehnsüchten, von Lüsten und Abenteuerlust, von Schmerzen und Ängsten. Der Ärger ist zu sehen, auch schon der Ärger, der sich nur als Möglichkeit ankündigt. Die Augen halten sich zurück oder warten ab, schließen sich oder öffnen sich weit für die Welt, die sich in ihnen spiegelt wie auf einer glatten oder bewegten Wasseroberfläche. In manchen Fällen haben die Augen schon so viel gesehen, dass sie nur noch aus dunklen Höhlen blicken, um maximale Distanz zu wahren.
Für Liebende wird der Blick in die Augen des Anderen geradezu zur Augenweide, Weide im ursprünglichen (mittelhochdeutschen) Sinn einer Speise, daher auch Augenschmaus. Ein einziger Augenblick macht deutlich, was daran so nahrhaft sein kann: Die vom Anderen ausgestrahlte Energie teilt sich durch die Augen mit, weckt Vertrauen, macht Mut, vermittelt Trost. Sich an dieser Energie wechselseitig laben zu können, macht das Wesen der Liebe aus. Bleiben Blicke jedoch unbeantwortet, sodass keine Energien mehr ausgetauscht werden können, schrumpft zur Endlichkeit, was zuvor Unendlichkeit war. Nicht mehr in die Augen des Anderen geht der Blick, sondern durch sie hindurch auf imaginäre Landschaften, in denen sich schemenhaft bereits die Umrisse einer neuen, vielversprechenden Heimat abzeichnen.
Vielfältige sinnliche Erfahrungen charakterisieren die körperliche Heimat, die dem Ich vertraut ist, oft verbunden mit der Herkunftsheimat, die ihm viel bedeutet, oder mit zweiten und weiteren Heimaten, zu denen eine sinnliche Beziehung entsteht. Ansprechend ist außer dem Blick auf die Menschen, die Heimat sind, auch der Blick auf dieses Haus, diese Straße, diesen Platz, diesen Hain, diesen Baum, diesen See, diese Berge, dieses Tal, diesen Himmel. Wie jede Liebe geht auch die zum Heimatort durch den Magen: Heimat ist dort, wo mir die Suppe schmeckt, die nur hier so zubereitet wird, dass sie den Gaumen schwelgen lässt. Die Geräusche der Heimat klingen beruhigend in den Ohren, egal, ob es ärgerlicher Straßenlärm oder zarte Zithermusik ist (Forschungsfeld Akustische Anthropologie). Der Wind streicht über die Wangen wie nirgendwo sonst. Die bekannten Wege machen es kinderleicht, sich zu bewegen, und zahllose Antennen des Körpers nehmen Schwingungen wahr, die auch denen Orientierung bieten können, die schicksalhaft nichts sehen oder hören.
Das Brot duftet nach Heimat, schon bevor es gegessen wird. Viele Menschen, auch ich, sind dort daheim, wo sie Kaffee riechen und schmecken. Und alle Menschen sind beheimatet bei dem Anderen, den sie »gut riechen können«. Gerüche legen sogar dann Zeugnis für die Heimat ab, wenn sie vom vertrauten Ort abgelöst sind. Ein wohlbekannter Duft, der irgendwo in die Nase steigt, kann augenblicklich Heimatgefühle hervorrufen. Für mich ist es der Duft von Phlox, dessen weiße, rosafarbene, rote, blaue oder violette Blüten auf hohen Stielen schwanken. Anblick und Geruch katapultieren mich sofort zurück in die Kindheit, denn das war die Blume meines Vaters, die er vor und hinter dem Haus pflanzte und pflegte und die den ganzen Sommer hindurch blühte. Begegne ich einem Phlox, beuge ich mich zu ihm hinab, ziehe seine herbsüße Duftwolke tief in meine Nase und küsse dankbar die Blütenblätter. Gut vorstellbar, dass Menschen, die am Verlust des Geruchssinns (Anosmie) leiden, ein wertvolles Stück Heimat entbehren müssen.