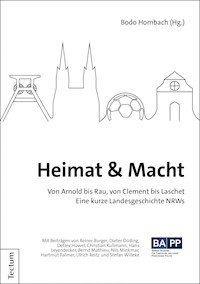
Heimat & Macht E-Book
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach Identität hat der Begriff der Heimat in den letzten Jahren eine ungeahnte Renaissance erlebt. Doch wo sie zu verorten ist, was sie ausmacht, wird kontrovers diskutiert. Ist Nordrhein-Westfalen für die Menschen, die hier leben, Heimat? Welche Identität hat das bevölkerungsreichste Bundesland überhaupt, und was haben seine Ministerpräsidenten aus diesem ursprünglich von britischen und amerikanischen Besatzern gegründeten Bindestrich-Land gemacht, etwa in punkto Innovation, Einwanderung und Integration? Wer von ihnen konnte das Land am nachhaltigsten prägen? Und was war der Steinkohle-Bergbau: Segen oder Fluch? Dieses Buch haben Journalisten geschrieben – eine Spezies mit der Leidenschaft zur Recherche und der Lust an der Pointe. Auf diese Weise ist ein temporeiches und dabei ebenso informatives wie unterhaltsames und anekdotenreiches Werk entstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bodo Hombach (Hg.)
Heimat & Macht
Bodo Hombach (Hg.)
Heimat & Macht
Von Arnold bis Rau, von Clement bis Laschet – Eine kurze Landesgeschichte NRWs
Tectum Verlag
Bodo Hombach (Hg.)
Heimat & Macht. Von Arnold bis Rau, von Clement bis Laschet – Eine kurze Landesgeschichte NRWs
© Tectum– ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019
ePub: 978-3-8288-7226-4
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4225-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: © Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Informationen zum Verlagsprogramm finden Sie unter
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available online at http://dnb.ddb.de.
Inhaltsverzeichnis
Die Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen
Vorwort von Christian Kullmann
Nordrhein-Westfalen – Eine politische Heimatkunde
von Ulrich Reitz
Die frühen Jahre: Von Amelunxen bis Meyers
von Detlev Hüwel
Ministerpräsident Heinz Kühn – Erneuerer und Gestalter
von Dieter Düding
Politik als Nächstenliebe zur Welt – Zwei Jahrzehnte Johannes Rau
von Hans Leyendecker
Immer unter Dampf: Wolfgang Clement – das genaue Gegenteil seines Vorgängers Johannes Rau
von Hartmut Palmer
Der lange Weg in kurzer Zeit – Wie Peer Steinbrück befremdete, überzeugte und verlor
von Nils Minkmar
Jürgen Rüttgers und die Spuren des rheinischen Katholizismus
von Bernd Mathieu
Hannelore Kraft – Aufstieg und Fall einer sozialdemokratischen Hoffnungsträgerin
von Reiner Burger
Der Unterschätzte: Armin Laschet hat die Macht nicht erobert. Sie ist ihm zugefallen. Was fängt er mit ihr an?
von Stefan Willeke
Der Binde-Strich im Land – Ein Lob des Föderalismus
Nachwort von Bodo Hombach
Autorenverzeichnis
Namensverzeichnis
Die Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen
Vorwort von Christian Kullmann
Elf insgesamt: zehn Männer, eine Frau; 292 Tage bis 20 Jahre; allein oder mit Partnern – alle diese Zahlen und Fakten erzählen eine Geschichte. Die Geschichte eines hohen Amtes und seiner Inhaber, der Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie waren und sie sind die Autoren und Gestalter, die die Geschichte des Landes vielfältig und bisweilen widersprüchlich geprägt und geschrieben haben – jeder in seinem ganz eigenen Stil. Das vorliegende Buch würdigt Verdienste und Leistungen, es zeichnet eine Skizze politischer, auch persönlicher Arbeit. Dabei ist kein Geschichtsbuch im klassischen Sinne entstanden. Elf Experten – Historiker wie Journalisten – würdigen elf Persönlichkeiten von Rudolf Amelunxen bis Armin Laschet. Und sie schaffen damit zugleich eine kurzweilige und authentische literarische Reise durch über 70 Jahre Landesgeschichte.
Diese Geschichte beginnt im August 1946. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg galt es im jungen Bundesland Nordrhein-Westfalen, „die Richtlinien der Politik“ zu bestimmen und dafür die Verantwortung zu tragen. So ist das Amtsverständnis des Ministerpräsidenten in der Landesverfassung seither definiert, so wird es heute von Armin Laschet in der Tradition seiner Amtsvorgänger erwartet. Laschet gibt die Richtung vor in einem Bundesland, in dem man damals wie heute das industrielle Herz Deutschlands schlagen hört – wenn auch in einem anderen Rhythmus. Über Jahrzehnte war Nordrhein-Westfalen das Energieland Nummer eins. Trotz des Strukturwandels und eines jahrzehntelangen, eher unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums bildet das Land mit seinem Bruttoinlandsprodukt das wirtschaftsstärkste in ganz Deutschland. An Rhein und Ruhr werden heute mehr als ein Fünftel der deutschen Wirtschaftsleistung erwirtschaftet.
„It’s the economy, stupid!“ Zu Deutsch: „Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!“ Dieses Motto aus dem amerikanischen Clinton-Wahlkampf bringt auf den Punkt, dass es die Wirtschaftslage ist, die entscheidet. Für Wahlkämpfe. Für die Menschen. Vor allem für erfolgreiches Regierungshandeln.
Wäre das Land ein eigener Staat, stünde er wirtschaftlich auf Rang 19 in der Welt – hinter der Türkei und vor der Schweiz. Das kommt nicht von ungefähr. Dahinter stecken Fleiß, Unternehmergeist – und eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Das Rückgrat der Wirtschaft sind kleine und mittlere Unternehmen, unter ihnen 150 sogenannte „Hidden Champions“, also meist im Verborgenen arbeitende Firmen mit internationalem Erfolg. Inzwischen werden in NRW die meisten Start-ups gezählt – mehr als in Berlin oder München. Wie Lokomotiven wirken daneben die Großunternehmen: 19 der größten 50 in Deutschland sind hier zu Hause. Maschinenbau, Chemieindustrie, Metallerzeugung und -verarbeitung sowie Automobile sind die Branchen, die das Land – gemessen am Umsatz und in dieser Reihenfolge – prägen. Innerhalb der Chemiebranche liegt NRW europaweit auf Rang 5 und weltweit auf Rang 14. Kein Zweifel: Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Wirtschaftsland!
Ein starkes Land braucht eine starke Führung – damit es auch wirtschaftlich stark bleibt. Die Personen im Amt des MP, wie es im Behördendeutsch heißt, waren dafür in den vergangenen sieben Jahrzehnten verantwortlich, haben ihre Akzente in der Wirtschafts- und Industriepolitik gesetzt: je nach parteipolitischer Ausrichtung und gesellschaftspolitischer Notwendigkeit. Ausgerichtet an ihren Zielen, ihren Werten und ihrer Persönlichkeit.
Sie alle eint dabei eine Grundhaltung, die die Verfassungsväter vor mehr als 70 Jahren wegweisend formuliert haben: „Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Arbeitskraft hat den Vorrang vor dem Schutz materiellen Besitzes. Jedermann hat ein Recht auf Arbeit“ (Art. 24 Landesverfassung). Bemerkenswert: Sogar von einer Vergesellschaftung ist hier die Rede: „Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen Stellung besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum überführt werden“ (Art. 27 Landesverfassung). Eine Forderung, die sich heute nur aus dem historischen Kontext erklären lässt.
Zugleich hält die Landesverfassung in diesen Passagen fest, was Ministerpräsident Karl Arnold einst als „soziales Gewissen“ bezeichnet hat. Frei nach der katholischen Soziallehre: Der Mensch ist wichtiger als die Sache. Gute nordrhein-westfälische Politik sucht daher stets den Ausgleich zwischen ökonomischer Vernunft und sozialen Bedürfnissen – und steht damit beispielhaft für das erfolgreiche gesellschafts- und wirtschaftspolitische Leitbild der Bundesrepublik Deutschland, für die Soziale Marktwirtschaft.
Die Ministerpräsidenten tragen eine hohe Verantwortung für unser Land: Was gut ist für Industrie und Wachstum, ist gut für die Menschen. Das klingt so einfach. Klientelpolitik, die nur wenigen nützt und viele überfordert, sollte es nicht sein. Und Ausnahmen dürfen nicht zur Regel werden. Diese Orientierung am Gemeinwohl hieß bei Ludwig Erhard „Wohlstand für alle“. Ein gutes Ziel. Nur Wachstum schafft „gute Arbeit“. Aber ohne „gute Arbeit“ kann es kein Wachstum geben.
Um dies zu erreichen, sind die Interessen von Kapital und Arbeit immer wieder neu zu balancieren. Am Gemeinwohl orientiert und mit einem langen Blick. Die liebevolle Bezeichnung des MP als „Landesvater“ (oder „-mutter“) geht auf diese Eigenschaften zurück. Landesmütter und Landesväter dieser Art sind auch in Zukunft zeitgemäß.
Die Portraits in diesem Buch zeugen von verantwortlichem Handeln und Wirken und nicht zuletzt davon, dass auch Ministerpräsidenten einfach nur Menschen sind. Die gesammelten Geschichten erzählen von Größe und von Schwäche, von kleinen Wundern und von großen Fehlern. Sie bringen uns elf Menschen ganz persönlich näher, über deren politische Verdienste sich eben erst dann belastbar urteilen lässt, wenn die Geschichte einen Rückblick aus der Distanz erlaubt. Sie alle verband und verbindet eins: für unser Land stets das Beste zu suchen.
Nordrhein-Westfalen – Eine politische Heimatkunde
von Ulrich Reitz
Inhalt
I. Herzkammer
Weshalb Nordrhein-Westfalen ein linkes Land ist – was das mit Karl Arnold zu tun hat – mit Jürgen Rüttgers – und mit Armin Laschet – Die Wende der FDP – Weshalb Bayern (noch?) ein rechtes Land ist
II. Pendelpolitik
Bund und Land, Hand in Hand – Kraft will nicht nach Berlin – Arnolds Kampf mit Adenauer – Kühn und die FDP – Rau und die Grünen – Merkel opfert Rüttgers – Steinbrücks Geheimplan – Laschets Spion
III. Bonner Republik
Wie Wolfgang Schäuble die „Bonner Republik“ Adenauers im Alleingang abschaffte – Der „Westen“ als Deutschlands Staatsräson – was das für Nordrhein-Westfalen bedeutet – Warum Benelux näher liegt als Berlin und Dresden
IV. Heimat
Sigmar Gabriel: Wir leben in Zeiten der Suche nach Identität – Identitär? – Giovanni Ali Lewandowski-Müller – 1000 Jahre Bayern, 70 Jahre NRW – Essen versus Dortmund – Der Identitätspolitiker Armin Laschet – Arbeiter-Verräter?
V. Wir in Nordrhein-Westfalen
VI. Schattenregierung
IC 72 oder Friedel Neubers polit-ökonomisches System – Raus Kampf gegen Schröder – Die Strukturpolitik der WestLB – Die CDU in der „Konsensfalle“ – Die Flugaffäre oder: Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein
VII. Unter Tage
Hightech unter Tage – Von wegen nur Maschinenbau und Autos: Wie der Bergbau Deutschland prägte – Pate Europas – Montan-Mitbestimmung statt Klassenkampf – Von schwarzen und von grünen Subventionen – Werner Müller
VIII. Innovation
China, China, China – Peer S. trifft „Commander Wu“ – Karl Ganser – Wolfgang Clement oder Modernisierung über Infrastruktur – Logistik heißt jetzt: Erich Staake – Meyers, Kühn, Rüttgers und die Unis – E-Mobilität: Günther Schuh
IX. Integration
Einwanderungsland war Nordrhein-Westfalen schon immer – Die empathische und die repressive Seite der Integrationspolitik – Der Fall Sami A. – Gegen den Strich: Willkommenskultur – El-Mafaalani – Eine Chefärztin
X. Literatur
I. Herzkammer
Weshalb Nordrhein-Westfalen ein linkes Land ist – was das mit Karl Arnold zu tun hat – mit Jürgen Rüttgers – und mit Armin Laschet – Die Wende der FDP – Weshalb Bayern (noch?) ein rechtes Land ist
Nordrhein-Westfalen ist, im Gegensatz zu Bayern, ein linkes Bundesland. Und so, wie das Rechtssein Bayerns an der CSU liegt, liegt das Linkssein Nordrhein-Westfalens an der CDU.
Wie das, werden jetzt einige vielleicht fragen: Nordrhein-Westfalen, das sei doch die „Herzkammer der Sozialdemokratie“ – und wenn Nordrhein-Westfalen also links sei, dann müsse das doch an der SPD liegen. Denn die hat schließlich bis dato in 43 Jahren der gut 70-jährigen Landesgeschichte den Ministerpräsidenten gestellt.
In Bayern allerdings, der rechten Alternative zu Nordrhein-Westfalen, erzählen die parteipolitischen Zahlen eine weitaus eindeutigere Geschichte. Dort konnte die CSU den Ministerpräsidenten 61 Jahre lang stellen, und ein Ende dieser ganz und gar einmaligen christsozialen Erfolgsgeschichte ist auch nicht in Sicht, selbst wenn den CSUlern das hypernervöse öffentliche Schlottern um ihre Macht in den Genen zu liegen scheint. Daran ändert auch wenig, dass die CSU nach der Landtagswahl 2018 eine Koalition bilden musste, weil sie ihre absolute Mehrheit einbüßte. Das Bündnis bildete sie allerdings mit den Freien Wählern, die in Bayern so etwas wie eine lokalere CSU sind.
Die CSU und Bayern, das ist sozusagen eins. Von der SPD und Nordrhein-Westfalen wird man das kaum sagen können. Denn immerhin 27 Jahre wird das Land von Regierungschefs der CDU geführt. Die SPD stellte sechs Ministerpräsidenten, die CDU brachte es auf vier. Und die Hälfte der NRW-Zeitrechnung bildete die CDU die stärkste Kraft im Landesparlament. Dass die SPD es auf weitaus mehr Regierungsjahre bringt als die CDU, liegt nur eingeschränkt an der Sozialdemokratie selbst, sondern an FDP und Grünen, die der SPD als Koalitionspartner zu diesem Vorsprung an Jahren verhalfen.
Auch in den Kommunen ging es zwischen SPD und CDU hin und her. Nicht einmal das Ruhrgebiet war für die Sozialdemokraten auf kommunaler Ebene immer eine sichere Bank. Unterm Strich kann man sagen: Das auch heute noch in vielen Berichten gebrauchte Wort von Nordrhein-Westfalen als „Herzkammer der Sozialdemokratie“ ist ein wirklich gelungener PR-Coup der SPD, den die CDU meistens noch medial unterstützt, damit ihre Wahlsiege sozusagen in Feindesland dann umso glanzvoller ausfallen. Tatsächlich ist „Herzkammer der Sozialdemokratie“ ein sorgsam gepflegter Mythos.
Sozialdemokratisch regiert heißt nicht automatisch: sozialdemokratisch geprägt. Die SPD hat unter ihren Koalitionspartnern noch stets gelitten und ganz gleich, ob die Roten mit den Gelben regierten oder mit den Grünen, stets erscholl aus der SPD-Führung schon nach kürzester Zeit der Ruf nach: rot pur. Die SPD wollte von ihren Koalitionen früh erlöst werden, sie betrachtete sie im Grunde als Unfälle der Geschichte. Der Grund dafür liegt in einer idealistischen Überheblichkeit: Die meisten Vertreter der SPD glauben, die Regentschaft Nordrhein-Westfalens gebühre ihnen, weil dieses Land aufgrund seiner Geschichte und seiner Sozialstruktur in besonderer Weise sozial gerecht regiert werden müsse und weil aus sozialdemokratischer Sicht ohnehin im Recht ist, wer antritt, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
An dieser Stelle kommt nun die CDU ins Spiel. Von den vier Ministerpräsidenten, die Christdemokraten waren oder sind, wird man, mit einer Ausnahme, drei auf dem linken Flügel verorten können. Das gilt für einen ganz besonders: Karl Arnold. Da Arnold nicht nur der erste frei gewählte Regierungschef Nordrhein-Westfalens war, sondern von allen Christdemokraten auch am längsten regierte – neun Jahre lang –, prägte er die Identität der CDU am nachdrücklichsten. Der wichtigste Satz seiner Amtszeit war ein programmatisches Versprechen, das weit über die Grenzen seines eigenen Bundeslandes hinausreichte: Nordrhein-Westfalen werde das „soziale Gewissen“ der gesamten deutschen Republik sein. Es gibt keinen einzigen Sozialdemokraten, der diesen Satz nicht unterschreiben würde. Für die Christdemokraten gilt das ebenso – wenngleich mit einer Ausnahme: Franz Meyers aus Mönchengladbach war dieses soziale Sendungsbewusstsein fremd, er war das, was man heute konservativ-liberal nennen würde, abgemildert von einem guten Schuss rheinischer Geselligkeit (einmal fiel er bei einem Karnevalsumzug vom Pferd). Weil er in der Geschichte der CDU fast so etwas ist wie eine seltsame Ausnahme war, ist Meyers heute so gut wie vergessen.
Letzten Endes liegt es an Karl Arnold, dass Nordrhein-Westfalen heute ein linkes Bundesland ist.
An dieser Stelle ein kurzer Rekurs auf „links“ und „rechts“: Für den langjährigen und einflussreichen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler stammen die dichotomischen Begriffe aus dem Reich der „politischen Gesäßgeografie“, seien der realpolitischen Wirklichkeit nicht mehr angemessen. Die Welt sei grauer, die Unterteilung schwarz und weiß eine allzu grobe Vereinfachung. Das stimmt, und es stimmt auch wieder nicht. Natürlich ist für die Vertreter der Linkspartei die SPD eine rechte Partei. So, wie für Vertreter der AfD die CDU eine linke Partei ist. Aber diese Kategorisierungen durch Linkspartei wie AfD folgen nicht dem Bemühen um möglichst große Exaktheit in der politischen Positionsbestimmung, sondern um möglichst großen Eigennutz. Wenn man selbst den durchaus arroganten Anspruch erhebt, als einzige Formation über links bzw. rechts entscheiden zu können, muss der andere schon ein Abweichler sein, um diesen Anspruch untermauern zu können. Dasselbe hatte Heiner Geißler im Sinn: Er wünschte, die Unterschiede zwischen rechts und links zu verwischen, um die CDU an ihrem Vorsitzenden Helmut Kohl vorbei ein Stück weit nach links zu rücken, etwa in der Sozial-, aber auch in der Deutschlandpolitik in den Jahren vor der Wiedervereinigung.
Selbstredend sind Jürgen Rüttgers und Armin Laschet nicht so links, wie es Heinz Kühn oder Johannes Rau oder Hannelore Kraft waren oder sind. Aus der Sicht von Angela Merkel wiederum sieht das anders aus: Jenen Rüttgers, der ihre liberale Wende zu Beginn der Nullerjahre auf dem Leipziger Parteitag mit voller Wucht und taktischer Finesse gleichermaßen bekämpfte, der sich für eine „Generalrevision“ der Hartz-Gesetze der Regierung Gerhard Schröders Richtung „Gerechtigkeit“ stark machte, die damals Merkel in Richtung sozialer Strenge nicht einmal weit genug gingen, jenen Rüttgers aus dem niederrheinischen Braunkohlenrevier bei Brauweiler musste sie für links halten. Rüttgers selbst wiederum hält sich für einen Mann der Mitte, aber das tat auch schon Rüttgers’ großes Vorbild Konrad Adenauer. Und den wiederum hielt Karl Arnold für ausgesprochen rechts, wobei aus dem, wie Arnold und Adenauer übereinander dachten, ein Machtkampf erwuchs, der mit harten Bandagen ausgefochten wurde. Dabei konnte mal Arnold siegen (gegen Adenauers Wunsch setzte er eine Große Koalition mit der SPD in Düsseldorf durch), mal Adenauer (gegen Arnolds Wunsch setzte er eine kleine Koalition mit der FDP in Bonn durch).
Wolfgang Clement und Peer Steinbrück, diese Brüder im forschen Geiste, hatten für die meisten ihrer Parteifreunde wenig mehr übrig als Spott. Als Regierende hielten sie sich für Überflieger, vielleicht sogar zu Recht, sahen die meisten Genossen in ihrem Bundesland in einem provinziell-miefigen Linkssein gefangen und verzwergt. Sie wollten einen Neuanfang, auch einen ihrer eigenen Partei. Schließlich spielte der Zeitgeist auch eine Rolle – und der war Ende der neunziger, anfangs der Nullerjahre eher neoliberal. Wirtschaftsliberal zu sein galt als modern. Aber waren Clement und Steinbrück, von denen einer bis heute bewusst Sozialdemokrat geblieben ist, deshalb schon rechts? Überhaupt – die SPD. Sie war einmal, heute mutet das fast seltsam an, ausgesprochen national. Adenauer hielt den SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher für einen „Nationalisten“, der wiederum hielt den Alten aus Rhöndorf für den „Kanzler der Alliierten“. Wenn die Schumacher-SPD links war, dann wegen ihrer wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen, darum nannte sie sich „sozialistisch“. Außen- und deutschlandpolitisch war sie rechts: Ihre Skepsis gegen Adenauers Westbindung, gegenüber Europa schlechthin, ihr Wunsch nach einer gewissen Hinwendung Richtung Russland – diese Positionen finden sich heute weit rechts von der CDU: in der AfD.
Man sieht: mit dem Verzicht auf die Kategorien links und rechts kommt man auch nicht viel weiter. Man landet bei fortwährenden Relativierungen und spitzfindigen Definitionsversuchen. Und da wir hier kein überbordendes Werk verfassen wollen, schreiben wir weiter von links und rechts, mit Helmut Kohl und Gerhard Schröder wissend, dass Wahlen „immer in der Mitte gewonnen werden“, und auf die Vernunft der Leser bauend, die schon ein Gefühl dafür haben, wie es gemeint ist.
Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen eben ein linkes Bundesland.
Dafür sind auch FDP und Grüne verantwortlich, Grüne freilich stärker als Liberale.
Das verdeutlicht ein Blick in die frühe nordrhein-westfälische Landesgeschichte. Für Karl Arnold kam 1947 eine Koalition mit der FDP überhaupt nicht in Betracht. An seinem ersten Kabinett waren alle Parteien beteiligt, es gab sogar zwei kommunistische Minister darin, aber: keinen einzigen von der FDP. Arnold, der soziale Europäer, hielt die FDP für sektiererisch, national und bonzenfreundlich. Adenauer sah das ganz anders. Der „Alte“ machte die erste Bundestagswahl 1949 zur Volksabstimmung über Marktwirtschaft oder Sozialismus, zog knüppelhart gegen die SPD zu Felde und strebte folgerichtig eine Koalition mit der FDP an. Zuvor hatte er sich für das marktwirtschaftliche, ordoliberale Modell des Wirtschaftsprofessors Ludwig Erhard entschieden und damit klar positioniert gegen das Ahlener CDU-Programm, das mit seinen Vorstellungen von einer Verstaatlichung von Schlüsselindustrien im Wesentlichen die Handschrift eines christkatholischen Sozialismus trug, dem sich Arnold verpflichtet fühlte.
Auf wen die Wahl als Koalitionspartner der CDU fiel, auf die FDP oder die SPD, war aus damaliger Sicht weitaus mehr als eine Richtungsentscheidung. Es war eine Systementscheidung. Heute, in einer Zeit, da sich die Programme der Parteien in der Mitte sehr einander genähert haben, mag das schwer nachvollziehbar erscheinen. Damals aber löste der harte Gegensatz von Parteien noch richtiggehende Fehden aus. Jedenfalls war die FDP in Arnolds Augen eine rechte Partei und er wollte links regieren. Also kam für ihn ein liberaler Koalitionspartner nicht in Frage. Und Adenauer, zu dieser Zeit immerhin Fraktionsvorsitzender der CDU im Düsseldorfer Landtag, versuchte alles, um Arnold an der Bildung einer Großen Koalition zu hindern – freilich vergeblich.
An diesem Beispiel sieht man im Übrigen: Geschichte hört nicht auf. Prägungen aus der Vergangenheit wirken lange fort. In den fünfziger Jahren war die FDP eine durchaus nationale Partei, sogar eine, die noch 1953 von den Engländern als Besatzern um ihre nationalsozialistischen Rest-Elemente bereinigt werden musste. Jedenfalls: Als diese FDP mit der SPD Arnold stürzte, um mit dem Sozialdemokraten Fritz Steinhoff 1956 die erste sozialliberale Koalition zu bilden, war dieser „Move“, abgesehen von bundespolitischen Gründen, überhaupt nur möglich wegen der nationalen Gemeinsamkeiten der beiden Parteien, die einen Sturz des „Europäers“ Arnold ideologisch grundierten. Dass die Landes-FDP früher einmal eine nationale Partei war, ist heute fast vergessen. Fast. Burkhard Hirsch ist zwar so etwas wie eine Ikone der linksliberalen FDP und Befürworter von „sozialliberal“, weiß aber noch sehr genau um die nationalliberalen Wurzeln seiner Partei. Deshalb urteilt Hirsch noch heute über den West-Mann Adenauer: „Der wollte die Wiedervereinigung gar nicht.“
Als die FDP zehn Jahre später mit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Heinz Kühn eine Koalition einging, war sie schon eine andere Partei geworden. Unter dem Einfluss einer Riege von jüngeren, ambitionierten Politikern, den „Jungtürken“ Hans-Dietrich Genscher, Willy Weyer und Walter Scheel, waren die Liberalen auf dem Weg zu einer sozialliberalen, also: Mitte-links-Partei. Und der fiel es nicht schwer, sich mit Sozialdemokraten zusammenzutun. Kurze Zeit darauf, 1971, gab sich die FDP mit ihren „Freiburger Thesen“ dann auch ein durchkomponiertes linksliberales Programm. Mit Burkhard Hirsch wurde einer der bis heute einflussreichsten linksliberalen Denker Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident unter Kühn und Rau.
„Jungtürken“ wurden grundsätzlich Reformer nach einer politischen Bewegung in der Türkei unter dem späteren Staatsgründer Kemal Atatürk genannt, die auf liberale Reformen und eine konstitutionelle Staatsform hinarbeiteten. Was damals in der FDP der „Jungtürke“ war, wurde in den Nullerjahren in der CDU der „junge Wilde“: Repräsentanten vom liberalen, ökologischen Flügel, der sich inzwischen auch bei den Christdemokraten gebildet hatte, die folgerichtig auf eine Koalition mit den Grünen hinarbeiteten. Heute koaliert in Nordrhein-Westfalen ein inzwischen älterer Wilder mit den „Jungtürken“ von ehedem: Armin Laschet mit der FDP. Wobei: Laschet könnte ebenso gut mit den Grünen koalieren, dessen Vorgänger Jürgen Rüttgers hatte sogar gezielt auf ein Bündnis mit den Grünen hingearbeitet, was umgekehrt auch für das Verhältnis der Grünen zur nordrhein-westfälischen CDU galt.
Zurück zu den Grünen in den Anfangsjahren. Mit diesen Grünen erging es der SPD in Nordrhein-Westfalen wie zuvor dem sozialdemokratischen Bundeskanzler: Helmut Schmidt hatte die Grünen abgelehnt. Anfangs verstand er sie gar nicht, später verachtete er sie. Helmut Schmidt hatte das grüne Selbstverständnis, deren „Policy-Mix“ aus Anti-Atomkraft, Technik-Skepsis, Feminismus und Friedensbewegung, wie es Peer Steinbrück heute erzählt, „überhaupt nicht auf der Pfanne“. Dieses Nicht-Verstehen, was von der CDU anfangs geteilt wurde (Kurt Biedenkopf war der erste Christdemokrat von Rang, der fand, die Grünen stellten zumindest „die richtigen Fragen“), machte den Aufstieg der Grünen von einer Bewegung zu einer Partei und ihre nachhaltige Etablierung im Parteien-System erst möglich. Als Johannes Rau 1995 erkannte, dass er nur mit Hilfe der Grünen Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben würde, war sein Entsetzen groß, kaum kleiner als das seiner Nachfolger Wolfgang Clement und Peer Steinbrück, denen es in dieser Hinsicht auch nicht besser ergehen sollte.
Für die Sozialdemokraten schloss erst Jahre später Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin Frieden mit den Grünen. Dafür musste sie Kommentare in Kauf nehmen, wonach nicht sie, sondern eigentlich ihre grüne Stellvertreterin Sylvia Löhrmann in diesem Bündnis im „Driver’s Seat“ sitzen würde. Ohne einen Generationswechsel hätte es diesen Kurswechsel der SPD in puncto Grüne kaum geben können: Kraft ist knapp 20 Jahre jünger als Clement und Steinbrück. Eine traditionelle anti-grüne Sozialisation hat sie – zumal als sozialdemokratische Seiteneinsteigerin – nie genossen.
Jedenfalls: Wenn von Nordrhein-Westfalen als einem linken Bundesland gesprochen werden kann, dann liegt das nicht nur an der durchweg sozialen Ausrichtung von Sozialdemokraten wie Union, sondern auch an der seit den sechziger Jahren linksliberalen FDP und den ökolibertären Grünen. Diese wurden in den achtziger Jahren praktisch gegen die Helmut-Schmidt-SPD gegründet, woran Joschka Fischer, so erinnert sich Sylvia Löhrmann, „uns immer wieder erinnert hat“.
Wenn man das alles so liest, könnte man fast meinen, die politischen Parteien hätten das Land geprägt. Es ist aber auch umgekehrt denkbar: Das Land hat auch die Parteien geprägt.
Der Sozialkatholizismus ist die dominierende Denkungsart im Rheinland. Viele Jahre galt: In der Union konnte nur der etwas werden, der aus den Sozialausschüssen kam oder ihnen im Denken nahestand. Dazu ein Beispiel: Heute verdankt die Stadt Düsseldorf ihre Blüte im Wesentlichen einem ordoliberalen oder, wie Linke sagen würden: „neoliberalen“ Oberbürgermeister. (Der Unterschied zwischen ordo- und neoliberal ist markant: Der Ordoliberale braucht den starken Staat, um die Interessen der Gesellschaft gegen die Großindustrie durchsetzen zu können, der Neoliberale will den Staat schwächen, damit die Großindustrie möglichst freie Bahn hat.)
Dass Joachim Erwin überhaupt Oberhaupt der Landeshauptstadt werden konnte, verdankte er einem Irrtum: Als die CDU diesen energischen Mann als ihren Spitzenkandidaten nominierte, ging sie von der festen Annahme aus, die sozialdemokratische Amtsinhaberin Marlies Smeets sei unschlagbar. „Sonst hätten die doch nie einen wie mich genommen“, so hat es Erwin später selbst erzählt. Diesen Irrtum seiner Partei nutzte Erwin aus: Rigoros setzte er durch, was er für richtig befand, etwa den Verkauf der RWE-Anteile der Stadt, ohne auf die Befindlichkeiten seiner christsozialen Parteifreunde Rücksicht zu nehmen. (Den Ruhr-Kommunen empfahl er den RWE-Verkauf gleichfalls; wären sie damals klug genug gewesen, stünden viele von ihnen nicht mehr unter Notverwaltung.) Dem zur selben Zeit als Ministerpräsident eher sozial re- und agierenden Jürgen Rüttgers war Erwin darum in herzlicher Abneigung verbunden. Das galt selbstverständlich beiderseitig.
Dass es bis heute einen signifikanten Unterschied zwischen der rheinischen und der westfälischen CDU gibt, liegt in eben jenem Umstand begründet: Die rheinische CDU ist sozial geprägt, die westfälische liberal. Die rheinische CDU hat dabei stets die bestimmende Macht gehabt: Alle vier christdemokratischen Ministerpräsidenten stammen aus dem Rheinland bzw. vom Niederrhein, mehr noch: Die Landesgeschichte der CDU kennt nicht einen Westfalen als Spitzenkandidaten einer Landtagswahl. Und, Ironie der Geschichte, der prominenteste und erfolgreichste Westfale der CDU heißt Karl-Josef Laumann und ist ein linker Sozialausschüssler.
Von wegen sozialdemokratische Herzkammer: Die SPD musste selbst das Ruhrgebiet erst erobern. Bedingt durch die Einwanderung aus katholisch geprägten Ländern wie Polen, Griechenland, Italien oder Spanien waren im Ruhrgebiet das christkatholische „Zentrum“ und die CDU eine starke Kraft gewesen. Und wegen des großindustriellen Charakters des Reviers und einer klassenkämpferischen Grundeinstellung der Arbeiterschaft waren in den Anfangsjahren Nordrhein-Westfalens die Kommunisten eine echte Macht. Zur dominanten Kraft wurden die Sozialdemokraten erst mit den großen Krisen von Kohle (beginnend Ende der fünfziger Jahre) und Stahl (beginnend Mitte der siebziger Jahre). „Wir werden immer erst gerufen, wenn der Karren in die Grütze fährt“, erklärt Steinbrück die traditionelle Rolle der SPD als Reparaturbetrieb des Industriestaates. Folgt man Steinbrücks Logik für einen Moment, ist die Rolle der CDU der Aufbau, die der SPD die Korrektur damit einhergehender Fehlentwicklungen. Aber ohne die Auflösung des linkskatholischen „Zentrums“, die Marginalisierung der Kommunisten im Zuge des „Kalten Krieges“ und ohne die realpolitische Wende, das „Godesberger Programm“ von 1959, hätte die SPD in den sechziger Jahren kaum zur dann viele Jahre dominierenden Partei im Ruhrgebiet aufsteigen können.
Die Rolle von evangelischer Kirche, traditionell in Nordrhein-Westfalen eher links beheimatet, und katholischer Kirche, die sich in NRW aus dem Sozialen definierte, plus der dominierende Charakter als Land der Großindustrie führte dazu, dass Nordrhein-Westfalen zu einem linken Land wurde. Die großen Parteien nahmen diese mentalen Dispositionen in sich auf und verstärkten diese Prägung noch.
Bayern wurde umgekehrt zu einem rechten Land nicht nur dank der CSU, sondern auch wegen anders gelagerter Voraussetzungen: Hier war der Katholizismus vor allem konservativ grundiert, und es gab und gibt einen starken Mittelstand aus Industrie und Handwerk. Klassenkämpferisches Denken konnte sich hier nie entwickeln, ebenso wenig wie Ideen, wie der Gegensatz von Kapital und Arbeit zu überwinden wäre. Kein Wunder, dass die besondere Form von Montan-Mitbestimmung, die die Macht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach dem Prinzip halbe-halbe aufteilt, eine nordrhein-westfälische Erfindung ist.
Nordrhein-Westfalen ist also mit „Herzkammer der Sozialdemokratie“ mindestens einmal allzu grob beschrieben, auch wenn sich diese Wendung bis heute in der medialen Berichterstattung wiederfindet. Wegen seiner Strukturen und der ausgesprochen sozialen Ausrichtung und Geschichte der CDU ist es aber ein linkes Land geworden.
Bis Ende der fünfziger Jahre, bis zum Beginn der Montankrise, war Nordrhein-Westfalen sogar das „Kernland der CDU“. Konrad Adenauers begnadeter Biograf Hans-Peter Schwarz, von dem diese Charakterisierung stammt, begründete sie so: Adenauers Kabinett von 1957 (er hatte die absolute Mehrheit geholt) bestand im Wesentlichen aus nordrhein-westfälischen Ministern. Der Bundeskanzler – ein Nordrhein-Westfale. Desgleichen der Landwirtschaftsminister (Heinrich Lübke), der Innenminister (Gerhard Schröder), der Arbeits- und Sozialminister (Theo Blank), der Wohnungsbauminister (Paul Lücke) und auch noch der Finanzminister (Franz Etzel). Damit nicht genug: Zum ersten Reformer der Bundes-CDU wurde Franz Meyers (Mönchengladbach), von 1958 bis 1966 NRW-Ministerpräsident. Der CDU-Bundesschatzmeister war mit Ernst Bach ein Bürgermeister wiederum aus NRW und der heimliche Schatzmeister und vielleicht engste Berater Adenauers war der Bankier Robert Pferdmenges, gleichfalls ein Nordrhein-Westfale.
Für die SPD war Nordrhein-Westfalen also keineswegs eine „Bank“, wie das Wort von der „Herzkammer“ nahelegt. Überhaupt leidet die Diskussion an mangelnder Präzision. Es ist doch nicht so, als ob das Zusammenzählen von Landesregierungen das Ergebnis bringen könnte, ob Nordrhein-Westfalen rot oder schwarz geprägt ist. Muss man nicht die politischen Farben in allen Gebietskörperschaften in Rechnung stellen? Und zu welchem Ergebnis findet man dann?
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemeinden, Landtag, Bundestag, Europaparlament – wenn man alle Wahlergebnisse für Nordrhein-Westfalen zusammennimmt, entdeckt man ein relatives Gleichgewicht – mit Vorteilen zugunsten der Christdemokraten. 1949 bis 1952 war Nordrhein-Westfalen durchgängig schwarz. 1961 bis 1964 war es dann wieder so – auf allen Ebenen dominierte die CDU. Rot war Nordrhein-Westfalen von 1989 bis 1994 – ganze fünf Jahre lang. Schwarz dann wieder von 2009 bis 2012. Und seit 2017. Bei der Betrachtung aller politischen Ebenen dominiert ergo nicht die SPD, sondern mit elf zu fünf Jahren schwarz im Verhältnis zu rot pur: die CDU.
Zahlen sind freilich das eine, Wahrnehmungen das andere. Es gab eine Zeit, in der Nordrhein-Westfalen tatsächlich zum sozialdemokratischen Stammland wurde. Und dafür war nur ein Mann verantwortlich: Johannes Rau. Weder sein Vorgänger Kühn noch seine SPD-Nachfolger Clement, Steinbrück und Kraft vermochten eine derart enge und vor allem nachhaltige Bindung zwischen der sozialdemokratischen Partei und dem Bundesland aufzubauen. Clement und Steinbrück wollten das nicht, sie strebten einen Bruch mit der Ära Rau an, und Kraft konnte es nicht, für sie hatten sich auch die strukturellen Verhältnisse geändert. Mit anderen Worten: Kernland der CDU war NRW knapp 20 Jahre lang, Herzkammer der SPD rund 25 Jahre lang, zählt man den Landtag. Nimmt man alle Ebenen, ist NRW eher ein CDU-Land. Aber macht das wirklich einen Unterschied, wenn man in Rechnung stellt, dass in Nordrhein-Westfalen eine eher linke, ausgesprochen sozial ausgerichtete CDU vorherrscht? Eher nicht.
Das heißt freilich nicht, dass es keine Herzkammer der Sozialdemokratie gäbe. Das Herz der SPD – es schlägt in Dortmund. Eindeutig. Dort regieren die Sozialdemokraten ununterbrochen – seit 1946.
II. Pendelpolitik
Bund und Land, Hand in Hand – Kraft will nicht nach Berlin – Arnolds Kampf mit Adenauer – Kühn und die FDP – Rau und die Grünen – Merkel opfert Rüttgers – Steinbrücks Geheimplan – Laschets Spion
2010 wird Hannelore Kraft als stilistische Nachfolgerin von Johannes Rau Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen. Sie hat gezeigt, dass sich mit einem Wir-in-NRW-Gefühlswahlkampf im Johannes-Rau-Land immer noch hinreichend viele Menschen bewegen lassen, ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten zu machen. Kraft benötigt allerdings die taktische Hilfe der Linken und den psychologischen Beistand ihrer grünen Partnerin Sylvia Löhrmann, um Jürgen Rüttgers ablösen zu können. Aber von dieser Art Machtübernahme soll in diesem Kapitel nicht die Rede sein.
Kraft ist gerade im Amt, da passiert in Duisburg die Tragödie. Bei der Love-Parade sterben 21 Menschen, 541 werden schwer verletzt, Hunderte traumatisiert. Und Kraft hält die Trauerrede, die man daraufhin so halten muss: ehrlich betroffen, authentisch tröstend, sehr nahe bei den zutiefst entsetzten und verunsicherten Menschen. Plötzlich ist sie als Politikern und einfühlsame Kümmerin bundesweit bekannt. Das Image, das sie sich im Wahlkampf aufgebaut hat, kann sie mit dieser Rede kraftvoll unterstreichen.
Nur ein Jahr später überholt Kraft die Bundeskanzlerin – sie ist jetzt vor Angela Merkel Deutschlands beliebteste Spitzenpolitikerin. In den Medien ist sie im Gespräch als nächste Kanzlerkandidatin für die SPD und Berliner Sozialdemokraten schlagen die populäre Kraft offiziell dafür vor. Jetzt, auf dem Höhepunkt ihres Ansehens, funktionieren Krafts politische Instinkte noch. Obwohl sie sich als Landespolitikerin sieht, weiß sie, dass man als nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin stets auf Augenhöhe mit dem Bundeskanzler wahrgenommen werden sollte. „Jeder sozialdemokratische Regierungschef in den Ländern hat die nötige politische Erfahrung, um ein solches Amt auskleiden zu können“, sagt sie in einem Interview mit der „Welt“. Sie variiert damit ein älteres Zitat von Johannes Rau, wonach selbstredend der Ministerpräsident des größten Bundeslandes das Zeug zum Bundeskanzler habe. Was Kraft sagt, klingt heute ein wenig kryptisch, aber 2011 hat wohl jeder Krafts Botschaft verstanden. Hier meldet Nordrhein-Westfalens Nummer eins in Richtung eigene Partei und Konkurrenz von der CDU gleichermaßen den Anspruch auf Augenhöhe mit Deutschlands Nummer eins, Angela Merkel, an.
Eine Überraschung ist das nicht. So haben es alle ihre Vorgänger ebenso wie ihr Nachfolger Armin Laschet gehalten, als er in der Diskussion um Merkels Erbe deutlich seine Anwartschaft auf das Bundeskanzleramt anmeldete. Es ist damit quasi eine nordrhein-westfälische Tradition. Sie rührt her aus der Zeit zwischen dem Kriegsende und der Wiedervereinigung, als die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und die Bundeshauptstadt im selben Bundesland und am selben Fluss liegen. Der Rhein als Deutschlands Fluss Nummer eins bildet eine tatsächliche wie symbolische Verbindung zwischen Bonn und Düsseldorf. Es steckt aber viel mehr dahinter als nur die geografische Nähe und ein Fluss als mäandernde Verbindung.
Seit der Nachkriegszeit sind Landes- und Bundespolitik so eng miteinander verknüpft wie in keinem anderen Bundesland. Landespolitische Weichenstellungen haben eine unmittelbare Auswirkung auf große Koalitionsentscheidungen auf der Bundesebene. Zweimal war NRW sozusagen Koalitions-Avantgarde: bei der Bildung der sozialliberalen Koalition von Heinz Kühn und Willy Weyer 1966, der 1969 dieselbe Bündniskonstellation auf Bundesebene folgte, und dann 1995, als Johannes Rau den Grünen Michael Vesper zum stellvertretenden Ministerpräsidenten machte oder vielmehr machen musste. Nach diesem wichtigen Test im Landeslabor kopierten 1998 Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Düsseldorfer Blaupause nach Bonn und dann nach Berlin.
Aber mehr als das: Grundlegende Personalentscheidungen fielen zwischen Düsseldorf und Bonn, später Berlin, im Zusammenspiel zwischen führenden landes- und bundespolitischen Akteuren. Nordrhein-Westfalen war seinerzeit politisch in Deutschland so bedeutsam, dass zwei landespolitische Akteure eine bundespolitische Spitzen-Entscheidung quasi unter sich ausmachen konnten: Wolfgang Clement konnte erst zum Ministerpräsidenten aufsteigen, nachdem klar war, dass der Düsseldorfer Amtsinhaber Johannes Rau in Berlin seinen Traum leben und Bundespräsident werden würde.
Kraft mag Berlin nicht. Der politische Betrieb ist ihr suspekt. Anders als ein Ministerpräsident ist ein Bundeskanzler beinahe jeden zweiten Tag im Flieger auf dem Weg zum nächsten Kriseneinsatz. Mal muss der Euro gerettet werden, mal die Nato, mal die gesamte Europäische Union. Gegenspieler heißen plötzlich nicht mehr Rüttgers oder Laschet und Lindner, sondern Putin, Trump und Xi.
Die Wahrscheinlichkeit, in Berlin einen weltpolitisch folgenreichen Fehler zu begehen, ist weitaus größer als in der überschaubareren Landespolitik. Wer in Berlin bestehen will, muss letztlich ein Alphatier sein: in der Grundausstattung von unerschütterlichem Selbstbewusstsein, bei den Extras hilft eine große Portion Rücksichts- und Ruchlosigkeit. Es erleichtert die Alphatier-Existenz, wenn man die Fähigkeit mitbringt, sich über diese egomanischen Qualitäten stets aufs Neue definieren und bestätigen zu können. In dieser Hinsicht war Konrad Adenauer nicht anders als Helmut Kohl oder Gerhard Schröder oder Angela Merkel. Wer die brütende Hitze in dieser Luxusküche der Politik nicht aushält, wird schon alsbald aus dieser Kochstätte wieder verjagt, wie Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger oder auch Willy Brandt, der, in diesem Fall lag Herbert Wehner brutal richtig, eben zu gerne „lau“ badete.
Nach einer Kümmerin hat in Berlin noch nie jemand gerufen. Bundestagswähler wissen, dass sozial-empathische Eigenschaften nicht reichen, um Europas wichtigstes Land zu steuern. Sie erwarten mindestens belegbare Führungsqualität und, wenn es schlimm kommt, auch noch eine Idee, wie es mit dem Land weitergehen soll. In solchen Fällen muss dann auf Deutschlands Plätzen und Talkshows gleich die Freiheit gegen den Sozialismus verteidigt, mehr Demokratie gewagt oder eine geistig-moralische Wende veranstaltet werden. Drunter geht es dann eben nicht.
Kurzum: Wenn Kraft alles, was mit Berlin zu tun hat, rundheraus ablehnt, wenn sie „nie, nie als Kanzlerkandidatin“ antreten will, dann ist das, ob nun bewusst oder unterbewusst, vor allem: Selbstschutz. Man kann das nachvollziehen. Aber eine solche Bescheidenheit hat einen Preis: Wer als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident partout nicht Bundeskanzler werden will, also den Anspruch auf die erste Liga gar nicht erst stellt, steigt eben ab. Wer sich selbst verzwergt, muss sich nicht wundern, wenn andere ihn nicht mehr als Riesen wahrnehmen. So urteilen auch enge Weggefährten Krafts.
Als Hannelore Kraft im kleinen SPD-Kreis zum ersten Mal ihre harsche Abneigung gegen Berlin kundtat, da ging der damalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel auf die Parteifreundin zu: „Hannelore, sag das bloß niemanden.“ Denn: „Wenn du dich kleinmachst, werden dich auch die anderen kleinmachen.“ Gabriel ist auch heute noch davon überzeugt, dass Krafts Abstieg aus dem Olymp mit dem öffentlichen Bekenntnis, nie nach Berlin wechseln zu wollen, begann.
Wer sich wie Kraft aus der Bundespolitik abmeldet, dem verbleibt als Spielfeld schließlich nur noch die Landespolitik. Von nichts kann er dann mehr ablenken, wenn ihm im eigenen Bundesland die Fortune abhandenkommt. Das ist das eine: Es ist eine Frage taktischer Klugheit und pragmatischer Intelligenz. Das andere: Man gibt durch diesen Akt der Selbstreduktion freiwillig ein Instrument aus der Hand, um Anerkennung, Achtung, Respekt, ja vielleicht sogar Stolz beim eigenen Publikum zu erhalten. Die eigenen Anhänger werden sich irgendwann selbst mit in den Strudel wachsender Bedeutungslosigkeit gezogen sehen. Letztendlich unterschreibt man mit den besten Absichten sein eigenes Todesurteil.
Hannelore Kraft hat damit in der Landesgeschichte ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Kein einziger ihrer Vorgänger hat sich bundespolitisch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das fing schon mit dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten an. Karl Arnold konnte sich aus der Bundespolitik gar nicht heraushalten. Er hatte das Pech, dass von allen mächtigen CDU-Politikern der allermächtigste von ihnen in „seinem“ Düsseldorf saß. In Arnolds Teich schwamm mit Konrad Adenauer der größte Hecht. Schlimmer hätte es für ihn kaum kommen können. Denn alles, was Arnold wollte, wollte Adenauer nicht. Arnold war links, fühlte gewerkschaftlich, dachte sozialistisch und für ihn war der allerorten proklamierte Neuanfang nach der Befreiung vom Dritten Reich gleichbedeutend mit einer Regierung, die er als überkonfessionelle, sozialistische Sammlungsbewegung verstand. Und mit der Erfahrung im Kreuz, dass wesentliche Industrieführer mit Hitler gemeinsame Sache gemacht hatten, wollte er dies als verantwortlicher Politiker ein für alle Mal unterbinden – durch Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, zuallererst derjenigen an der Ruhr.
Adenauer hatte mit dem Sozialismus nichts, aber auch gar nichts am schwarzen Hut, für ihn war diese Ideologie gleichbedeutend mit dem real existierenden Kommunismus Stalinscher Prägung. Die ideologische Gegnerschaft von Arnold und Adenauer hatte handfeste Folgen: Arnold wollte mit den gleichfalls sich sozialistisch definierenden Sozialdemokraten (die Godesberger SPD-Wende sollte erst gut zehn Jahre später stattfinden) eine Koalition eingehen. Also legte es Adenauer darauf an, nicht nur diese Art von Koalition in Düsseldorf zu verhindern, sondern gleich Arnold selbst. Adenauer versuchte, für das Amt des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen den Verbandspräsidenten der katholischen Arbeitervereine, Josef Gockeln, zu platzieren. Der hatte aus Adenauers Sicht den Extra-Vorteil, immer schon gegen den christlichen Sozialismus gewesen zu sein (wie Adenauer-Biograf Hans-Peter Schwarz erzählt). Damit aber scheiterte Adenauer, Arnold war inzwischen zu etabliert und zu beliebt. Gockeln durfte später Landtagspräsident werden.
Das heißt freilich noch lange nicht, dass Adenauer seine Übergriffigkeiten aufgab. Immer wieder grätschte er Arnold zwischen die Beine, sorgte etwa dafür, dass der Ministerpräsident seine zwei kommunistischen Minister hinauswerfen musste. 1950 versuchte er erneut, Arnold aus dem Amt zu drängen, was erneut misslang. Dann versuchte er nochmals, Arnold zu einer Koalition mit der FDP zu nötigen. Auch das ging schief, andererseits schaffte es Arnold aber auch nicht, an Adenauer vorbei eine Koalition mit den Sozialdemokraten zu bilden. Darunter wiederum musste ein anderer leiden, den wir später noch näher beleuchten werden: Heinz Kühn, der zu Arnolds wichtigsten Koalitionspartnern gezählt hätte. So aber konnte Kühn erst 16 Jahre später selbst zur Regierung werden, dann allerdings als deren Chef.
Für Kühn war das Bündnis zwischen den laizistischen Sozialisten aus der SPD und den christlichen Sozialisten aus der CDU das Bündnis seiner Wahl: eine „soziale Koalition“. Kühn sondierte länger als ein Jahr mit Arnold, bisweilen auch persönlich und unter vier Augen. Am Ende war alles doch vergeblich und Kühn erkannte, dass er in Düsseldorf erst einmal nichts mehr werden konnte. Also ging er nach Bonn, wechselte in den Bundestag und fiel von diesem Moment an seinem Lieblingsgegner, der seinen Aufstieg in Düsseldorf torpediert hatte, gehörig auf den Wecker: Konrad Adenauer. Kühn konnte holzen. Bliebe Adenauer weiter Bundeskanzler, sagte er laut „Kölner Stadtanzeiger“, „würde es am Ende der zweiten Legislaturperiode keine Demokratie mehr geben“. Eine drastische Übertreibung, auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass die Verrohung der Sprache nicht erst mit der Existenz von sozialen Netzwerken begann.
Arnold, Kühn, Adenauer – in Wahrheit war schon in jenen Jahren der Abstand zwischen Bonn und Düsseldorf weitaus geringer als die rund 80 Kilometer Autobahn, welche die beiden Städte mit beneidenswert unmittelbarer Rheinlage voneinander trennt.
Das wurde nach der Landtagswahl 1954 wieder einmal deutlich. Erneut liebäugelte Wahlsieger Arnold, sich im Geiste treu bleibend, mit einer GroKo und wieder waren es bundespolitische Einflüsse, die ihn davon abbrachten. Adenauer glaubte, wenn die Koalition in Düsseldorf anders zusammengesetzt wäre als die auf Bundesebene in Bonn, werde dies seine Regentschaft gefährden. Ein Argument, dem sich Arnold nur schwer entziehen konnte. Schließlich hinderten ihn auch die bundespolitischen Ansichten der SPD daran, mit ihr in der Landeshauptstadt zusammenzugehen. Die SPD war immer noch strikt antiklerikal und europaskeptisch, obwohl der „Nationalist“ Schumacher 1952 gestorben war und Erich Ollenhauer sein gemäßigterer Nachfolger wurde. Doch immer noch waren die Sozialdemokraten in Adenauers Augen wahlweise Sozialisten oder „Marxisten“, und so durfte in Düsseldorf Arnold nicht tun, was er am liebsten getan hätte – wobei man erwähnen muss, dass Arnold die außenpolitische Linie Adenauers voll mittrug.
Arnolds letzte Koalition sollte nur zwei Jahre halten, und wieder lag es nicht an den Düsseldorfer Dingen, sondern an den bundespolitischen Verhältnissen. In Bonn entzweite sich Adenauer zusehends mit den Liberalen, besonders mit deren Vorsitzendem Thomas Dehler. Adenauer betrieb Dehlers Sturz und die CDU-Fraktion erhöhte stetig den Druck auf die FDP. Und dann passierte dem gewieften Machttechniker Adenauer doch einmal ein folgenreicher Kunstfehler: Er verlangte eine Änderung des Wahlrechts, und die Leidtragenden wären vor allem SPD und FDP gewesen. Das „Grabenwahlrecht“ hätte allein die Liberalen, wie die CDU selbst nicht ohne dümmlichen Urheberstolz ausrechnete, zehn Mandate gekostet. Dehler, der den Machtkampf mit Adenauer doch noch überstanden hatte, fuhr jetzt im Kampf gegen das neue Wahlrecht schweres Geschütz auf. Er drohte mit dem Ende von sechs (!) Koalitionsregierungen zwischen CDU und FDP in den Ländern, was die Union die Mehrheit im Bundesrat gekostet hätte – mindestens. Daraufhin ließ Adenauer, inzwischen 80 Jahre alt, die Wahlrechtspläne fallen. Für seinen Parteifreund Arnold kam jedoch jede Hilfe, auch die des Bundeskanzlers, zu spät. Er verlor sein Amt. Der liberale Bundespräsident Theodor Heuss fand die Angelegenheit in Einklang mit Adenauer absurd und notierte: „Tolle Wirrnis: In Nordrhein-Westfalen wollen die Nazi-FDP mit den Soz.-Dem. und Zentrum den CDU-Arnold stürzen …“
Völlig zu Recht beklagte sich Arnold, der damit zum ersten Opfer eines konstruktiven Misstrauensvotums in der Nachkriegsgeschichte geworden war, dass damit „eine Schlacht im falschen Saal“ geschlagen worden sei. Wie bitter: Arnold hatte nie eine Koalition mit den Liberalen gewollt, sich von Adenauer aber hineinzwängen lassen. Und wurde nun Opfer eines Putsches der Liberalen in Düsseldorf, der doch in Wahrheit Adenauer in Bonn gegolten hatte.
Zwei Jahre später, mitten im Wahlkampf 1958 und eine Woche vor der Wahl, starb Arnold überraschend an den Folgen eines Herzinfarkts. Die CDU stand plötzlich ohne Spitzenkandidaten da. Arnolds Popularität im Land war jedoch so groß, dass die Bevölkerung dem unbekannteren zur Wahl stehenden Franz Meyers, der im Kabinett Arnold Innenminister gewesen war, zu einem fulminanten Wahlsieg verhalf. Besser als Meyers hatte die CDU nie abgeschnitten und würde sie auch nie wieder abschneiden: 50,5 Prozent. Absolute Mehrheit.
Der nächste Fall, bei dem sich die Interessenlagen zwischen Landes- und Bundeshauptstadt folgenreich überschnitten, spielte sich 1966 ab. Kühn, 1962 vom Bundes- in den Landtag zurückgekehrt, hatte vier Jahre später unter dem Eindruck einer schwächelnden Konjunktur, der Krise im Bergbau und grassierender Abstiegsängste in den unteren Mittelschichten einen fulminanten Wahlerfolg gegen Meyers und dessen Christdemokraten eingefahren: 49,5 Prozent. Und doch reichte es nicht für eine Regierungsbildung. Amtsinhaber Franz Meyers hatte zwar eine beachtliche Wahlniederlage für die CDU zu verantworten, aber gemeinsam mit der FDP sollte es für ihn noch einmal reichen. Die SPD musste zurück in die Opposition – für kurze Zeit. Dann zerbrach in Bonn die Regierung von Ludwig Erhard, dessen christlich-liberale Koalition war an ihr Ende gelangt.
Dass dieses Bonner Ereignis Auswirkungen auf Düsseldorf haben würde, war klar. Dort führte, am CDU-Ministerpräsidenten vorbei, der selbstbewusste christdemokratische Fraktionschef Wilhelm Lenz geheime Sondierungsgespräche mit dem sozialdemokratischen Oppositionsführer Heinz Kühn. Die Sache blieb natürlich nicht geheim, die CDU rebellierte daraufhin gegen ein Bündnis mit den „Sozis“, ebenso wie auf der anderen Seite die Sozialdemokraten gegen eine Regierung mit den „Schwarzen“. Daraufhin bildete Kühn, der selbstredend auch schon mit den Liberalen sondiert hatte, die zweite sozialliberale Koalition. Sie bereitete den „Machtwechsel“ in Bonn vor. Drei Jahre nach Kühns Amtsantritt konnte Willy Brandt mit Walter Scheel koalieren. Es war die erste sozialliberale Regierung auf Bundesebene.
Damit war augenfällig geworden: Ein sogenanntes „bürgerliches Lager“ gab es nun nicht mehr – ein tiefer Einschnitt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und der Ausgangspunkt dafür hatte in Düsseldorf gelegen, in der Landespolitik.
Es begann damit, dass Arnold als linker Christdemokrat mehr Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten erkannte als mit den Liberalen. Die Koalition mit ihnen sah er als Mesalliance an. Der Wandel der FDP von national zu sozialliberal war sodann die Voraussetzung für ein Bündnis zwischen FDP und SPD. Jedenfalls bescherte das Ende des bürgerlichen Lagers Nordrhein-Westfalen eine 39 Jahre lang dauernde Periode von sozialdemokratisch geführten Regierungen, bevor im Jahr 2005 Jürgen Rüttgers die schwarz-gelbe Wende gelang. Dazwischen lag die Gründung der Grünen als Bewegung und ihr Aufstieg zur Regierungspartei.
Und wieder nahm Nordrhein-Westfalen eine Schlüsselrolle ein. Zum zweiten Mal wurde das Land zur Koalitions-Avantgarde. Manchmal helfen selbst Aphorismen nicht mehr weiter. „Lieber ein Haus im Grünen als die Grünen im Haus“, hatte Johannes Rau im Wahlkampf 1995 wieder und wieder ins Volk gerufen. „Wir brauchen kein fünftes Rad am Wagen“, hatte die SPD plakatiert, ohne zu erklären, wer denn wohl die anderen vier Räder gewesen sein sollten. Gleichwohl: Der SPD reichten für rot pur nicht einmal satte 46 Prozent, die Grünen konnten sich auf zehn Prozent verdoppeln und Johannes Rau trank am Wahlabend sehr viel Pils, bevor er sich entschloss, diese Vernunftehe auf Probe einzugehen. Es war aus Sicht von Rau ein Akt doppelter Vernunft: Er wollte ja nicht nur jetzt wieder Ministerpräsident werden, sondern später auch noch zum Bundespräsidenten aufsteigen. Diesen Traum hatte er auch nach dem ersten missglückten Versuch gegen Roman Herzog noch nicht aufgegeben.
In der Rückschau wirkte es wie ein Signal, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen nicht in Düsseldorf stattfanden, sondern in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Bonn. Es wirkte wie eine Drohung gegen Helmut Kohl, der in unmittelbarer Nachbarschaft das Kanzleramt regierte. Joschka Fischer nutzte die Verhandlungen dementsprechend: „Rot-Grün ist nicht mehr aufzuhalten“, rief er den lungernden Journalisten zu, die nächste Bundestagswahl im Blick. Er sollte Recht behalten.
Nachdem der Präsidial-Regierungschef Rau im Frühjahr 1998 an der Spitze der Regierung endlich dem drängenden Wolfgang Clement Platz gemacht hatte, konnten ein halbes Jahr später Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Joschka Fischer publikumswirksam auf die Machtübernahme von SPD und Grünen anstoßen. Das Foto, das die drei mit Champagner-Kelchen zeigte, markierte – auch stilistisch – einen Epochenwechsel. Was in Düsseldorf bei reichlich Pils begonnen hatte, endete in Bonn mit Champagner. Ein halbes Jahr später wurde Rau im zweiten Anlauf zum Bundespräsidenten gewählt.
In der Rückschau auf die 20-jährige Ära Rau, die im Positiven wie im Negativen wohl prägendste Zeit der Landesgeschichte, fällt auf, wie sehr hier die Wechselwirkung zwischen Düsseldorf und Bonn machtwirksam wurde. Für Rau hatte das Ende der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt und die dann folgende langjährige Regierungszeit Helmut Kohls, die Freien Demokraten an seiner Seite, eine segensreiche Bedeutung: Alles, was in Nordrhein-Westfalen politisch problematisch lief, sei es die Schulden-Entwicklung ebenso wie die Krisen bei Kohle und Stahl, konnte Rau in Richtung Bonn schieben, Richtung Kohl. Helmut Kohl war ein integraler Bestandteil der Machtausübung Johannes Raus: Der Kanzler wurde der wichtigste Sündenbock des Ministerpräsidenten. Dieses „Spiel“ konnte Rau durchhalten, solange aus Düsseldorf sozialdemokratisch, aus Bonn christdemokratisch regiert wurde.
Aber es war keineswegs nur Rau, der von dieser Art informeller Arbeitsteilung profitierte. Diese war nämlich zum beiderseitigen Nutzen. Auch Kohl hatte seinen Vorteil davon, dass in Düsseldorf Johannes Rau regierte. Und nicht etwa Kurt Biedenkopf. Das zeigte folgende Begebenheit:
Es ist der 6. März 1983, Helmut Kohl und die FDP haben gerade die Bundestagswahl gewonnen. Die durch konstruktives Misstrauensvotum gegen die Regierung Helmut Schmidt entstandene Kohl-Koalition ist nunmehr durch den Wähler legitimiert. Noch an diesem Abend ruft der frisch gewählte Bundeskanzler bei Bernhard Worms an. Seine klare Botschaft an den treuen Gefolgsmann in der Landeshauptstadt: Biedenkopf muss jetzt endlich weg. Kohl ahnt, dass sein inzwischen größter Rivale in der CDU, eben jener Kurt Biedenkopf, die nächste Landtagswahl, 1985, gewinnen kann. Und er weiß, auf einem Bundesparteitag stellen die Delegierten aus Nordrhein-Westfalen den mächtigsten Stimmenblock: 40 Prozent. Eine Gefahr für den Kanzler und CDU-Bundesvorsitzenden, wenn er seinen stärksten Gegner in Nordrhein-Westfalen sitzen hat.
In dieser Lage setzt Kohl auf den Machtwechsel in der Düsseldorfer CDU: Biedenkopf soll weg, Worms muss ran. Heiner Geißler, der sich später selbst mit Kohl überwarf, hat den Vorgang gegenüber Parteifreunden bestätigt: Der CDU-Führung, so Geißler, sei völlig klar gewesen, dass Worms gegen Rau nicht den Hauch einer Chance haben werde. Aber zur Arrondierung seiner Macht war es dem Bonner Kanzler wichtiger, dass in Düsseldorf ein roter Regent statt eines schwarzen Gegners sitzt. Den Preis für den Machtwillen des Bundeskanzlers von der CDU müssen in Düsseldorf die Christdemokraten zahlen. Kohl mischt hier ebenso skrupellos mit wie dessen Idol Konrad Adenauer Jahrzehnte zuvor; eine bemerkenswerte historische Kontinuität.
Die rot-grüne Ära in Berlin ging nach sieben Jahren zu Ende. Schröder hatte die rot-grüne Macht verloren. Und der Grund dafür lag wieder einmal in Düsseldorf. Clement-Nachfolger Peer Steinbrück hatten die zweieinhalb Jahre an der Spitze der Regierung nicht gereicht, um die Mehrheit der Bevölkerung von seinen Macher- und Denker-Qualitäten oder die eigene Partei von einem Regierungswechsel zu überzeugen mit dem Ziel: die Grünen aus der Regierung zu werfen, um eine andere Koalition zu bilden. Die Kommentatoren analysierten damals, Steinbrück habe, wie vor ihm schon einmal Clement im Schulterschluss mit dem damaligen nordrhein-westfälischen FDP-Vorsitzenden Jürgen Möllemann, die Freien Demokraten in seine Regierung holen wollen. So ist es aber offensichtlich nicht gewesen. Nachfrage bei Peer Steinbrück: Wie war es denn dann?
Steinbrück bilanziert heute den Dauerkonflikt mit den Grünen in den Jahren 2002 und 2003 selbstkritisch und ungeschminkt: „Rot-Grün war am Ende, die Leute hatten es satt.“ Und: „Dieser Konflikt ging zu meinen Lasten.“ Die Grünen standen als staatstragend da, Steinbrück und seine SPD in der Position der ewigen Nörgler und Unruhestifter, und welcher Wähler mag schon Quälgeister – zumal, wenn nicht klar ist, wohin die ganze Qual führen soll. In Berlin schauten sie jedenfalls sorgenvoll nach Düsseldorf. Der Krach zwischen Roten und Grünen in Düsseldorf gefährdete längst schon den Koalitionsfrieden in der Bundeshauptstadt, wo dieselben Farben regierten. „Dass mein harter Kurs die Koalition in Berlin gefährden würde, hatte ich unterschätzt“, gibt Steinbrück heute zu. „Darum wurde ich an die Kette genommen.“ Und zwar vom Parteivorsitzenden Franz Müntefering und von Kanzler Gerhard Schröder.
Allerdings sei es nicht sein Ziel gewesen, die rot-grüne Regierung in Düsseldorf durch ein sozialliberales Bündnis zu ersetzen, wie viele damals glaubten, sondern: durch eine Große Koalition unter Führung der SPD, unter seiner – Steinbrücks – Führung. Der Ministerpräsident in Finanznöten hatte sehr genau studiert, dass die Union seit Jahren schon, längst vor seiner eigenen Regierungszeit, eine Methode kultiviert hatte, wenn es um konkrete Sparvorschläge ging: Sie schlug sich noch stets in die Büsche. So war das schon, als Johannes Rau seinen Büroleiter Steinbrück die Kniffe und Tricks der Politik lehrte. Und hier wollte Steinbrück ansetzen: Mit einer Großen Koalition wäre das nicht mehr möglich gewesen. Gemeinsam hätte man den Landeshaushalt konsolidieren können, für dessen verheerenden Zustand vor allem Johannes Rau verantwortlich war. Das hatte ihm sein langjähriger Freund und Finanzminister Diether Posser persönlich 1985 in einem „Alarmbrief“ bescheinigt. So habe allein zwischen 1977 und 1984 die absolute Verschuldung des Landes um 408,9 Prozent zugenommen, während es im Bundesschnitt nur 188,9 Prozent gewesen seien. Damit ist Johannes Rau – und nicht Hannelore Kraft, wie von der CDU behauptet – Nordrhein-Westfalens Schuldenkönig. Seine Nachfolger mussten dessen machtpolitisch motivierte Freigiebigkeit ausbaden.
Steinbrück erzählt weiter: Sein Plan sei es gewesen, einen Emissär zur Führung der CDU zu schicken, um geheim die Chancen für die Bildung einer Großen Koalition auszuloten, einem Regierungsduo aus dem Ministerpräsidenten Steinbrück und einem CDU-Vize Jürgen Rüttgers. Von diesem Plan habe ihn dann jedoch „ein Freund“ (Wolfgang Clement?) abgebracht.
Dieser Freund, dessen Namen Steinbrück nicht preisgibt, muss jedenfalls ein mit allen Wassern gewaschener Polit-Profi gewesen sein. Der habe mit Steinbrück den Plan als Szenario einfach durchgespielt. Also: Steinbrück schickt einen „Postillon d’Amour“ zu Rüttgers, um auszuloten, ob der CDU-Chef zu einer solch heiklen Operation bereit wäre. Steinbrück hätte mit der Vize-Ministerpräsidentschaft dem Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach als Nummer eins in NRW den Vorzug gegeben. Was aber, wenn Rüttgers sich für die Taube entschieden hätte? „Was wäre, wenn Rüttgers das dann bekanntgemacht hätte, nach dem Motto: ‚Stellt Euch vor, der Ministerpräsident hat gerade bei mir um Hilfe nachgesucht.‘“ Und was, wenn es danach im Landtag zu einem konstruktiven Misstrauensvotum gekommen wäre, „bei dem CDU, FDP und Grüne sich zusammengetan und mich und die SPD aus dem Amt gewählt hätten“? Das war das entscheidende Argument. Steinbrück ließ seinen waghalsigen Plan fallen, nachdem ihm klargeworden war, „dass Rüttgers mich hätte verhungern lassen können“. Für eine solche Wendung der Dinge sei es im Grunde genommen damals schon zu spät gewesen. Immerhin: Steinbrück war offenkundig bereit, die Grünen aus der Regierung zu putschen. In früheren Zeiten hieß so etwas: Verrat. Steinbrück stimmt zu – und zitiert ein berühmtes Wort von Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, kurz: Talleyrand, einem der bekanntesten französischen Staatsmänner, der zu Zeiten der Französischen Revolution Spitzendiplomat gewesen war. Es lautet: „Hochverrat ist immer eine Frage des Zeitpunkts.“
Abgeschlossen hat Steinbrück mit dem Thema bis heute nicht. Steinbrück bereitet es ein großes Vergnügen sich auszumalen, wie die deutsche Geschichte weiter verlaufen wäre, wenn die Genossen in Berlin ihm keine Knüppel zwischen die Beine geworfen hätten, sondern ihm strategisch gefolgt wären. Die GroKo aus Steinbrück und Rüttgers wäre also 2003 gebildet und 2005 wohl bestätigt worden, „denn ich lag ja in den Umfragewerten weit vor Rüttgers“. Dann aber hätte es auf Bundesebene nicht zu vorgezogenen Neuwahlen kommen müssen, die Schröder ja unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale in Nordrhein-Westfalen angekündigt hatte. Schröder hätte mit den Grünen weiter regieren können, und, falls diese Koalition dann an ihr Ende gelangt wäre, mit Angela Merkel – als Kopilotin – eine Große Koalition bilden können. An dieser Stelle ist man versucht, eines der bekanntesten Bonmots von Steinbrück zu zitieren: Hätte, hätte, Fahrradkette …
Es kam anders, nämlich zu einem geheimen Treffen zwischen dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler. Und, weil beide Sozialdemokraten keine Kinder von Traurigkeit sind, verabredete man sich im Schlosshotel Bensberg zum Sterne-Menü. Sechs Wochen vor der Landtagswahl sagte Schröder dem Genossen Steinbrück dessen Machtverlust voraus: „Peer, du wirst die Wahl verlieren.“ Dieser traurigen Einschätzung stimmte Steinbrück freimütig zu. Daraufhin verriet Schröder, für diesen Fall werde er selbst Neuwahlen anstreben. Als Mann von Ehre behielt Steinbrück diese Sensation für sich; sein Sprecher Oliver Schumacher war der Erste, den er einweihte – am Tag der NRW-Wahl gegen 16 Uhr, nachdem die Demoskopen Steinbrück über dessen Wahlniederlage informiert hatten.
Über die damalige SPD-Parteiführung sagt Steinbrück heute, im Grunde habe dort eine mangelnde strategische Weitsicht geherrscht. „Die haben das nicht vom Ende her gedacht.“ Ein Wechsel zu einer Großen Koalition in Nordrhein-Westfalen „hätte Schröder an der Macht gehalten“. Von dieser Episode ist Steinbrück das ambivalente Gefühl geblieben, in der Strategie richtig, in der Taktik aber falsch gelegen zu haben. So ein riskanter Wechsel in Düsseldorf hätte kommunikativ exzellent vorbereitet werden müssen. „Und das habe ich nicht getan“, räumt Steinbrück selbstkritisch ein. Das SPD-Establishment habe ihn gebremst, „weil es immer auf der Bremse steht, weil es sich am Status quo orientiert, weil es dazu neigt, sich mit dem Ziel der Risiko-Vermeidung sein eigenes Grab zu schaufeln“. Jedenfalls wäre aus seiner Sicht die CDU als Partner für die SPD viel verträglicher gewesen als die FDP. Die sei viel „zu flippig, zu sehr Lifestyle-Partei“ gewesen. In der grundsoliden rheinischen CDU dominiere hingegen seit der Nachkriegszeit der Sozialkatholizismus, während der westfälische Teil eher mittelstandsorientiert und wirtschaftsliberal ticke. Wobei „ein Norbert Blüm besser in die Ahnenreihe der CDU-Granden passt als ein Friedrich Merz“. Aber einerlei, wer bei der CDU das Sagen habe: „Wenn solche Leute dran sind, kann ich wenigstens gut schlafen.“
Nach dem Regierungswechsel inszenierte Steinbrück-Nachfolger Jürgen Rüttgers zwischen der Landes- und der Bundeshauptstadt ein Wechselspiel zu seinen Gunsten. Erfolgreich schärfte er sein sozialpolitisches Profil, von entscheidender Bedeutung in einem Bundesland, das seine politische Existenz unter Karl Arnolds Führung als sozialer Modellfall der gesamten Bundesrepublik begann, gegen die Bundeskanzlerin in Berlin. Dass darunter die persönliche Beziehung zwischen ihm und Merkel erheblich litt, brauchte den Ministerpräsidenten nicht weiter zu bekümmern – er regierte schließlich mit eigener, von Merkel unabhängiger Legitimation durch die nordrhein-westfälischen Wähler.
In der Abgrenzung von der Bundespolitik fuhr Rüttgers im Fahrstuhl nach oben – mit der Bundespolitik aber auch wieder im Lift nach unten. Einige Wochen vor der Landtagswahl 2009 verabschiedeten die Europäer ein Paket, um Griechenland vor der Pleite zu retten. Rüttgers ist bis heute davon überzeugt, dass diese in Deutschland äußerst unpopuläre europäische Entscheidung für seine Wahlniederlage verantwortlich ist. Sein Nach-Nachfolger Armin Laschet teilt diese Ansicht weitgehend. Die Griechenland-Rettung zeichne zu circa 80 Prozent für die Wahlniederlage von Rüttgers verantwortlich. Was Laschet elegant umgeht: Die restlichen 20 Prozent verbucht er auf das Konto von Rüttgers selbst.
Jedenfalls ist auch die siebenjährige Regentschaft von Rüttgers Nachfolgerin und erster weiblicher Ministerpräsidentin, Hannelore Kraft, ohne die Wechselwirkung von Landes- und Bundespolitik kaum erklärbar. Das gilt für den Beginn der Regierungszeit von Kraft ebenso wie für deren Ende. Nach einer ganzen Reihe von Sondierungsgesprächen verkündete Kraft, die 2010 nur einen relativen Wahlsieg errungen hatte, aber keine regierungsfähige Koalition bilden konnte, sie werde nunmehr in die Opposition gehen. Die Parteizentrale in Berlin war mehr oder weniger fassungslos über so viel Machtvergessenheit. Vor allem war es der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel, dem ein Verzicht auf Macht per se wesensfremd war – und bis heute ist. Gabriel jedenfalls überlegte, wie er Kraft doch noch nötigen könnte, Rüttgers abzulösen und zu regieren. Also rief er auf dem Weg nach Berlin, noch in seiner Heimatstadt Goslar auf dem Bahnsteig stehend, den starken Mann der Grünen an. Jürgen Trittin sollte seine grünen Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen bewegen, Kraft zu ermutigen, das Risiko einer Regierung ohne klare Mehrheit einzugehen. Mit Sylvia Löhrmann stand für diesen Schachzug eine entschlossene und selbstbewusste Partnerin in Düsseldorf zur Verfügung – und so kam es dann auf Druck aus der Bundeshauptstadt zu dieser ersten Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Womöglich deutete auch diese Begebenheit am Anfang der Regierungszeit von Hannelore Kraft auf deren späteres Scheitern hin. Kraft musste schließlich überredet werden, beherzt nach der höchsten Macht zu greifen, mittelbar von ihrem eigenen Parteivorsitzenden in der Bundeshauptstadt, unmittelbar von ihrer späteren Koalitionspartnerin. Sie selbst zögerte lange. So verhält sich niemand, der zur Nummer eins geboren ist.
Und nun das Ende: Wie sich doch die Dinge ähneln zwischen Rüttgers und Kraft. Was bei Rüttgers die Griechenland-Rettung war, war bei Kraft der Regierungswechsel in Berlin. Solange eine fürchterlich zerstrittene schwarz-gelbe Regierung unter der Führung Angela Merkels in Berlin regierte, konnte Kraft mit dem Finger dorthin weisen. Berlin wurde für sie zum glaubwürdigen Beispiel dafür, wie man es auf gar keinen Fall macht. Aber dann änderte sich die Lage. Schwarz-Gelb bekam vom Wähler die verdiente Quittung für diese Misstrauenskoalition – und Merkel blieb als einziger Ausweg zur Rettung ihrer Kanzlerschaft die Bildung einer Großen Koalition. Kraft kämpfte verbissen dagegen – sie wusste: Von dem Tag an, an dem in Berlin die Sozialdemokraten in der politischen Mitverantwortung stehen würden, war ihr ein wichtiges Legitimations-Instrument aus der Hand geschlagen. Sie konnte nicht mehr die Bundesregierung für alles Übel der Welt verantwortlich machen, um von eigenen Regierungsversäumnissen, schlechten wirtschaftlichen oder sozialen Zahlen abzulenken. Berlin, großkoalitionär regiert, bedeutete für Kraft eine reale Bedrohung: Sie würde von nun an keinen Sündenbock mehr haben. Darum ging sie ihren Parteivorsitzenden hart an, teilte ihm mit, die Große Koalition werde sie nicht mittragen. „Dann musst du gegen mich antreten“, antwortete Gabriel. Kraft hätte das tun können, und ihre Chancen, Gabriel zu entmachten, um als erste Frau überhaupt die Spitze der ältesten deutschen Partei zu erobern, hätten seinerzeit sogar gut gestanden. Allein vor diesem letzten konsequenten Schritt zuckte sie zurück. Wie schon Jahre zuvor bei der Bildung einer Minderheitsregierung zögerte sie. Aber diesmal gab es niemanden, der sie zu ihrem Glück zwang.
Laschet ist bis heute davon überzeugt, dass sich mit dieser Entscheidung zur Großen Koalition in Berlin das Schicksal der Kraft-Regierung in Düsseldorf wendete. Von da an sei es nur noch bergab gegangen. Aber das heißt nun gar nicht, dass es von da an mit Laschet selbst immer nur bergauf gegangen wäre, dass sich seine Spitzenkandidatur zum Selbstläufer entwickeln würde, kurz: dass er sozusagen im Schlafwagen an die Macht käme.
CDU-Parteizentrale in der Wasserstraße: Zwei Jahre vor der Landtagswahl ist das Team von Laschet überzeugt, dass ihr Spitzenmann es





























