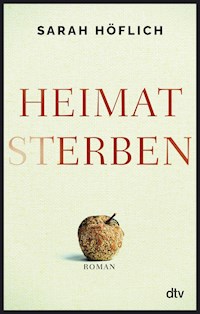
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großartiger Familienroman, der sich zusehends zum Politthriller entwickelt Tilde Ahrens, mehrfache Mutter, Oma und Uroma, liegt im Sterben und bittet kurz vor ihrem Tod Lieblingsenkelin Hanna, die Familie zusammenzuhalten. Keine einfache Aufgabe für die freigeistige Journalistin, die eigentlich seit Jahren in den USA lebt, denn in dem weitverzweigten Ahrens-Clan prallen die unterschiedlichsten Weltanschauungen aufeinander. Hanna taucht ein in die Geschichte ihrer Familie und stellt sich der Auseinandersetzung mit ihrer erzkonservativen Schwester, deren Mann Felix Kopf einer nationalistischen Partei ist. Es kommt zu einer vorsichtigen Annäherung. Doch dann gewinnt der charismatische Felix überraschend die Wahl, zieht ins Kanzleramt ein und ausgerechnet Hanna soll ihn bei seiner politischen Arbeit unterstützen. …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sarah Höflich
Heimatsterben
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für »Mutti«
Helga Sofie Höflich
(1923 – 2015)
Weh denen, die dem Ewigblinden
Des Lichtes Himmelsfackel leih’n!
Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden,
Und äschert Städt’ und Länder ein.
Friedrich Schiller
Erster Teil HERBST Versuchung
1
Sie hatte sich immer gefragt, ob man den Tod wohl spüren konnte, bevor er kam. Ob er Vorboten hatte, wie die Sehstörungen, die jedes Mal kurz vor ihren Migräneanfällen auftraten. Warnsignale, die er aussandte, damit die Sterbenden einen Augenblick hatten, sich zu sammeln und sich auf seine Ankunft einzustellen.
Die Stadt brannte. Trotz tiefster Nacht war es taghell. Überall waren Flammen und Rauchsäulen von Brandsätzen und Feuerwerkskörpern zu sehen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Räumfahrzeugen gegen die Demonstranten vor. Durch die Straßen trabten Hundertschaften. Hubschrauber mit Flutlichtscheinwerfern kreisten am Himmel. Eine Gruppe vermummter Gestalten lieferte sich eine Schlägerei mit Sondereinsatzkräften in schwarzen Uniformen. Man konnte sie kaum auseinanderhalten. Steine flogen gegen Schutzschilde. »Ihr Schweine!«, schrie jemand. »Ihr Hurensöhne!« Dann hallten Schüsse durch die Nacht.
Tilde Ahrens schreckte hoch. Sie lag auf dem Sofa. Der Fernseher lief. Spätnachrichten. Sie versuchte zu rekonstruieren, ob das, was sie gerade gesehen hatte, ein Fernsehbericht oder ein Traum gewesen war. Doch es wollte ihr nicht ganz gelingen. In letzter Zeit vermischten sich die Gedanken in ihrem Kopf, vor allem wenn sie müde war. Gegenwart und Vergangenheit schienen manchmal eins zu werden. So viele Bilder. So viele Erinnerungen. Im Frühjahr war sie siebenundneunzig geworden. Um mehr als siebzig Jahre hatte Tilde ihren ersten Mann überlebt, um fünfzig ihren zweiten. Sie hatte drei Kinder, vier Enkelkinder, drei Urenkel. War eine erfolgreiche Unternehmerin gewesen. Ein erfülltes Leben. Nun war Herbst, das Jahr neigte sich seinem Ende entgegen, und Tilde hatte plötzlich das untrügliche Gefühl, dass ihr die Zeit davonlief. Sie hoffte, dass Hanna an Weihnachten zu Besuch kommen würde – ihre älteste Enkeltochter stand ihr von allen Familienmitgliedern am nächsten. Schon seit fünf Jahren lebte sie in den USA und fehlte ihr sehr. Tilde nahm sich vor, Hanna gleich morgen anzurufen.
Mühsam stand sie auf. Ihre Hüfte schmerzte und das linke Knie wurde auch immer steifer. Sie schaltete den Fernseher aus und ging durch den Flur. Die Standuhr tickte leise. Es war schon nach Mitternacht. Langsam stieg sie die knarrende Holztreppe hinauf zum Schlafzimmer. Ein Schritt nach dem anderen. Plötzlich spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrem linken Knie. Das Bein gab nach, Tilde stolperte, verlor das Gleichgewicht, sah die Stufen auf sich zukommen und schlug dumpf auf. Dann wurde ihr schwarz vor Augen.
Tilde Ahrens war dreizehn Jahre alt gewesen, als der Krieg ausbrach. 1945, auf der Flucht aus Schlesien, bekam sie mit neunzehn in einem völlig überfüllten Lazarett ihr erstes Kind. Wenige Wochen zuvor hatte sie Mutter und Schwester verloren. Ihr Mann Wilhelm war trotz unzureichend verheilter Kriegsverletzungen erneut an die Ostfront abkommandiert worden. Die Presswehen kamen in einer Pause zwischen zwei Bombenangriffen. Sie nannte ihren Sohn Carl-Friedrich. Zwei Kaisernamen. In der verzweifelten Hoffnung, dass sie ihn stark machen würden. Doch der Säugling war schwach, die Mutter unterernährt. Im Lazarett konnte sie nicht bleiben. Und die Rote Armee rückte täglich näher. Also nahm sie ihren Sohn, wickelte ihn in sämtliche Lumpen, die sie bei den Krankenschwestern erbetteln konnte, und machte sich wieder auf den Weg.
»Lass ihn liegen«, sagte eine Frau, die sich neben ihr durch den eiskalten Matsch Richtung Neisse quälte. »Der stirbt dir sowieso.«
Tilde blickte auf das winzige, dick eingepackte, komatös schlafende Menschlein in ihren Armen. Wenn er es nicht schafft, dachte sie, dann schaff ich’s auch nicht.
»Frau Ahrens?! Können Sie mich hören?«
Tilde blinzelte. Undeutlich sah sie das Gesicht eines jungen Mannes.
»Ich bin Notarzt. Sie sind gestürzt. Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus.«
Tilde versuchte, etwas zu sagen, doch es kam nur ein Stöhnen. Wie sie sich zum Telefon geschleppt hatte, wusste sie nicht mehr. Ihr Kopf dröhnte. Sie schloss die Augen.
Sterben war immer eine Option gewesen in jenem Winter, der nicht enden wollte. Jetzt, fast achtzig Jahre später, im Krankenwagen, im Widerschein des Blaulichts, war die Option wieder da. Und mit ihr die Erinnerung. Schlagartig. Schonungslos. Die eisige Luft. Das Quietschen der vollgepackten Handwagen. Die vor Schmerz und Kälte taub gewordenen Füße. Das dröhnende Echo der Fliegerbomben, die auf die nahe gelegenen Städte fielen.
Vielleicht lag es am Morphium. Der Arzt hatte einen Zugang gelegt. Er sprach leise mit dem Sanitäter. Während der Krankenwagen vorwärtsruckelte, driftete Tilde langsam weg. Sie hatte das Gefühl, wieder bis zu den Knöcheln im Schneematsch zu versinken, inmitten des endlosen Flüchtlingstrecks, der wie ein gigantischer Wurm aus Menschen Richtung Westen kroch.
Der Tod war überall gewesen, auf den verschneiten Feldern Schlesiens, im Herzen Europas, das durch den Wahnsinn eines sogenannten »Führers« in Schutt und Asche gelegt worden war. Sie hatte viele gesehen, die einfach aufgaben. Sich vollkommen erschöpft und halb erfroren an den Wegrand legten oder stolperten, hinfielen und nicht mehr aufstanden. Mehr Vorboten, als man ertragen konnte.
Tilde hatte sich weitergeschleppt Richtung Neisse. Irgendwann kam die Sonne. Eine Ärztin. Milchpulver. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Sie hatten damals beide überlebt. Sie und der kleine Carl-Friedrich. Doch jetzt spürte Tilde sehr deutlich, dass ihre eigene Kapitulation unmittelbar bevorstand.
2
Hanna Ahrens hasste Entscheidungen. Sie stand mit ihrem Zweitschlüssel vor dem Haus am Morningside Park. Es war ein Uhr nachts. Im dritten Stock wohnte der Mann, den sie liebte. Und er schlief mit einer anderen Frau. Er war nicht ihr Mann. Das hätte die Situation klarer gemacht, die Entscheidung leichter. Aber sie war nur die Affäre, die nun wiederum zur Betrogenen geworden war. Sie hatte keinen Anspruch auf seine Treue. Weder rechtlich noch moralisch. Sie hatte in seinem Leben – genau wie in diesem Land – nur ein begrenztes Aufenthaltsrecht. Das, ähnlich wie ihr H1-B-Arbeitsvisum, demnächst abzulaufen drohte.
Im Nachhinein schien die Entwicklung, die Abfolge der Dinge immer klar zu sein. In der Geschichte wie im Leben. Eine Republik geriet in die Krise, es folgte eine Diktatur, Krieg, möglicherweise Frieden. Geriet eine Beziehung in die Krise, folgten Streit, Trennung, Neuorientierung. Aus Zukunft wurde Gegenwart, Vergangenheit. Aus Unsicherheit Gewissheit. Vielleicht, dachte Hanna, hatte sie deshalb Geschichte studiert. Weil sie es so sehr hasste, Entscheidungen zu treffen. Und weil sie sich nichts sehnlicher wünschte, als dass die nächste Entwicklung schon hinter ihr lag und Gewissheit war. Erwiesen.
Sie drehte den Hausschlüssel in ihrer Hand und überlegte. Konfrontation oder Rückzug? Entschärfung oder Eskalation? Während sie verschiedene Szenarien in ihrem Kopf durchspielte, versuchte sie, sich damit zu beruhigen, dass es im Grunde egal war, wie sie entschied. Der Schmerz würde bleiben. So oder so. Und letztlich wurde Geschichte, auch die Geschichte jedes Einzelnen, von enorm vielen Faktoren beeinflusst. Es war immer eine Verkettung von Umständen, die eine historische Veränderung hervorbrachte, beschleunigte oder bremste. Umstände wie eine Inflation, eine Naturkatastrophe, ein instabiles Parlament, eine Terrorgruppe. Oder wie das Smartphone, das jetzt klingelte: +49. Call from Germany.
»Oma Tilde ist gestürzt. Sie liegt im Sterben.«
Trixies hohe Mädchenstimme klang brüchig, sie rang um Fassung. Hanna hatte seit Monaten nicht mit ihrer Schwester gesprochen. Und Trixie wusste, dass es bei ihr in New York mitten in der Nacht war. Hanna wandte den Blick vom Fenster ab. Es gab keinen Zweifel: Ihre Großmutter, bei der sie aufgewachsen war, die sie unendlich liebte und von der sie in standhaft kindlicher Unvernunft gehofft hatte, dass sie unsterblich sein würde, war es eben nicht. Während Trixie ihr mit medizinischer Genauigkeit die schweren Verletzungen schilderte, hastete Hanna bereits zur nächsten Subway Station. Ihre Entscheidung war gefallen.
Wenige Stunden später lief sie, ihren Rollkoffer hinter sich herziehend, durch die endlosen mit Teppich ausgelegten Gänge des John-F.-Kennedy-Flughafens.
»Han-na Ah-rens! This is your last call!«, klang es blechern aus dem Lautsprecher.
»Your flight to Frankfurt is now closing. Last call for passenger Hanna Ahrens.«
Hanna rannte nun. Der Aufruf begleitete ihren Sprint wie die jubelnden Rufe der Zuschauer die Läufer beim New York Marathon. Letztes Jahr hatte sie David angefeuert. Drei Stunden sechsundvierzig. Eine beachtliche Zeit für einen Mann über fünfzig. Hanna hasste Joggen. Aber mit David war sie immer gelaufen. Durch den Central Park, Runde um Runde um das Jackie O. Reservoir. So verknallt, dass ihr der anschließende Muskelkater völlig egal war.
»Seriously? Your name is Hannah Arendt?«, hatte David ungläubig gefragt, als sie einander vorgestellt worden waren.
»Like THE Hannah Arendt?«
Er war nicht der Erste, der sie das fragte. In der linken New Yorker Kulturszene war Hannah Arendt eine Ikone, ihr umstrittenes Buch über Eichmanns Prozess in Jerusalem legendär.
»Ahren-s«, berichtigte Hanna. »With an S, not a T.«
David sah sie an und lachte dann.
»Well, I’ve always liked asses better than teas.«
David J. Abrams war einer jener Amerikaner, die durch ihre Feingeistigkeit und Selbstironie das Klischee einer gesamten Nation ausgleichen zu wollen schienen. Er war Intendant und Managing Director eines Off-Broadway-Theaters, trug hauptsächlich Schwarz und rauchte Gitanes ohne Filter. Das dichte graue Haar fiel ihm in die Stirn, und wenn er – was er häufig tat – beim Reden sein Kinn zwischen Zeigefinger und Daumen zerknautschte, sah er ein bisschen aus wie Sean Penn. David gehörte zu der Sorte Männer, die grundsätzlich jeder Frau das Gefühl geben, etwas ganz Besonderes zu sein. Nicht aus Berechnung. Sondern aufgrund der Begabung, in jedem Menschen das zu sehen, was ihn einzigartig machte. Special. Jeder, der in Davids Dunstkreis trat, durfte sich ein wenig special fühlen. Wie weit dieser Dunstkreis reichte und wie viele, besonders weibliche, Menschen special waren, begriff Hanna erst, als es längst zu spät war. Tildes Warnungen, dass David ihr eines Tages sehr wehtun werde, hatte Hanna nicht hören wollen. Jetzt zahlte sie den Preis dafür.
Die Turbinen heulten auf, als Hanna sich völlig außer Atem auf ihren Platz fallen ließ. Das Flugzeug war voll. Sie hatte Businessclass buchen müssen. Ein schwerer Schlag für ihr Bankkonto, aber der Champagner tat gut. Und der Stapel deutscher Zeitungen, den die Stewardess ihr anbot, würde sie von ihrer Sorge um Tilde ablenken. Hanna nahm sich die Süddeutsche, die Welt und das Handelsblatt. Ein bisschen lesen, dann ein bisschen schlafen, das war der Plan. Doch als sie den ersten Politikteil aufschlug, verschluckte sie sich am Champagner. Auf der Doppelseite prangte das Konterfei ihres Schwagers. WIRSINDHEIMAT! – Anmaßung oder Realität? lautete die Schlagzeile. Und darunter: Felix von Altdorff – die neue deutsche Hoffnung?
Felix, der Mann ihrer Schwester Trixie, hatte vor drei Jahren überraschend das Direktmandat seines Wahlkreises für die CDU gewonnen und war seitdem Bundestagsabgeordneter. Hanna hatte mitbekommen, dass er sich inzwischen mit seiner Fraktion überworfen und eine wertkonservative Abspaltung, die BürgerUnion, gegründet hatte. Sie war ein willkommenes Auffangbecken für den rechten Flügel der Post-Merkel-CDU und erhielt großen Zulauf von ehemaligen Parteimitgliedern der AfD, die nach einer heftigen Kollision mit dem Verfassungsschutz und einer horrenden Strafzahlung wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz praktisch implodiert war. Mit der seltsam entrückten Distanziertheit einer Deutschen, die seit Jahren im Ausland lebte, hatte Hanna in den letzten Monaten das Scheitern der Regierungskoalition verfolgt. Die riesige Flüchtlingswelle, von der die Bundesrepublik nach einem heftigen Zerwürfnis mit der Türkei überrollt worden war. Die missglückte Vertrauensfrage. Es standen Neuwahlen an. Und Europa, das gerade erst begonnen hatte, sich langsam von den Nachwirkungen einer mehrjährigen weltweiten Pandemie zu erholen, glich einem Pulverfass. Was Hanna unterschätzt hatte, war die offenbar exponentiell gestiegene Beliebtheit der BürgerUnion. Es schien tatsächlich so zu sein, dass ihr Schwager Felix, den Hanna für einen blasierten, reaktionären Schaumschläger hielt, im Begriff stand, ein ernst zu nehmender Kanzlerkandidat zu werden.
Das Interview war lang, Hanna las es aufmerksam, auch wenn ihr vieles bekannt war. Felix’ Werdegang, sein Jurastudium, der harte Kampf um den Erhalt des Renaissanceschlosses – seit Jahrhunderten im Familienbesitz – und sein Weg in die Politik. Sie war überrascht, wie geschickt ihr Schwager seine Ansichten als klare und moderne Antworten auf die »Bedürfnisse der Bürger« verkaufte. Und sich selbst als Identifikationsfigur. Als jungen, aufstrebenden Bundespolitiker, der aneckte, weil er »die Deutschen ernst nahm« und »das Chaos beim Namen« nannte. Als Charakterkopf, der sich nicht hinter Parteipolitik verschanzte, sondern mit großer Klarheit und Standhaftigkeit für seine Überzeugungen eintrat. Hinzu kam natürlich der Glamourfaktor. Die gräfliche Familie. Niedliche Kinder in blauen Steppjacken vor der historischen Schlosskulisse. WIRSINDHEIMAT, der Wahlkampfslogan der BürgerUnion, fand ein Zuhause in diesen Bildern. Eine junge Familie vor alten Mauern. Trixie, schmal und blond, mit rosa Halstuch und Kugelbauch. Erst Anfang dreißig – und erwartete ihr viertes Kind. Tradition und Moderne. Das Narrativ und die Fotos waren wie gemacht für die Titelseiten von Hochglanzmagazinen. Felix selbst gab sich bodenständig: »Sie machen sich keine Vorstellung, was so ein vierhundert Jahre alter Sandsteinbau monatlich kostet. Geldsorgen sind in meiner Familie altbekannt. Von Tradition und Ehre allein kann man nicht leben.«
Als Hanna mit dem Artikel fertig war, hatte die Maschine bereits ihre Reiseflughöhe erreicht und die Stewardess kam mit einem weiteren Glas Champagner.
»Guter Typ«, bemerkte sie mit Blick auf Felix’ Riesenporträt. Erst da wurde Hanna bewusst, wie lange sie die Doppelseite schon anstarrte. Eilig legte sie die Zeitung zusammen, nur um sie gleich wieder aufzuschlagen. Es stimmte. Auf dem Foto war er wirklich gut getroffen. Felix trug die Haare kürzer als früher, weniger Gel, weniger Seitenscheitel. Die Schläfen waren etwas angegraut, die Fältchen um die Augen tiefer geworden, seit sie ihn vor zwei Jahren bei der Taufe seiner jüngsten Tochter Roxana zum letzten Mal gesehen hatte. Aber insgesamt wirkte er mit seinen sechsundvierzig Jahren immer noch sehr jugendlich. Und weitaus weniger abgehoben, als sie ihn in Erinnerung hatte. Offenbar hatte er exzellente Berater. Wenn er sich im Wahlkampf so präsentiert wie in diesem Interview, dachte Hanna, dann hat er durchaus eine Chance.
Machtergreifung war das Thema ihrer Masterarbeit gewesen – eine vergleichende Betrachtung der Militärputsche und Staatsstreiche des 20. Jahrhunderts – und hatte sie seitdem nicht mehr losgelassen. Seit drei Jahren arbeitete Hanna für ein kleines, aber recht renommiertes New Yorker Kulturmagazin und schrieb Rezensionen zu Theaterstücken und Kunstprojekten. Immer wieder hatte sie sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren eine politische Umwälzung begünstigten. Wirtschaftliche Krisen. Bedrohungen von außen. Eine polarisierte Gesellschaft. Ein Mensch, der den Nerv der Zeit traf. Eine Bewegung, die nach und nach ein ganzes Land erfasste. Am Beispiel der USA hatte Hanna eindrucksvoll miterlebt, wie fragil selbst eine alte, erprobte Demokratie plötzlich werden konnte. Dennoch war sie überzeugt gewesen, dass ein Phänomen wie die Trump-Präsidentschaft in ihrem Heimatland nahezu unmöglich war. Sie schien sich geirrt zu haben.
3
Mit geradem Rücken, dynamischen Schritten und ausgestreckten Händen betrat Felix von Altdorff den gut gefüllten Bankettsaal des Viersternehotels Wesermühle, ging auf die Menschenmenge zu und kam für die nächsten zehn Minuten aus dem Händeschütteln nicht mehr heraus. Um ihn herum Blitzlichtgewitter. Der Ortsverband des Wahlkreises hatte ganze Arbeit geleistet. Fünfhundert bis sechshundert Leute, schätzte Felix. Und hinter ihm strömten weitere herein. Mehr Männer als Frauen, das war ausbaufähig, aber immerhin mehr Karohemden als Sakkos. Sie brauchten die Wähler aus der unteren Mittelschicht. Er erreichte den Bürgermeister. Blitz. Den Hotelchef. Blitz. Den Leiter des Ortsverbands. Blitz. Und eine attraktive dunkelhaarige Frau, von der er keine Ahnung hatte, wer sie war. Blitz.
Immer mit beiden Händen die Hand des Gegenübers umfassen – das hatte er sich bei Bill Clinton abgeschaut, dem Idol seiner Jugend. Nahbar wirken. Verbindlich. Souverän. Er erreichte das Podium. Irgendein Depp hatte ein Namensschild drucken lassen: Felix Graf von Altdorff. Wann begriffen diese Amateure endlich, dass ein Adelstitel Distanz schaffte? Mit einer unauffälligen Handbewegung ließ er das Schild zu Boden gleiten, trat neben das Podium, breitete die Arme aus und schmetterte ohne Mikro in den Raum: »Guten Abend zusammen. Sie vermuten richtig: Ich bin der Mann vom Wahlplakat.«
Er war ein solider Tenor und zu Internatszeiten ein geschätztes Mitglied des Kirchenchors gewesen. Ohne Mikrofon zu sprechen fiel Felix leicht. Seine Frau hatte die Idee gehabt, es zu seinem Markenzeichen zu machen. Überhaupt sein ganzes Styling. Die modernere Brille, der kürzere Haarschnitt. Trixie hatte sich insgesamt als ausgezeichnete Beraterin erwiesen. Und auch wenn die unbekannte, attraktive Dunkelhaarige, die nah beim Podium stand, ihn wahrlich verführerisch anlächelte – Felix von Altdorff war ein Mann von starken Werten. Treu. Geradlinig. Konservativ. Niemals würde er auch nur auf die Idee kommen, seine Frau zu betrügen. Die Mutter seiner drei, bald vier Kinder. Diesmal wieder ein Junge nach den zwei Mädchen. Perfekt.
»Familie«, fuhr er gemäßigter fort. Im Raum herrschte erwartungsvolle Stille. »Familie ist der verkannte Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Unsere Erziehung macht uns zu dem, was wir sind. Sie öffnet die Türen für unsere Entwicklung im Erwachsenenalter. Wenn wir Familien nicht fördern, verbauen wir nicht nur unseren Kindern die Zukunft, sondern unserem ganzen Land. Unserer Heimat.«
Pause. Ernster Blick in die Runde.
»Wir sind aktuell fast die geburtenschwächste Nation der Welt. Ja, die Rate ist ein wenig gestiegen in den letzten zwei Jahren. Es gibt wieder mehr Babys. Aber in was für Familien werden sie hineingeboren? Wie viel Prozent dieser Eltern sind regelmäßig erwerbstätig? Wie viele von ihnen sind gebürtige Deutsche? Wie viele sind Christen?«
Er senkte die Stimme noch ein wenig.
»Meine Damen und Herren, es ist ganz einfach: Wenn wir so weitermachen, sterben wir aus!«
Ein herzlicher Zwischenapplaus. Felix sah sie an, die Karohemdenträger im Gasthof Wesermühle. Die deutschen Väter. Die alle Schiss hatten, dass ihre Kinder bald nur noch vereinzelt zwischen Migranten in den Klassenräumen der deutschen Schulen sitzen würden. Auch wenn das keiner von ihnen laut aussprach.
»Die Bundesregierung muss endlich wieder anfangen, im Interesse der Deutschen zu handeln! Das klingt heutzutage nach Rechtspopulismus. Dabei ist es die ureigenste Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen. Es steht sogar in unserem Grundgesetz.«
Beifälliges Gemurmel. Felix kam in Fahrt.
»In den letzten Jahren waren die Regierungsparteien so sehr damit beschäftigt, Krisen in anderen Teilen Europas zu entschärfen, die Pandemie zu bewältigen, Staatsverschuldungen anderer Länder auszugleichen und Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen, zu versorgen, zu integrieren – oder sich darüber zu streiten –, dass sie die Nöte, die Sorgen und die Ängste ihrer Bürgerinnen und Bürger gänzlich aus den Augen verloren haben. Nationale Interessen zu vertreten hat mit Nationalismus nichts zu tun!«
Der Applaus schwoll an.
»Oft wird mir vorgeworfen, ich sei gegen Europa. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Ich halte die EU sogar prinzipiell für eine gute Idee. Aber die Währungsunion ist es nicht. Nie gewesen. Der Euro hat den Ländern Europas die Möglichkeit genommen, wirtschaftspolitische Schwierigkeiten über schwankende Wechselkurse abzupuffern. Die Pandemie hat uns alle zusätzlich geschwächt. Immer wieder müssen Rettungsschirme her. Und wer sind die Leidtragenden? Starke Industrienationen mit hohem Bruttoinlandsprodukt. Wir.«
Wieder Applaus. Felix hob die Hände.
»Bei der Sicherheitsunterweisung im Flugzeug heißt es: Ziehen Sie eine der Sauerstoffmasken zu sich herunter – ERSTDANN helfen Sie anderen. Warum? Weil man nicht helfen kann, wenn man selbst keine Luft bekommt!«
Jubel im Saal. Felix trank einen Schluck Wasser. Es lief.
»Wenn ich Angst habe, meine Kinder allein auf den Schulweg zu schicken. Wenn in den Großstädten Clans ganze Viertel terrorisieren. Wenn niemand mehr ins Fußballstadion geht oder auf den Weihnachtsmarkt, weil Hass und Gewalt allgegenwärtig sind. Wenn wir uns hier, in unserem eigenen Land, nicht mehr wohl und sicher fühlen, dann hat unser Staat versagt.«
Felix warf einen Blick auf die große Wanduhr am anderen Ende des Saals. Es war Zeit für den Abschluss, den persönlichen Teil.
»Viele von Ihnen haben die Nase voll von Politikern, von Wahlkampfversprechen, von Eliten. Sie meinen vielleicht, dass auch ich zur Elite gehöre, aber das ist nicht so. Meine Familie stand vor noch nicht allzu langer Zeit kurz vor dem Bankrott. Und wissen Sie, wer uns nicht geholfen hat? Der Staat.«
Er ließ den Satz einen Moment verklingen.
»Deshalb stehe ich heute hier. Als Familienvater. Als Bürger. Als einer von Ihnen. Mitglied des Bundestags bin ich erst seit wenigen Jahren. Ich habe mich mit meiner Fraktion überworfen, weil ich zu dem stehe, was ich im Wahlkampf versprochen habe. Damit habe ich den Verlust vieler Rechte als Abgeordneter in Kauf genommen. Das, was Sie heute Abend von mir hören, ist keine Parteipolitik. Es sind meine Überzeugungen.«
Er senkte seine Stimme ein wenig.
»Ich sage: Wir haben unsere Interessen vernachlässigt. Wir meinen, für politische Bekenntnisse der Vergangenheit geradestehen zu müssen, auch wenn sie uns schaden. Wir nehmen unzählige Flüchtlinge auf, die andere Länder bedenkenlos abweisen. Warum? Aus einem völlig überholten Schuldgefühl heraus? Weil wir als einziges Land auf dieser Welt meinen, immer noch kein Nationalgefühl empfinden zu dürfen?«
Er zog seinen Reisepass aus der hinteren Hosentasche und hielt ihn hoch.
»Ich möchte dafür sorgen, dass dieses Dokument hier wieder zu dem wird, was es sein soll: Ihre Identität. Ihre Zugehörigkeit. Ihr Privileg. Ein Dokument, das viele Menschen auf dieser Welt gerne hätten. Ein Dokument, auf das Sie stolz sein können. Ich danke Ihnen.«
Der Applaus wollte nicht enden. Felix blieb noch eine Weile stehen, umfasste Hände, posierte für Selfies und signierte sein vor Kurzem erschienenes Buch: DER STAAT – MEINE HEIMAT? Es war nur ein schmales Taschenbuch, kaum mehr als eine Broschüre und kostete nicht mal zehn Euro. In den drei Monaten seit Erscheinen waren bereits mehrere Hunderttausend Exemplare verkauft worden. Ein Erfolg, den er zum großen Teil Tobias Thiel zu verdanken hatte. Seinem Pressereferenten und Webstrategen.
Sie hatten sich vor einigen Jahren kennengelernt, als Felix, damals mitten in seinem ersten Wahlkampf, zu einem Vortrag über Europapolitik nach Münster gereist war – zurück in die Wiege seiner akademischen Ausbildung. Und zurück in das Verbindungshaus, das ihm so viele Jahre Schutz und Anker gewesen war. Tobias war dort ein sehr aktives Mitglied, ein Digital Native, geboren Mitte der Neunziger. Über fünfzehn Jahre trennten sie, und trotzdem kam es Felix so vor, als wäre Tobias eine Art jüngerer Bruder. Vielleicht sogar ein bisschen gescheiter als er selbst, aber auch ein bisschen weniger selbstbewusst. Das Rückgrat, welches eine achthundert Jahre zurückreichende Ahnentafel einem verlieh, war dann eben doch durch nichts aufzuwiegen.
Momentan arbeitete Tobias an seiner Dissertation, für die Felix einen renommierten Münsteraner Professor als Doktorvater gewonnen hatte. Selbstverständlich, wie Felix selbst, ein alter Herr der Verbindung. Tobias hatte seitdem alle Zeit der Welt, um mit seiner »Diss« fertig zu werden, und konnte Felix im nunmehr zweiten – und entscheidenden – Wahlkampf unterstützen. Denn noch viel besser als im deutschen Recht kannte Tobias sich mit sozialen Medien aus – und damit, wie man sie für sich nutzen konnte.
Jetzt hielt er den linken Arm hoch und deutete auf seine Smartwatch. Es war spät geworden. Felix schüttelte noch ein paar Hände, machte zwei letzte Selfies und ließ sich mit entschuldigender Geste von Tobias aus dem Raum ziehen. Auf dem Weg zum Auto rief er seine Frau an.
»Wie lief’s?«, fragte Trixie so leise, dass er sie kaum hören konnte.
»Gut. Sehr gut. Wie geht es Tilde?«
»Ihr Zustand ist kritisch.«
Trixies Stimme zitterte.
»Ich habe Hanna angerufen. Sie ist auf dem Weg hierher.«
Felix schwieg. Trixies Verhältnis zu ihrer großen Schwester war nicht unkompliziert – und seins schon gar nicht. Aber er schätzte Hanna, trotz aller politischen Differenzen. Vielleicht sogar genau aus diesem Grund. Weil sie es immer wieder wagte, ihm Paroli zu bieten. Davon abgesehen würde es Trixie auf jeden Fall guttun, Hanna an ihrer Seite zu haben. Auch eine schwierige Schwester war eine Schwester.
Trixie fragte nicht, wann er nach Hause komme. Das tat sie nie. Felix wusste, wann sie ihn brauchte. Er stieg in die bereitgestellte Limousine. Tobias Thiel setzte sich neben ihn auf die Rückbank und reichte ihm die Termine für den nächsten Tag. Durchgetaktet von 8:00 bis 22:00 Uhr. Felix legte die Stirn an das kühle Seitenfenster. Es hatte zu regnen begonnen.
»Hinnerk Ahrens hat einige Leute von der Basis in die Fuhrkammer eingeladen«, begann Tobias vorsichtig. »Ich dachte, du willst vielleicht …«
»Ich will nach Hause«, antwortete Felix entschieden.
Tobias nickte, wandte sich an den Fahrer und sagte: »Zum Schloss.«
Zügig glitt der Wagen durch den stärker werdenden Regen. Felix wusste, dass es strategisch klüger gewesen wäre, sich kurz in der Fuhrkammer blicken zu lassen. Es war nie gut, Hinnerk Ahrens mit Publikum allein zu lassen. Trixies Onkel war Gründungsmitglied der BürgerUnion, ein tendenziöser Aufwiegler und Wichtigtuer.
»Fahr du hin«, sagte er, einer Eingebung folgend, zu Tobias, der sein Smartphone in der Hand hielt und eifrig twitterte. Tobias war ehrlich überrascht.
»Aber ich …«
»Du kennst die Leute, bist in der Lage, meine Positionen zu vertreten, und du weißt, wie man mit Hinnerk Ahrens umgeht.«
Er sah ihn von der Seite an, lächelte.
»Setz mich zu Hause ab und nimm meinen Wagen.«
Tobias Thiel errötete. Felix hatte ihn gerade inoffiziell befördert. Aus reinem Eigennutz. Heute musste die gottverdammte Basis ohne ihn klarkommen.
Tilde war wie eine Mutter für Trixie gewesen. Und Felix wusste, wie es sich anfühlte, wenn man seine Eltern verlor.
4
Stefan Kruse trat vor die Tür des Hotels Wesermühle und fummelte fahrig ein Päckchen Zigaretten aus seiner Jackentasche. Hektisch zog er eine Zigarette heraus, zündete sie sich an und sog den Rauch ein. Schon besser. Dieser Tag war eine Achterbahnfahrt gewesen. So wie fast jeder Tag der letzten acht Wochen seit seiner Kündigung. Langsam war er mit den Nerven am Ende. Nicht, weil er im Moment keine Arbeit hatte. Sondern, weil er befürchtete, dass dieser Zustand ihn seine Ehe kosten würde. Nicole hatte zunächst mit Entsetzen auf seine Entlassung reagiert. Dann mit Kampfgeist, der ihn anfangs beeindruckt hatte, bis er begann, sich gegen ihn zu richten.
»Du TUST nichts, Stefan! Du musst doch was TUN! Denk mal an die KINDER!«
Und schließlich, das finale Stadium: Vorwurf.
»Wie KONNTEST du das ZULASSEN! Deinetwegen geht ALLES den Bach runter!«
Nicole hatte die Angewohnheit, einzelne Wörter in ihren SMS zu Betonungszwecken GROSS zu schreiben. Wenn sie ihn anmeckerte, hatte Kruse das Gefühl, sie tat es ebenfalls in Großbuchstaben.
»Kruse! Wir treffen uns gleich in der Fuhrkammer. Kommst du mit?«
Sein Kumpel Peter Schmitz trat neben ihn, ebenfalls eine Zigarette im Mundwinkel. Kruse gab ihm Feuer. Er kannte Schmitz schon seit der Schulzeit. Sie hatten zusammen gedient. Die Marotte, sich beim Nachnamen zu rufen, war beim Bund entstanden und bis heute geblieben. Kruse hatte kurz nach dem Wehrdienst geheiratet. Bald kam das erste Kind. Inzwischen waren die Mädchen dreizehn und sechzehn. Schmitz hatte sich verpflichtet, war drei Jahre in Bosnien gewesen. »Nicht meine schlechtesten Jahre«, sagte er gern.
Schmitz war ein Macher. Drahtig, braun gebrannt, meistens guter Dinge. Keine Kinder, dafür wechselnde attraktive Frauen an seiner Seite – und ein sehr treuer, inzwischen in die Jahre gekommener Rottweiler namens Blücher. Er hatte eine kleine Security-Firma in Hannover, die ganz ordentlich zu laufen schien. Seine derzeitige Freundin Britta betrieb den Gasthof Zur Post. Die Fuhrkammer war die zugehörige Kneipe. Hier bekam man tagsüber Ofenkartoffeln mit Salat, abends Wildgulasch und immer ein frisches Pils vom Fass. Die Fuhrkammer war ein beliebter Treffpunkt bei Mitgliedern der BürgerUnion. Schmitz leitete den Ortsverband und hatte gemeinsam mit Hinnerk Ahrens einen »ausdrücklich unpolitischen« Stammtisch ins Leben gerufen. Schon mehrfach hatte er Kruse dazu eingeladen. Allerdings trank Nicole grundsätzlich keinen Alkohol und schätzte es auch nicht, wenn ihr Mann es tat. Britta wurde von ihr nur abfällig als »die Kneipenwirtin« bezeichnet. Kruse mochte Britta.
»Komm schon«, sagte Schmitz. »Wenigstens auf ein Bier. Die wollen dich kennenlernen, jetzt, wo du Mitglied bist.«
Kruse warf einen Blick auf sein Smartphone. Drei verpasste Anrufe und eine Nachricht von Nicole: »Wo BLEIBST du? Wir müssen REDEN!!!«
»Meine Frau«, begann er. Dann hielt er inne. Er dachte, dass das einzig Erfreuliche, was er seit einigen Wochen erlebt hatte, Felix von Altdorffs Rede gewesen war – und die begeisterte Stimmung im Saal. Er nahm einen letzten Zug, schnippte die Kippe weg und schaltete sein Handy aus.
»Scheiß drauf«, sagte er. Schmitz klopfte ihm grinsend auf die Schulter.
»Wurde auch mal wieder Zeit.«
In der Fuhrkammer war es warm und laut. Britta stellte Kruse ein routiniert gezapftes Pils mit beeindruckender Schaumkrone auf den Tresen. Und einen Schnaps.
»Geht aufs Haus«, sagte sie, als sie seinen Blick bemerkte, und schenkte sich auch einen ein.
»Ich muss noch fahren«, gab Kruse zu bedenken.
Britta zuckte mit den Schultern. Scheiß drauf, dachte Kruse erneut und kippte den Kurzen. Dann hörte er Schmitz seinen Namen rufen und ging zum Stammtisch im Hinterzimmer. Dort saßen gut zwanzig Leute. Alle tranken Pils. Auch die Frauen. In der Mitte stand das Parteibanner.
»Mein Kumpel Kruse«, stellte Schmitz ihn vor. »Baut eine AK-74 in fünfunddreißig Sekunden auseinander und wieder zusammen.«
»Schon ’ne Weile her«, sagte Kruse. Aber er freute sich trotzdem über das Kompliment.
Die anderen hoben ihre Gläser. Kruse kannte nur zwei von ihnen. Der eine war sein Schwippschwager Hinnerk Ahrens, der andere dessen Sohn Helge. Hinnerk gehörte der Reitstall, in dem das Pony seiner Tochter stand, das sie nun wahrscheinlich verkaufen mussten (wie KONNTEST du das ZULASSEN!).
Kruse fand ihn nicht besonders sympathisch. Er war herrisch, laut und gab ihm immer das Gefühl, ihn nicht ernst zu nehmen. Hinnerks Frau Frieda war Nicoles Halbschwester. Nicole neidete Frieda alles. Den Hof, das Geld, die Privilegien. Sie hatte immer dazugehören wollen, zum Ahrens-Clan. Auf ihren Druck hin hatte Kruse es geduldet, dass die Familie über ihre Verhältnisse lebte. Die Klamotten, der Reitsport, die Statussymbole. Urlaube an Orten, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten, nur damit Nicole und die Mädchen Ruhe gaben. Ein Kredit nach dem anderen. Und jetzt fehlte ihm das Geld, sie abzuzahlen.
»Kruuuuse!«, donnerte Hinnerk über den Tisch. »Deine Frau macht mich wahnsinnig mit ihrem plötzlichen Sparwahn!«
»Lass ihn in Ruhe, Hinnerk!«, zischte Schmitz.
Es war nett gemeint, aber Kruse spürte deutlich: Wenn er es nicht schaffte, sich in dieser Runde zu behaupten, würde er das letzte bisschen Selbstachtung, das ihm noch geblieben war, verlieren. »Schon gut«, sagte er bemüht leichthin zu Hinnerk: »Mich macht sie auch wahnsinnig. Kannst du es wie einen Unfall aussehen lassen?«
Hinnerk sah ihn konsterniert an. Sein ohnehin schon rötliches Gesicht verfärbte sich noch eine Nuance dunkler. Dann knallte er sein Glas auf den Tisch und brach in schallendes Gelächter aus – und die ganze Runde mit ihm.
Kruse war dankbar, dass die Gruppe sich anschließend anderen Themen zuwandte. Es lag ihm überhaupt nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Als Kind hatte er gestottert, und wenn er aufgeregt war, neigte er immer noch dazu. Alles, was mit Sprache zu tun hatte, fiel ihm schwer. Er mochte Physik, Mathematik, Maschinen. Welten, in denen es klare Gesetze gab, in denen es nicht um den sprachlichen Ausdruck ging. Trotz der obligatorischen Fünf in Deutsch schaffte er den Realschulabschluss und begann eine Ausbildung zum KfZ-Mechaniker. In der Werkstatt fühlte er sich wohl. Sein Meister war sehr genau und förderte ihn, leider erlitt er kurz vor Kruses Gesellenprüfung einen Herzinfarkt, und die Werkstatt wurde aufgelöst. Kruse ging zum Bund, schloss seine Ausbildung ab und fand eine gute Anstellung bei einem mittelgroßen Hersteller von Nutzfahrzeugen und Landmaschinen. Er hatte nie seinen Arbeitgeber gewechselt – vielleicht hätte er das tun sollen. Hin und wieder hatte er darüber nachgedacht, sich selbstständig zu machen, aber das Gehalt war gut und Nicole jobbte nur halbtags bei einer Versicherung, sie verdiente nicht viel dazu.
Kruse hatte mitbekommen, dass das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte – Sommerfest und Weihnachtsgeld wurden gestrichen. Als die Übernahme durch einen großen amerikanischen Konzern erfolgte, atmeten zunächst alle auf. Dann flatterte die betriebsbedingte Kündigung ins Haus. Kruse war nicht der Einzige. Er hatte sich mit seinen Kollegen zusammengetan und geklagt, der Bruder eines Mitstreiters war Rechtsanwalt. Gegen die fünf Topanwälte der Gegenseite, die in teuren Anzügen aus Berlin und Detroit anreisten, hatte er keine Chance. Die Kündigungen seien wirksam, befand das Gericht, die Firma stellte alle sofort frei, Kruse blieben sechs Monatsgehälter, und der Anwalt kostete trotz des mauen Ergebnisses eine Menge Geld. Mittlerweile war Kruse hoch verschuldet und das Arbeitslosengeld reichte kaum für die Rückzahlungsraten. Dennoch bestellte Kruse noch ein Bier. Heute Abend, nur heute Abend, wollte er einmal nicht ans Geld denken.
Die Stimmung am Tisch war gut, und nachdem Hinnerk von seinem Smartphone aktuelle Klicks, Likes und Umfragewerte vorgelesen hatte, steigerte sie sich ins Euphorische. Kruse fiel auf, dass niemand sich auf Altdorffs Rede bezog, und warf, ermutigt durch das zweite Pils, einen lobenden Kommentar dazu in die Runde. Es wurde für einen Moment ruhiger am Tisch. Kruse war irritiert – hatte er etwas Falsches gesagt?
»Bisschen viel Familie, bisschen wenig Einwanderungspolitik«, gab Hinnerks Sohn Helge schließlich zurück.
Die zwei jüngeren Männer neben ihm nickten zustimmend.
»Hat er das Wort Islam überhaupt in den Mund genommen?«
»Natürlich nicht!«, ereiferte sich Hinnerk. »Dabei habe ich ihm drei Mal gesagt: Wir müssen langsam Farbe bekennen!«
»Aber echt!«, fügte eine ältere Frau mit Kurzhaarschnitt hinzu. »Habt ihr gehört, dass der niedersächsische Landtag noch mal fünfzehn Millionen lockergemacht hat für den Bau neuer Flüchtlingsheime? Das Geld war ursprünglich für die Renovierung weiterführender Schulen vorgesehen.«
»Diesen Schwachsinn wird unser lieber Wahlkreiskandidat ja hoffentlich in Zukunft verhindern können«, erwiderte Helge und warf einen vielsagenden Blick zu seinem Vater hinüber, der selbstgefällig grinste.
»Schotten dicht und Schluss! Das werde ich ihm schon noch einbläuen«, polterte Hinnerk und lehnte sich zurück. »Er weiß ja, was er uns zu verdanken hat.«
Kruse tauschte einen Blick mit Schmitz. So also stand die Basis zu ihrem Spitzenkandidaten.
»Ich hoffe, Sie vergessen nicht, was Sie ihm verdanken«, meldete sich plötzlich eine markante Stimme. Alle am Tisch sahen zur Tür. Ein junger Mann im Anzug stand dort, hatte eine Hand lässig in die Hosentasche gesteckt und musterte die Gruppe abschätzig. Er war sicher noch keine dreißig, wirkte aber sehr selbstbewusst und energisch. Hinnerk brummte etwas Unverständliches und orderte dann lautstark bei Britta eine neue Runde. Der junge Mann setzte sich neben Kruse.
»Tobias Thiel«, stellte er sich vor und reichte Kruse die Hand. »Ich bin der Pressereferent des Parteichefs.«
Im Laufe des Abends kam zur Sprache, dass Thiels Vater eine Maschinenfabrik in Hannover leitete. Schmitz nutzte die Gelegenheit und erwähnte, dass Kruse auf Jobsuche sei. Kruse wäre am liebsten im Boden versunken, zumal Hinnerk das als Steilvorlage für einen sarkastischen Spruch nahm, doch Tobias Thiel ignorierte ihn. Er zückte sein Handy, ließ sich Kruses Nummer geben und schickte ihm den Kontakt.
»Rufen Sie ihn an«, sagte er. »Ich bin sicher, Sie werden sich einig.« Dann fügte er leiser hinzu: »Die Verwandtschaft mit Hinnerk Ahrens ist ja per se kein Ausschlusskriterium.«
Kruse lächelte und dachte, dass sein Beitritt zur BürgerUnion die beste Entscheidung war, die er in den letzten zehn Jahren getroffen hatte.
5
Sie war nach Osten geflogen. »Against time« nannte David das. Man verlor Zeit. Obwohl Hanna den nächsten verfügbaren Flieger gebucht und eiligst gepackt hatte, ging die Sonne schon wieder unter, als sie schließlich in Hamburg-Fuhlsbüttel landete. Der Chefredakteur des Magazins, für das sie schrieb, hatte zum Glück Verständnis gezeigt. Als feste Freie war sie nicht unentbehrlich. Hanna telefonierte mit Trixie, die sich entschuldigte, sie nicht abholen zu können. Die Kinder mussten ins Bett. Sie war bis eben bei Tilde gewesen und klang besorgt. Hanna wurde klar, dass sie jetzt keine Zeit verlieren durfte. Die Autovermieter waren fast alle restlos ausgebucht. Messe. Es half nichts: Sie musste ihr durch den Businessflug ohnehin schon überzogenes Konto noch ein bisschen mehr strapazieren. Hanna mietete einen gut motorisierten Audi zu einem absurd hohen Preis, besorgte sich einen doppelten Latte To go und brauste in Richtung Autobahn.
Sie hatte ihre Indie-Playlist aufgerufen, per Bluetooth mit dem Soundsystem des Audi synchronisiert, und war gerade zu den Beats von »Ashtray Heart« an der Ausfahrt Lengenbostel vorbeigerast, als der Anruf kam. David calling. Hanna versuchte, ihn wegzudrücken und gleichzeitig die Kontrolle über den 220 km/h schnellen Wagen zu behalten, was dazu führte, dass kurz darauf der volle Bassbariton von David J. Abrams aus den Dolby-Surround-Boxen hallte.
»Hanna, are you okay?«
Hannas Finger krampften sich um das Lenkrad. Nie war irgendwas, vor allem nicht sie, weniger okay gewesen.
»I’m in Germany«, erwiderte sie, so kühl es ging. »My grandma is dying.«
»God, I’m so sorry.«
Die Scheißwärme in seiner Stimme machte Hanna fertig. Das Ende musste her. Jetzt.
Sie hielt ihren Blick fest auf die vorbeirasende linke Leitplanke gerichtet und machte in wenigen, kurzen Sätzen klar, dass sie wusste, wer seit Kurzem die Nächte mit ihm in seinem Apartment am Morningside Park verbrachte.
Als Antwort kam lange nichts. Sie hörte ihn atmen. Dann schließlich: »Hanna … Can we please talk about this?«
Hanna trat das Gaspedal durch. 240 km/h.
»No«, sagte sie. Und dann, in seinem Tonfall: »I’m so sorry.«
Das Auflegen gelang ihr einwandfrei.
Hanna drehte das Radio lauter. Es lief ein Bericht über die anstehenden Neuwahlen. Sie waren für den letzten Sonntag im November angesetzt. Der Sprecher gab einen kurzen Abriss der geschichtlichen Präzedenzfälle, dann folgten eine Analyse der aktuellen Umfragen und ein Porträt der BürgerUnion. Neben Felix ging es um eine Frau, Greta Meyer zur Mühlen, die offenbar einen erfolgreichen Wahlkampf im Osten Deutschlands führte. Hanna hörte aufmerksam zu, vor allem bei den O-Tönen. Diese Greta war gut, rhetorisch konnte sie Felix absolut das Wasser reichen. Der Slogan WIRSINDHEIMAT klang durch ihren leichten sächsischen Akzent sogar fast noch ein bisschen authentischer.
Hanna hatte während ihres Studiums eine Hausarbeit über die parlamentarischen Unruhen geschrieben, die 1982/83 auf den NATO-Doppelbeschluss folgten: die Vertrauensfrage von Helmut Schmidt, das Misstrauensvotum gegen ihn und dann die Vertrauensfrage von Helmut Kohl, mit der er das endgültige Wählermandat für die schwarz-gelbe Koalition und auch für sich selbst als Bundeskanzler erhielt. Kohl hatte sich die aufgewühlte Stimmung im Land zunutze gemacht. Felix verfolgte eine ganz ähnliche Strategie. Noch nie waren die Volksparteien so schwach gewesen. Wenn es der BürgerUnion gelang, viele Direktmandate zu holen, was ganz offensichtlich möglich war, dann hatten sie eine realistische Chance, Regierungspartei zu werden.
Als Hanna den Mietwagen auf dem Krankenhausparkplatz abstellte, sah sie eine hochgewachsene, blonde Frau zu einem großen grünen Geländewagen gehen. Ihre Tante Frieda. Die Frau von Hinnerk, Tildes jüngstem Sohn. Trixie nannte sie die Friesenstute. Tilde war damals nicht begeistert gewesen von Hinnerks Wahl, aber er hatte sich durchgesetzt. Keine fünf Jahre nach der Hochzeit überschrieb Tilde ihm den landwirtschaftlichen Betrieb und kaufte sich ein renovierungsbedürftiges Fachwerkhaus im Nachbardorf. Ihr Altenteil, wie sie es selbst nannte. Offiziell, weil sie ihrem Sohn die Möglichkeit geben wollte, sich geschäftlich zu entfalten. Doch Hanna wusste, dass Tilde in Wahrheit die tägliche Konfrontation mit diesem Paar einfach nicht mehr ertragen hatte.
»Sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte«, sagte Hinnerk gern spöttisch über seine Frau, was Hanna unmöglich fand, abgesehen davon, dass man Frieda damit nicht gerecht wurde. Sie war vielleicht nicht sehr gebildet, aber durchaus bauernschlau und ein echtes Arbeitstier. Die gelernte Speditionskauffrau machte die Buchhaltung selbst, hielt den Hof zusammen und rechnete jeden Cent genau ab, sodass Hinnerk sich um das kümmern konnte, was ihm Spaß machte: Pferde, Landmaschinen, Lokalpolitik, seine Gäste und seine Schnapsbrennerei.
Hannas Sympathie für Frieda hielt sich in Grenzen, aber sie beneidete ihre Tante auch nicht um diese Ehe. Abends, im Reiterstübchen, wenn er sein erstes Bier intus hatte, konnte ihr Onkel Hinnerk ein netter Kerl sein. Hauptsächlich kannte Hanna ihn aber als launischen, selbstgefälligen Gutsherrn, der sich gern an Reitschülerinnen heranmachte und wahlweise über die deutsche Regierung oder über seine Frau herzog. Das hatte Frieda im Laufe der Jahre immer mehr abstumpfen lassen. Freundlich war sie meist nur zu Menschen, von denen sie Geld oder Informationen wollte. Und wirkliche Wärme zeigte sie allein im Umgang mit ihrem älteren Sohn Helge – Friedas ganzem Stolz. Bundeswehrsoldat, Ausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister mit Auszeichnung und danach noch ein Fachhochschulstudium Agrarwirtschaft. Helge würde den Hof übernehmen, so viel stand fest, und entsprechend benahm er sich auch. Ein arroganter Angeber, zu dem Hanna, jenseits von gelegentlichem Small Talk auf Familienfeiern, keinen Kontakt pflegte. Umso enger war ihr Verhältnis zu Helges jüngerem Bruder Joost. Dem in Ungnade gefallenen zweiten Sohn, über den weder Hinnerk noch Frieda gern sprachen. Mit sechzehn Jahren hatte er sein Coming-out gehabt, nach einem Riesenstreit den elterlichen Hof verlassen und ein Zimmer in Hannas Hamburger Studenten-WG bezogen. Neben Tilde war Joost der Mensch in der Familie Ahrens, der ihr am nächsten stand. Weit näher als ihre eigene Schwester.
Hanna stieg aus und überlegte, ob sie einfach so tun sollte, als hätte sie Frieda nicht gesehen. Da gellte es schon quer über den Parkplatz: »Hanna? Bist du das?«
Hanna schloss kurz die Augen und ging auf Frieda zu. Sie begrüßten sich distanziert.
»Die Besuchszeit ist gerade vorbei«, bemerkte Frieda, während sie sich die blondierten Haare zu einem straffen Pferdeschwanz band.
»Dann beeile ich mich besser.« Hanna wollte sich schon abwenden, doch Frieda war zu neugierig, um sie einfach gehen zu lassen.
»Seit wann bist du wieder in Deutschland?«, forschte sie.
»Seit zweieinhalb Stunden«, erwiderte Hanna knapp.
»Willst du bei uns übernachten? Wir könnten dich problemlos in einem der Gästezimmer unterbringen.«
Und dich weiter ausfragen, ergänzte Hanna im Geist.
»Danke. Ich schlafe bei Trixie.«
Eine glatte Lüge. Aber sie wollte endlich zu Tilde. Nach einer kurzen Abschiedsfloskel ging sie eilig Richtung Krankenhauseingang. Im Rücken spürte sie Friedas bohrende Blicke.
Niemand hielt sie auf, sodass Hanna irgendwann vor einer gelben Schiebetür stand – mit der Aufschrift »Intensivstation – kein Zutritt«. Sie drückte die Klingel und machte sich auf eine längere Diskussion mit dem Pflegepersonal gefasst, doch zu ihrer Überraschung öffnete sich die Tür mit einem zischenden Geräusch und ein junger Mann mit Brille und braunen Locken kam ihr entgegen. Auf seinem weißen Kittel trug er ein aufgenähtes Namensschild: Dr. Martin Born. Chirurgie.
»Sie sind also Hanna«, konstatierte er lächelnd, nachdem Hanna ihr Anliegen vorgebracht hatte. »Sie werden schon sehnlichst erwartet.«
Gemeinsam gingen sie den Gang hinunter. Es war sehr ruhig. Aus den Zimmern drang nur ab und zu ein leises Piepen oder das rhythmische Schnaufen eines Beatmungsgeräts. Vor der Tür mit der Nummer 321 blieb Dr. Born stehen.
»Ihr Zustand ist leider kritisch.« Er sprach leise, sein Blick war jetzt sehr ernst. »Während der Not-OP gestern hat ihr Herz zweimal ausgesetzt. Aber wir hatten keine Wahl, eine der gebrochenen Rippen hatte den rechten Lungenflügel perforiert. Zumindest konnten wir Ihre Großmutter vorerst stabilisieren.«
Hanna merkte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich.
»Müssen Sie noch mal operieren?«
»Das Schädel-CT macht uns Sorgen. Es scheint, dass der Aufprall zu einem subduralen Hämatom geführt hat, einer Blutung unterhalb der Hirnhaut. Aber wir warten erst einmal ab, ob es sich in den nächsten Stunden vergrößert. Frau Ahrens ist auf jeden Fall bei Bewusstsein und auch ansprechbar.«
Dr. Born blieb noch einen Moment in der Tür stehen, während Hanna sich langsam dem Bett näherte. Tilde Ahrens hatte die Augen geschlossen. Ihr Gesicht war totenblass, am linken Hinterkopf klebte eine Kompresse, offenbar war dort die Schädelverletzung. Wangenknochen und Kinn schillerten dunkelviolett. Ihr weißes Haar stand wirr in alle Richtungen. Sie wirkte unglaublich klein und sehr, sehr alt. Tränen brannten in Hannas Augen. Sie ging zum Bett und ergriff vorsichtig Tildes linke Hand. Der rechte Arm war eingegipst. Diverse Schläuche führten unter die Bettdecke. Hanna sah nicht hin. Die Frequenz des Herz-Kreislauf-Monitors erhöhte sich etwas, als sie die Hand berührte, kurz darauf öffnete Tilde die Augen.
»Han-na«, sagte sie leise, fast tonlos. »End-lich.«
Sie atmete einmal tief ein und aus. Dann lächelte sie schwach.
Hanna wollte etwas sagen, doch es ging nicht. Unaufhaltsam liefen ihr nun die Tränen über die Wangen. Sie sah zur Tür, dorthin, wo eben noch Dr. Born gestanden hatte. Doch er war nicht mehr da.
»Nicht wei-nen«, sagte Tilde und strich kaum merklich mit ihrem Daumen über Hannas Hand.
Hanna lachte kurz auf, schüttelte dann den Kopf und wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht.
»Scheiße«, sagte sie schließlich. Es war das erste Wort, das ihr über die Lippen kam. Danach fand sie langsam die Sprache wieder. »Wie ist das passiert?«
»Trep-pe«, flüsterte Tilde.
»Bist du … Hast du Schmerzen?«
Tilde hob die Hand und ließ sie wieder fallen. Es war ein Abwinken. Dann sah sie Hanna an. Ihre Augen waren müde.
»Glück-lich?«, fragte sie.
Hanna dachte an den Spätsommerabend vor zwei Jahren zurück. Es war ihr letzter Aufenthalt in Deutschland gewesen. Mit Tilde auf der Terrasse. Zwei Sekt auf Eis. Sie hatte ihr von David erzählt. Völlig verknallt. Vollkommen überzeugt, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Tilde hatte ihr lange zugehört. Dann hatte sie gesagt: »Ich glaube, er wird dich eine Zeit lang sehr glücklich machen. Und danach sehr unglücklich.«
Es war nicht das gewesen, was Hanna hatte hören wollen. Ihr Abschied war deutlich reservierter ausgefallen als sonst. Und bei ihren regelmäßigen Telefonaten sprach sie fortan nie wieder von David.
»Du hattest recht. Was David anging«, sagte Hanna jetzt.
Tilde schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder. In ihnen stand echtes Mitgefühl.
»Tut … mir leid«, sagte sie.
»Mir auch«, erwiderte Hanna.
Beide wussten, dass es längst nicht mehr um David ging. So war das zwischen ihnen. Sie mussten nur wenig sprechen, und doch sagten sie alles. Mit keinem anderen Menschen, hatte Hanna je dieses innige Verständnis erreicht, außer ansatzweise vielleicht mit Joost.
Tilde ließ Hannas Hand kurz los und deutete auf die Morphinpumpe. Hanna reichte sie ihr. Tilde drückte zweimal auf den Knopf, dann lächelte sie schief und sagte: »Besser.«
Kurz darauf schlief sie ein. Hanna blieb sitzen, hielt Tildes Hand und lauschte den rhythmischen Geräuschen der Überwachungsgeräte. Sie glaubte schon lange nicht mehr an Gott. Aber sie dankte dem Schicksal, oder vielmehr ihrem Instinkt, dass sie den deutlich teureren Flug gebucht hatte und noch an diesem Abend in Deutschland gelandet war.
6
Im Frühsommer 1945 war Matilde Bolkowski mit ihrem immer noch schmächtigen Säugling auf dem Bauernhof der Familie Ahrens in Niedersachsen eingetroffen. Bauer Hanno musterte sie. Nicht feindselig. Eher überfordert.
»Kann dich mit dem Lütten ja schlecht in den Stall stecken«, murmelte er und wies ihr eine winzige, aber halbwegs warme Dachkammer zu.
Tilde war heilfroh, nicht das Stalllager mit den zwölf weiteren Flüchtlingen teilen zu müssen. Nachts hörte sie die Bäuerin weinen. Drei Söhne hatte sie gehabt. Alle drei waren in den Krieg gezogen. Und keiner von ihnen war zurückgekehrt. Hildburg Ahrens, einst eine energische norddeutsche Bauersfrau, war ein Schatten ihrer selbst. Bleich, gramgebeugt und abgemagert schlich sie nachts schlaflos über die knarrenden Holzdielen. Als die dritte Benachrichtigung von der Wehrmacht kam, hatte sie lange am Weserufer gestanden. Der Fluss war kalt. Sie konnte nicht schwimmen. Drei gesunde Knaben. Drei Hoferben. Der jüngste war nicht einmal sechzehn gewesen. Anfangs hatten sie noch Briefe geschrieben von der Front. Hildburg hatte sie alle aufbewahrt. In einer geschnitzten Holzkiste mit goldenen Beschlägen.
Auch Tilde lag nachts wach. Ihr Körper war müde von der Feldarbeit, aber ihr Kopf kam nicht zur Ruhe. Sie dachte an Wilhelm. Seine letzten Worte. »Sieh zu, dass du wegkommst, nach Westen.« Dann war er in den Zug gestiegen. Richtung Osten. Tilde hoffte, dass er überlebt hatte. Irgendwo in Kriegsgefangenschaft war. Aber nachts zogen vor ihren Augen die Bilder der Tausenden von Toten vorbei und raubten ihr den Schlaf. Sie nahm ein zerknicktes Foto aus der Brusttasche ihrer zerschlissenen Bluse. Es zeigte ihre Mutter mit den drei Kindern. Tilde, ihren älteren Bruder und ihre kleine Schwester. Ein weiterer Grund für ihre Schlaflosigkeit. Sie war die Einzige von ihnen, die es geschafft hatte, diesen verdammten Krieg zu überleben. Sie durfte jetzt nicht aufgeben. Sie war es den Toten schuldig.





























