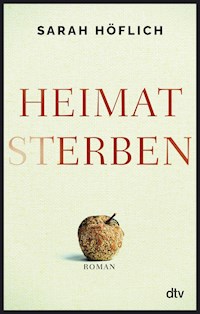16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Krieg ist vorbei – darf die Liebe beginnen? Ein mitreißender Liebesroman über vier junge Menschen, die schmerzvoll begreifen müssen, dass Liebe nicht alle Wunden heilt. Aber manche. »Wir haben überlebt«, sagte Anni. »Das hat mit Schuld nichts zu tun.« Adam wiegte den Kopf. »Ich fürchte, in manchen Fällen schon.« Frühjahr 1945, Europa ist zerstört. Anni flieht mit ihrer kleinen Tochter und dem halbjüdischen Geiger Adam aus dem brennenden Dresden, quer durch das besetzte Deutschland – auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht. Im Tiroler Bergdorf bei Annis Schwiegereltern werden sie dann vor eine folgenreiche Entscheidung gestellt: Will Anni bleiben, muss Adam gehen. Was kann Liebe leisten, was kann sie verzeihen? Eine Frage, die sich Anni & Adam, Tristan & Rosalie angesichts von Leid und Zerstörung stellen müssen. Ihr geliebter Zwillingsbruder Tristan ist als junger Luftwaffenpilot nur knapp dem Tod entronnen und in englische Kriegsgefangenschaft geraten. Trotz schwerer Anfeindungen pflegt ihn die britische Krankenschwester Rosalie – es entsteht eine Liebe, die vom Gesetz verboten ist. »Jeder Blick, jede Geste, jede verstohlene Berührung war ein Versprechen. Was sie taten, war streng verboten, das wussten sie beide.« Zwei tragische Liebesgeschichten, ein historischer Roman voller großer Gefühle über das Verzeihen und die Unausweichlichkeit der Liebe, hoffnungsvoll und mitfühlend. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs getrennt, in Gedanken immer verbunden: Nie hören die Geschwister Anni und Tristan auf, sich Briefe zu schreiben – in der verzweifelten Hoffnung, der jeweils andere möge noch leben. »Was Menschen im Angesicht von Zerstörung Großartiges leisten können – das fasziniert mich und gibt mir eine Zuversicht, die sich bei aller Tragik auch in meinem Roman widerspiegelt.« Sarah Höflich Mit einer Playlist zum Buch - denn die Musik spielt in diesem gefühlvollen Roman eine Hauptrolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Frühjahr 1945, Europa ist zerstört. Anni flieht mit ihrer kleinen Tochter und dem halbjüdischen Geiger Adam aus dem brennenden Dresden, quer durch das besetzte Land – auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht. Ihr geliebter Zwillingsbruder Tristan ist als junger Luftwaffenpilot nur knapp dem Tod entronnen und befindet sich in britischer Kriegsgefangenschaft. Der Schwerverletzte verliebt sich in die Krankenschwester Rosalie und muss mit heftigen Anfeindungen umgehen. Nie hören die Geschwister Anni und Tristan auf, sich Briefe zu schreiben – in der verzweifelten Hoffnung, der jeweils andere möge noch leben.
Sarah Höflich
Maikäferjahre
Roman
Die Unschuld grassiert
wie die Pest.
Erich Kästner, 8. Mai 1945
Success is not final,
failure is not fatal;
It is the courage to
continue that counts.
Winston Churchill
Teil 1
Leutnant Tristan Baumgartner
Feldpostnummer 4367852 K
An
Anna-Isolde Angerer, geb. Baumgartner
Kapuzinergasse 11
Dresden
9. Januar 1944
Liebste Anni, mein Schwesterlein!
Heute denke ich nur an Dich und feiere unser beider Geburtstag – so gut das hier am Stützpunkt eben geht. Mein Kamerad Hermann, unser Navigator, hat sogar ein bisschen Kuchen und eine Flasche Wein für uns aufgetrieben! Hoch sollst Du leben, mein Schwesterlein!
Sie wollten natürlich alle Dein Foto sehen. Ich kann Dir verraten, Du hast hier große Verehrer! Spaß beiseite, ich hoffe doch sehr, dass Du von Fritz gehört hast? Und dass es Dir und dem kleinen Leben in Dir gut geht?
Ich warte schon sehnsüchtig auf meinen nächsten Urlaub – vielleicht zu Ostern? Wäre das nicht ein Fest? Hoffentlich bist du bis dahin noch nicht geplatzt. Ich freu mich so auf Dich und den Kleinen – oder die Kleine? Bitte grüße die Eltern ganz lieb von mir.
Sag Mamá, ich bete mehr als je zuvor. Und Papa, er soll seinen Humor nicht verlieren. Das fällt uns hier allen immer schwerer, aber wenn es gar nicht mehr geht, erzähle ich einen von seinen Witzen. Du kennst ja die besten.
Bitte passt gut auf Euch auf, mein Schwesterlein! Und schau ab und zu bei unserem lieben Sigi vorbei, ja? Ich weiß, er freut sich – von wo auch immer er zu uns herabschaut.
Gedenke mein, mein Herz, ich gedenke Dein.
Dein Maikäfer fliegt!
1944
Der Zweite Weltkrieg nähert sich seinem endgültigen Wendepunkt. Die Übermacht der Alliierten beginnt sich zu stabilisieren.
Die Rote Armee gewinnt die westliche Sowjetunion zurück und rückt im Laufe des Jahres bis nach Polen vor.
Das Unternehmen Steinbock, eine der letzten Luftwaffen-Operationen gegen Großbritannien, endet nach vier Monaten mit desaströsen Verlusten für die Deutschen.
Die Landung in der Normandie gelingt und wird zum Höhepunkt der westalliierten Offensive.
Das Hitler-Attentat vom 20. Juli scheitert. Die Hauptakteure werden innerhalb weniger Tage standrechtlich exekutiert.
Die deutsche Wehrmacht marschiert in Ungarn ein. Es beginnt die Deportation der größten verbliebenen Gruppe europäischer Juden nach Auschwitz-Birkenau. Hunderttausende werden grausam ermordet.
Die alliierten Streitkräfte befreien Paris.
US-Präsident Franklin D. Roosevelt gewinnt seine vierte Wahl.
In Dresden kommt ein Kind zur Welt.
1
Ihr Kind kam zu früh, obwohl es für so vieles zu spät war. Anni hatte sich gerade erschöpft auf den Schreibtischstuhl fallen lassen, um noch einmal den letzten Feldpostbrief ihres Zwillingsbruders zu lesen, als ihr der Schmerz wie ein Faustschlag in den Unterleib fuhr. Sie stemmte sich hoch, taumelte zum hohen Doppelfenster und riss es auf. Draußen wölbte sich der azurblaue Himmel über den Dächern der umstehenden Jugendstilgebäude, kleine Schäfchenwolken zogen vorbei, und im großen Kastanienbaum, der den Innenhof beinahe ausfüllte, zwitscherten die Amseln. Sie versuchte, ruhig ein- und auszuatmen, so wie es in dem Ratgeberbuch stand, das sie nicht mochte, aber doch brav gelesen hatte: Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind.
Während der Schmerz langsam nachließ, dachte sie, dass dieser Tag viel zu friedlich wirkte, zu schön. Der Himmel, die Frühlingsluft, das Vogelgezwitscher – wie ein trügerischer Traum oder ein gefälschtes Bild, unter dem sich in Wahrheit ein anderes verbarg.
Anni wusste, dass sie dankbar sein musste, trotz des schrecklichen Krieges um sie herum noch ein halbwegs normales Leben führen zu können. Doch seit diesem Nachmittag erschien ihr jede Friedlichkeit, jede Schönheit schal. Die letzte Farbe der Fälschung war abgeblättert, der Traum durch ein jähes Erwachen beendet.
Ein Spaziergang an der Elbe, nur Vater und Tochter, ihr sonntägliches Ritual. Durch die Gassen zum Neumarkt, an Frauenkirche und Oper vorbei, hinunter zum Fluss. Am Lutherdenkmal blieb ihr Vater kurz stehen, wandte sich um und beschrieb mit dem Arm einen großen Halbkreis um den prächtigen Platz, von der Kirche über das Johanneum bis hin zum Palais de Saxe.
»Genießen wir diesen Anblick«, sagte er leise. »Solange es ihn noch gibt.«
Anni schluckte. Bisher war Dresden von Luftangriffen weitestgehend verschont geblieben, doch ihr Vater hatte natürlich recht: Das konnte sich schnell ändern. In den Kasernen der Stadt sammelten sich Tag für Tag neue Rekruten, die dann zu Tausenden in die Züge stiegen und an die Ostfront fuhren. Dorthin, wo auch ihr Ehemann Fritz stationiert war, der Vater ihres Kindes. Ihre Jugendliebe, den sie während eines zehntägigen Heimaturlaubs geheiratet hatte – als sie bereits im dritten Monat schwanger war. Sie betete, dass er sich »schon durchschlagen« würde, wie Fritz das nannte. Er war Gebirgsjäger, unglaublich stark und zäh. Aber die vielen Toten und Verletzten, die vom Roten Kreuz mühsam zurücktransportiert wurden, gaben nur wenig Anlass zur Hoffnung. In Dresden waren inzwischen die meisten der ehemaligen Ballhäuser, Gaststätten und Cafés zu Lazaretten umfunktioniert worden. Gelegentlich drangen die Schreie der Verwundeten bis hinaus auf die Straße und bildeten einen morbiden Gegensatz zu den herrschaftlichen Barockfassaden und den elegant gekleideten Sonntagsspaziergängern des Dresdner Bürgertums. Viele von ihnen grüßten freundlich, gelegentlich wechselte man ein paar Worte, der ein oder andere beklagte sich über die neuesten Rationierungen, doch die wenigsten sprachen wirklich über den Krieg. Es war, als wollten sie alle noch ein bisschen länger an der Täuschung festhalten, an dem Rest von friedlicher Fassade, die die prunkvolle Stadt ihnen bot.
Nicht so Annis Vater. Gottlieb Baumgartner war Violinist bei der Sächsischen Staatskapelle. Ein begnadeter Musiker, ein Freund der Künste, ein Freigeist, der sich immer schon schwergetan hatte mit der Herrschaft der Nationalsozialisten. Oft schlich sich diese Abneigung in einen seiner Witze, die er gern in vertrauter Runde erzählte.
»Zehn kleine Meckerlein, die saßen einst beim Wein – der eine machte Goebbels nach, da waren’s nur noch neun.«
Es war seine Art, mit dem umzugehen, was er »das Regime« nannte. Seit Annis älterer Bruder Siegfried im Rahmen des erweiterten Russlandfeldzugs gefallen war, trank ihr Vater oft schon mittags zu viel Wein und konnte dann abends nachdenklich und melancholisch werden. Aber so verzweifelt wie heute hatte Anni ihn nur selten erlebt.
Zunächst dachte sie, es sei wegen Tristan, seinem zweiten Sohn, Annis geliebtem Zwillingsbruder, der irgendwo im Westen Luftangriffe gegen England flog, die ihr Vater längst als Todeskommandos bezeichnete. In der Wochenschau sprach man noch vom heroischen Einsatz der tapferen Kämpfer, aber Anni hatte längst begriffen, dass man den deutschen Nachrichten nicht trauen konnte.
»Du machst dir Sorgen um Tristan?«, fragte sie, als sie an der majestätischen Fassade der Semperoper vorbeigingen.
Ihr Vater blieb stehen und strich sich mit der Hand über das Gesicht, als wollte er eine Maske abstreifen. »Natürlich«, sagte er heiser. »Jeden Tag.«
Aber Anni hatte das Gefühl, dass ihn noch etwas anderes, ungleich Größeres belastete.
»Gehen wir zum Fluss«, schlug er vor und bot ihr seinen Arm.
Gemeinsam schritten sie über den Theaterplatz hinunter zum Terrassenufer. Auf der einst so imposanten Elbpromenade zeigten sich die Spuren des Krieges deutlicher als in der Innenstadt. Auch die Elbdampfer der Ausflugsreederei Weiße Flotte waren zu Lazaretten umfunktioniert worden. Flakgeschütze wurden von Transportwagen auf Binnenschifferkähne geladen. Soldaten patrouillierten am Quai und verjagten Schwarzhändler, die verstohlen ihre Waren feilboten. Die Stimmung war weitaus trubeliger und chaotischer als oben am Neumarkt, sicher war es auch ein wenig gefährlicher, aber ihren Vater zog es oft hierher, und Anni faszinierte das wilde Treiben ebenfalls mehr als die banalen Konversationen mit weitläufigen Bekannten.
Diesmal jedoch schien Gottlieb Baumgartner ein besonderes Anliegen zu haben. Er führte Anni weg von den Schiffslazaretten, wo es ruhiger wurde und sie weniger Gefahr liefen, jemandem zu begegnen.
Anni kam ins Schwitzen. Sie war im neunten Monat und konnte kaum mehr ihre Füße sehen, geschweige denn ihre geschwollenen Knöchel.
»Papa, was ist los?«, fragte sie schließlich.
Ihr Vater ging langsamer, nahm seinen Hut ab und fuhr sich mit der Hand durch die grau melierten Locken.
»Schon wieder sind zwei Spitzenmusiker verhaftet worden«, erwiderte er halblaut, nicht ohne sich vorher umzusehen. Man wusste nie, wer plötzlich hinter einem auftauchte. »Dieser Wahnsinn muss endlich aufhören! Er stürzt uns noch alle ins Verderben!«
Anni sah ihn überrascht an. So deutlich hatte ihr Vater sich bisher selten geäußert, vor allem nicht in der Öffentlichkeit.
Er ließ ihr keine Zeit zum Nachfragen, sondern sprach sofort weiter. »Den Pianisten Karlrobert Kreiten haben sie vor einem halben Jahr einfach erhängt. Trotz mehrerer Gnadengesuche, nach einem aberwitzigen Prozess.« Er blickte Anni direkt in die Augen. »Ich lasse nicht zu, dass Adam das Gleiche passiert!«
Anni begriff sofort. Es ging um Adam Loewe, den »Jahrhundertgeiger«, wie ihr Vater seinen Protegé bezeichnete. Sie hatte ihre Eltern mehrfach seinetwegen streiten hören, anfangs leise und im Geheimen, inzwischen heftiger. Bereits im Alter von vierzehn Jahren hatte dieser Adam im Rahmen eines Gala-Abends in der Semperoper sein Konzertdebüt gegeben. Sibelius – unter der Leitung des grandiosen Fritz Busch. Anni hatte mit ihrer Mutter und ihren Brüdern im Publikum gesessen und gebannt die entschlossenen Bogenstriche des hochgewachsenen Jugendlichen verfolgt, dessen Frack an den Schultern zwei Nummern zu groß wirkte. Offenbar kümmerte ihn das nicht. Er schien sich vollständig in der Musik zu verlieren, sein Gesichtsausdruck wirkte regelrecht entrückt, und Anni, die zehnjährige Nachwuchsgeigerin, begriff plötzlich, was es bedeutete, ein Streichinstrument wirklich zum Singen zu bringen.
Dann folgte die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Fritz Busch wurde als Generalmusikdirektor abgesetzt und von SA-Männern im Konzert ausgebuht. Er emigrierte nach England. Kurz darauf traten die Nürnberger Rassengesetze in Kraft – und Adam war Halbjude.
Anni wusste, dass ihr Vater und einige seiner Freunde und Kollegen sich immer wieder für ihn eingesetzt, ihn nach Wien geschickt hatten und später, nach dem Anschluss Österreichs, weiter nach Prag. Zuletzt hatte sie ihren Vater über Adams Emigration in die USA sprechen hören. Aber sie kannte keine Details.
»Ich dachte, er ist längst in Amerika?«, bemerkte Anni leise.
Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Wir haben zu lange gewartet.«
Er ließ den Blick über die Promenade schweifen, wo in einiger Entfernung eine Soldatengruppe vorbeischritt, wartete, bis sie außer Sichtweite waren, und dirigierte Anni dann zu einer Lücke im Geländer. Hier führte eine steile Treppe direkt hinunter zum Fluss. Vorsichtig geleitete er Anni die schlüpfrigen Stufen hinab, bis sie auf einer kleinen Plattform standen, gegen die das strömende Flusswasser schwappte. Niemand konnte sie hier sehen oder hören.
»Adams talentierte Finger«, fuhr ihr Vater leise fort, »haben die letzten Monate damit zugebracht, in einem Arbeitslager Zündköpfe zusammenzuschrauben. Schlimm genug. Aber jetzt kam der Befehl zum auswärtigen Arbeitseinsatz, und wir fürchten …« Er schloss kurz die Augen.
Anni sah, dass ihr Vater mit den Tränen kämpfte. »Papa?«
Er zog einen Flachmann aus der Innentasche seiner Jacke und nahm einen tiefen Schluck.
»Ich habe schon einen Sohn verloren«, presste er hervor. »Möglicherweise zwei.« Er sah Anni mit feuchten Augen an. »Adam ist wie ein dritter Sohn für mich, verstehst du?«
Anni nickte, obwohl sie tausend Fragen hatte. »Auswärtiger Arbeitseinsatz, heißt das …?«
Ihr Vater legte seinen Zeigefinger an die Lippen. Dann fuhr er sich mit der flachen Hand einmal quer über die Kehle. Anni fühlte ein Ziehen in ihrem Bauch und strich beruhigend mit den Händen darüber.
»Was … willst du denn tun?«, fragte sie angespannt.
Das Gesicht ihres Vaters hatte einen entschlossenen Zug angenommen. Er steckte den Flachmann weg und sah auf die Elbe, auf die sich stetig vorwärtswälzenden Wassermassen, die keinen Aufschub duldeten. »Ich werde eine Lösung finden. Ich denke, ich habe sie bereits gefunden.«
Anni merkte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich. Ihre Hände begannen zu zittern beim Gedanken daran, was ihr Vater möglicherweise mit dieser »Lösung« riskierte. Sie hatte gehört, dass manche Leute es wagten, jüdischen Mitbürgern zu helfen, sie gar zu verstecken. Darauf standen drakonische Strafen, schlimmstenfalls sogar KZ-Haft.
Ihr Vater schien zu merken, wie sehr Anni das Gespräch aufwühlte. Er strich ihr sanft über den Rücken. »Mach dir keine Gedanken, mein Engelchen. Ich bin vorsichtig.«
Anni war keineswegs beruhigt.
Doch ihr Vater schien zufrieden, mit sich im Reinen. Er legte ihr die Hände auf die Schultern und sah sie ernst an. »Kein Wort zu deiner Mutter«, befahl er leise, aber eindringlich. »Kein Wort, Anni. Das meine ich sehr, sehr ernst!«
Anni versprach, sich an diese Anweisung zu halten, so wie sie sich fast immer an die Vorgaben ihres Vaters hielt.
Sie blickten nun beide auf den dahinströmenden Fluss, die breite, verlässliche Elbe. Ihr Vater hatte sich entschieden, für einen anderen Menschen sein Leben zu riskieren. Und er hatte dieses Geheimnis bei ihr abgeladen. Ein schweres Gewicht, das sie – zusätzlich zu dem Kind in ihrem Bauch – fortan würde tragen müssen.
Der nächste innere Faustschlag zwang sie in die Knie. Anni hielt sich an der Tischkante ihres Sekretärs fest und zerknickte dabei aus Versehen den Brief ihres Bruders. Verzweifelt stöhnte sie auf und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Dieser Schmerz war anders als das gelegentliche Ziehen im Unterleib, das sie in den vergangenen Wochen gespürt hatte. So mussten sich die Geburtswehen anfühlen. Aber Annis Termin war erst für nächsten Monat errechnet worden. Ihr Kind kam definitiv zu früh!
Mühsam rappelte sie sich hoch und stolperte mit zitternden Knien hinunter in den Salon, wo ihre Mutter sich gerade von der Haushälterin die verbliebenen Essensmarken zeigen ließ und eine Liste für den anstehenden Schwarzmarkteinkauf durchging. Sie erwarteten Gäste.
»Mein Gott, Anna-Isolde, jetzt stell dich nicht so an«, bügelte Friederike Baumgartner, geborene von Clausewitz, ihre Tochter ab, ohne von der Warenliste aufzusehen. »Das sind bloß Senkwehen.«
Annis Mutter war die Einzige, die sie mit ihrem verhassten vollen Vornamen ansprach. Genauso wie sie selten »unsere Familie« sagte, sondern meist »unsere Dynastie«. Sie war in jeder Hinsicht eine Erscheinung mit ihrer sorgfältig zurechtgesteckten Haarpracht, den hochgeschlossenen Kleidern. Mezzosopran. Für die ganz große Bühne hatte es nie gereicht, aber für viele wohlbeachtete Nebenrollen und die Aufnahme ins Ensemble der Semperoper. Es genügte ihr – man hatte als deutsche Mutter schließlich noch andere Aufgaben. Worunter sie hingegen insgeheim litt, auch wenn sie das nie zugegeben hätte, war die Tatsache, dass sie deutlich unter Stand geheiratet hatte.
»Aus Liebe und aus Liebe zur Musik!« So trugen Annis Eltern diese Angelegenheit gern selbstironisch zur Schau, wenn der entsprechende Anlass sich bot. Ein über Jahre einstudiertes Schauspiel, das mittlerweile ein wenig abgedroschen wirkte. Seit Kriegsbeginn war die Kluft zwischen den beiden tiefer geworden. Immer wieder gerieten sie in politischen Streit, oft spätabends, wenn sie glaubten, dass niemand sie hörte. Doch Anni verstand jedes Wort, auch durch geschlossene Türen. Sie hatte das Spitzengehör ihres Vaters geerbt.
Anni wusste, dass ihre Eltern sich einst sehr geliebt hatten. Die preußische Adelige und der Tiroler Bergbauernsohn mit dem Ausnahmetalent. Wie die berühmten Gegensätze, die sich anziehen. Allerdings schien ihre Verschiedenheit unter der Herrschaft der Nationalsozialisten immer deutlicher zutage zu treten. Anfangs hatte Friederike noch über die gewagten Witze ihres Mannes gelacht. Inzwischen sah sie ihn nur strafend an.
»Kein Wort zu deiner Mutter.«
Keine Kluft mehr – ein Bruch. Und die Tatsache, dass ihr Vater sein Geheimnis um Adam mit seiner Tochter, aber nicht mit seiner Frau teilte, zeigte, wie schwer es wog.
Erneut schoss Anni der Schmerz in den Unterleib, heftiger als zuvor. Sie presste sich die Hand vor den Mund, trotzdem entfuhr ihr ein gellender Schrei.
»Was ist denn hier los?«
Annis Vater erschien mit erschrockenem Blick in der Tür, die Geige in der Hand. Er war nach dem Spaziergang ins Musikzimmer gegangen, um sich für Bruckners Achte warmzuspielen – zumindest hatte er das behauptet.
Statt einer Antwort stöhnte Anni, hielt sich erst am Arm ihres Vaters fest, dann an einem Stuhl – und plötzlich ergoss sich ein Schwall Flüssigkeit aus ihrem Inneren und strömte zwischen ihren Schenkeln hindurch auf den gebohnerten Parkettboden. Sowohl Vater als auch Tochter starrten ungläubig auf die sich ausbreitende farblose Lache.
»Auch das noch«, ließ Friederike Baumgartner verlauten, die nun endlich von ihrer Liste aufsah.
Ein Geburtsdrama war das Letzte, was ihre Mutter ertragen konnte. Das wusste Anni, das wussten alle in diesem Haus – trotzdem bahnte sich die nächste Generation unaufhaltsam ihren Weg.
Annis Vater musste den DKW persönlich zur Klinik steuern – der Chauffeur lag mit einer Grippe im Bett. Ihre Mutter hielt zu Hause die Stellung. Anni war es lieber so, auch wenn sie sah, dass ihr Vater mit der Situation überfordert war. Sitzen konnte sie nicht mehr, sie kniete sich verkehrt herum auf den Beifahrersitz, schnaufte und stöhnte. Ihrem Vater standen Schweißperlen auf der Stirn, während er sie ungeübt durch den Straßenverkehr manövrierte.
»Ich hätte es dir nicht sagen dürfen«, schalt er sich. »Nicht in deinem Zustand. Es tut mir leid.«
Anni ergriff seine Hand. »Ach, Papa …«
Dann schrie sie erneut auf, und Gottlieb verriss vor Schreck das Steuer. Gerade noch konnte er einem entgegenkommenden Brauereiwagen ausweichen. Zum Glück war das Universitätsklinikum bereits in Sichtweite.
Als man ihren Vater am Eingang zur Gynäkologie respektvoll aufhielt, wirkte er fast ein wenig erleichtert.
»Du machst das schon, mein Engelchen!«
Eine flüchtige Umarmung, dann war Anni allein.
Die Hebammen in ihren gestärkten Schürzen zwangen sie in einen unbequemen Stuhl. Dann kam der Oberstabsarzt, der unter dem Kittel eine Uniform mit Eichenlaub auf dem Kragen trug. Er roch nach Tabak und tastete mit kalten Fingern ihren Bauch ab.
»Kaiserschnitt?«, fragte eine der Hebammen.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Zu spät. Bringen Sie das Kind raus. Jetzt!«
Anni schrie und schrie, während die Hebammen unbarmherzig mit den Ellenbogen auf ihrem Bauch herumdrückten. Und während sie allmählich fürchtete, vor lauter Schmerzen das Bewusstsein zu verlieren, dachte sie an ihren Zwillingsbruder.
»Stell dir vor«, hatte Tristan ihr am Abend vor ihrem letzten Abschied anvertraut. »Es heißt ›Unternehmen Steinbock‹. Wenn das mal kein gutes Omen ist!«
Sie waren beide am 9. Januar geboren. Sternzeichen Steinbock. Ein Notkaiserschnitt, den sowohl Annis Mutter als auch die Zwillinge nur knapp überlebt hatten. Wie gern hätte sie ihn jetzt an ihrer Seite gehabt.
Anni wusste von ihrem Vater, der bei guten Freunden heimlich BBC hörte, dass diese neue Offensive der Luftwaffe gegen England bisher nichts als katastrophale Verluste eingebracht hatte. Die Chancen, dass Tristan seinen Einsatz überlebte, wurden mit jedem Tag geringer. Doch Anni weigerte sich, das zu glauben. Tristan würde es schaffen! Dieser Gedanke nährte im Kreißsaal des Uniklinikums ihren Kampfgeist, und nach vier endlos scheinenden Stunden und einer letzten, kaum auszuhaltenden Kontraktion ließ der Schmerz plötzlich nach.
Anni konnte nur einen flüchtigen Blick auf das winzige verschmierte Bündel erhaschen, das die Hebammen als »Mädchen« klassifizierten und sofort nach draußen trugen. Wenigstens ein leises Wimmern hatte sie gehört.
Ihre kleine Tochter lebte!
Zu Annis großem Leidwesen verlegte man das Kind als Frühchen direkt auf die Neugeborenen-Station. Anni durfte sie nicht einmal kurz im Arm halten.
In ihre Brüste schoss Milch ein, die niemand trank. Die Schwestern drückten sie aus. Anni schrie und weinte um die verlorene Nahrung, die ihre kleine Tochter so dringend gebraucht hätte. Sie nahm sich vor, das Mädchen Clara zu nennen, nach Clara Schumann, deren Stärke sie immer bewundert hatte. Es vergingen drei graue, schreckliche Tage, in denen Anni sich so sehr nach ihrem Baby sehnte, dass es körperlich wehtat. Immer wieder bettelte sie den Oberstabsarzt an, sie zu ihrer Tochter zu lassen, doch der Gynäkologe blieb kühl und unnachgiebig. Anni solle sich »erst mal richtig erholen«. Im Übrigen sei es von Vorteil, wenn ein Kind nach der Geburt allein sei und nicht verhätschelt werde.
Die Hebammen ermahnten sie zur Tapferkeit, doch Anni fühlte sich elend und versank in traurigen, hoffnungslosen Gedanken. Ihr Kampfgeist hatte sie verlassen.
Es war ausgerechnet ihre sonst so strenge Mamá, die sich als Retterin in der Not erwies.
»Ein Kind gehört zur Mutter!«, schmetterte sie dem Arzt mit ihrer durchdringenden Mezzosopranstimme entgegen. Sie sah wie immer blendend aus in ihrem leichten Frühlingsmantel mit edlem Nerzkragen, umgeben vom Glanz der alten preußischen Dynastie, in die sie einst hineingeboren worden war. »Und deshalb nehme ich jetzt beide mit nach Hause. Ob es Ihnen passt oder nicht. Heil Hitler!«
Der Arzt grummelte unwillig, war aber zu beeindruckt von Friederikes Erscheinung, um ernsthaft zu widersprechen.
Ungewohnt sanft strich ihre Mutter ihr über den Kopf und reichte Anni eine kleine, in Silberpapier eingewickelte Praline.
»Was ist das?«
»Sie nennen es Panzerschokolade«, erklärte ihre Mutter leise. »Das bringt dich wieder auf die Beine, du wirst sehen.«
Gehorsam zerkaute Anni die Süßigkeit und fühlte, wie die Energie in sie zurückströmte. Sie schaffte es, allein aufzustehen und sich anzuziehen. Als man ihr endlich das winzige, in rosa Deckchen eingewickelte Mädchen reichte, war sie so ergriffen, dass sie sich wieder setzen musste. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Clara war so klein, so zerbrechlich, ihr Gesichtchen eher runzlig als niedlich, doch für Anni war sie das schönste Wesen, das sie jemals gesehen hatte.
»Lass uns gehen«, drängte ihre Mutter. »Und hör um Gottes willen auf zu heulen, sonst behalten sie dich am Ende doch noch da.«
Als sie im Auto saß, ihr Mädchen fest in den Armen haltend, vom wieder gesundeten Chauffeur achtsam nach Hause geschunkelt, schwor sie sich, ihre kleine Tochter nie wieder aus den Augen zu lassen. Koste es, was es wolle.
»Danke, Mamá«, sagte sie leise zu ihrer Mutter, die nun wieder kerzengerade neben ihr saß und aus dem Fenster blickte. »Ich hätte es dort keinen Tag länger ausgehalten.«
Ihre Mutter winkte nur ab und schloss kurz die Augen.
»Ich danke Gott, dass die Kleine wohlauf ist«, erwiderte sie mit rauer Stimme. »Wir haben seit gestern nämlich weitaus größere Sorgen.«
»Tristan?«, fragte Anni angstvoll. »Habt ihr Nachricht von ihm?«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf und sah sie ernst an. »Es geht um deinen Vater.«
2
Schon als er ins Flugzeug stieg, hatte Tristan ein schlechtes Gefühl. Das lag weder an der Junkers Ju 188, einem soliden Jagdbomber, mit dem er inzwischen recht gut vertraut war, noch an seinen beiden Kameraden: Hermann, dem Navigator, und Willi, dem Schützen. Die drei waren ein gutes Team, auch wenn Tristan fand, dass Hermann ihn ein wenig von oben herab behandelte. Er war fast sechs Jahre älter als Tristan, hatte allerdings einen niedrigeren Dienstgrad, weil er kein Gymnasium besucht hatte. Tristans Blitzbeförderung zum Leutnant war ihm selbst ein wenig unheimlich. Aber die Luftwaffe brauchte nun einmal fähige junge Piloten. Und dass Tristan einer war, bestritt selbst Hermann nicht.
Der wahre Grund für Tristans nagende Unruhe waren die dichten Wolken, die seit Tagen über dem Ärmelkanal hingen wie eine schwere graue Decke – und die zunehmend schlechter werdende Laune ihres Kommandeurs Major Wellner.
»Verfluchtes Himmelfahrtskommando«, hatte der alte Haudegen mit dem unübersehbaren Bauchansatz und dem ständig glimmenden Zigarillo im Mundwinkel gemurmelt, als sie nach der strategischen Besprechung die Offiziersbaracke am Stützpunkt Brüssel-Melsbroek verließen.
Tristan besaß vielleicht nicht das absolute Gehör seiner Schwester, dafür aber, wie sein Bruder Siegfried oft gespottet hatte, »Ohren wie Rhabarberblätter«. Er hatte den Major genau verstanden.
Wellner zog ein paarmal kräftig am Zigarillo, warf ihn dann auf den Boden und trat ihn mit seinem Fliegerstiefel entschlossen aus. Tristan fragte sich, ob sein Vorgesetzter mit »Himmelfahrtskommando« die laufende Operation oder die gesamte Leitung der Luftwaffe gemeint hatte. Vermutlich beides.
»Sie bleiben direkt in meinem Windschatten, Baumgartner«, knurrte Wellner. »Wir fliegen da rüber, streuen noch ein paar Kilo TNT auf den Hafen von Portsmouth, und dann nix wie kehrt. Sie sind mein bester Kaczmarek. Ich brauch Sie noch. Verstanden?« Seine Hand landete schwer auf Tristans Schulter.
Die Zweier-Rotte war Wellners Lieblingsformation. Sie waren in den letzten Wochen schon öfter in dieser Konstellation geflogen. Wellner als Rottenführer, Tristan als sein Flügelmann, sein »Kaczmarek«. Man war nicht allein und trotzdem wendig – und verlor im Ernstfall nicht zu viele Maschinen. Tristan versuchte den Gedanken an letzteres Szenario zu verdrängen. Pflichtgemäß legte er die Hand an die Mütze.
»Wohin führt uns das alles?«, hätte er Wellner gern gefragt. Aber er ahnte, dass selbst den Eingeweihten allmählich die Antworten ausgingen.
Seit Anfang April befanden sie sich nun schon in Brüssel-Melsbroek, beinahe zwei Monate also. Die Nachrichten von den vorrückenden Truppen der Roten Armee im Osten hatte die Einheit ebenso demoralisiert wie die wachsenden Erfolge der US Air Force und der britischen RAF, die mittlerweile einen großen Teil des Luftraums über Westeuropa dominierten. Dennoch: Es war Hitlers erklärtes Ziel, die Briten durch eine weitere Luftoffensive zu schwächen. Wie viel Sinn das in der aktuellen Situation noch ergab, konnte Tristan nicht einschätzen. Major Wellners Haltung machte ihm jedenfalls wenig Mut.
Er zog sich seine Felljacke über, schlang den Schal über dem Ritterkreuz am Kragen zu einem lockeren Knoten, befestigte Fallschirm und Schwimmweste an seinem Oberkörper und schlüpfte in die warmen Pelzstiefel. Dann stapfte er hinüber zum Flugzeug, das bereits von den Technikern inspiziert und betankt wurde. Der Geruch von Kerosin hing in der Luft.
»Nervös, Herr Leutnant?«, hörte Tristan die kratzige Stimme seines Navigators. Hermann stand an der Einstiegsluke und rauchte eine letzte Zigarette, was in der Nähe des Flugzeugs streng verboten war.
»Mach das Ding aus, Hermann«, mahnte Tristan halbherzig.
Natürlich war der Navigator genauso nervös wie er. Sie hatten allen Grund dazu.
Zum Glück erschien in diesem Moment Willi – wie immer bestens gelaunt.
»So«, rief er den beiden entgegen. »Dann versenken wir mal ein paar britische U-Boote, oder?«
Sein unbekümmertes Naturell erinnerte Tristan an Anni. Wie es ihr wohl ging? Ob ihr Kind schon zur Welt gekommen war? Er nahm sich vor, Wellner nach der Landung um Urlaub zu bitten. Wenn heute alles nach Plan lief, standen die Chancen nicht schlecht.
Entschlossen kletterte Tristan ins Flugzeug. Ein Sichtflug über hundert Kilometer offenes Meer bei zweifelhaftem Wetter bot beileibe keinen Anlass zur Vorfreude. Zumal der Feind alles daransetzen würde, sie so zusammenzuschießen, dass sie den Rückweg über das Wasser nicht schafften. Doch der Gedanke, demnächst ein Flugzeug heimwärts in Richtung Dresden steuern zu dürfen und vielleicht bald Annis Kind in den Armen zu halten, gab ihm Kraft.
Sie starteten bei guten Windverhältnissen und klarer Sicht. Die Junkers war hervorragend gewartet, alle Instrumente funktionierten einwandfrei. Tristan sah die Dünen der normannischen Nordküste unter sich, hörte das gleichmäßige Brummen von Wellners Maschine linker Hand und dachte: Es kann gelingen. Doch als sie den Ärmelkanal fast überflogen hatten, kam Nebel auf. Dichter als vorhergesagt, Hermann standen Schweißperlen auf der Stirn. Tristan versuchte verzweifelt, in der Suppe vor sich etwas zu erkennen, die Funksprüche überschlugen sich. Als er endlich vage die Lichter von Portsmouth ausmachen konnte, hörte er auch schon die knatternden Salven der Flak.
Dann platzten vor ihnen wie aus dem Nichts drei Jagdflieger aus dem Himmel. Spitfires, die sie nicht hatten kommen sehen. Sie schossen scharf, die Briten, und sie trafen verdammt gut.
Wellner versuchte eilig, ein Ausweichmanöver zurück in die Nebelbank zu fliegen. Tristan setzte alles daran, ihm zu folgen, doch er kassierte mehrere Treffer. Das rechte 1750-PS-Triebwerk seiner Ju 188 stockte. Sie verloren an Höhe.
Tristan brüllte Willi zu, alles abzuwerfen, was sie an Bord hatten. Doch es meldete sich nur Hermanns heisere Stimme.
»Willi hat’s erwischt!«
Scheiße, dachte Tristan. Er hatte keine Zeit, sich um Willi zu kümmern, da eine der Spitfires zurückkam und ihn von vorn attackierte. Tristan tauchte unter ihr hindurch und versuchte, das rechte Triebwerk neu zu starten, doch der Gegner hatte ganze Arbeit geleistet – dort, wo der rechte Propeller gewesen war, sah Tristan nur noch Flammen. Das ganze Flugzeug brannte, und sie befanden sich in raschem Sinkflug. Wenn das Feuer den Tank erreichte, war es vorbei. Die Junkers konnte jeden Moment explodieren.
»Raus, alle raus!«, schrie Tristan und befreite sich hektisch von den Sitzgurten. Seine Hand flog nach oben zum Haubennotwurf. Hoffentlich klemmte das Kabinendach nicht! Zum Glück sprang es gehorsam auf, als wäre es sich des Ernstes der Lage bewusst.
Eilig half er Hermann, den angeschossenen Willi in den Ausstieg zu bugsieren, doch der wirkte so weggetreten, dass Tristan sich wenig Hoffnung machte.
»Du ziehst die Leine, Willi, verstanden?!«
Willi nickte mutlos. Einer nach dem anderen sprangen sie in die dunkle, neblige Nacht. Keine Sekunde zu spät. Die Junkers trudelte noch ein wenig abwärts und verwandelte sich dann mit einem gewaltigen Krachen in einen gleißenden Feuerball.
Tristan rauschte durch die Luft, der Fallwind nahm ihm den Atem. Sie hatten diese Sprünge geübt, aber der Ernstfall war eben doch etwas völlig anderes. Er zwang sich zur Ruhe und bemühte sich, seinen Körper in die richtige Freifallhaltung zu bringen. Dann zog er die Reißleine und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte mit seinem Schirm. Das abrupte Bremsgefühl war viel zu schwach!
Tristan sah nach oben und entdeckte vereinzelte Flammen, die durch den enormen Luftzug bereits ausgedrückt wurden, doch sie hatten das Gewebe beschädigt. Der Schirm bremste nicht richtig, und auch der Notschirm, den er nun verzweifelt auslöste, vermochte seinen rasanten Fall nicht wirklich aufzuhalten. Acker und Hecken unter ihm kamen viel zu schnell näher.
Das war’s, dachte Tristan.
Sekunden später schlug er so hart auf, dass er augenblicklich das Bewusstsein verlor.
Dann kam das Licht. Tristan hatte es vor Jahren schon einmal gesehen. Und wieder erschien es ihm so unendlich friedlich. So viel erstrebenswerter als all die anderen Lichter, mit denen sein Leben in den letzten Monaten angefüllt gewesen war. Detonationen am Boden, Explosionen in der Luft, das Blinken der Warnlampen im Cockpit, das Aufblitzen der feindlichen Schusssalven. Dieses Licht, auf das er sich nun zubewegte, war einfach nur schön.
Tristan war nicht besonders religiös. Seinen von der Mutter streng anerzogenen Kinderglauben hatte er fast ganz verloren – ähnlich wie seine Geschwister. In den nunmehr drei Jahren bei der Luftwaffe hatte er versucht, sich mit den neuen Göttern zu arrangieren, die Führer, Endsieg und Vaterland hießen. Doch auch sie erschienen ihm mit jedem weiteren gefallenen Kameraden hohler und fadenscheiniger.
»Für Mamá«, hatte Anni gesagt, als sie ihm bei ihrem letzten Abschied das zarte Silberkreuz mit der Jesusfigur um den Hals legte – ausgerechnet an Weihnachten. »Sie schläft dann ruhiger.«
Doch Anni gab ihm die Kette nicht nur ihrer Mutter zuliebe, das spürte er genau. Es lag noch etwas Tieferes in ihrer Geste, etwas Verletzliches und zugleich Bleibendes, eine Liebe, die ihm mehr Hoffnung machte als alle sogenannten Erlöser, seien sie nun geistlich oder weltlich. Nichts war stärker als die Bindung zwischen ihm und seiner Zwillingsschwester.
Es war dennoch keine Freude aufgekommen an jenem Weihnachtsfest. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Nachricht, dass ihr großer Bruder Siegfried an der Ostfront gefallen war, die Familie erschüttert. Ihre Mutter lag mit Migräne im Bett, und ihr Vater hatte sich schon vor dem Abendessen so betrunken, dass Anni und Tristan allein vor dem spärlich geschmückten Christbaum saßen und versuchten, sich gegenseitig ein wenig Trost zu spenden. Doch selbst das wollte nicht recht gelingen. Der Tod hatte dem lächelnden Porträt ihres geliebten Sigi einen Trauerflor umgehängt und damit den letzten Funken Hoffnung erstickt, dass man diesen Krieg halbwegs unbeschadet überstehen könnte.
Beim Abschiednehmen hatten Annis Hände gezittert, nur mit Mühe bekam sie den Verschluss des Silberkettchens zu.
»Maikäfer flieg«, sagte sie leise, und auch ihre Stimme zitterte. »Und komm mir ja heil zurück!«
Tristan schloss sie in die Arme, hielt sie lange fest und flüsterte ihr ins Ohr: »Keine Sorge, mein Schwesterlein. Herr Sumsemann hat doch sein sechstes Bein.«
Es war ihre Abschiedslosung. Das alte Volkslied, das sie als Kinder gern gesungen hatten, und die Hauptfigur aus Peterchens Mondfahrt, ihrem Lieblingsbuch. Unzählige Male hatten sie die Geschichte der beiden Geschwister gelesen und nachgespielt: Peterchen und Anneliese, die sich auf den Weg zum Mond machten, um dem Maikäfer, der so schön Violine spielte, sein fehlendes Bein zurückzuholen. Gemeinsam hatten sie Lieder dazu komponiert. Anni an der Geige, Tristan am Klavier. Er sah sie vor sich, in ihrem fliederfarbenen Sonntagskleidchen, wie sie den Bogen sanft zu seinen Akkorden über die Saiten strich.
Maikäfer flieg.
Anni und er waren einander mehr Glaube als jedes Kirchenlatein.
Seit Tristan denken konnte, hatte er alles mit ihr geteilt. Schnuller, Spielzeuge, Kindergartenverse, Schulaufgaben, Beulen, Schürfwunden, Freunde, den großen Bruder und natürlich jedes Jahr den Geburtstag. Er war nur wenige Minuten älter als seine »kleine Schwester«, die er allein deshalb so nannte, weil es immer noch funktionierte, sie damit liebevoll zu ärgern.
Die Tatsache, dass er ein Junge war und sie ein Mädchen, hätte sie um Welten trennen können. Doch so war es nicht, im Gegenteil. Oma Traudl behauptete immer, Tristan habe im Mutterbauch von seiner Schwester ein Stückchen weibliche Intuition erhalten und Anni im Gegenzug von ihm eine Portion Bubenschneid. In der Tat spielte Tristan als Kind gern mit Mädchen, und Anni konnte – auch wenn sie es eigentlich nicht durfte – ziemlich gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Natürlich drängten sie Erziehung und gesellschaftliche Zwänge in den Jahren des Heranwachsens immer stärker in ihre jeweilige Geschlechterrolle. Was aber erhalten blieb, war ihre fast schon telepathische Verbindung. Sie »fühlten« den jeweils anderen, sogar dann – und das fanden selbst ihre eigenen Eltern manchmal befremdlich –, wenn sie sich gar nicht am selben Ort befanden.
Als er das Licht zum ersten Mal sah, war Anni glücklicherweise gerade noch in Rufweite. Auslöser für die lebensbedrohliche Situation damals war ebenfalls ein Flugzeug gewesen – wenn auch unter völlig anderen Umständen.
»Schau, Tris, da oben!«, hatte Sigi während des Sommerurlaubs 1927 plötzlich geschrien und war hinausgelaufen ins Watt, um ihn besser sehen zu können, den wagemutigen Kunstflieger, der über der Nordseeküste seine Runden drehte. Ohne nachzudenken, lief der fünfjährige Tristan seinem drei Jahre älteren Bruder hinterher, den Kopf starr nach oben gereckt, um ja keine Bewegung der Propellermaschine zu verpassen. Die beiden Jungs breiteten die Arme aus und rannten mit wildem Gebrumm in großen Kreisen in den Schlick, ohne dabei zu bemerken, dass sie sich immer weiter von der Küste entfernten. Sie sprangen durch Pfützen und Priele und überhörten das Geschrei ihrer Schwester am Strand.
Als das Flugzeug beidrehte und die beiden zu sich kamen, standen sie schon fast bis zu den Knien im rasch auflaufenden Wasser. Hektisch zog Sigi seinen kleinen Bruder mit sich und versank plötzlich bis zu den Schultern in einem tieferen Priel. Die Strömung darin war reißend. Einen Moment hielt der achtjährige Sigi ihr stand, dann riss sie ihn und Tristan mit sich. Verzweifelt versuchten die Brüder, sich an der Oberfläche zu halten. Sigi konnte schon ein wenig schwimmen, Tristan nicht. Er ging unter und strampelte so panisch, dass auch der Größere ihm nicht helfen konnte. Tristan schrie nach Sigi, Sigi schrie nach Tristan. Letztlich war es Anni, die sie beide rettete, weil sie am Strand ebenso verzweifelt nach ihren Eltern schrie.
Tristan erinnerte sich deutlich an das lähmende Gefühl, als die Wellen über ihm zusammenschlugen und er Unmengen von Wasser schluckte, hustete, würgte und schließlich gar keine Luft mehr bekam. Das Licht vor seinem inneren Auge war damals sehr nah gewesen – und es hatte ihn magisch angezogen.
Doch die Schreie seiner Schwester und die väterlichen Hände zerrten ihn zurück ins Leben. Wenig später lag Tristan schwallweise Salzwasser spuckend am Strand und sah aus den Augenwinkeln, wie seine Mutter dem schlotternden Siegfried eine heftige Ohrfeige verpasste.
»Es war eine Hansa-Brandenburg W29!«, flüsterte sein Bruder ihm zu, als sie am nächsten Tag im Zug zurück nach Dresden saßen. Der Sommerurlaub an der Nordsee war beendet, aber ihrer Begeisterung für Flugzeuge hatte das traumatische Erlebnis keinen Abbruch getan.
Es hing alles miteinander zusammen: der Traum vom Fliegen, der Hang zum Abenteuer, die innig verbundene Schwester, die ihnen das Leben gerettet hatte, und der wagemutige große Bruder, dem er blindlings überallhin folgte. Damals ins Nordseewatt, später zur Luftwaffe und nun ins Licht.
Tristan spürte genau wie damals, dass die Wellen über ihm zusammenschlugen, und er meinte in seinem Delir, oberhalb des Wassers zwei verschwommene Gesichter zu sehen. Ein älteres männliches und ein weibliches. Für einen Moment dachte er, es seien Sigi und Anni, aber diese Gesichter waren ihm fremd. Dann hörte er dieses Murmeln, weit entfernt, wie durch eine Wand hindurch, aber doch eindringlich: »C’mon lad, don’t ye die on me!«
Es klang wie ein gesungener Psalm, der Refrain zu einem Lied, das Anni einst auf der Geige gespielt hatte.
Tristan fühlte, wie er innehielt, gebannt zwischen Licht und Musik.
Er war nie so begabt gewesen wie seine beiden Geschwister. In ihn hatte man nicht die Hoffnung gelegt, er könne ein »Heldentenor« werden wie Sigi, der schon im Alter von sechs Jahren im Knabenchor der Oper gesungen hatte. Und er war kein »Wunderkind« wie Anni, die bereits als Sextanerin Geigenunterricht bei gestandenen Hochschullehrern bekam. Tristan liebte Zahlen. Und da es als Mitglied der Familie Baumgartner undenkbar war, nicht wenigstens ein Instrument zu beherrschen, wählte er das Klavier. Es hatte eine klare Struktur, die er begriff, jeden Ton konnte man sehen, anfassen, zuordnen – und der Rest war Übung. Er begleitete seine hochbegabten Geschwister und wurde sehr gut darin, aber niemand sah je einen Konzertpianisten in ihm. Im Nachhinein war Tristan froh darum, auch wenn es manchmal schmerzlich gewesen war, stets im Schlagschatten der blutsverwandten Virtuosen zu stehen. Aber wer nicht allzu hoch kletterte, lief auch nicht Gefahr, besonders tief zu fallen.
Sigis Stimme brach und war selbst mit aufreibendster Intensivförderung nicht zu retten. Anni entwickelte eine panische Bühnenangst, die sie fast ihre Aufnahmeprüfung an der Universität gekostet hätte. Sie hatte es nie erwähnt, aber Tristan ahnte, dass nicht nur der Krieg sie zu der eiligen Eheschließung und Schwangerschaft gedrängt hatte. Tristan kannte Fritz gut, er war ein entfernter Cousin und ein anständiger Kerl, der Anni aufrichtig liebte. Ob sie dasselbe auch für ihn empfand, würde wohl immer ihr Geheimnis bleiben. Fritz hatte Anni einen sicheren Hafen geboten, als sie diesen dringend brauchte. Sie war, genau wie ihr älterer Bruder, an den überhöhten Erwartungen ihrer Eltern gescheitert – und hatte sich in Sicherheit gebracht.
Siegfrieds Geschichte hatte sich dramatischer gestaltet. Das Gefühl des Versagens, das mit seinem Stimmbruch einherging, trieb ihn in einen tiefen Konflikt mit dem Vater – und letztlich in die Arme der Nationalsozialisten. Um dem väterlichen Druck eine Grenze aufzuzeigen, war er für seine Überzeugung früh in den Krieg gezogen und für sie gestorben.
Tristans politische Einstellung unterschied sich deutlich von der seines Bruders. Er konnte dem Kult, den Dogmen nichts abgewinnen – auch wenn er Sigi für seine militärische Karriere bewunderte. Als der Krieg ausbrach, war Tristan gerade mal ein Unterprimaner, Siegfried hingegen bereits Offizier. Ehrfurchtsvoll hatte Tristan die glänzenden Abzeichen an Sigis Fliegerjacke bestaunt, die so verheißungsvoll knirschte, wenn er ihn bei seinen Besuchen umarmte. Später kannte sein Bruder die richtigen Leute. Man nahm Tristan bei der Luftwaffe, er begann seine Offizierslaufbahn direkt nach dem Notabitur, die Wehrmacht brauchte junge Soldaten. So wurde, im Alter von achtzehn Jahren, der Traum vom Fliegen schließlich wahr. Wofür genau er da kämpfen sollte, das schob Tristan in den Hintergrund. Genauso wie die ewigen Schlachtrufe und Parolen. Er konzentrierte sich aufs Fliegen.
Die Pilotenausbildung eröffnete ihm völlig neue Möglichkeiten. Die geliebten Zahlen waren nun Koordinaten. Höhenmeter. Geschwindigkeiten. Windstärken. Hektopascal. Tristan liebte alles am Fliegen: das Abheben, die Codes, den Geruch von Kerosin – vor allem das Gefühl der Freiheit, dort oben über den Wolken. Hier war er mit sich im Reinen, außerdem brachte er alles mit, was es brauchte: Konzentrationsfähigkeit, schnelles Denken und eine gute Portion Mut.
Tristan war ganz sicher kein Heldentenor und möglicherweise auch nur ein mittelmäßig begabter Pianist, aber, wie sich herausstellte, ein begnadeter Pilot.
Und nun das Licht. Es zerrte an ihm, ebenso wie der klangvolle Psalm, der ihn zurückhielt.
»C’mon, lad! Don’t ye die on me!«
Und plötzlich wusste er, woran ihn die Stimme erinnerte: an ein irisches Volkslied, das Anni in den letzten Jahren gern auf der Geige gespielt hatte, als Ausgleich für all die Tonleitern, Terzen und Quarten, die ihr als Hochschulstudentin auferlegt wurden.
Oh Danny Boy, I love you so.
Dass es das Irisch von Dr. Liam O’Malley, Militärarzt der Royal Air Force, war, der immer und immer wieder seine Handballen auf Tristans Brustkorb drückte, erfuhr Tristan erst sehr viel später.
Er wurde hin- und hergerissen im Tunnel zwischen dem Licht und den Gedanken an Anni. Er sah sie vor sich, seine geliebte Zwillingsschwester, die dunklen Haare zurückgestrichen hinter die kleinen Ohren, die oben ganz leicht spitz zuliefen. Magische Elfen-Lauscher, hatte Sigi dazu gesagt, Ohren, die ein eingestrichenes C erkannten, ohne hinzusehen. Er sah ihr Lächeln, ihren verträumten, leicht entrückten Blick, wenn sie den Bogen über die Saiten strich, bei einem Stück, das ihr wirklich Freude bereitete.
Anni, dachte er, liebste Anni.
Dann holte Dr. Liam O’Malley ihn mit einem letzten kräftigen Schlag auf den Brustkorb zurück ins Leben.
3
Anni schreckte hoch, als hätte sie jemand aus dem Schlaf gerissen – doch da war niemand. Um sie herum war alles dunkel und ruhig. Verwirrt schaltete sie ihre Nachttischlampe ein und blickte auf die Uhr. Halb vier. Sie beugte sich zu ihrer kleinen Tochter, die im Kinderbettchen neben ihr leise atmete, und wartete, bis ihr eigenes Herz ebenfalls wieder ruhiger schlug.
Fetzen eines Traumes hingen ihr nach. Tristan. Das Meer. Er hatte sie gerufen. Kurz versuchte Anni, den Traum zu rekonstruieren, doch es wollte ihr nicht gelingen. Die Wirklichkeit hatte längst wieder von ihr Besitz ergriffen – mit ihrer ganzen Härte. Es war immer noch Krieg und Tristan vielleicht schon tot.
Anni richtete sich im Bett auf. Sie wusste, sie würde nicht mehr schlafen können. Tristans Flugzeug war laut einem Bericht der Luftwaffe nach britischem Beschuss über dem Ärmelkanal verschollen. Auch von ihrem Mann Fritz hatte sie ewig nichts gehört – sie wusste nicht einmal, ob die Nachricht von Claras Geburt bis zu ihm an die Front vorgedrungen war.
Wenigstens schlief die Kleine inzwischen halbwegs durch. Anni war es mithilfe ihrer Mutter gelungen, Clara trotz der mehrtägigen Trennung nach der Geburt ans Stillen zu gewöhnen. Der »reichliche Milchfluss«, der in Annis Ratgeberbuch beschrieben wurde, wollte sich trotzdem nicht einstellen. In den ersten zwei Wochen hatte Clara viel geschrien, vor allem abends, wenn Annis wundgenuckelte Brust nicht mehr genügend Milch hergab.
»Sie hat einfach Hunger«, konstatierte Friederike schließlich und trug einer der Haushälterinnen auf, Milchpulver und eine Säuglingsflasche aus Jena-Glas zu besorgen. Anni lernte, das Pulver mittels eines Trichters in die Flasche zu füllen und mit handwarm temperiertem Wasser zu vermischen. Seit sie abends die Industriemilch bekam, schlief Clara durch bis in die frühen Morgenstunden, sodass auch Anni langsam wieder zu Kräften kam.
Der Grund für ihre neuerliche Schlaflosigkeit war ganz entschieden nicht ihre Tochter, sondern die täglich stärker nagende Sorge um die männlichen Mitglieder ihrer Familie: um ihren Mann, ihren geliebten Zwillingsbruder – und am allermeisten um ihren Vater.
»Kein Wort zu deiner Mutter« – diese Anweisung hatte sich erübrigt. Ein unschöner Brief der Reichskulturkammer war auf dem Schreibtisch des amtierenden Generalmusikdirektors Elmendorff gelandet, in dem der GMD der Staatskapelle dringlichst aufgefordert wurde, »die Sache mit dem Geiger« aufzuklären. Seitdem herrschte größte Aufregung im gesamten Orchester – und in Annis Wohnzimmer flogen die Fetzen.
»Schwöre mir, dass du nichts damit zu tun hast«, schleuderte ihre Mutter mit vor Wut zitternder Stimme ihrem Vater entgegen, woraufhin dieser sich eine Zigarre anzündete und vom Cognac nachschenkte.
Anni stand hinter der gläsernen Flügeltür, wiegte ihre kleine Tochter in den Armen und lauschte angespannt. Doch ihr Vater schwieg.
Die Nachricht, dass der Jahrhundertgeiger Adam Loewe sich seinem Aufruf zum auswärtigen Arbeitseinsatz widersetzt hatte und nie auf der zuständigen Dienststelle erschienen war, verbreitete sich in den Dresdner Kulturkreisen wie ein Lauffeuer. Die Gestapo stellte die Semperoper auf den Kopf, weil man vermutete, dass der Geiger sich dort versteckt hielt. Doch er wurde nicht gefunden. Und das eiserne Schweigen ihres Vaters machte ihre Mutter rasend. Anni hatte mehrfach versucht, zu ihm durchzudringen, doch ihr Vater hatte sich komplett in sich zurückgezogen. Er schien entschlossen, die Sache mit sich selbst auszumachen.
Sie würde nicht mehr schlafen können. Außerdem hatte Anni schrecklichen Durst. Sie stand auf, band ihre dunklen Locken zu einem losen Zopf, legte sich ihren Morgenmantel um die Schultern und schlich in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen. Wieder im Flur sah sie, dass im Wohnzimmer Licht brannte. Sie versuchte leise hineinzugehen, doch das Parkett knarzte verräterisch unter ihren Füßen.
Ihr Vater, der rauchend in einem der Ledersessel saß, wandte sich sofort um. Ein schwaches Lächeln flog über sein Gesicht. »Anni, mein Engelchen. Kannst du nicht schlafen?«
Sie schüttelte den Kopf und ließ sich etwas unschlüssig auf dem Klavierhocker nieder. Jetzt oder nie, dachte sie. »Papa?«
»Hm?«
»Damals an der Elbe …«
Er hob die Hand und schüttelte den Kopf. »Es ist besser, wenn du nichts weißt.«
»Aber …«
»Anni, bitte. Ich habe damals zu viel gesagt, und noch mal: Es tut mir leid. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, was ich tue.«
Anni schwieg. Was sollte sie dazu auch sagen?
Ihr Vater stand auf und sah sie ernst an. »Konzentrieren wir uns auf das Hauskonzert morgen. Es ist von enormer Wichtigkeit für mich, und wir brauchen dich als zweite Geige. Also lass uns schlafen gehen.« Er tätschelte ihr kurz die Schulter, bevor er den Raum verließ.
Wieder keine Antworten, dachte Anni. Das bevorstehende Hauskonzert hatte sie für ein paar Stunden erfolgreich verdrängt gehabt. Nun wurde ihr klar, warum es so wichtig für ihren Vater war. Es ging um die illustren Gäste, die er dringend brauchte, um sich gesellschaftlich abzusichern, während er im Verborgenen alles riskierte.
Anni wusste nicht, wo ihr Vater Adam versteckte. Ob er es allein tat oder Helfer hatte. Aber dass er es tat und dass sein Tun in höchstem Maße gefährlich war, daran bestand kein Zweifel. Die Stimme ihrer Mutter hinter der Tür war oft schrill geworden, wenn sie ihren Vater mit den möglichen Konsequenzen konfrontierte. Von Gefängnis war die Rede, von Straflagern, einmal sogar von Hochverrat und dem Tod durch den Strang. Anni machte sich schreckliche Sorgen, aber sie wusste auch, dass sie ihren Vater durch nichts von seinem Weg abbringen konnte. Sie konnte nur das tun, worum er sie bat.
Deshalb hatte sie ihm versprochen mitzuspielen – ein Streichquartett, zusammen mit seinen beiden Vertrauten: Claus Brennecke, dem ersten Cellisten der Staatskapelle, und dessen jüngerem Bruder Wolfram, einem Bratschisten. Ihr Vater spielte die erste Geige, sie die zweite. Schostakowitsch und Ravel durfte man nicht mehr aufführen. Schuberts Der Tod und das Mädchen schien allen zu gewagt, deshalb entschieden die Männer sich schließlich für Beethoven. Nummer 7 in F-Dur.
Anni war das nur recht. Sie liebte den schwungvollen ersten Satz des Quartetts. Er ließ ihr keine Zeit zum Nachdenken. Denn das Grübeln, das hatte sie in ihrer Jugendzeit schmerzlich begriffen, war ein entschiedener Feind des Musizierens. Ihre Hände wurden jetzt schon feucht vor Aufregung, wenn sie an den Auftritt dachte.
Es war eben nicht einfach, ein Wunderkind zu sein. In den Kindheitsjahren vielleicht noch am ehesten, als sie kaum wahrnahm, was um sie herum passierte, sondern einfach spielte und sich von der Musik tragen ließ. Doch ebendiese Leichtigkeit war Anni ungefähr im Alter von dreizehn Jahren verloren gegangen. Sie fing an, sich alles bewusst zu machen, wurde nervös, patzte und wurde noch nervöser. Es war, als hätte die Musik ihr die Freundschaft aufgekündigt.
Die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule hatte sie nur bestanden, weil ihr Vater über beste Kontakte verfügte und man »das mit den Nerven« schon hinbekommen würde. Zum Glück waren diese Dinge inzwischen niemandem in der Familie mehr wichtig. Anni würde keine Star-Geigerin werden. Das wusste sie – und im Grunde wusste es auch ihr Vater, selbst wenn er es nicht offen zugab. Sie war nun eine verheiratete Frau mit einer kleinen Tochter, einem Mann an der Front, einem toten und einem vermissten Bruder, einem waghalsigen Vater – und das alles mitten im Krieg. Es war nicht die Zeit, sich Gedanken um ihre musikalische Karriere zu machen.
Allerdings war sie noch immer Studentin der Musikhochschule und entsprechend ausgebildet. Heute Abend musste sie funktionieren.
Nachmittags ging sie mit Clara im Kinderwagen spazieren, um ihre Nerven zu beruhigen. Über der Elbe trieben an diesem Spätsommertag dichte graue Wolken, die ab und an einen Schauer nach unten sandten, bevor sie wieder von Sonnenstrahlen durchbrochen wurden. Wechselhaftes Wetter mit leichten Böen, so hatte es in der Tageszeitung gestanden. Ausnahmsweise keine Hiobsbotschaften und Schreckensnachrichten von Brandbomben, die mit jeder Woche zahlreicher auf die deutschen Großstädte zu fallen schienen. Wenn auch bisher nicht auf Dresden. Nur die letzten Lindenblüten segelten, vom Wind umhergewirbelt, auf die Elbpromenade. Die Blätter begannen sich allmählich gelblich zu verfärben und leuchteten mild in der tiefer stehenden Sonne.
»Genießen wir diesen Anblick, solange es ihn noch gibt.«
Seltsamerweise beruhigten sie die Gedanken an das Geheimnis, ihre Eltern und den Krieg. Wer nahm schon wahr, ob die Töne der zweiten Geige im Quartett wirklich akkurat waren, wenn in Wahrheit ganz andere Dinge auf dem Spiel standen.
Die winzigen Wassertropfen auf Werner Contzens Kaschmirmantel glänzten mit den Schweißperlen auf seiner Stirn um die Wette, als er zur Tür hereinkam. Er war der erste Gast, wie immer. Ein Tuchfabrikant mit besten Verbindungen, steinreich, Förderer der Staatskapelle, Bewunderer von Annis Vater – und glühender Verehrer ihrer Mutter. Einer von den ganz wichtigen Gästen für diesen Abend. In seinem großen Koffer befanden sich Cognac, Ölsardinen, Champagner, Zigaretten, Pastetchen und Schokolade. In Dresden herrschte wie überall im Land längst Lebensmittelknappheit, aber Contzen war übergewichtig und freigiebig wie eh und je.
Anni mochte ihn trotzdem nicht besonders. Er war selbstgerecht, anzüglich und, wenn er getrunken hatte, stets ein wenig zudringlich. Doch ohne Contzen, den Tristan und sie heimlich »Bontzen« getauft hatten, wäre eine Festivität wie die am heutigen Abend recht sparsam ausgefallen. Davon abgesehen verfügte er über hervorragende Kontakte zu sämtlichen hochrangigen SS-Offizieren der Region, und man munkelte, dass er auch bei der Gestapo ein und aus ging. Damit war er für Annis Vater so etwas wie eine Lebensversicherung.
Dieser hatte sich jedoch zu einer Besprechung mit den anderen beiden Musikern zurückgezogen, bei der es ganz sicher nicht um das anstehende Quartett ging, und ihre Mutter lag mit einem Migräneanfall im Bett. So war es denn an Anni, Contzen hereinzubitten, unter Oh und Ah den Kofferinhalt zu bestaunen, mit ihm den Cognac zu probieren, ob er »denn auch gut« sei.
»Und, gibt es Nachrichten von der Front?«, fragte Contzen, während er ihnen beiden einschenkte.
»Leider nein.«
Er sah sie mitfühlend an. »Das muss schwer sein. Jetzt mit der kleinen Clara.«
Er legte ihr die Hand auf den Arm.
Anni versteifte sich. »Wir kommen zurecht.«
»Liebste Anni.« Er hob sein Glas. »Wenn ihr jemals etwas brauchen solltet …«
Sie stießen an.
Anni nahm vorsichtig einen kleinen Schluck. Der Alkohol half gegen die Nervosität, aber wenn sie zu viel trank, würde sie nicht mehr akkurat spielen können. Ein schwieriger Balanceakt im Beisein von Contzen, der nun den Arm um sie legte.
»Ich bin immer für euch da, das weißt du ja.«
Er zog sie an sich.
Anni fühlte sich zunehmend unwohl, doch Contzen hielt sie fest im Arm, wie ein Stück wertvolles Tuch, das ihm niemand mehr entreißen würde.
»Mein lieber Werner!«, kam es in diesem Moment von der Tür.
Ihre Mutter. Gott sei Dank. Kerzengerade und stolz stand sie da, im türkisblauen, tief dekolletierten Seidenkleid. Auferstanden vom Migräneanfall. Vermutlich hatte sie eine ihrer »Pralinchen« gegessen.
»Wir wissen deine Großzügigkeit wirklich zu schätzen!«
Contzen ließ Anni sofort los, verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor ihrer Mutter und küsste ihr die Hand. »Liebste Friederike.«
Annis Mutter lächelte milde und warf Anni einen beruhigenden Blick zu. Dann hakte sie Contzen unter und raunte ihm etwas ins Ohr, woraufhin er leicht errötete und leise erwiderte: »Aber natürlich!«
Anni sah den beiden nach, wie sie durch den Flur davongingen. Sie atmete auf. Dann half sie dem Hausmädchen, Contzens Köstlichkeiten auf den Präsentiertellern zu arrangieren.
Nach und nach trafen weitere Gäste ein – man kam immer noch gern ins Haus Baumgartner. Annis Mutter hatte sich schon vor dem Krieg einen Ruf als formidable Gastgeberin erarbeitet. Jetzt, wo die Nahrung immer stärker rationiert wurde, kamen die Dresdner umso lieber, trotz der Unruhe um den verschwundenen Geiger. Und genau darum ging es: Die Familie sollte über jeden Verdacht erhaben sein. Anni begriff, dass ihr Vater dieses Fest mit viel politischem Geschick geplant hatte. Unter den Gästen befanden sich der Konzertmeister, der Opernintendant mit seiner jungen zweiten Ehefrau, Oberbürgermeister Nieland mit seiner Mätresse, die allerorten stillschweigend geduldet wurde, und Oberst Böttcher, Siegfrieds ehemaliger militärischer Mentor, der sich den Baumgartners seit dem Tod ihres Ältesten in höchstem Maße verpflichtet fühlte. Der Oberst kam in Begleitung von zwei hohen Tieren aus der Reichskulturkammer, die Annis Vater ehrerbietig begrüßte.
Anni ließ den Blick schweifen und sah, dass die ersten Gläser sich langsam leerten und die beiden Hausmädchen kaum hinterherkamen. Sie lief in Richtung Küche, um Nachschub zu holen – und vernahm Stimmen aus Tristans Zimmer. Dorthin würde sich doch kein Gast zurückziehen? Instinktiv verlangsamte sie ihre Schritte und erkannte, dass es ihre Mutter war, die leise auf Contzen einredete. Anni verstand ihre Worte nicht genau, aber sie hörte sehr deutlich die von Contzen, der sagte: »Mach dir keine Sorgen, liebe Friederike. Ich werde mich darum kümmern!«
Dann wurde die Tür geöffnet, und die beiden traten in den Flur.
Anni verschwand eilig in der Küche. Während sie eine Flasche entkorkte, fragte sie sich, was das zu bedeuten hatte. Warum taten die beiden so heimlich? Hatten sie eine Affäre? Ihre Mutter und Contzen? Undenkbar! Oder doch nicht?
Ihr blieb keine Zeit, sich weiter den Kopf zu zerbrechen. Der Abend war in vollem Gange und Annis Mutter dank ihrer Panzerschokolade in Hochform. Anni wusste inzwischen, was Pervitin war und wie es wirkte. Friederike Baumgartner schwebte durch den Salon wie ein schillerndes Fabelwesen, stolz und elegant, parlierte hier, warf dort eine Bemerkung ein und verstand es, den ganzen Raum in Feierstimmung zu versetzen. Die Farben ihres Kleides changierten bei jeder Bewegung, und Contzens Augen folgten ihr unablässig.
Wenn er ein Hund wäre, dachte Anni, dann würde er sabbern.
Ihr Vater hingegen, sonst bekannt für seine pointierten Witze und sein schallendes Lachen, wirkte recht zurückhaltend. Er scharte nicht wie sonst eine Gruppe um sich, sondern unterhielt sich mit ausgewählten Gästen, zudem verschwand er mehrfach im Musikzimmer. Anni, die gerade ein etwas verkrampftes Gespräch mit der affektierten jungen Frau des Opernintendanten führte, war froh, als ihre Mutter sie bat, sich ans Piano zu setzen, um während des Aperitifs für ein wenig »fröhliche Hintergrundmusik« zu sorgen.
Nach etwa einer Stunde war es Zeit für das Konzert. Die Gäste waren bereits angetrunken, Ölsardinen, Gebäck und Pastetchen waren sämtlich verzehrt worden, und als ihr Vater leicht mit dem Silberlöffel an sein Glas schlug, um in das Stück einzuführen, bekam die Atmosphäre einen feierlichen Anstrich.
»Ludwig van Beethoven«, begann Gottlieb, »widmete die besten seiner zahlreichen Quartette seinem Mäzen Andrej Rasumowsky, einem russischen Adeligen. Politisch zur Stunde etwas heikel, mögen Sie denken. Aber, meine verehrten Damen und Herren, als Österreicher darf ich Ihnen versichern: Im Herzen war der gute Herr Rasumowsky ein Wiener. Wir sind also auf der sicheren Seite.«
Gelächter.
Anni atmete auf. Ihr Vater schien zu seiner alten Form zurückzufinden.
»Viel wichtiger als die Politik«, fuhr er fort, »ist ohnehin die Musik.« Er hob seine Geige. »Diese Quartette, von denen wir heute das schönste spielen, zeigen Beethovens Freigeist und seinen Hang zur Modernität. Er selbst soll über diese Stücke gesagt haben, sie seien nicht für diese, sondern für eine spätere Zeit.«
Der Salon schwieg andächtig.
Einen Moment lang befürchtete Anni, ihr Vater würde mit diesem melancholischen Gedanken schließen wollen, doch er lächelte und fügte hinzu: »Eines kann ich Ihnen jedenfalls versichern: Für Amateure sind sie praktisch unspielbar.«
Wieder lachten die Gäste.
»Umso dankbarer bin ich, dass meine beiden geschätzten Kollegen, die Gebrüder Brennecke, und ich heute ein besonderes Talent an der zweiten Geige begrüßen dürfen: meine Tochter Anna-Isolde.«
Ein warmer Applaus folgte.
Anni fing einen aufmunternden Blick ihres Vaters auf und war zum ersten Mal seit sehr langer Zeit vor einem Konzert kein nervliches Wrack.
Sie begannen den ersten Satz in flottem Allegro. Anni spürte die Kraft der Musik, es gelang ihr, alle Gedanken auszuschalten. Sie versank in dem komplizierten, wunderschönen Stück, ging in ihm auf, und ihre Nervosität verschwand allmählich. Die Art und Weise, wie ihr Vater und sie sich ergänzten, wie sie alle vier miteinander harmonierten, rief Erinnerungen an ihre Kindheit hervor, als es sich so angefühlt hatte, als würde die Musik in sie hineinströmen und sich von selbst spielen.
Gerade hatten sie eine schwierige Schlüsselstelle im zweiten Satz gespielt, als Anni entfernt die Türklingel und ein dumpfes Poltern auf der Treppe hörte. Sie war so konzentriert auf die anspruchsvollen Läufe, dass sie annahm, es sei ein später Gast. Das Quartett wirbelte durch das Stück, und mit jeder Passage, die sie meisterten, wuchs Annis Vergnügen.
Vielleicht, dachte sie, haben die Musik und ich doch noch eine Chance.
Dann plötzlich, im kurzen Innehalten vor dem letzten Satz, sah sie die beiden Gestalten in der Tür stehen. Zwei Männer in langen schwarzen Ledermänteln, die ihre Hüte aufbehielten. Als Anni den Bogen wieder ansetzte, zitterten ihre Finger so sehr, dass der Ton kratzte.
Auch ihrem Vater und den Brenneckes schien der Anblick in die Knochen gefahren zu sein. Der vierte Satz, das Thème Russe, eigentlich so kraftvoll und fulminant, misslang zwar nicht in Gänze, dafür waren die drei Männer zu sehr Profis, aber er fiel wesentlich dünner aus als die ersten drei.
Anni hatte zunehmend Probleme, sich zu konzentrieren, und flog zweimal fast raus.
Mit Mühe und Not kämpfte sich das Quartett durch die letzten Takte.
Die Spannung im Raum war fast greifbar, als Anni, ihr Vater und die Brenneckes die kraftvollen Schlussakkorde erklingen ließen und sich anschließend unter großem Applaus verbeugten. Die Gäste schienen um die Wette zu klatschen. Vermutlich nutzten sie die Gelegenheit, sich die Nervosität, die der Anblick der ungebetenen Besucher in ihnen hervorrief, aus den Körpern zu schütteln.
Die Männer in den Mänteln applaudierten ebenfalls. »Sehr schön«, sagte der größere von ihnen, als der Applaus verklungen war. Er hatte eine massige Gestalt und ein rötliches Gesicht. »Mozart?«
Im Raum herrschte gespenstische Stille.
»Beethoven«, erwiderte Annis Vater schließlich heiser. Er legte den Bogen und seine wertvolle Guarneri del Gesù vorsichtig auf den Stuhl und ging auf die ungebetenen Besucher zu. »Was kann ich für Sie tun?«
Der Kleinere trat vor. Er hatte stechende graue Augen. »Nur ein paar Fragen beantworten, Herr Baumgartner.«
Annis Vater straffte sich. »Wie Sie sehen, haben wir Gäste. Wäre es vielleicht möglich, das auf morgen …«
»Es ist leider sehr dringend!«
Der Große fasste Annis Vater am Arm. Nicht grob, aber eine deutliche Geste, die keinen Widerspruch duldete. Gottlieb sah hilfesuchend in die Runde.
Oberst Böttcher erhob sich. »Meine Herren. Ich versichere Ihnen, dass Herr Baumgartner ein absolut unbescholtener und integrer Bürger unseres Reiches ist. Sein älterer Sohn ist heldenhaft für Führer, Volk und Vaterland gefallen, der jüngere gibt alles in der Luftoffensive gegen England. Dürften wir also darum bitten, dass Sie uns erklären …«
Der Kleinere hob die Hand und brachte Böttcher zum Schweigen – Böttcher in seinem Paradewaffenrock! Dann griff er ins Innere seines Mantels und zog ein Dokument hervor, das er dem Oberst reichte. Dieser überflog die Zeilen und gab das Papier dann kreidebleich an Gottlieb weiter.
Anni sah zu ihrer Mutter, die leise mit Contzen sprach. Dessen Gesichtsausdruck wirkte merkwürdig leer. Auch der Oberbürgermeister senkte seinen Blick. Niemand machte Anstalten, dem Oberst beizuspringen.
»Gut«, sagte Annis Vater, faltete das Dokument zusammen und reichte es dem Gestapo-Offizier zurück. »Gehen wir.«
Er warf Friederike und Anni einen letzten Blick zu, drückte Böttcher kurz die Hand und verließ dann, eskortiert von dem großen Beamten, in bemüht aufrechter Haltung das Wohnzimmer.
Der Offizier blickte katzenfreundlich in die Runde: »Feiern Sie noch schön!«