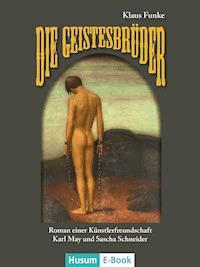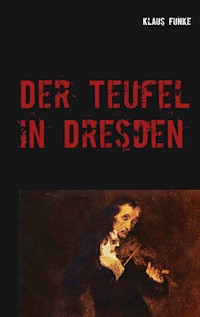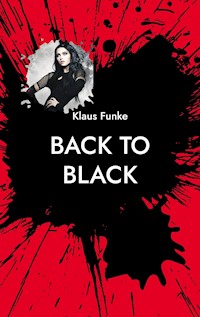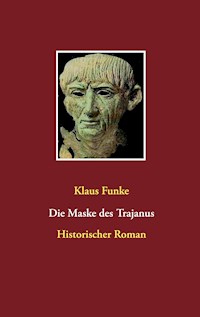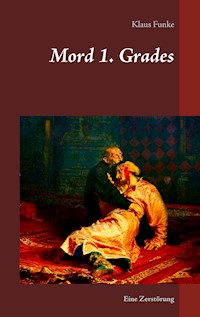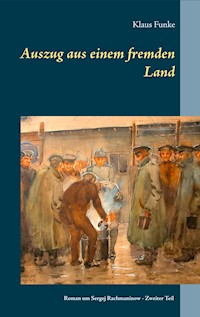Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist ein Kriegsbericht. Ein Bericht über den Alltag an der ehemaligen Staatsgrenze der DDR in den Siebzigerjahren. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg: Die ehemalige Staatsgrenze ist ein lebensgefährliches Gebiet. Nicht nur für Republikflüchtige, sondern auch für die Grenzsoldaten selbst kann sie zum Todesstreifen werden. Der Held der Geschichte Franz Malef wird als Soldat zu den Grenztruppen der DDR eingezogen. Am „Strich“, wie die Grenze genannt wird, herrscht im dichten Überwachungsnetz der Staatssicherheit ein Klima der Angst, der Repressalien und des gegenseitigen Belauerns. Als sich Malef eines Tages in eine junge Genossenschaftsbäuerin verliebt, gerät der verheiratete junge Vater in einen Strudel dramatischer Ereignisse und auch in den Fokus der Stasi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-89876-704-0 (Vollständige E-Book-Version des 2013 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-691-3) Umschlagabbildung: Grenzpatrouille durch Postenpaar culture-images/ddrbildarchiv.de/Manfred Uhlenhut © 2013 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
Alle im Buch auftretenden Personen sind erfundene Figuren. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt. Die auftretenden Figuren sind Typen und stehen stellvertretend für Menschen, die so oder ähnlich agiert und argumentiert haben.
Die im Buch dargestellten Zusammenhänge und Vorkommnisse entsprechen tatsächlichen Ereignissen an der ehemaligen Staatsgrenze der DDR in den Jahren 1972 bis etwa 1974. Das Aufzeigen von Brutalität und Menschenverachtung ist beabsichtigt. Es soll zeigen, welche Verhältnisse damals an der innerdeutschen Grenze geherrscht haben. Der Autor hat sie selber erlebt oder sie sind ihm von Augenzeugen glaubhaft berichtet worden.
Jedes Wort dieses Buches ist wahr. Aber es ist ein Roman und kein Tatsachenbericht. Aus diesem Grund sind der Handlung entsprechende Orte und geografische Besonderheiten verändert und angepasst worden. Ein Vergleich mit heutigen Orten und landschaftlichen Verhältnissen ist deshalb unangebracht.
Das Buch will eine Zeit deutsch-deutscher Geschichte lebendig machen, die manche heute Lebenden nur noch aus den Geschichtsbüchern oder aus Erzählungen kennen, eine Zeit der Konfrontation und des Kalten Krieges, die niemals vergessen werden sollte.
Klaus Funke
Ihre Hand kommt langsam näher.
Sie berührt mich.
Warm und glatt fühlt sich die Hand an.
Ich beginne zu zittern, ein wonniges Wärmegefühl ergreift mich.
Die Hand tastet suchend an meinem Körper abwärts.
Meine Männlichkeit wächst.
Ich höre die geflüsterten zärtlichen Worte, sehe jetzt auch ihr Gesicht, sehe, wie es sich langsam auf meine Brust schiebt.
Oh, welche Wonne, denke ich – …
Plötzlich ein gellender Pfiff. Trillerpfeife …
Der Traum verschwindet. Husch! ist er weg, ohne eine Spur, tonlos, ohne ein Bild, nicht einmal sowas wie ein Standbild bleibt.
Dafür eine dröhnende Männerstimme, verstärkt durch das Echo des Kompanieganges:
Nachtruhe beenden! Fertigmachen zum Frühsport!
Es dauert ein paar Sekunden. Dann begreife ich, wo ich mich befinde: Stube 3, 3. Gruppe, 1. Zug, Unterkunft der 11. Grenzkompanie in Hundfeld, gehörig zum Grenzbataillon III im Grenzregiment 9, ungefähr fünfzehn Kilometer südwestlich von Römhild.
Hundfeld, ein Nest von vielleicht zwei Dutzend, teilweise heruntergekommenen Gehöften, keine Kirche, kein Bürgermeister, Altersdurchschnitt über fünfzig Jahre, dreieinhalb Kilometer Luftlinie von der Westgrenze entfernt – der Staatsgrenze zur Bundesrepublik, unserem Klassenfeind … jetzt, wo ich diese Zeilen aufschreibe, weißt du, da kommen mir Zweifel, ob ich das damals wirklich so gedacht habe. Ich glaube nicht, wahrscheinlich werde ich nach dem Aufwachen nur eines gedacht haben – Scheiße. Warum immer Frühsport, wo wir doch in einer Stunde sowieso am Strich sind? Der Strich – so nennen wir die Grenzlinie.
Nun stell dir vor: Im Zimmer entsteht nach dem Weckruf Bewegung. Einer macht Licht. Irgendeiner rülpst, ein anderer hustet, ein Dritter furzt. Die meisten sind mehr oder weniger schnell aus den Betten und auf den Beinen. Otto, der Mann im Bett über mir, springt herunter: Scheißfrühsport! brummt er und geht zu seinem Spind, den Trainingsanzug hervorzuzerren. Neben mir, Karli, sitzt auf der Bettkante:
Den Holzknie bringe ich noch um!
Irgendwann ist er dran, das Schwein. Holzknie, wie er wirklich hieß, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube Kniewedel, Jürgen Kniewedel oder so ähnlich. Holzknie ist der Stellvertreter des Zugführers, er wird, wie jeden Tag, unseren Frühsport leiten. Holzknie ist Oberfeld (Oberfeldwebel), ein Berufssoldat, ein Zehnender also, will sagen, einer, der sich für zehn Jahre verpflichtet hat. Er wird in diesen Aufzeichnungen noch weiter eine Rolle spielen. Weißt du, ohne den Holzknie wäre mein Dienst am Strich und auch der von manchem Kameraden bestimmt ganz anders verlaufen. Zwar erscheint er brutal, dümmlich, auch feige und hinterhältig wie ein Bauer, allerdings, es gibt hier noch ganz andere unter den Vorgesetzten. Da ist der Holzknie dann doch ein wahrhaftiger Kumpel. Allerdings, auch vor manchem Soldaten-Kameraden muss man sich vorsehen. Wem kann man trauen? Das Misstrauen gehört hier mit zum System. Das lernt man schnell. Weißt du, ob der, mit dem du draußen bist, dich nicht im nächsten Moment hinterrücks abknallt, damit er die Fliege machen kann? Die sagen einem das andauernd, im Politunterricht, nennen Beispiele, oh ja, es gäbe solche Fälle, wo die eigenen Kameraden … so wird das gegenseitige Misstrauen wachgehalten, nein, nicht nur vom Gegner, sagen die Politoffiziere, nicht allein vom kriminellen Grenzverletzer ginge Gefahr aus, nein, dein Feind könne jeder sein. Und es stimmt, die Spannung, das Belauern in der eigenen Kompanie ist allgegenwärtig.
Wie ein Wolf unter Wölfen lebt man. Wer frisst wen zuerst, das ist die Frage. Sogenannte militärische Kameradschaft wie in Kriegsfilmen oder Büchern – hier an der Grenze gilt das nicht. Am Ende ist jeder mit sich allein.
Und dann, verstehst du, ist da noch das Militärregime, was darauf ausgerichtet ist, der Vorgesetzte befiehlt, der Untergebene gehorcht, bedingungslos, ohne zu fragen, selbst beim sinnlosesten Scheiß – und nicht nur von Offizier oder Unteroffizier zu Soldat, nein auch von Soldat zu Soldat, draußen am Strich zum Beispiel, wo der Postenführer, selber Soldat oder höchstens Gefreiter, dem anderen alles befehlen kann. Einfach alles! Jawohl. Du legst dich jetzt dort in die Pfütze, na los, marsch. Oder man schickt den untergebenen Posten durchs dickste Gebüsch, wo er sich Arme und Beine zerkratzt. Oder man lässt ihn das schwere Funkgerät tragen, ohne Trageriemen, einfach so in der Hand soll er es halten, bis ihm die Finger wehtun. Oder man jagt ihn im Winter raus aus dem Unterstand oder der fein mit Reisig ausgepolsterten Mulde, lässt ihn bei strömendem Regen vor dem B-Turm hin- und herlaufen. Tausend Schikanen gibt es, tausend Möglichkeiten, die Macht, die Befehlsgewalt zu demonstrieren und durchzusetzen. Freilich, die meisten Postenführer sind Kumpel und friedlich, erinnern sich, vor einem halben Jahr selber in der Lage gewesen zu sein, aber es gibt auch Schweine, die Freude daran haben, den anderen zu quälen, ihn die Stärke fühlen zu lassen, oder die einen nicht leiden können. Wozu auch regionale und sprachliche Differenzen gehören: Ein Berliner geht nicht gerne mit einem Sachsen, ein Rostocker mag einen Erfurter nicht … ja, so ist das.
Schluchtensauser, Fichtenscheißer, Fischkopp, Sachsenbirne …
Kann all das, frag ich dich, den Zusammenhalt oder Kameradschaften fördern?
Natürlich nicht. Klaro.
Freilich gibt es trotzdem Freundschaften unter uns. Ehrliche, treue Freundschaften. Meist stellt sich sowas schnell ein. Den mag man, und den nicht. Dem vertraue ich, obwohl ich nichts von ihm weiß. Es dauerte bei mir gar nicht lange. Aber ich hab während meiner ganzen zwölfmonatigen Zeit am Strich nur ein oder zwei wirkliche Freunde gehabt, und wir haben uns danach auch noch besucht. Schreiben uns noch heute. Oder rufen uns an. Mit den anderen, den meisten, waren es Bündnisse auf Zeit, für eine Schicht oder länger, je nachdem ... und man sollte sich nicht täuschen und nichts verwechseln, denn die berühmte Kumpelhaftigkeit, das gemeinsame ewige Skatspielen, das dreckige Witzerzählen, der Austausch von Weibergeschichten, die Saufereien, ob im Ausgang oder heimlich in der Kaserne, all das sind keine Freundschaften. Auch im Knast, man weiß, gibt es sowas …
Auf einmal: Los kommt, mahnt Gruppenführer Otto, unser Ältester und deshalb manchmal auch „Vati“ gerufen, los macht, Mensch, sonst gibt’s wieder Ärger und zum Frühstück kommen wir wieder zu spät. Dann sind die besten Sachen schon weg. Los, Karli, du bist immer der Letzte.
Karli, ein kleiner, schlanker Kerl mit einem unverkennbar vogtländischen Akzent, bummelt tatsächlich, noch nicht einmal die Turnschuhe hat er zugeschnürt. Och, ich krieg de Senkel net zu, schimpft er. Er kniet sich hin und knubbelt an den Schnürsenkeln. Einer ist zu allem Unglück abgerissen. Er fummelt, um einen Knoten zu binden. Die meisten anderen aus unserer Stube und aus den Nachbarstuben stehen schon ordentlich aufgereiht auf dem Gang. Auch ich. Neben mir links steht Pitti, ein kleiner dicklicher Mensch mit Piepsstimme. Er stammt aus der Oberlausitz. Und er rollt das „R“, zum Beispiel in „Ebersbach“, seinem Heimatort, sagt „Eberrrsbach“ oder „Aperrnmauke“, ohne danach gefragt zu sein, haut er ein paar Mal am Tag Oberlausitzer Worte raus, nur um uns seine Zungenfertigkeit zu zeigen.
Nun stell dir vor: Holzknie kommt den Gang entlanggeschlurft. Seine langen Beine schlenkern. Seine Augenlider sehen verquollen und blaurot aus. In der Hand hält er die Zugkladde, in die er jede Kleinigkeit einträgt und in welcher sicherlich schon, vom Zugführer vorgegeben, die Grenzerpaare für die kommende Schicht aufgeschrieben stehen. Wir starren alle auf diese Kladde, eine unscheinbare hellbraune Mappe mit einem linierten A4-Heft darin. Eine spannende Sache, denn nie weiß man, wer mit wem hinaus an den Strich gehen muss. Alles Geheimnistuerei und absichtliche Gemeinheit. Damit die Freundschaften unter uns nicht allzu fest werden, gibt es dieses unbestimmte System. Keiner weiß, mit wem und wann er an der Grenze zusammen sein wird. Indes, es nützt denen sowieso nichts. Denn natürlich gibt es Freundschaften unter uns und natürlich wissen wir Bescheid. Die Möglichkeiten sind ja nicht unendlich, obwohl … Es gibt drei Gruppen in unserem Zug, das sind knapp 40 Mann. Davon ist die Hälfte Postenführer, dann noch die vier Unteroffiziere. Alles zusammengenommen, ungefähr zweihundertfünfundzwanzig verschiedene Postenpaarungen gäbe es, allein in unserem Zug … wenn ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung richtig im Kopf habe. Ach, was soll der Scheiß … wir werden sehen.
Pitti neben mir flüstert, Holzknie werrrd wiederr gsoffen ham, schau mal, krrriegt seine Glotzen kaum uff, dorr Apernfrrresser dorr Versuffene.
Vor dem immer noch knienden Karli bleibt der Vorgesetzte stehen. Von seiner Höhe, er prahlt damit, dass er einsfünfundneunzig lang ist, schaut er auf den Kleinen herab.
Na, Genosse Soldat, Probleme?
Karli schnauft, ieh bi gla fertsch.
Der Zug wartet, Genosse, sagt Holzknie und er knackt mit einem seiner Kniegelenke. Wir kennen das und wissen, Holzknie hat üble Laune, gleich wird er zu toben beginnen oder noch schlimmer, er wird sich Gemeinheiten beim Frühsport ausdenken. Doch es kommt vorläufig anders. Karli wird mit seiner Aktion fertig, springt hoch, strafft sich und steht in Habachtstellung vor dem Vorgesetzten. Sie schauen sich in die Augen, Karli ein wenig von unten, er ist mindestens zwei Köpfe kleiner, und Holzknie von oben herab. Das dauert nur Sekunden, aber ich kenne Karlis Blick. Da ist so viel Spott und Häme, so viel vogtländischer Mutterwitz, so viel von „Leck mich am Arsch“ und „Du kriegst mich nie“ drin, dass Holzknie, der aus dem für seine Humorlosigkeit bekannten Cottbus stammt, innerlich zu kochen beginnt. Aber noch beherrscht er sich.
Rechts um! kommandiert er, im Laufschritt marsch.
Wir traben in gemächlichem Tempo erst den Kompaniegang vor, bis zum Treppenhaus, warten, bis wir „ohne Tritt“ hören, dann geht es die Treppe hinab, die gesprenkelten Terrazzo-Stufen erbeben unter unseren Füßen, hinaus auf den asphaltierten Kasernenhof.
Halt! ruft Holzknie.
Na, wenigstens jagt er uns nicht auf die nassen Wiesen, flüstert einer. Wart’s nur ab, antwortet ein anderer, der wird deinen Arsch schon zum Kochen bringen. Da wär mir ne kühle Wiese lieber gewesen …
Wir nehmen Aufstellung. Das sogenannte Platztraining beginnt, was bedeutet: Übungen am Ort – Hüpfen, Armkreisen, Rumpfbeugen, Kniebeugen. Holzknie steht mit dem Gesicht zu uns. Er kommandiert nur, macht keine Übung selber mit. Wahrscheinlich ist er zu müde, oder noch nicht ganz nüchtern, die Glieder und der Kopf schmerzen ihn. Einer sagt halblaut: Das faule Schwein! Der steht nur da und lässt die Puppen tanzen!
Katzschmar hat das gesagt, Fotze Katzschmar, wie er genannt wird, ein langer Typ, letztes Diensthalbjahr, Postenführer, ein Heimi. Katzschmar kann sich allerhand herausnehmen. Er weiß Bescheid, hat, wie er sagt, die Arschlöcher alle in der Hand. Womit und warum, weiß ich nicht. Ich bin noch zu neu hier, bin erst vor einem Monat von der Ausbildung, zusammen mit dem halben Zug, hierher nach Hundfeld versetzt worden. Indes, Holzknie hat Katzschmars Bemerkung gehört, man sieht, er ringt mit sich, was er tun soll, dann entschließt er sich.
Zug, Achtung! brüllt er, zur Pause weggetreten! Gefreiter Katzschmar zu mir!
Katzschmar nimmt kurz Haltung an und trottet zum Vorgesetzten. Er ist fast so groß wie Holzknie. Steht mit seiner Schlottergestalt da und feixt dem Vorgesetzten ins Gesicht. Ich sehe, Holzknie versucht Katzschmar ins Gewissen zu reden, er schnauzt ihn nicht an, es ist sogar eine Art Bitte in seinem Gesicht zu lesen.
Katzschmar aber wendet sich ab. Er grient. Erstaunliches geschieht. Er klopft dem Vorgesetzten auf die Schulter. Schon gut, reg dich ab! heißt das. Das Gespräch dauerte nur kurz, wir müssen uns wieder aufstellen und der Frühsport geht weiter. Holzknie lässt uns wieder auf der Stelle hüpfen. Dann kommt der Can-Can. Wir müssen die Beine wie die Varietégirls hochwerfen. Eine Übung, die an den Sehnen zerrt. Karli hat Schwierigkeiten mit seinem linken Schuh. Wahrscheinlich ist der Knoten doch nicht so fest gewesen. Der Schuh löst sich vom Fuß und fliegt davon. Karli hüpft auf einem Bein, die graue Socke ragt in die Luft. Holzknie stutzt, greift zur Trillerpfeife. Soldat Reimann! Das ist Karli. Kommen Sie zu mir. Dalli, dalli! Karli hüpft nach vorn, steht stramm, was komisch aussieht, denn er hat einen Turnschuh und einen grauen Socken an. Karli bekommt den Anschiss! Nach Dienst melden Sie sich bei mir, jetzt zurück ins Glied und weitermachen! Nein, Soldat Reimann nach rechts. Ja, dort aufstellen. Karli darf nicht wieder an seine alte Stelle, er muss sich rechts außen postieren. Dort befindet sich eine kleine Senke im Asphalt, eine Pfütze glitzert im Laternenschein des Kasernenhofes. Halt! brüllt Holzknie, als er sieht, wie Karli der Pfütze ausweichen will. Bleiben Sie stehen! Machen Sie Ihre Übungen. Wir starren alle hin, sind gespannt, was geschieht. Karli macht noch einen Versuch, breitbeinig bleibt er stehen. Hacken zusammen! kommandiert Holzknie. Patsch! Karli muss in die Pfütze treten. Die graue Socke wird eingeweicht. Was stieren Sie alle so? Es war keine Glotzpause befohlen. Die Trillerpfeife ertönt. Alles in die Hocke! Na los! In der Hocke hüpft! Ich wende mich von Karli ab, er tut mir leid, doch was kann man tun, wenn einem in dieser befohlenen Hockstellung die Oberschenkelmuskulatur zerspringen will. Wir hüpfen und wir verfluchen den Vorgesetzten, schwören ihm, wie schon oft, Rache und Vergeltung. Die Minuten verrinnen. Dann wieder ein Trillerpfiff, der Frühsport ist zu Ende.
Wir traben in unsere Unterkünfte, schlüpfen in die Grenzerklamotten, die sogenannten Kampfanzüge „Ein-Strich-Kein-Strich“, allerdings jetzt ohne Tragegestell und Munitionstasche, nur der Gürtel wird umgeschnallt, das Käppi aufgesetzt, die Bestecktasche gefasst und schon geht es zum Frühstück. Natürlich sind wir die Letzten. Das kalte Büfett, welches der Bullettenschmied, unser Fourier, ein wendiges Kerlchen mit Brille und einem spitzen Kindergesicht, aus Rostock stammend, vor jedem Frühstück und Abendbrot so schön aufbaut, ist von den anderen schon fast kahl gefressen. Nicht mal alle Wurstsorten sind mehr da, nur von der Scheißmortadella und dem Camembert gibt es reichlich. Auch ein paar angetrocknete Scheiben Tilsiter Käse sieht man noch. Er fängt schon an, sich zu rollen. Ein paar von uns maulen. Das wird er uns büßen, der Schleifer. Gemeint ist Holzknie. Doch der kann uns nicht hören, er isst mit den Offizieren in der, wie wir sagen, Messe, einem separaten Zimmer, gleich neben dem Speiseraum. Dorthinein geht der Fourier während der Mahlzeiten wie ein Etagenkellner mit weißer Schürze und weißem Käppi und serviert Bohnenkaffee und verschiedene Extras wie Schinken und Hühnerschenkel. Wir kennen diese Schweinerei und regen uns nicht mehr auf. Nur manchmal hört man Anspielungen und Witze. Ich erbeute noch zwei Salamischeiben. Gott sei Dank, meine Grenzverpflegung ist gerettet. Auch von den Knackern kann ich eine Wurst beiseiteschaffen. Schön, da können wir draußen wieder grillen. Eine Sitte, die zwar verboten ist, uns aber gut gefällt. Das Frühstück verläuft ohne weitere Aufregung. Wir müssen uns beeilen. In ein paar Minuten ist Befehlsausgabe. Da werden wir, vollständig uniformiert, über die Lage im Grenzabschnitt aufgeklärt, wie immer auch politisch belehrt, manchmal liest Buddy, der Zugführer, ein junger, aber ungeheuer dickleibiger Leutnant, den Tagesbefehl des Grenzkommandos aus Meiningen wortwörtlich vor, und schließlich, was das Wichtigste ist, werden die Postenpaare zusammengestellt. Wir sind jedes Mal gespannt, wo wir eingesetzt werden und wer unser Partner für acht Stunden sein wird ... denn es gibt „Sahnereviere“ und „Scheißreviere“, Lieblingspartner und Arschlöcher.
Wir stehen auf dem blank polierten Flur, in drei Reihen, wie es sich gehört, natürlich in Habachtstellung, und blicken auf unseren Zugführer, Leutnant Gerber, Buddy, den Dicken, der jetzt im Augenblick seiner Wichtigkeit ein hoheitsvolles und strenges Gesicht macht. Das äußert sich bei ihm darin, dass er das Doppelkinn hochreißt, die Brauen zusammenzieht, die Mundwinkel nach unten verzieht, die Daumen im Revers der Uniform verhakt und überhaupt im Ganzen wie der italienische Duce aussieht, wenn der seine Reden vom Zentralbalkon des Palazzo Venezia in Rom gehalten hat. Buddy lässt seine dunklen kleinen Iltisaugen über unseren Köpfen kreisen, holt dann tief Luft und beginnt, indem er die bedeutenden Worte herausschreit: Genossen! Sie stehen heute wieder bereit, unsere Staatsgrenze gegen jeden Feind zu verteidigen! Er macht eine Pause, sein Brustkasten hebt sich und mit ihm bläht sich sein mächtiger Bauch, der das breite hellbraune Lederkoppel verrutschen lässt.
Genossen! fährt er fort, das Grenzkommando gibt Ihnen folgende Lage bekannt.
Und nun liest er tatsächlich von dem Papierstreifen aus dem Fernschreiber ab. Es sieht aus, als hielte er den Rest einer Rolle Klopapier in den Händen. Zeile für Zeile liest er vor und der Streifen in seinen Händen verlängert sich nach unten. Ein paar von uns grienen, aber keiner sagt etwas, denn wir stehen ja im Stillgestanden. Es ist das übliche allgemeine Gelaber vom Klassenfeind mit einem Gemisch aus eingestreuten aktuellen politischen Meldungen. Nichts Besonderes. Nicht etwa, dass die 7. US-Armee, die uns in unserem Grenzabschnitt gegenüberliegt, mobil gemacht hätte oder sich nun vor der Grenze eingräbt, die Panzer in Stellung bringt, der Dritte Weltkrieg bevorstünde, dass der Bundesgrenzschutz mit Hubschraubern vom Typ Alouette verstärkt Patrouille fliege oder die Bayrische Grenzpolizei begonnen habe, die Grenzanlagen zu demontieren, nichts von alledem, nur Gesülze vom jüngsten SED-Plenum in Berlin, was dieser und jener Sekretär des Zentralkomitees wieder abgesondert hat. Uninteressantes Zeug, was der normale Bürger der DDR – also wir – gelernt hat zu überhören, indem er seine Ohren auf Durchzug stellt. Auch wir hören kaum noch zu. Dann aber, der Dicke hat wieder eine kleine Pause gemacht und seine Klopapierrolle eingerollt, gibt er den konkreten Einsatzbefehl für die bevorstehende Grenzschicht und nennt die befohlenen Postenpaare. Wir sind gespannt. Jetzt sind unsere Ohren auf Empfang gestellt. Holzknie geht mit Schykora, auch Trabbi genannt, und weil Schykora der Trabbifahrer ist, deshalb heißt er „Trabbi“, mancher kennt Schykora nur mit diesem Spitznamen, auch ich wusste in den ersten Wochen nicht seinen wirklichen Namen. Einer murmelt, da hat das Tagesilo wieder Schwein gehabt, die ganze Schicht im Kübel rumpennen, keinen Schritt laufen, der faule Sack. Ein anderer flüstert, ich wette, das ist abgekartet. Der fährt schon das dritte Mal in dieser Woche im Trabbi mit. Die Befehlsausgabe geht weiter. Karli, der wieder neben mir steht, muss mit Katzschmar gehen. B-Turm an der GÜST. Auch so ein Superrevier. Die ganze Schicht im Turm abhängen. Wo gerade an der Grenzübergangsstelle, der Fernverkehrsstraße nach drüben, nicht das Geringste passiert. Ein Schnarchposten. Oh Katzschmar, die Fotze, mit seinen Beziehungen. Das ist wieder mal typisch. Rühri hinter mir flüstert mir diese Worte ins Ohr, er kann seinen Ärger kaum unterdrücken. Otto geht mit Pauli. Sie müssen das Waldstück am Schwarzen Hügel übernehmen. Ein Scheißposten. Viel Laufen, unübersichtlich, im Rücken die Hunde an den Laufkatzen, die nie Ruhe geben, ununterbrochen jaulen oder bellen. Kein Auge kann man schließen, nicht mal ein Stündchen abruhen. Absolut nervend. Oh, hallo, jetzt komm ich dran. Ich soll mit Schnulli gehen – Soldat Malef und Gefreiter Byschek. Unser Revier ist der alte Holz-B-Turm im Wald neben der GÜST. Kein schlechter Platz, aber vor einem halben Jahr, im letzten Frühjahr, soll hier einer durchgebrochen sein. Die Posten sind bestraft worden – der Postenführer wurde degradiert, kam nach Schwedt, sein Posten, ein Soldat aus Jena, wurde strafversetzt. Scheiße! Das möge uns erspart bleiben. Ich wende den Kopf, blicke zu Schnulli, der ganz rechts steht. Er ist ein Rotschopf aus der Oberlausitz, für meine Begriffe ein bisschen ruhig, kein Schwätzer, aber mit Mutterwitz und großem Appetit, ein Bauernjunge. Die ganze Familie in der LPG. Immer bekommt er Fresspakete von zu Hause. Vielleicht hat er auch heute ein paar Reste vom letzten Paket am Mann. Einmal hat er Leber- und Blutwürste in der Stube verteilt. Hat sagenhaft geschmeckt, ein anderes Mal Hackepeter, aber der war schon nicht mehr ganz frisch. Wir haben ihn draußen über einem Holzfeuer gebraten, und da ging’s.
Buddy nennt die weiteren Postenpaare. Zum Schluss vergattert er uns alle, wünscht eine gute Schicht zum Wohle unseres sozialistischen Vaterlandes. Dann geht’s zur Waffenausgabe. In einer Reihe stehen wir und empfangen unsere Flinten, natürlich sind es die bewährten Kalaschnikows, aber schon die neueren Modelle, mit Plastekolben, allerdings nicht die mit einklappbarer Stahlstütze wie die Fallschirmjäger, na egal, auch die zwei Magazine mit je 30 Schuss scharfer Munition gibt uns der Waffen-Uffz, davon zehn Leuchtspur, denn zwei Stunden lang wird es an diesem Morgen im Herbst noch dunkel sein.
Auf dem Hof müssen wir uns noch einmal aufstellen. Die LOs werden angelassen. Blauer Auspuffqualm zieht über uns hinweg. Auch die Trabbis und die Motorräder werden bereit gemacht und angelassen. Motorenlärm und Auspuffgerüche sind um uns. Aufsitzen! Wir klettern auf die Ladeflächen der LKWs. Die Trabbis werden mit vier Mann voll besetzt. Jeder Motorradfahrer hat einen Beifahrer. Die Kompanie, bestehend aus drei Lastkraftwagen, Typ Robour 3000, wir sagen „Zittauer Doppelgeläut“, weil die Motoren, wenn sie kalt sind, so einprägsam klingeln, es sind dabei drei PKW Typ Trabant Kübel und drei Motorräder, Typ ES 250 – alle Fahrzeuge in schönstem Mattgrün, auch der Jeep vom Kompaniechef, ein Sachsenring Typ P3, der Alte natürlich mit personengebundenem Fahrer – all das, dieser ganze Konvoi, setzt sich in Marsch, verlässt jetzt die Kaserne. Es ist genau 5.00 Uhr …
Nach einer halben Stunde Fahrt werden wir, Schnulli und ich, an unserem Revier abgesetzt. Vor uns liegt noch ein Fußmarsch von zwanzig Minuten, ehe wir am Ziel, dem Revier Holz-B-Turm, Nähe GÜST, ankommen. Hinten auf dem LKW haben wir kaum geredet, auch die anderen waren schweigsam, wir schwankten auf der Holzpritsche hin und her, Scheißstraße, Schlaglöcher, Frostaufbrüche, schließlich über Feldwege, es rüttelte und schüttelte uns – ein paar rauchten verdeckt in der hohlen Hand, die meisten dösten im Halbschlaf vor sich hin. Katzschmar schlief in der vorderen Ecke, halb in die Plane gehüllt. Ihn schien nichts zu stören. Er kann überall pennen.
Plötzlich wird gebrüllt: Malef und Byschek absitzen! Wir schrecken aus unserer Döserei auf. Scheiße! Hinaus in Kälte und Dunkelheit. Wir sind nicht die Ersten, vor uns waren schon zwei Paare abgestiegen. Steif klettern wir von der Ladefläche. Die Klappe bleibt oben! knurrt Löbel, der Uffz von Gruppe 2. Springt so runter! Na los! Wird’s bald! Wir verabschieden uns von den Kameraden. Kurzes Kopfnicken. Tschüß! Auwiehö!
Unser Revier besteht aus einem acht Kilometer langen hügeligen Waldstück mit niedrigen Fichten, ein paar Lärchen, einzelnen Birken und dichten Brombeerhecken, einen Steinwurf vom Waldrand zieht sich westlich der Plattenweg entlang, dann kommen der Kfz-Graben und die Minensperre mit dem Streckmetallzaun; nach dem Westen, unserer Frontlinie also, sind es vom Plattenweg bis zum Strich manchmal 50, höchstens 70 Meter. Im Hellen mit bloßem Auge vom B-Turm alles wunderbar zu sehen, bis auf ein paar Senken, die wir im Laufe der Schicht ein oder zwei Mal zu Fuß kontrollieren müssen.
Wir lösen die Kameraden der Nachtschicht ab. Sie stammen von der Nachbarkompanie. Wir geben uns kurz die Hände. Sie wirken müde, und soweit wir jetzt ihre Gesichter sehen können, schimmern sie grau, ausgelaugt und abgekämpft. Eine Nacht in dieser Kälte, ohne Schlaf und richtiges Essen – selbst jungen Kerlen wie uns geht das an die Substanz.
Gibt’s was?
Nee, alles ruhig. Vor zwei Stunden zwei Mann BGS mit Nachtsichtgeräten. Sonst nix.
Macht’s gut.
Ja, ihr auch.
Schlaft schön!
Schnulli und ich, wir klettern rauf auf den Turm, beziehen den B-Punkt, ein Holzgestell, fast wie ein Jagdstand, nur höher und stabiler. Oben setzen wir uns und rauchen erst einmal eine. Durch die engen Schlitze kann man uns von draußen kaum sehen. Jetzt im Dunkeln sowieso nur, wenn einer raucht. Weshalb wir die Köpfe runternehmen und die Hände schützend um die Stäbchen halten. Schnulli greift in die Brusttasche und holt einen Brief heraus. Hab ich gestern bekommen, will nur noch mal lesen.
Da brauchste aber Licht?
Na und? Ich nehm die Leuchte mit Rotfilter. Er knipst seine Taschenlampe an und schiebt mit dem Daumen den roten Filter vor. Ein rötliches Glimmen ist zu sehen. Ein ganz schwacher Schein nur. Wahrscheinlich kann er dabei gar nicht richtig lesen.
Von deiner Kleinen? frage ich.
Schnulli antwortet nicht.
Kannste was sehen? frag ich noch mal. Wart doch, bis es hell wird.
Nee, es geht. Ich will hier nur schnell eine Stelle noch mal lesen.
Ach so.
Von meinem Bruder, sagt er einsilbig. Er zieht den Brief näher vor die Augen.
Hast du keine Post gekriegt? murmelt er noch, es klingt, als wolle er jetzt seine Ruhe und nichts mehr gefragt werden. Mach mal Rundumbeobachtung. Na los!
Er ist der Postenführer, ich gehorche, weiß aber nun, Schnulli will tatsächlich nicht gestört und nichts gefragt werden. Na gut, denke ich, halt ich eben die Schnauze, der wird mir schon noch flüstern, was ihn drückt, die Schicht ist lang.
Ich blicke mit dem Glas durch den Sehschlitz in die Dunkelheit, schalte den Feldstecher auf Infrarotanzeige, aber es nützt nichts. Niemand von der Gegenseite beobachtet uns. Von draußen weht es nur kühl durch die Öffnung, ich ziehe den Kopf ein wenig zurück.
Plötzlich höre ich, wie Schnulli vor sich hinbrummelt. Auf einmal macht er eine jähe Bewegung. Erschrocken wende ich mich ihm zu. Ist was?
Es muss einer meinen Brief aufgemacht haben, zischt er.
Wieso? Das ist doch unmöglich. Das glaub ich nicht.
Hast du eine Ahnung. Was weißt du Naseweiß schon. Im letzten Halbjahr, da wart ihr noch in der Ausbildung in Rudolstadt, sind einem Postenführer hier ganze Briefe weggekommen. Und dann sind ein Offizier vom Grenzkommando und die Stasi aufgetaucht und man hat ihn tagelang verhört. Versetzt haben sie ihn schließlich. Irgendwohin. Nee, nach Schwedt ist er nicht gekommen. Wir haben ihn nicht wiedergesehen. Arme Sau …
Ich schüttle den Kopf. Unglaublich.
Klar, so war´s, Mensch. Glaub’s nur. Und bei mir fehlt jetzt eine Seite. Gestern hab ich den Brief nur flüchtig durchgesehen, war zu müde, wollte ihn in Ruhe hier draußen lesen. Aus ganz bestimmten Gründen wollte ich meine Ruhe dabei … aber gestern schon hatte ich so ein Gefühl: Mensch, da fehlt doch was? dachte ich, da stimmt was nicht? Hab aber nicht nachgeschaut. Zu müde eben und zu faul. Aber jetzt weiß ich’s. Die Seite 3 fehlt. Es waren insgesamt vier Seiten, A5, kleinformatig. Mein Bruder hat doch nicht vergessen, die Seite 3 einzulegen. Unmöglich. Diese Schweine!
Schreibt er denn was Gefährliches? Was macht dein Bruder überhaupt?
Schnulli antwortet mir nicht, er dreht sich weg, nimmt wieder den Brief vor die Augen, leuchtet mit dem Rotschein der Lampe auf’s Papier, ich sehe, wie seine Hände ein wenig zittern. Ich frage nicht nach, glotze wieder hinaus ins Dunkle. Am östlichen Horizont färbt sich der Himmel grau, ich höre einzelne Vogelstimmen aus dem nahen Wald, verschlafen und nicht so prächtig, nicht so selbstbewusst wie im Frühling klingen sie. Ich schaue auf die Armbanduhr. Es ist sechs Uhr. Eine halbe Stunde erst hocken wir hier in der Einsamkeit des Grenzgebietes. Noch fast acht Stunden warten auf uns, öde, langweilige Stunden oder nervenzerfetzende, bedrohliche Stunden. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Obwohl wir gefrühstückt haben, meldet sich schon wieder der Hunger bei mir. Remarque schrieb, der Magen sei dem Soldaten ein vertrauteres Gebiet als jedem anderen Menschen. Das stimmt. Andauernd müssen wir was zu fressen kriegen. Zu den unglaublichsten Zeiten. Der Magen ist unser Zentralorgan, nicht etwa das Neue Deutschland wie für Hauptmann Bünger, den Polit. Der Magen ist für unsere Stimmungen verantwortlich. Schon mancher von uns hat irgendeine Dummheit begangen, hat Alarm ausgelöst oder am Strich um sich geschossen, seine Kameraden schikaniert, vor Wut ein Bäumchen im Wald zerhackt oder einen Igel mit dem Seitengewehr erstochen, und alles nur, weil er Hunger hatte. Dabei leiden wir weder wirklichen Hunger noch echte Not. Die Verpflegung ist gut und reichlich. Wir kriegen mehr und besseres Fressen als die ganze übrige Armee, mehr als die Soldaten bei den Motschützen oder der Arie – die würden staunen, wenn sie unsere kalten Platten oder die Fressbeutel voller Bananen und Schokolade zum Wochenende sehen könnten. Trotzdem ist es so, wir denken mit unseren Verdauungsorganen, wir sind verfressen, ewig hungrig und voller Gier. Das Brecht’sche Wort „Erst kommt das Fressen, dann die Moral!“ gilt für uns im besonderen Maße.
Ich überlege: Am liebsten würde ich mir jetzt ein kleines Feuerchen machen, die Knackwurst auf den Reinigungsstab ziehen und mit einer kleinen, feinen Rösterei beginnen. Schon der Gedanke an den Bratenduft und das zischende Fett bewirkt Schluckreiz und Fressfantasien. Aber es geht nicht. Schnulli, mein Postenführer, gibt hier die Befehle.
Doch der rührt sich nicht und liest immer noch in seinem Brief. Ich weiß nicht, zum wievielten Male. Ich halt es nicht mehr aus und frage: Mensch, das scheint ja spannend zu sein? Sag doch mal was, Schnulli. Ich kann das Maul halten. Was is’n los?
Wieder hab ich mich vom Beobachtungsschlitz weggedreht. Starre auf meinen Kameraden, warte, dass er was wegpfeift.
Schnulli steckte den Brief in seine linke Brusttasche, setzte das Käppi auf, das er neben sich gelegt hat, hob langsam den Kopf.
Bist du nicht auch verheiratet? fragte er.
Ich nickte. Klar. Bin ich.
Na, dann weißt du ja auch, dass da so manches vorkommen kann.
Wieder nickte ich. Weiß ich, sagte ich.
Schnulli, etwas stockend und heiser: Mein Bruder schreibt mir von Ilka. Ilka ist meine Frau. Wir sind seit fünf Jahren verheiratet. Ich hatte meinen Bruder gebeten …
Du lässt deine Frau überwachen? fragte ich hastig, Scheiße, man hört mir die Empörung an, dachte ich und bereute die Frage im nächsten Moment, denn Schnulli fuhr wütend hoch.
Was weißt du Scheißer über sowas? Du kennst ja gar nicht …
Entschuldige, sagte ich, kein Vorwurf …
Ja, gut, o.k. – es ist so, weißt du, antwortete Schnulli, jetzt ruhiger, es gab schon, als ich noch nicht hier rumhängen musste, als wir jeden Tag zusammen waren, in Milkel, wo wir wohnen, so ein paar Sachen. Ilka ist ein attraktives Weib – und sie weiß das. Und sie nutzt das aus. Schon in der Oberschule in Bautzen, ich ging in die Parallelklasse, musste sie alle Jungs haben, die ihr gefielen, sogar den Stabülehrer, einen Präsent-20-Schnösel von Mitte Zwanzig, soll sie vernascht haben. Mensch, was war ich stolz, als ich kurz vor den Abschlussprüfungen ihr Freund wurde. All den anderen Arschlöchern hab ich’s gezeigt, he, he – und ich beschloss schon damals: an die lässt du keinen ran! Die soll mein bleiben auf immer und ewig. Zwar maulte mein Vater, du weißt, wir sind Bauern. Vater war damals LPG-Vorsitzender, vielleicht, weil wir vor der Kollektivierung den größten Hof hatten, o.k. er hat mir wegen Ilka einmal sogar eine geschossen. Die Hure kommt mir nicht auf den Hof! brüllte er, und meine Mutter saß in der Küchenecke und hatte verheulte Augen. Junge, findest du nicht eine andere? jammerte sie. Ich weiß, sie regten sich beide nicht nur deswegen auf, weil sie was Anrüchiges von Ilka und ihrem Lebenswandel gehört hatten, sondern auch, weil ihre Eltern ganz arme Schlucker waren, der Vater, aus Ostpreußen, soll sogar bei den Russen gesessen haben, kurz nach dem Krieg, und ihre Mutter war ’ne Poln’sche. Egal, ich hab mich durchgesetzt, weißt du, mir war das egal damals, ich wär auch fortgezogen aus unserem Nest und nach Dresden oder Leipzig gegangen oder in eine andere Kolchose, nach dem Studium. Ich wollte nämlich in Leipzig Veterinärmedizin studieren, was Besseres werden, weg vom Kolchosenalltag. Verstehst du? Sogar nach Ungarn oder in die Tschechei wär ich gegangen. Ist dann nicht so gekommen. Die haben mich nich genommen bei den Tierärzten, ich wurde umgepolt, Numerus Clausus, verstehst du, meine Schulnoten waren nicht so besonders, obwohl mein Alter war ja LPG-Vorsitzender, Arbeiter- und Bauern-Kind, das hätte schon gepasst und er ist ja auch in der Partei – trotzdem, sie haben mich nicht genommen und stattdessen gefragt: Wolln Se nich gleich Landwirtschaft studieren? Noch am Tage der Aufnahmeprüfung fragten sie, noch in der Vetmed-Fakultät, im Prüfungszimmer, als ich schon die Klinke in der Hand hielt. Was blieb mir übrig? Ich wollte ja studieren und nicht bei uns zu Hause die Mistgabel schwingen. Also sagte ich zu. Ilka hatte sich nicht beworben, obwohl sie mir geschworen hatte, auch zu studieren, um immer bei mir zu sein. Oh, die Weiber, sie lügen und wir fliegen drauf rein. Sie hatte eine Lehre begonnen, in Bautzen, als Facharbeiterin für Schreibtechnik. Würde also Sekretärin werden, bei Robotron, die auch in Bautzen ein großes Zweigwerk betrieben.
Hast du einen dummen Sohn, gibst du ihn zu Robotron! Dieser Spruch fiel mir sofort ein, aber ich schwieg und sagte stattdessen: Klingt doch alles ganz normal, Schnulli! und ich warf wieder einen Blick durch den Sehschlitz des B-Turmes. Draußen hatte der Tag begonnen, die Nebel zogen über dem Wald nach Osten, ein paar Krähen flogen krächzend auf, von Ferne hörte ich die Grenzhunde bellen.
Wart’s nur ab, entgegnete Schnulli, wart’s nur ab, du wirst schon sehen und mir recht geben, wegen dem Auftrag an meinen Bruder …
Ein bisschen hatte ich den Eindruck, Schnulli wollte sich die Sache vom Herzen reden. Es war schon richtig, wie ich gedacht hatte, die Grenzschicht ist lang und die Einsamkeit hier draußen führt dazu, dass man zu quatschen anfängt, dass man dazu neigt, wie auf dem Freud’schen Sofa, seine Seele auszukotzen. Er würde mir, dachte ich, ohne dass er es wollte, alles sagen, was ihn bedrückte, würde zu mir reden wie zu einem alten Freund, obwohl wir uns genau genommen überhaupt nicht kannten, und man ja immer vorsichtig sein musste …
Ich fing also mit dem Studium an, sprach Schnulli weiter, fast jedes Wochenende fuhr ich nach Hause und traf mich mit Ilka. Sie hatte in Bautzen eine kleine Bude. Da brachten wir die Zeit zu, waren verliebt wie nichts und ein halbes Jahr später haben wir uns verlobt. Heimlich natürlich, gemeinsam mit einem Kumpel von mir und einer Freundin von ihr. Meine Eltern wussten nichts davon. Mein Alter wäre ausgerastet, ich konnte ihm das nicht sagen. Sie allerdings hatte ihren Eltern Bescheid gesagt, und an einem der nächsten Wochenenden stand ein Geschenk von ihrer Mutter auf dem Tisch – eine selbst gebackene Verlobungstorte. Echt polnisch, klar. Ein buntes Monstrum, mit Butter und Schokolade überzogen, süß und schwer verdaulich. Am Tag darauf war mir kotzübel. Verdammt. Seit dieser Zeit kann ich an keine Buttercremetorte mehr ran. Schließlich erfuhren meine Eltern doch von der Verlobung. Mein Vater redete ein halbes Jahr nicht mehr mit mir, die Mutter war versöhnlicher und weicher. Irgendwann gab es ein Familientreffen. Wir saßen, Ilkas Eltern, die meinigen, und wir beide, in unserer Wohnstube, tranken Kaffee und aßen mitgebrachten Kuchen von Ilkas Mutter. Nein, keine Torte. Aber sie kann Kuchen backen wie keine Zweite, sag ich dir. Das hat meinen Vater wahrscheinlich am Ende versöhnt. Zum Schluss holte er Selbstgebrannten aus dem Keller und trank mit meinem Schwiegervater Brüderschaft, auch die Mütter sagten nach einem Likör schließlich „Du“ zueinander und küssten sich auf die erhitzten Wangen. Alles schien im Lot. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Doch dann kam ein Jahr später mein Praktikum. Ich musste als Praktikant auf eine Kolchose nach Thüringen. Weit weg also. Und ich konnte ein halbes Jahr lang nicht jedes Wochenende nach Hause. Ilka war inzwischen mit der Lehre fertig und nicht zu Robotron gegangen, sondern hatte, auf Vermittlung meines Vaters, in Milkel auf der Kolchose als Sekretärin angefangen. Bei meinem Vater, stell dir das mal vor. In seinem Vorzimmer saß sie nun. Wer hätte das gedacht. Seine alte Sekretärin hatte das dritte Kind bekommen und wollte zu Hause bleiben. Staatliche Maßnahmen! Fickprämie! Ein paar Tausend, du weißt. Ihr Mann, Fernfahrer bei Deutrans, verdient genug und bringt außerdem immer schöne Geschenke aus dem Westen mit. Was soll sie auf der Kolchose rumlungern und jeden Tag, acht Stunden, meinen Vater, diesen Choleriker, ertragen. Ich wette, sie ist heilfroh gewesen, durch das Kind fortzukommen. Jedenfalls, nun hatte er meine Ilka vor der Nase. Und die erste Zeit muss ihm das gefallen haben. Die Traktoristen und die Leute aus der Werkstatt, grobe Typen, sonst ölig und mit dreckigen Stiefeln, kamen plötzlich sauber in’s Büro, sprachen geschraubt, rauchten nicht und benahmen sich halbwegs höflich. Auch die Leute vom Kreis und von der Kreisleitung machten Stielaugen und klopften meinem Alten auf die Schulter: Tolle Sekretärin! Glückwunsch! Im Rausgehen sagten sie vornehm „Auf Wiedersehen“, einer hat sogar mal Blumen mitgebracht, und der Landwirtschaftssekretär der Kreisparteileitung übertraf sich selber, er erschien eines Tages mit einer Schachtel „Sarrotti-Weinbrandbohnen“. Wo der die bloß her hatte? Egal, mein Vater war hochzufrieden. Sein Ansehen war gestiegen. Doch dann, die LPG hatte einen Sicherheitsinspektor eingestellt. Nicht ganz freiwillig. Auf Weisung des Rates des Kreises. Das Neue ökonomische System der Planung und Leitung – das NÖSPL – erfordere das, hieß es. Und dieser Kerl, ein ehemaliger Ausbilder von der Offiziersschule in Löbau, technisch ein wenig versiert, fast fünfzig, geschieden wie alle diese Typen, lungerte andauernd bei meinem Alten rum. Und wenn der nicht da war, was häufig vorkam, saß er bei meiner Ilka und ging ihr auf’s Schwein. Saß da rum und raspelte Süßholz. Und er wusste schon, wie man das macht. Hatte Erfahrungen, der Lump. Ein bisschen Halbbildung, ein bisschen Rhetorik, mal ein Witzchen, mal den Kavalier gespielt. Ach, verlobt sind Sie? Und der Herr Verlobte sitzt in Thüringen? Ob der wohl immer treu ist? Ein wenig Appetit wird er sich wohl holen, und das ist ja auch nicht verboten. Die Thüringer Mädel sind flotte Bienen. Ich weiß das, hab mal ein Jahr in Thüringen Dienst gemacht. Und so ging das weiter, Gesülze, Reizen, aber keinen Trumpf in der Tasche. Ilka nun, selber allzu gern zum Flirten bereit, war nicht schwer rumzukriegen. Eines Tages im Sommer. Im fernen Thüringen hatte ich am Abend zuvor Bergfest gefeiert. Mein Vater war draußen bei den Dreschern gewesen, er stürzt ins Büro, er hat das Funkgerät vergessen, draußen tuckert noch sein Motorad, weil er gleich wieder weg will. Da sieht er seine Sicherheitsnadel mit meiner Ilka im Arm. Sie spritzen auseinander wie die Spatzen, aber gesehen ist gesehen, und bei meinem Alten kommen die früheren Vorwürfe wieder ins Gedächtnis. Also doch! denkt er, und stellt erst einmal den Sicherheitsinspektor zur Rede. Der stottert irgendwas, will sich rausreden, murmelt eine Entschuldigung. Eine Jammerfigur, ohne Mumm in den Knochen. Mein Vater aber hört kaum hin, schmeißt den Kerl raus. Dann nimmt er sich seine Schwiegertochter vor. Die, wie alle Weiber, fängt sofort zu heulen an. Es wär gar nicht so, wie er denkt, schluchzt sie, sie habe gar nicht gewollt, es wär alles ganz harmlos usw. Mein Alter, vor Wut ganz außer sich, schickt sie nach Hause. Wir sprechen uns noch! brüllt er ihr hinterher. Natürlich ist die Szene nicht geheim geblieben. Ein paar Büroweiber hatten alles gehört und gesehen. Der Dorftratsch nimmt seinen Anfang. Doch zu allem Unglück ruft mich mein Vater am Abend an. Haarklein erzählt er mir den Vorfall, reimt noch dazu, was er sich gedacht und vorgestellt hat. Ich taumle vom Kolchosbüro in meine Bude. Ich sehe mich noch in meinem kleinen armseligen Praktikantenzimmerchen stehen. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Alle Wahnideen und Eifersuchtsfantasien sind mit einem Mal wieder da. Ich hab dann irgendeine Ausrede ersonnen und bin auf meiner ES die 350 Kilometer von Thüringen nach Hause gedüst. Wir sprachen uns aus, Ilka schwor heilige Eide, ich verzieh ihr – doch das Misstrauen blieb wie ein heimlicher Gast in unserer Ehe, und da sich auch kein Kind einstellte, was vielleicht manches geheilt hätte, war unser Leben wie eine Zeitbombe, sie tickte und tickte, und jederzeit konnte sie hochgehen … es wollte sich einfach kein Vertrauen, auch keine Sorglosigkeit einstellen. Hinzu kam, dass meine Eltern immer wieder stichelten, sie fühlten sich in ihren Warnungen bestätigt, obwohl seit meinem Praktikum nichts wieder vorgekommen war.
So ist das bis heute geblieben, mein Lieber, und du kannst dir vorstellen, mit welchen Gefühlen ich Soldat wurde …
Schnulli machte eine Pause, er rückte an seinem Tragegestell herum, zog den Gürtel gerade und blickte hinaus ins Gelände. Er tat mir leid, und ich musste an meine eigene Eifersucht, an die Zweifel denken, die mich, hier bei der Armee meine Frau betreffend, besonders in Rudolstadt, in den ersten Monaten der Ausbildung, überfallen und gepeinigt hatten.
Denn neben dem Fressen, dem Hören auf den Magen sind es die Qualen der Liebe, besonders die Eifersucht, das angebliche oder tatsächliche Fremdgehen der Partnerin daheim, was einem Soldaten am meisten zu schaffen macht. Jede Geschichte, die man von anderen hört, wo wieder ein Weib einem Soldaten davongerannt ist, während der seine Zeit in Uniform abreißt, all diese Geschichten lassen Fantasien blühen, und wenn man dann einsam stundenlang auf Wache steht oder irgendwo im Dreck liegt oder, wie wir, an der Grenze lungert, dann geistert einem der Eifersuchtsteufel die schlimmsten Gedanken herbei.
Auch mir war es so gegangen. War ja grad mal zwei Jahre verheiratet, das Töchterchen sechs Wochen alt, als sie mich einzogen, meine Frau schrieb nur spärlich Briefe und ich bedachte nicht, dass sie ja arbeiten geht, den Haushalt und das Kind zu versorgen hat, sie schrieb in 14 Tagen zwei Briefe, was für mich entschieden zu wenig war. Also musste ich nach Hause, musste wissen, warum ich so vernachlässigt würde, musste wissen, was los war. Hatte sie einen anderen? Trieb sie sich herum? Aber Urlaub würde es erst in ferner Zukunft geben. Ich war ja in der Ausbildungskompanie. Mindestens zehn Wochen würde es noch dauern mit dem Urlaub. Dies konnte ich nicht aushalten. Und ausgerechnet auf dem Höhepunkt meiner Selbstquälerei hatte ich Wachdienst – GOvD. Gehilfe des Offiziers vom Dienst: Man saß rum, hatte nichts zu tun, las ein wenig, machte Kreuzworträtsel. Der Offizier vom Dienst war ein gewisser Hauptmann Schönlebe. Stellvertreter des Kommandeurs der Einheit. Ein schlanker, fast zierlicher Typ, wortkarg, mit traurigen Augen. Er las andauernd Tolstois „Anna Karenina“, blickte trübe vor sich hin. Ich wusste, und nirgends wird so gequatscht wie in der Truppe, er lebt in Scheidung, was ihn offenbar ziemlich mitnahm. Der wäre mein Mann, dachte ich, denn ich hatte, listiger Odysseus, der ich war, einen Plan gefasst. Ich wollte unbedingt außerplanmäßig nach Hause. Dafür gab es bei den Grenztruppen nur dann eine Chance, wenn zu Hause die Beziehung wackelte oder zu zerbrechen drohte, denn die Ehen und Partnerschaften der Soldaten mussten in Ordnung sein, weil sonst, du weißt – Fluchtgefahr. Eine interne moralische Richtlinie, die mal so und mal so gehandhabt wurde. Und nun glaubte ich, dieser Hauptmann Schönlebe, selber in Schwierigkeiten, würde Verständnis haben für einen wie mich und mir einen Sonderurlaub genehmigen, wenn ich ihm nur glaubhaft machen konnte, wie schlimm es um meine Ehe stand. Ich will es gleich sagen, ich hatte richtig kalkuliert. Alles klappte wunderbar.
Es war zwei Uhr nachts. Tiefe Stille in der Kompanie. Die idealste Stunde für Geständnisse. Während der Hauptmann nun von seinem Tolstoi traurig aufschaute, verwickelte ich ihn in ein Gespräch über die Untiefen einer Ehe, die Qualen von Eifersucht, die Folgen von Leidenschaft und Misstrauen. Vielleicht war er in seiner Lektüre gerade an der Stelle, wo bei Tolstoi die Anna über ihren Fehltritt mit dem Grafen Wronski eine moralische Anwandlung ergreift, wo sie nachdenkt, wo sie in Selbstschuld versinkt – oh, was habe sie da getan, wie solle es jetzt weitergehen und lauter solche Dinge, oder ich hatte einfach nur seinen Nerv getroffen, ich weiß es nicht, jedenfalls sah ich bei Schönlebe, während ich ihm in dunkelsten Farben mein Leid und meine Verzweiflung schilderte, ein tiefes Mitgefühl über seine Züge gleiten. Die dunklen Augen wurden noch dunkler und die Mundwinkel zuckten in schmerzlicher Ergriffenheit. Er könne verstehen, was ich ihm da sagen wolle, oh, er wisse um diese Dinge aus eigener Erfahrung, ja, so weit ging es mit ihm, er sagte sogar, er fühle mit mir. Ungewöhnlich für einen Offizier, wenn man bedenkt, wen er vor sich hatte – einen ihm im Prinzip unbekannten Soldaten. Nun leitete ich ganz sacht zu meinem Anliegen über, fragte, ob er nicht etwas für mich tun könne. Und tatsächlich, dieser Hauptmann Schönlebe, der liebe Gott erhalte sein Andenken, versprach mit dem Kompaniechef zu reden und ich würde Bescheid bekommen, allerdings, ein förmlicher Antrag sei nötig. In Ordnung sagte ich, oder hatte ich „Zu Befehl!“ gesagt? auf alle Fälle schrieb ich den Antrag sogleich nieder und übergab ihn dem barmherzigen Hauptmann.
Inzwischen war es fünf Uhr geworden. Wir mussten zum normalen Dienstbetrieb zurückkehren. Gleich würde der Wachwechsel vollzogen.
Jedenfalls, eine Woche später fuhr ich in den sogenannten VKU, kam freudestrahlend zu Hause an und erzählte meiner Frau, während ich sie, noch im schweren und dicken Dienstwintermantel, lachend umarmte, von meinem Streich, natürlich nicht ohne sie zu ermahnen, künftig ein wenig häufiger zu schreiben, um mir nicht wieder zu solchen Anlässen zu verhelfen, denn noch einmal würde es sicher nicht klappen.
An diese Sache also musste ich denken, wie mir Schnulli so ergreifend von sich erzählte. Allerdings, ich sagte ihm nichts von mir. In seinen Augen war ich ja der unerfahrene Soldat im zweiten Diensthalbjahr. Was konnte ich, der Neuling, von solchen Dingen wissen. Ich wüsste an der Grenze von nichts, also auch nichts vom Leben. So dachte er, wie wir alle, wie auch ich später, dem Dienstjüngeren gegenüber gedacht habe. Sollte Schnulli also ruhig glauben, was er glaubte. Ich würde ihm die Illusion nicht rauben.
Wie es nun weitergegangen wäre mit seiner Ilka, fragte ich …
Ich sagte schon, sprach Schnulli weiter, es ging immer so fort. Meine Eifersucht, ihre kleinen und großen Abenteuer. Aber ich liebe sie. Glaub mir, kaum halte ich sie in meinen Armen, ist der Verstand im Eimer, ich bin ihr verfallen, weiß nicht, wie sie das macht. Und da hab ich meinen Bruder gebeten, auf sie ein bisschen aufzupassen. Mein Bruder arbeitet auch in der Kolchose, ist Leiter einer 2000er Milchviehanlage. Er hat zwar wenig Zeit, aber er hat es mir versprochen. Auf ihn kann ich mich zu 100 Prozent verlassen. Vielleicht ist er sogar in Ilka verknallt, oder sie in ihn, aber er würde das niemals ausnutzen. Der Brief hier (und Schnulli hob die Papierseiten) ist sein dritter. Bei den anderen hat er nichts herausgefunden, alles war normal, ich brauchte mir keine Gedanken zu machen. Doch jetzt – wieder hob er die Seiten hoch, schwenkte sie wie zum Beweis. Hör zu, mein Bruder schreibt: Letzte Woche ist sie (gemeint ist meine Frau Ilka) nach Dresden gefahren, hat einen Tag freigenommen, sie wollte einkaufen. Doch am Abend ist sie nicht zurückgekommen. Sie rief an und sagte, es sei spät geworden und sie werde bei einer alten Schulfreundin übernachten, die sie zufällig getroffen hätte. Die Freundin wohne auf der Prager Straße und so würden sie bestimmt noch ein wenig bummeln gehen. Die Freundin hätte auch Besuch bekommen, ihren Stiefbruder aus Westberlin … das sind die letzten Zeilen auf der Seite 2, die Seite 3 aber fehlt vollständig. Denkst du, dass das ein Zufall ist? Mein Bruder hat sie nicht vergessen, hineinzulegen. Das ist sicher. Was ist mit Ilka und dem Bruder der Freundin? Wer ist die Freundin? Nirgends ein Name. Mysteriös. Ich kenne keine Freundin von ihr, die in Dresden auf der Prager Straße wohnt. Das hätte ich mir gemerkt. Da hätten wir bestimmt mal drüber gesprochen. Ich war mit Ilka ein paar Mal in Dresden, auch auf dieser Prager Straße. Niemals hat sie gesagt, dass hier eine Freundin von ihr wohnt. Und dann ein Stiefbruder von ihr aus Westberlin! Ausgerechnet Westberlin! Ein Reizwort für die Stasi. Die machen doch regelmäßig Stichproben bei unseren Briefen. Garantiert haben die Schweine die Seite geklaut. Haben „Westberlin“ gelesen und dann irgendwas für sie Verdächtiges auf der folgenden Seite gefunden. Wer weiß, was da noch alles gestanden hat? Ich muss meinen Bruder anrufen. Unbedingt muss ich ihn anrufen. Aber wie? Von welchem Apparat? Und wann und wo? Etwa vom Dienstzimmer des UvD aus? Hier wird doch überall mitgehört, und das Grenzkommando zeichnet jedes Gespräch auf. Verdammte Scheiße! Verdammt! Verdammt!
Los sag was! Schnulli war aufgesprungen und rüttelte an meiner Schulter. Was soll ich machen? Verdammt! Ich lieb sie doch, aber wenn sie jetzt irgendeine Dummheit gemacht hat – was soll werden? Die Stasi kennt kein Erbarmen. Man wird mir nachweisen, dass ich davon gewusst habe, dass ich sie vielleicht sogar angestiftet habe, dass ich flitzen will – denn darauf läuft es doch immer hinaus, das ist doch das, was sie einem immer nachweisen wollen: Du hast eine Republikflucht vorbereitet, du verrätst deine Kameraden, du bist ein Verbrecher. Mein Gott, Franz, was soll ich tun? Ich liebe sie doch! Verstehst du? Aber ich kann sie nicht fragen, was da war auf der Prager Straße oder über die Freundin und ihren Stiefbruder aus Westberlin. Ich würde meinen Bruder bloßstellen. Kapierst du das? Ilka selber schreibt mir nichts darüber, ihr letzter Brief war voller Gesäusel, tausend Küsse stand drunter, jede Menge allgemeiner Floskeln, sogar vom Wetter in Milkel hat sie geschrieben, und vom Kolchosen-Tratsch. Den ganzen Scheiß! Je länger ich über all das nachdenke, desto übler wird mir. Ich fühle mich ohnmächtig, ganz und gar ausgeliefert. So sag doch was! Franz!
Er war laut geworden. Und ich dachte, dass ich den Schnulli noch nie so viel hintereinander hätte reden hören. Er hatte sich in Rage geredet, musste ziemlich aufgeregt sein.
Auch ich war inzwischen aufgestanden, aber ich hatte ihn, den erhitzten Kerl, mit sanftem Nachdruck wieder zu seinem Sitz geführt, sagte: Mensch, halt doch dein Maul, Schnulli! Was brüllst du hier an der Grenze herum, was spielst du den Verrückten. Noch ist doch nichts passiert. Noch ist gar nichts erwiesen. Vielleicht hat dein Bruder wirklich die Seite vergessen hineinzutun, oder er hat sie wieder herausgenommen, weil er im letzten Moment überlegt hat, wie gefährlich das für dich werden könnte. Kann doch sein, Mensch. Oder nicht? Wenn du hier weiter so brüllst, hört der BGS jedes Wort, die hören alles, was du hier blökst, die brauchen nur 40 Meter von uns entfernt drüben im Wald zu liegen und alles mit einem Richtmikrofon aufzunehmen, was du Affe hier herausschreist. Dann schicken sie das Band ans Grenzkommando und dran bist du, mein Lieber. Beherrsch dich doch! Ich bitte dich! Ich versteh dich ja, ich versteh dich wirklich – doch wart erst einmal ab. Geh meinetwegen morgen zum Spieß und frag ihn, wo deine Seite hingekommen ist, wenn dich das beruhigt, ich würde das allerdings nicht machen, weil die dann erst richtig Verdacht schöpfen. Also abwarten! heißt die Devise. Vielleicht klärt sich alles auf, vielleicht war gar nichts. Und, wenn die Stasi kommen sollte?
Na und? Was kannst du dafür? Nimm einfach Dummpulver. Denk dran, wie sich unsere Fotze Katzschmar verhalten würde. Der würde nicht so verrücktspielen wie du. Der würde sich irgendwas Schlaues ausdenken. Eine List oder so. Also, Schnulli, schlaf erst mal drüber – und jetzt Schnauze …
Außerdem, ich schaute auf die Uhr, müssen wir uns jetzt nicht melden? Es ist 6.30 Uhr! Wenn wir das verpassen, schickt uns der Buddy noch den Holzknie auf den Pelz. Geh also runter an den Anrufmast, ich halt inzwischen den Strich im Auge.
Schnulli schaute mich groß an, er war erstaunt über mich und meine Rede.
Bist du der Boss oder ich? Wer gibt hier die Befehle, he? So ein Neunmalkluger, der Kleine. Noch Tage wie Mist, aber schon klug wie ein Heimi. Und woher weißt du das überhaupt vom BGS?
Schnulli lächelte und er sagte das ohne Zorn und Vorwurf, dann ging er tatsächlich nach unten, um den FP anzurufen. Nach ein paar Minuten kam er wieder hoch, klopfte mir auf die Schulter: Entschuldige! Ich dank dir, Kleiner. Ich werde es so machen.
Als ich ihn dann fragend anschaute, sagte er: Abwarten! meine ich. Abwarten, wie du gesagt hast. Ja, ich werde erst einmal abwarten! Gehen wir bis zum nächsten Mast, wir sollen jetzt links die zwei Senken kontrollieren. Komm!
Also, wir kletterten runter vom Turm und trotteten los. Immer auf dem Kolonnenweg lang. Scheißbetonplatten. Das sind solche mit Löchern drin, für die Griffigkeit der Fahrzeuge, wenn es regnet oder Schnee liegt. Wenn man da eine Weile drauf läuft, tun einem die Rotten weh.
Das Wetter hatte sich aufgeklart. Es schien ein schöner freundlicher Novembertag zu werden. Links vom Wald her wehte eine kleine Brise westwärts, würziger, herber Tannenduft. Ich nahm eine Nase, pumpte die Lungen mit Frischluft randvoll, hörte einen Häher krächzen. Plötzlich sah ich ein Reh. Gott sei Dank flüchtete es in den Wald zurück. Wenn diese Viecher vor lauter Angst zur Minensperre laufen, eine Lücke im Streckmetallzaun finden, reinhopsen und dann auf eine von den kleinen runden „Schuhcremeschachteln“ treten, gibt es einen Rums und hoch fliegt das liebe Tierchen – allerdings ohne Beine. Dann haben wir ’nen Zapfen, müssen den LKW anfordern und mit der Bergebrücke rüberturnen, um das arme Tier, das meistens noch lebt, rauszuholen. Wildbraten gibt’s trotzdem nicht. Wer nur das ganze Wild frisst? Solche Wildunfälle gibt es schließlich andauernd, manchmal jede Nacht.
Aber mein Reh flüchtete dorthin, wo es hergekommen war. Schnulli hatte es auch gesehen. Wir atmeten durch. Glück gehabt.
Bei den Senken war nichts los. Alles normal. Kein Schwein zu sehen. Weder BGS noch die Bayrische Grenzpolizei. Auch keine Amis, die hier, weil die Fahrstraße drüben bis zum Wald geht, mit ihren kleinen, wendigen M4-Sherman-Panzern ab und zu zum Strich kommen, den Turm drehen, mit der Kanone wackeln, auch aussteigen, die schwarzen Käppis absetzen und zu winken anfangen. Manchmal machen wir uns dann den Spaß, mit dem LMG zu drohen. Das Zweibein wird ausgeklappt und wir lassen den Verschluss schnappen. Natürlich ohne durchzuladen. Das Magazin muss man dabei vorsichtig ausklinken, damit keine Patrone mitgenommen wird. Und natürlich können wir das nur machen, wenn einer von uns LMG-Schütze ist und die schwere Knarre mit rausgeschleppt hat. Vor dem sowjetischen LMG haben die Amis eine Heidenangst. Warum, wissen wir nicht. Sofort springen sie in ihre Panzer und rasen davon.
Heute war, weißt du, wie gesagt, nichts von ihnen zu sehen. Schade. Oder besser: Gut so, denn wir haben keine Lust auf solchen Scheiß. Klar. Erstens haben wir kein LMG, zweitens Schnulli hat den Kopf voll, ihm ist nicht nach Scherzen.
Schnulli ging also zum Mast, um sich zu melden. Er quatschte eine Weile, immer schön die Codierung nutzend, mit dem Führungspunkt. Was der nur zu sabbeln hat? dachte ich, will sich wichtig machen, der Junge, weil er die Hosen voll hat.