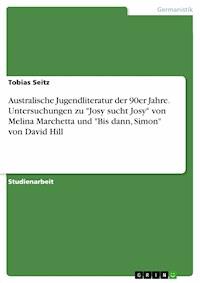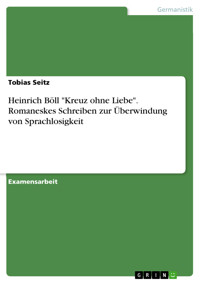
Heinrich Böll "Kreuz ohne Liebe". Romaneskes Schreiben zur Überwindung von Sprachlosigkeit E-Book
Tobias Seitz
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Germanistisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung „Es war so unglaublich schwer, kurz nach 1945 auch nur eine halbe Seite Prosa zu schreiben“. Trotzdem schafft es Heinrich Böll 1946 einen ganzen Roman mit immerhin 200 Manuskriptseiten Text zu verfassen. Fiel es ihm also wirklich so schwer wie im Zitat oben behauptet? Oder zeigt sich in diesem „Trotzergebnis“ ein Böllscher Charakterzug? Mit der Heimkehr nach Köln waren zwar die Schrecken des Krieges überstan-den, aber seine Folgen noch lange nicht. Heinrich Böll fand seine Heimatstadt völlig zerstört vor. Hunger und Existenzängste waren von nun an die ständigen Begleiter für ihn und seine Frau Annemarie. Der frühe Tod seines ersten Sohnes Christoph, im Oktober 1945, war zudem ein weiterer schwerer Schlag für das jun-ge Ehepaar. Als Hilfsarbeiter in der Schreinerei seines Bruders Alois verdient Böll den Unterhalt für das Allernötigste. Die Zeitumstände ließen es vorerst also gar nicht zu, dass Böll viel Zeit zum Schreiben aufbringen konnte. Dennoch wollte er sich von diesem Vorhaben nicht abbringen lassen. In einem Brief vom 15. Oktober 1946 äußert Böll gegenüber Ernst-Adolf Kunz: Und meine eigentliche Arbeit, meine große Freude und meine große Not ist, daß ich abends schreibe; ja, ich habe das Wagnis begonnen und schreibe…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Page 1
Heinrich Böll „Kreuz ohne Liebe“. Romaneskes Schreiben als erster Versuch zu
Page 4
1. Einleitung 3
1. Einleitung
„Es war so unglaublich schwer, kurz nach 1945 auch nur eine halbe Seite Prosa zu schreiben“.1
Trotzdem schafft es Heinrich Böll 1946 einen ganzen Roman mit immerhin 200 Manuskriptseiten Text zu verfassen. Fiel es ihm also wirklich so schwer wie im Zitat oben behauptet? Oder zeigt sich in diesem „Trotzergebnis“ ein Böllscher Charakterzug?
Mit der Heimkehr nach Köln waren zwar die Schrecken des Krieges überstanden, aber seine Folgen noch lange nicht. Heinrich Böll fand seine Heimatstadt völlig zerstört vor. Hunger und Existenzängste waren von nun an die ständigen Begleiter für ihn und seine Frau Annemarie. Der frühe Tod seines ersten Sohnes Christoph, im Oktober 1945, war zudem ein weiterer schwerer Schlag für das junge Ehepaar. Als Hilfsarbeiter in der Schreinerei seines Bruders Alois verdient Böll den Unterhalt für das Allernötigste.
Die Zeitumstände ließen es vorerst also gar nicht zu, dass Böll viel Zeit zum Schreiben aufbringen konnte. Dennoch wollte er sich von diesem Vorhaben nicht abbringen lassen. In einem Brief vom 15. Oktober 1946 äußert Böll gegenüber Ernst-Adolf Kunz:
Und meine eigentliche Arbeit, meine große Freude und meine große Not ist, daß ich abends schreibe; ja, ich habe das Wagnis begonnen und schreibe…2
Heinrich Böll geht dasWagnisein und startet den Versuch den Beruf des Schriftstellers ernsthaft auszuüben. Die Erlebnisse des Krieges mussten einfach zu Papier gebracht werden. Ein wichtiges Ziel, welches Böll damit verfolgte, war das Verarbeiten der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt. Das aufs Blatt gebrachte Wort erleichtert die Seele und befreit von einer Last, die schließlich vor einem „stehend“ viel besser und einfacher zu reflektieren ist. So dient das Schreiben zuerst der Entlastung. Zugleich ermöglicht es dem Autor aber auch das Erlebte zu sortieren und es in Relation zur Gegenwart zu betrachten. Es entsteht langsam eine Distanz zu den Ereignissen:
1Widmer, Urs: So kahl war der Kahlschlag nicht. In: Die Gruppe 47. Hg. v. Reinhard Lettau. Neuwied, Berlin 1967. S. 334. Das Zitat entstammt aus einem Brief Bölls an Widmer.
2Die Hoffnung ist wie ein wildes Tier. Der Briefwechsel zwischen Heinrich Böll und Ernst-Adolf Kunz 1945-1953. Köln 1994. S. 24.
Page 5
1. Einleitung 4
Das Kaleidoskop der zahllosen Fragmente aus Erlebnissen, Erfahrungen und Wahrnehmungen, aus Empfindungen, Ängsten, Schrecken und Ungewißheiten, denen der Soldat Böll abhängig und hilflos ausgeliefert gewesen war, drehte sich für den Heimkehrer langsamer, es kam zur Ruhe. Es zeigte nun festere Bilder. Erzählen bedeutete, sich zu sammeln, Einblick und Überblick zu suchen, all den Fragmenten in Bildern faßliche Kontur zu geben, die Pegelstände der veränderten Realität zu ermitteln.3
Mit „Kreuz ohne Liebe“ beginnt der Autor also die Arbeit an seinem wohl „egoistischsten“ Werk.
Der zweite Grund, warum Böll zur Feder greift, ist das Erwachen des literarischen Gewissens. Das, was geschehen war, durfte nie wieder geschehen. Böll spürte schon früh, dass er für etwas auserkoren war:
Gott hat mir nicht umsonst eine so tiefe Empfindsamkeit gegeben und hat mich nicht umsonst so leiden lassen, ich habe gewiß eine Aufgabe zu erfüllen, von der ich selbst vielleicht nicht einmal etwas ahne;4
Dieser Aufgabe entzieht sich Heinrich Böll nicht. Er stellt sich der Verantwortung des Schriftstellers und nutzt dessen Handwerkszeug, das Auge:
[…]ein gutes Auge gehört zum Handwerkszeug des Schriftstellers, ein Auge, gut genug, ihn auch Dinge sehen zu lassen, die in seinem optischen Bereich noch nicht aufgetaucht sind.5
Böll wollte also schreiben. Der Wunsch nach Entlastung der Seele und das mahnende Gewissen des Schriftstellers trieben ihn förmlich dazu. So klar demnach seine Aufgabe war, so schwer stellte sich ihm aber darauf auch die Hürde der Sprachlosigkeit entgegen. Um in Worte fassen zu können, was er erlebt hatte, musste sich Böll zuerst aus seinen eigenen sprachlichen Zwängen befreien, die auch ihn als Folge der Naziherrschaft dominierten. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint „Kreuz ohne Liebe“ also als erster Versuch zur Überwindung der Sprachlosigkeit.
Sprachlosigkeit ist ein Phänomen, welches sich durch alle Generationen der Menschheit zieht. Schaut man z.B. in die jüngste Vergangenheit und ruft sich den 11. September 2001 oder noch näher den Irak Krieg aus dem Frühjahr 2003 ins Gedächtnis, so fällt es nicht schwer sich vorzustellen, was es heißt sprachlos zu sein. Wir alle saßen vor den Bildschirmen und fanden keine Worte zu den uns
3Vormweg, Heinrich: Der andere Deutsche. Heinrich Böll. Eine Biographie. Köln 2000. S.127.
4Böll, Heinrich: Briefe aus dem Krieg. 1939-1945. Band I und II. Hg. von Jochen Schubert. Köln 2001. S. 170.
5Böll, Heinrich: Bekenntnis zur Trümmerliteratur. In: Heinrich Böll. Werke. Essayistische Schrif- ten und Reden I. 1952-1963. Hg. v. Bernd Balzer. Köln[1978]. S. 33.
Page 6
1. Einleitung 5
übermittelten, entsetzlichen Bildern. Ereignisse, die außerhalb des Beschreibbaren liegen, für die kein Wort des Wortschatzes aller Sprachen ausreichend oder treffend wäre, machen uns sprachlos.
In derselben Situation befand sich Deutschland nach Ende des zweiten Weltkrieges. Der Tod von Millionen Menschen, tausende zerbombte Städte und unzählige, grausame Einzelschicksale ließen die Überlebenden verstummen. Die Deutschen fanden aber nicht nur ihr Land in Trümmern vor, sondern auch ihre eigene Sprache, die durch den Nationalsozialismus missbraucht wurde. Jungen Autoren wie Heinrich Böll stellte sich folglich nicht nur die Aufgabe der Überwindung der Sprachlosigkeit, sondern auch die Aufgabe der Findung einer „neuen“ Sprache:
Wiederherstellung der Sprache. Das setzt voraus, daß die Sprache zerstört vorgefunden worden ist. Für die Generation Heinrich Bölls trifft es zu. Sie hatte, als ihr Reden und Schreiben die Form der Verantwortung suchte, in der Sprachgegenwart nur die Muster der totalen Verantwortungslosigkeit zuhanden; einen Schutthaufen, in welchem für die wichtigsten wie für die unscheinbarsten Wörter der gehörige Ort im Sinngefüge kaum mehr auszumachen war - nicht einmal mehr Lügen, die man allenfalls zu durchschauen und richtigzustellen vermöchte, sondern Chaos.6
Die erste Frage, die sich sogleich stellt, ist, in welcher literarischen Form man nun versuchen sollte, eine neue Sprache zu entwickeln. Eine nahe liegende Antwort bietet da zuerst die Lyrik. In ihr werden nur wenige Worte benötigt, um ein Gedicht zu vollenden. So könnte man sich Schritt für Schritt bzw. Wort für Wort eine neue Sprache „erdichten“. Diesen Weg gingen nach 1945 auch viele Schriftsteller, wie z. B. Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann, Eugen Gomringer oder auch Paul Celan. Auf der Suche nach einer neuen Ausdrucksweise und neuen Inhalten entstand so eine große Bandbreite an hermetischer Lyrik. Auch Heinrich Böll war die Gedichtform nicht fremd und er schrieb kurze, eindringliche Zeilen wie z.B. „Frühling“7und „Gruß“.8
Aber das für die Sprachfindung offensichtlich Positive in der Lyrik wird bei genauerer Betrachtung zu einem Nachteil. Zwar braucht man nicht viele Worte für ein Gedicht, umso intensiver ist aber die geistige Arbeit der Abstraktion und Re-
6Weber,Werner: Die Suche nach einer bewohnbaren Sprache. In: In Sachen Böll. Hg. v. Marcel Reich-Ranicki. Köln, Berlin 1968. S. 72.
7Vgl. Böll, Heinrich: Werke. Kölner Ausgabe: Band 2. 1946-1947. Hg. v. J. H. Reid. Köln 2002. S. 138.
8Vgl. ebd. S. 141.
Page 7
1. Einleitung 6
flektion. Dahinter verstecken sich so viele Worte, die auf dem Papier nicht erscheinen. Sprachfindung wird so also eher erschwert als erleichtert. Darum kann es auch nicht verwundern, dass Heinrich Böll gerade die epische Breite eines Romans zur Überwindung der Sprachlosigkeit wählt. Hier bietet sich dem Autor die Möglichkeit ihr vehement entgegenzutreten. Keinen Gedanken muss er aussparen, wodurch er verhindert, dass ihm „wertvolle“ Worte verloren gehen.
Heinrich Böll will in seinen epischen Texten der Wirklichkeit so nahe wie möglich kommen. Im Rahmen eines Romans ist dies am wahrscheinlichsten. Warum Böll gerade der Wiedergabe der Realität so viel Bedeutung beimisst, zeigt folgendes Zitat:
Die Wirklichkeit ist wie ein Brief, der an uns gerichtet ist, den wir aber ungeöffnet liegenlassen, weil die Mühe, ihn zu öffnen, uns lästig ist - oder weil uns die Vorstellung quält, der Inhalt könne unerfreulich sein, eine Vorstellung, die uns fast gewiß erscheint. Die Wirklichkeit ist eine Botschaft, die angenommen sein will - sie ist dem Menschen aufgegeben, eine Aufgabe, die er zu lösen hat.9
Mit „Kreuz ohne Liebe“ beginnt der Autor Heinrich Böll den Prozess der Sprachfindung, um so die Sprachlosigkeit einer ganzen Generation zu brechen. Vor allem gegenüber den Schrecken des Krieges will er nicht länger schweigen und sieht seine Aufgabe darin, diesen in seiner Wirklichkeit wiederzugeben. So tritt Böll auch Adorno entgegen, allerdings ohne ihm dabei zu widersprechen: Es ist in dieser Stadt von Theodor W. Adorno ein großes Wort gesagt worden: man kann nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben. Ich moduliere das Wort: man kann nach Auschwitz nicht mehr atmen, essen, lieben, lesen - wer den ersten Atemzug getan hat, sich nur eine Zigarette ansteckt, hat sich entschlossen, zu überleben, zu lesen, zu schreiben, zu essen, zu lieben.10
Heinrich Böll hat sich entschlossen zu überleben, weil er sich seiner Stellung und seiner Verantwortung bewusst ist. Schweigen ist für ihn keine Lösung, vielmehr der Anfang des Vergessens. Und so wie Sprache „der letzte Hort der Freiheit
9Böll, Heinrich: Der Zeitgenosse und die Wirklichkeit. In: Heinrich Böll. Werke. Essayistische Schriften und Reden I. 1952-1963. S. 71.
10Böll, Heinrich: Frankfurter Vorlesungen. In: Heinrich Böll. Werke. Essayistische Schriften und Reden 2. 1952-1963. Hg. v. Bernd Balzer. Köln[1978]. S.44.
Page 8
1. Einleitung 7
sein“11kann, so kann sie auch das erste Stück der Rückeroberung dieser bedeuten. Mit „Kreuz ohne Liebe“ will Böll dieses Stück der Freiheit zurückgewinnen.
11Böll, Heinrich: Die Sprache als Hort der Freiheit. In: Heinrich Böll. Werke. Essayistische Schriften und Reden I 1952-1963. S. 302.
Page 9
2. Ziele der Arbeit 8
2. Ziele der Arbeit
In der folgenden Arbeit wird nun der Roman „Kreuz ohne Liebe“ von Heinrich Böll auf mehrere Aspekte hin untersucht. Zentrale Frage wird dabei sein, wie und ob der Autor so kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs seine Sprachlosigkeit überwindet.
Nach einer kurzen Übersicht über die Entstehungsgeschichte des Romans und einem Einblick in die Nachkriegsliteratur wird die sprachliche Ausgangssituation des Textes analysiert. Dabei liegt zum einen ein besonderes Augenmerk auf Bölls Umgang und Verwendung des nationalsozialistischen Vokabulars im Text, zum anderen wird die Bedeutung der Bildhaftigkeit seiner Sprache herausgearbeitet. Anschließend soll aufgezeigt werden, inwieweit Heinrich Bölls Sprache noch von Zeichen der Sprachlosigkeit durchzogen ist.
Die Romanhelden stehen im Mittelpunkt, wenn untersucht wird, in welcher Form ihr Handeln von den beschriebenen Zeitumständen beeinflusst ist. Dabei wird herausgearbeitet, wie die Figuren die im Roman beschriebene Situation wahrnehmen bzw. deuten. So können Hinweise gewonnen werden auf Bölls Verarbeitung der Kriegsjahre.
Den Roman zeichnet eine nicht zu übersehende Religiosität aus. Diese wird vor allem in Bezug auf die schon im Titel angedeutete Kreuzsymbolik untersucht, die als zentrales Motiv im Text erscheint. Hier wird unter anderem dargestellt, in welcher Form der Gegensatz von Hakenkreuz und Christenkreuz als Basis für Bölls religiöse Wirklichkeitsdeutung dient, bzw. inwieweit die Darstellung beider Kreuze ineinander fließt.
Da der Roman „Kreuz ohne Liebe“ erst im Oktober 2002 veröffentlicht wurde, fand er bisher noch keine Beachtung in der Forschung, so dass bis zur Entstehung der vorliegenden Arbeit, mit Ausnahme einiger Rezensionen, noch keine eingehende Untersuchung bekannt war. Weil es sich bei „Kreuz ohne Liebe“ um das Erstlingswerk Heinrich Bölls handelt, soll auch die Sekundärliteratur zu seinen späteren Texten nur in Einzelfällen herangezogen werden, da diese in einem Rückvergleich dem Roman in der Regel nicht gerecht werden kann. Gerade nach der Lektüre der Rezensionen ist mir bewusst geworden, dass ich gegenüber den Verfassern der Artikel einen großen Vorteil in Bezug auf Heinrich
Page 10
2. Ziele der Arbeit 9
Böll und seinen ersten Roman habe. Mein Bild über diesen Autor ist keineswegs festgelegt. Seine Romane und anderen Werke treten für mich nicht in der chronologischen Folge ihrer Veröffentlichung auf. So lese ich „Kreuz ohne Liebe“ nicht als einzigen Roman aus dem Nachlass Heinrich Bölls, da für mich die anderen Texte auch im weitesten Sinne als Nachlass wirken. So habe ich den Vorteil, dass ich „Kreuz ohne Liebe“ ohne besondere Erwartungen an seinen Inhalt oder an seinen Autor lesen kann. Mein Standpunkt ist folglich der, dass ich das Erstlingswerk eines jungen Autors vor mir habe und es als solches auch lesen und bewer- ten kann.
Page 11
3. „Kreuz ohne Liebe“: Der erste Roman Heinrich Bölls 10
3. „Kreuz ohne Liebe“: Der erste Roman Heinrich Bölls
Nach 56 Jahren „Schubladendasein“ erschien im Oktober 2002 der erste Nachkriegsroman Heinrich Bölls. „Kreuz ohne Liebe“ ist somit nach „Der Engel schwieg“ der zweite Roman aus dem Nachlass des Autors. Zum ersten Mal veröffentlicht, findet sich der Text im 2. Band der insgesamt 27 Bände umfassenden Kölner Ausgabe der Werke Heinrich Bölls wieder. Ursprünglich begonnen hat Böll die Arbeit an diesem Roman im Juli 1946. Wohl mit kurzer Unterbrechung schließt er im Mai 1947 den ca. 200 Manuskriptseiten langen Text ab.
Im Rahmen eines Wettbewerbes des Augsburger Verlags Johann Wilhelm Naumann, der den „besten Roman, der die weltanschauliche Auseinandersetzung des Christentums mit dem Nationalsozialismus gestaltet“, sucht, legt Heinrich Böll seinen Roman vor. Am 15. April 1948 erhält er allerdings sein Manuskript zurück. Zu einer Veröffentlichung kommt es nicht. In einem beiliegenden Schreiben wird Böll mitgeteilt, dass die Verlagslektoren „zwar ein menschliches Dokument und künstlerische Gestaltung“ erkennen und darüber hinaus auch einräumen, dass Böll „über dichterische Möglichkeiten verfüge[]“, doch wird auch klargestellt, dass die „Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu wenig in Erscheinung“ trete und „eine starke Schwarz-weiß-Schilderung“12der deutschen Armee gezeichnet würde.
Das Ablehnen des Manuskriptes durch den Verlag ist sicherlich der Haupt-grund für dessen Nichtveröffentlichung. Dass Böll aber offensichtlich jedes weitere Bemühen um eine Publikation des Romans unterlässt, ist ein Beleg für die schlechte wirtschaftliche Situation in Deutschland, der auch gerade ein junger Autor wie Böll unterlag:
Neben der ungünstigen Wirtschaftslage - es gab kaum Papier - war es vor allen Dingen die Spaltung Deutschlands in vier Besatzungszonen, die den Buchhandel traf.13
12Zit. nach Böll, Viktor [u.a.]: Heinrich Böll. Hg. v. Martin Sulzer-Reichel. München 2002. S. 50.
13Widmer, Urs: 1945 oder die „Neue Sprache“. Studien zur Prosa der „Jungen Generation. Düs- seldorf 1966. S.22.
Page 12
3. „Kreuz ohne Liebe“: Der erste Roman Heinrich Bölls 11
Zudem war Heinrich Böll als Autor noch unbekannt und seine Heimatstadt Köln galt darüber hinaus im literarischen Bereich als „tiefste Provinz.“14Die Veröffentlichung eines längeren Prosatextes erwies sich also als äußerst schwierig. So waren es dann vor allem Kurzgeschichten, die in Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt werden konnten, die Heinrich Böll nach und nach ins Bewusstsein der Öffentlichkeit brachten.
Warum er den Roman dann auch später nicht mehr hat drucken lassen, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich war ihm die Distanz zu seinem Werk nach einigen Jahren zu groß geworden und es traten andere Texte in den Vordergrund, die Böll wohl zum jeweiligen Zeitpunkt wichtiger und aktueller erschienen. Außerdem räumte er in einem Antwortschreiben an den Johann Wilhelm Naumann Verlag vom 10. Juni 1948 ein: „Dem Urteil Ihres Kollegiums unterwerfe ich mich vollkommen, soweit es die künstlerische[…]Beurteilung meiner Arbeit belangt.“15Heinrich Böll war sich also seiner „Anfängerstellung“ im literarischen Sinne bewusst. In einem Interview von 1977, in dem Böll in Bezug auf seine früheren Werke sagt, er „habe so ungeheure Mengen pathetisch-geschwätzigen Kram geschrieben“16wird noch mal deutlich, dass er selber sehr kritisch mit seinen Texten umgegangen ist und von diesen auch nicht immer überzeugt war.