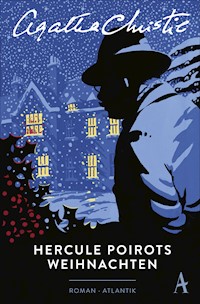
9,99 €
Mehr erfahren.
Simeon Lee ist ein richtiger Familien-Tyrann. Umso überraschender ist es, dass er seine gesamte Verwandtschaft an Weihnachten zu sich einlädt. Doch wie immer beginnt er sofort damit, alle zu beleidigen und zu provozieren - und wird schon bald tot aufgefunden. Wer aber hat ihm die Kehle durchgeschnitten? Als Hercule Poirot zur Hilfe gerufen wird, muss er erkennen, dass jedes der Familienmitglieder genügend Gründe hatte, den alten Mann zu hassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Agatha Christie
Hercule Poirots Weihnachten
Roman
Aus dem Englischen von Michael Mundhenk
Atlantik
Mein lieber James,
Du bist immer einer meiner treuesten und wohlwollendsten Leser gewesen, weshalb ich ernstlich verstört war, als ich ein kritisches Wort von Dir hörte.
Du hast Dich beschwert, meine Morde seien mittlerweile zu raffiniert, regelrecht anämisch. Du würdest Dich nach einem »guten brutalen Mord mit viel Blut« sehnen. Einem Mord, bei dem kein Zweifel daran bestehe, dass es sich um einen Mord handelt!
Hier ist sie also, Deine Geschichte – extra für Dich geschrieben. Ich hoffe, sie gefällt Dir.
Deine Dich liebende Schwägerin
Agatha
Teil 122. Dezember
I
Stephen schlug den Mantelkragen hoch, während er eilig den Bahnsteig entlangging. Dichter Nebel hing über dem Bahnhof. Schwere, laut fauchende Lokomotiven stießen Rauchwolken in die kalte, raue Luft. Alles war schmutzig und verrußt.
Was für ein scheußliches Land, was für eine scheußliche Stadt!, dachte Stephen mit Widerwillen.
Seine erste Begeisterung über London und seine Geschäfte, seine Restaurants, seine gut gekleideten, attraktiven Frauen war abgeflaut. Mittlerweile glich die Stadt für ihn nur noch einem glitzernden Strassstein in einer schäbigen Fassung.
Wenn er jetzt in Südafrika wäre … Plötzlich verspürte er heftiges Heimweh: Sonnenschein, blauer Himmel, Gärten voller Blumen, kühl-blaue Blüten, Bleiwurzhecken, blaue Winden, die sich an jeder kleinen Baracke emporranken.
Und hier: Schmutz, Ruß und ständige, endlose Menschenmassen – ein einziges Gehetze, Geschiebe und Gedränge. Emsige Ameisen, die geschäftig in ihrem Ameisenhaufen umherwuseln.
Einen Augenblick dachte er: Wäre ich bloß nie hergekommen …
Doch dann fiel ihm ein, weshalb er hier war, und grimmig entschlossen presste er die Lippen zusammen. Nein, zum Teufel, er würde weitermachen! Er hatte es jahrelang geplant. Hatte das, was er jetzt vorhatte, schon immer tun wollen. Ja, er würde weitermachen!
Dieses kurze Zögern, dieser plötzliche Selbstzweifel: Warum? Ist es das wert? Warum ständig auf der Vergangenheit herumreiten? Warum nicht die ganze Sache aus der Erinnerung löschen? Nichts als Schwäche. Schließlich war er kein kleiner Junge mehr, der sich von der Stimmung des Augenblicks treiben ließ. Er war ein Mann von vierzig Jahren, selbstsicher und zielstrebig. Er würde auf jeden Fall weitermachen. Er würde das tun, um dessentwillen er nach England gekommen war.
Er stieg in den Zug, ging den Gang entlang und suchte sich einen Platz. Den Gepäckträger hatte er abblitzen lassen und trug seinen Lederkoffer selbst. Er sah in jedes Abteil hinein. Der Zug war voll. Es waren nur noch drei Tage bis Weihnachten. Angewidert blickte Stephen Farr auf die dichtbesetzten Abteile.
Menschen! Überall unzählige Menschen! Und alle sehen so, so – was wäre das richtige Wort dafür? –, so trist aus! So gleich, so furchtbar gleich! Die, die kein Schafsgesicht haben, haben Hasenzähne, dachte er. Manche schnattern und jammern. Andere, Männer in gesetztem Alter, grunzen, erinnern an Schweine. Sogar die Mädchen, schlank, eierköpfig, rotlippig, sehen sich alle bedrückend ähnlich.
Voller Sehnsucht dachte er an das offene Feld, das ausgedorrte, einsame Grasland …
Als er in das nächste Abteil blickte, hielt er jäh den Atem an. Dieses Mädchen war anders. Schwarze Haare, sahneweiße Haut, Augen, in denen die Tiefe und Dunkelheit der Nacht lagen. Die traurigen, stolzen Augen des Südens … Es war aberwitzig, dass dieses Mädchen hier in diesem Zug unter all diesen öden, tristen Menschen saß, absolut aberwitzig, dass sie in die trostlosen Midlands fuhr. Auf einem Balkon müsste sie sitzen, eine Rose zwischen den Lippen, ein Tuch aus schwarzer Spitze um den stolzen Kopf geschlungen, und Staub und Hitze und der Geruch von Blut müssten in der Luft liegen, der Geruch einer Stierkampfarena … Sie müsste irgendwo sein, wo es wunderschön war, statt eingezwängt in der Ecke eines Dritte-Klasse-Abteils zu hocken.
Er war ein aufmerksamer Beobachter. Ihm entgingen weder die Schäbigkeit ihres kleinen schwarzen Mantels und Rocks noch die minderwertige Qualität ihrer Stoffhandschuhe, ihre dünnen Schuhe oder die freche Note ihrer feuerroten Handtasche. Trotzdem empfand er sie als wunderschön. Sie war wunderschön, elegant, exotisch …
Was zum Teufel wollte sie hier in diesem Land des Nebels und der Kälte und der emsig umherwuselnden Ameisen?
Ich muss herausfinden, wer sie ist und was sie hier will, dachte er. Ich muss es unbedingt herausfinden …
II
Pilar saß in die Fensterecke gedrängt und dachte darüber nach, wie eigenartig die Engländer doch rochen … Das war ihr in England bisher am meisten aufgefallen: dieser andere Geruch. Weder nach Knoblauch noch nach Staub und kaum je nach Parfüm. In dem Abteil herrschte eine kühle Muffigkeit – der Schwefelgeruch der Züge, ein Hauch von Seifenduft sowie ein anderer, äußerst unangenehmer Geruch, der aus dem Pelzkragen ihrer fülligen Nachbarin aufzusteigen schien. Verstohlen schnuppernd, atmete Pilar widerwillig den Mief von Mottenkugeln ein. Wie kann man sich nur mit einem solch seltsamen Duft umgeben?, dachte sie.
Ein Pfiff, ein durchdringender Ruf, und der Zug ruckelte aus dem Bahnhof. Die Fahrt hatte begonnen. Jetzt war sie also unterwegs …
Ihr Herz schlug ein wenig schneller. Würde es gut gehen? Würde sie erreichen, was sie sich vorgenommen hatte? Sicher, ganz sicher, sie hatte doch alles so gründlich durchdacht … Sie war auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet. O ja, sie würde es schaffen, sie musste es schaffen …
Pilars geschwungene rote Lippen verkrampften sich. Plötzlich wirkte ihr Mund grausam. Grausam und gierig, wie der Mund eines Kindes oder eines Kätzchens, ein Mund, der nur seine eigenen Begierden kannte und von Mitleid noch nichts wusste.
Mit der offenen Neugier eines Kindes blickte sie um sich. Diese Leute, alle sieben – wie eigenartig die Engländer doch waren! Sie wirkten alle so reich, so wohlhabend in ihren Kleidern, ihren Stiefeln. Ja, England war zweifellos ein sehr reiches Land, genau, wie sie es immer gehört hatte. Aber fröhlich, das waren sie ganz und gar nicht, nein, auf keinen Fall fröhlich.
Der Mann im Gang allerdings war schön … Ausgesprochen schön, fand Pilar. Ihr gefielen sein tiefbraunes Gesicht, seine scharfgeschnittene Nase und seine breiten Schultern. Schneller als jede junge Engländerin hatte Pilar die bewundernden Blicke des Mannes bemerkt. Obwohl sie ihn kein einziges Mal direkt angesehen hatte, wusste sie ganz genau, wie oft und wie gründlich er sie taxiert hatte.
Sie nahm es ohne großes Interesse oder irgendeine Regung zur Kenntnis. Pilar kam aus einem Land, wo es für Männer völlig normal war, Frauen relativ unverhohlen anzustarren. Sie überlegte, ob er Engländer sei, hielt es allerdings für unwahrscheinlich.
Für einen Engländer ist er zu lebendig, zu natürlich, entschied Pilar. Andererseits ist er blond. Vielleicht ist er ein Americano. Eigentlich, fand sie, sah er aus wie die Schauspieler, die sie aus Wildwestfilmen kannte.
Der Speisewagenschaffner bahnte sich einen Weg durch den Gang.
»Erstes Mittagessen, erstes Mittagessen. Bitte Platz nehmen zum ersten Mittagessen.«
Alle sieben anderen Abteilinsassen hatten Karten für das erste Mittagessen. Geschlossen erhoben sie sich, und plötzlich war es um Pilar herum völlig leer und still.
Schnell schob sie das Fenster hoch, das die militant wirkende grauhaarige Dame aus der gegenüberliegenden Ecke mehrere Zentimeter heruntergelassen hatte. Dann streckte sie sich bequem auf ihrem Platz aus, sah aus dem Fenster und ließ die nördlichen Vororte Londons an sich vorüberziehen. Als die Abteiltür aufgeschoben wurde, wandte sie nicht einmal den Kopf. Es war der Mann aus dem Gang, und Pilar wusste, dass er hereingekommen war, um sie anzusprechen.
Sie starrte weiterhin gedankenverloren aus dem Fenster.
»Hätten Sie das Fenster gern ein klein wenig offen?«, fragte Stephen Farr.
»Im Gegenteil. Ich habe es gerade zugemacht«, erwiderte Pilar reserviert.
Sie sprach perfektes Englisch, allerdings mit einem leichten Akzent.
Während des Schweigens, das nun eintrat, dachte Stephen: Eine himmlische Stimme. In ihr liegt die Sonne … die Wärme einer Sommernacht …
Pilar dachte: Ich mag seine Stimme. Sie ist kraftvoll und fest. Er ist attraktiv, ja, er ist wirklich attraktiv.
»Der Zug ist komplett voll«, sagte Stephen.
»O ja, allerdings. Wahrscheinlich fahren die Leute aus London weg, weil es dort so düster ist.«
Pilar war nicht in dem Glauben erzogen worden, dass es ein Verbrechen sei, sich in einem Zug mit fremden Männern zu unterhalten. Sie konnte genauso gut auf sich aufpassen wie jede andere junge Frau auch, kannte jedoch keine strikten Tabus.
Wäre Stephen in England aufgewachsen, hätte er sich möglicherweise nicht wohl dabei gefühlt, mit einem jungen Mädchen eine Unterhaltung zu beginnen. Doch er war ein herzensguter Mensch, der es absolut natürlich fand, mit jedem zu reden, mit dem er reden wollte.
Er lächelte unbefangen und sagte:
»London ist wirklich ziemlich schrecklich, was?«
»Allerdings. Mir gefällt es dort überhaupt nicht.«
»Mir auch nicht.«
»Sie sind kein Engländer, oder?«, fragte Pilar.
»Ich bin Brite, komme aber aus Südafrika.«
»Ach so, das erklärt einiges.«
»Kommen Sie auch gerade aus dem Ausland?«
Pilar nickte. »Ich komme aus Spanien.«
Stephen war fasziniert.
»Aus Spanien, ja? Dann sind Sie also Spanierin?«
»Zur Hälfte. Meine Mutter war Engländerin. Deshalb kann ich so gut Englisch.«
»Und wie ist es mit dem Krieg dort?«, fragte Stephen.
»Ja, das ist wirklich schrecklich, sehr, sehr traurig. Es ist einiges zerstört worden, eine ganze Menge sogar, doch.«
»Und auf welcher Seite stehen Sie?«
Pilars politische Ansichten klangen recht vage. In ihrem Dorf, erklärte sie, habe sich niemand groß um den Krieg geschert: »Er findet ja nicht vor unserer Haustür statt, verstehen Sie. Der Bürgermeister, der ist natürlich ein Regierungsbeamter, also ist er für die Regierung, und der Priester ist für General Franco – aber die meisten Leute sind in ihren Weinbergen und auf ihren Feldern zugange, die haben gar keine Zeit, sich mit solchen Fragen zu befassen.«
»Es ist also um Sie herum überhaupt nicht gekämpft worden?«
»So ist es«, erwiderte Pilar. »Aber dann bin ich im Auto durchs ganze Land gefahren, und da gab es große Zerstörungen. Und ich sah eine Bombe fallen und ein Auto explodieren, ja, und eine andere zerstörte ein Haus. Es war alles sehr aufregend!«
Stephen Farr setzte ein leicht schiefes Lächeln auf.
»Sie fanden es aufregend?«
»Gleichzeitig aber auch sehr lästig«, erklärte Pilar. »Denn ich wollte weiter, und plötzlich war mein Chauffeur tot.«
»Und das hat Sie nicht erschüttert?«, fragte Stephen, den Blick auf sie geheftet.
Pilars große dunkle Augen weiteten sich.
»Jeder muss einmal sterben! Das ist doch so, oder? Wenn der Tod blitzschnell vom Himmel fällt – bums, einfach so –, dann ist das genauso gut wie jede andere Art zu sterben. Man lebt eine Zeit lang, ja, und dann ist man tot. So ist es doch auf dieser Welt.«
Stephen Farr lachte.
»Pazifistin sind Sie also nicht.«
»Was bin ich nicht?« Pilar wirkte verwirrt von diesem Begriff, der es noch nicht in ihr Vokabular geschafft hatte.
»Vergeben Sie Ihren Feinden, Señorita?«
Pilar schüttelte den Kopf.
»Ich habe keine Feinde. Aber wenn ich einen hätte …«
»Ja?«
Er beobachtete sie, erneut gefesselt von ihren süßen, grausam verzogenen Lippen.
»Wenn ich einen Feind hätte«, sagte Pilar ernst, »wenn mich jemand hassen und ich ihn zurückhassen würde, dann würde ich meinem Feind die Kehle durchschneiden, und zwar so …«
Sie machte eine eindeutige Handbewegung.
Es war eine derart schnelle und brutale Geste, dass Stephen Farr für einen Moment die Fassung verlor.
»Sie sind eine blutrünstige junge Frau!«, sagte er.
»Was würden Sie denn mit Ihrem Feind machen?«, fragte Pilar ihn in ausgesprochen sachlichem Ton.
Er zuckte zusammen, starrte sie an und lachte laut auf.
»Ich weiß nicht …«, sagte er. »Ich weiß es wirklich nicht!«
»Aber, das müssen Sie doch wissen«, erwiderte Pilar missbilligend.
Er unterdrückte sein Lachen, holte tief Atem und sagte leise:
»Ja. Ich weiß …«
Dann fragte er sie unvermittelt:
»Was führt Sie denn nach England?«
»Ich besuche meine Verwandten, meine englischen Verwandten«, antwortete Pilar mit einer gewissen Reserviertheit.
»Aha.«
Er lehnte sich auf seinem Sitz zurück und musterte sie, überlegte sich, was das wohl für englische Verwandte waren und was sie von dieser exotischen Spanierin halten würden, versuchte, sie sich zu Weihnachten inmitten einer stocknüchternen britischen Familie vorzustellen.
»Südafrika ist schön, ja?«, fragte Pilar.
Er begann ihr von Südafrika zu erzählen. Sie hörte ihm mit der freudigen Aufmerksamkeit eines Kindes zu, das eine Geschichte erzählt bekommt. Ihm gefielen ihre simplen, aber cleveren Fragen, und er machte sich einen Spaß daraus, etwas zu übertreiben und eine Art Märchen zum Besten zu geben.
Die Rückkehr der rechtmäßigen Platzinhaber setzte diesem Zeitvertreib ein Ende. Er erhob sich, sah ihr lächelnd in die Augen und begab sich wieder hinaus auf den Gang.
Als er an der Tür kurz zur Seite trat, um eine ältere Dame vorbeizulassen, fiel sein Blick auf das Schild an Pilars exotischem Strohkoffer. Voller Interesse las er ihren Namen: Miss Pilar Estravados; als sein Blick jedoch auf die Adresse fiel – Gorston Hall, Longdale, Addlesfield –, weiteten sich seine Augen vor Unglauben, gepaart mit anderen Gefühlsregungen.
Er wandte sich halb um und starrte das Mädchen jetzt mit einem völlig anderen Gesichtsausdruck an: verblüfft, unwillig, misstrauisch. Dann stellte er sich in den Gang, rauchte eine Zigarette und runzelte die Stirn …
III
In dem großen, in Blau und Gold gehaltenen Salon von Gorston Hall saßen Alfred Lee und seine Frau Lydia und besprachen ihre Pläne für Weihnachten. Alfred war ein stämmiger Mann mittleren Alters mit einem freundlichen Gesicht und sanften braunen Augen. Seine Stimme war ruhig, präzise und klar akzentuiert. Der Kopf war ihm zwischen die Schultern gesunken, wodurch er seltsam lethargisch wirkte. Lydia dagegen war eine energiegeladene, schlanke Windhündin von einer Frau. Sie war erstaunlich feingliedrig, bewegte sich jedoch mit einer flinken, verschreckten Anmut.
Schön war ihr gleichgültiges, hageres Gesicht nicht, aber es wirkte distinguiert. Ihre Stimme war bezaubernd.
»Vater besteht darauf!«, sagte Alfred. »Da kann man nichts machen.«
Lydia wollte aufbrausen, beherrschte sich jedoch und erwiderte:
»Musst du ihm denn immer nachgeben?«
»Liebes, er ist ein sehr alter Mann …«
»Ja, ich weiß, ich weiß!«
»Er erwartet einfach, dass er seinen Willen bekommt.«
»Natürlich, weil er ihn bisher immer bekommen hat!«, sagte Lydia trocken. »Aber irgendwann, Alfred, wirst du ihm einmal Paroli bieten müssen.«
»Was willst du damit sagen, Lydia?«
Er starrte sie derart bestürzt und erschrocken an, dass sie sich auf die Lippen biss und unsicher schien, ob sie weiterreden sollte.
»Was willst du damit sagen, Lydia?«, wiederholte Alfred.
Sie zuckte die schlanken, anmutigen Schultern.
Ihre Worte sorgfältig wählend, sagte sie:
»Dein Vater – neigt zur – Tyrannei …«
»Er ist alt.«
»Und wird immer älter. Und daher immer tyrannischer. Wo soll das enden? Er schreibt uns jetzt schon ständig vor, wie wir zu leben haben. Wir können überhaupt keine eigenen Pläne machen! Und wenn wir es doch einmal tun, werden sie garantiert durchkreuzt.«
»Vater erwartet einfach, immer an erster Stelle zu stehen. Er ist sehr gut zu uns, vergiss das nicht.«
»Oh! Gut zu uns!«
»Sehr gut zu uns.«
In Alfreds Stimme schwang eine Spur von Strenge.
»Du meinst finanziell?«, fragte Lydia ruhig.
»Ja. Er selbst hat ja keine großen Ansprüche. Aber er hat es uns noch nie übel genommen, dass wir sein Geld ausgeben. Du kannst dir Kleidung und Hausrat anschaffen, so viel du willst, und die Rechnungen werden anstandslos beglichen. Erst letzte Woche hat er uns ein neues Auto geschenkt.«
»Was Geld angeht, ist dein Vater sehr großzügig, das gebe ich zu«, sagte Lydia. »Aber im Gegenzug erwartet er von uns, dass wir uns wie Sklaven verhalten.«
»Wie Sklaven?«
»Genau dieses Wort habe ich gerade benutzt. Du bist wirklich sein Sklave, Alfred. Wenn wir die Absicht haben, irgendwohin zu fahren und Vater plötzlich wünscht, dass wir zu Hause bleiben, sagst du sofort, ohne zu murren, alles ab und bleibst hier! Wenn er plötzlich auf die Idee kommt, uns wegzuschicken, verschwinden wir … Wir haben überhaupt kein eigenes Leben, keine Unabhängigkeit.«
»Ich wünschte, du würdest nicht so reden, Lydia«, erwiderte ihr Mann bedrückt. »Das ist äußerst undankbar. Mein Vater hat alles für uns getan …«
Sie verbiss sich die Entgegnung, die sie bereits auf den Lippen hatte. Wieder zuckte sie die Schultern.
»Weißt du, Lydia«, sagte Alfred, »der alte Herr mag dich sehr gern …«
Die Reaktion seiner Frau war klar und deutlich:
»Ich mag ihn überhaupt nicht.«
»Lydia, es betrübt mich, wenn ich dich so reden höre. Es klingt so lieblos …«
»Vielleicht. Aber manchmal verspürt man einfach den Drang, die Wahrheit zu sagen.«
»Wenn Vater das ahnen würde …«
»Dein Vater weiß ganz genau, dass ich ihn nicht mag! Ich glaube sogar, es amüsiert ihn.«
»Lydia, da täuschst du dich. Er hat mir oft gesagt, wie charmant er dich findet.«
»Ich bin natürlich auch immer höflich gewesen. Und das bleibe ich auch. Ich möchte dir nur sagen, was ich wirklich fühle. Ich kann deinen Vater nicht ausstehen, Alfred. Für mich ist er ein boshafter, tyrannischer Greis. Er schubst dich herum und nutzt deine Zuneigung zu ihm aus. Du hättest ihm schon vor Jahren die Stirn bieten sollen.«
»Das reicht, Lydia«, erwiderte Alfred scharf. »Bitte schweig jetzt.«
Sie seufzte.
»Verzeih. Vielleicht war es verkehrt von mir … Reden wir lieber über unsere Weihnachtspläne. Meinst du, dein Bruder David kommt wirklich?«
»Warum nicht?«
Zweifelnd wiegte sie den Kopf.
»David ist – komisch. Vergiss nicht, er ist schon seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Er hat sehr an eurer Mutter gehangen – da hat er, was dieses Haus anbelangt, natürlich ziemlich starke Gefühle.«
»David ging Vater ständig auf die Nerven«, sagte Alfred, »mit seiner Musik und seinem verträumten Wesen. Vielleicht war Vater ein bisschen zu streng zu ihm. Aber ich glaube, David und Hilda kommen trotzdem. Ist ja schließlich Weihnachten, verstehst du.«
»Friede und Wohlgefallen«, sagte Lydia. Ironisch verzog sie ihren schönen Mund. »Mal sehen! George und Magdalene kommen auf jeden Fall. Sie meinten, sie würden wahrscheinlich morgen eintreffen. Ich fürchte, Magdalene wird sich schrecklich langweilen.«
Alfred erwiderte mit leichtem Ärger in der Stimme:
»Warum mein Bruder ein Mädchen heiraten musste, das zwanzig Jahre jünger ist als er, wird mir ewig ein Rätsel bleiben! George war schon immer ein Narr!«
»Beruflich ist er sehr erfolgreich«, entgegnete Lydia. »Die Leute in seinem Wahlbezirk mögen ihn. Ich glaube, Magdalene investiert eine Menge harter Arbeit in seine politische Karriere.«
»Irgendwie mag ich sie nicht besonders«, sagte Alfred langsam. »Sie sieht phantastisch aus, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie hat zwar wunderschöne Apfelbäckchen, aber gleichzeitig diesen seltsam wächsernen Schimmer …« Er schüttelte den Kopf.
»Und innen ist sie faul?«, fragte Lydia. »Komisch, dass gerade du das sagst, Alfred!«
»Wieso?«
»Weil du normalerweise solch eine gutmütige Seele bist. So abfällig äußerst du dich eigentlich kaum je über jemanden. Manchmal regt es mich geradezu auf, dass du nicht, wie soll ich sagen, nicht misstrauisch genug bist, nicht welterfahren genug!«
Ihr Mann lächelte.
»Die Welt, finde ich, ist immer so, wie man sie sich selbst zurechtlegt.«
»Nein! Das Böse lebt nicht nur in unserer Vorstellung. Es existiert tatsächlich! Dir scheint das Böse in der Welt nicht bewusst zu sein. Mir schon. Ich spüre es. Ich habe es immer gespürt, gerade hier in diesem Haus …« Sie biss sich auf die Lippen und wandte sich ab.
»Lydia …«
Doch plötzlich hob sie warnend die Hand, während ihr Blick an ihm vorbei über seine Schulter glitt. Alfred wandte sich um.
In ehrerbietiger Haltung stand dort ein dunkelhaariger Mann mit glattem Gesicht.
»Was gibt’s, Horbury?«, fragte Lydia scharf.
Horburys Stimme war leise, lediglich ein respektvolles Murmeln.
»Eine Nachricht von Mr Lee, Madam. Er trug mir auf, Ihnen mitzuteilen, dass noch zwei weitere Weihnachtsgäste kommen werden, und Sie zu bitten, Zimmer für sie richten zu lassen.«
»Zwei weitere Gäste?«
»Jawohl, Madam, ein Gentleman sowie eine junge Lady«, antwortete Horbury geschmeidig.
»Eine junge Lady?«, fragte Alfred verwundert.
»So hat es Mr Lee ausgedrückt, Sir.«
»Ich gehe hoch und rede mit ihm«, sagte Lydia schnell.
Horbury machte einen winzigen Schritt nach vorn, nur den Hauch einer Bewegung, doch er genügte, Lydia innehalten zu lassen.
»Entschuldigen Sie, Madam, aber Mr Lee hält gerade seinen Mittagsschlaf. Er bat ausdrücklich darum, nicht gestört zu werden.«
»Aha«, sagte Alfred. »Selbstverständlich werden wir ihn nicht stören.«
»Vielen Dank, Sir.« Horbury zog sich zurück.
Lydia brauste auf:
»Wie ich diesen Kerl hasse! Wie eine Katze schleicht er durchs Haus! Man hört ihn weder kommen noch gehen.«
»Mir ist er auch nicht besonders sympathisch. Aber er versteht seine Arbeit. Es ist nicht einfach, einen guten Kammerdiener und Pfleger zu finden. Und Vater mag ihn, das ist die Hauptsache.«
»Ja, das ist, wie du sagst, die Hauptsache. Alfred, was ist das für eine junge Lady? Wer ist das?«
Ihr Mann schüttelte den Kopf.
»Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer es sein könnte.«
Sie starrten sich an. Dann verzog Lydia plötzlich ihren ausdrucksvollen Mund und sagte:
»Weißt du, was ich glaube, Alfred?«
»Was?«
»Ich glaube, dein Vater langweilt sich in letzter Zeit. Ich glaube, er hat vor, über Weihnachten für etwas Abwechslung zu sorgen.«
»Indem er zwei Fremde zu unserem Familientreffen einlädt?«
»Ach, die Einzelheiten kenne ich auch nicht, aber ich vermute, dein Vater hat es darauf abgesehen, sich zu – amüsieren.«
»Ich hoffe, dass er dann auch wirklich seinen Spaß hat«, erwiderte Alfred ernst. »Armer Kerl, so gut wie an den Sessel gefesselt, ein Invalide, und das nach dem abenteuerlichen Leben, das er geführt hat.«
»Nach dem – abenteuerlichen Leben, das er geführt hat«, wiederholte Lydia langsam.
Ihre Pause vor dem Adjektiv verlieh diesem eine besondere, düstere Bedeutung. Alfred schien es zu spüren. Er errötete und wirkte bedrückt.
Plötzlich rief sie aus:
»Wie er jemals einen Sohn wie dich bekommen konnte, ist mir schleierhaft! Ihr beide seid doch wie Tag und Nacht. Aber er fasziniert dich, du betest ihn regelrecht an.«
Mit einer Spur von Verärgerung entgegnete Alfred:
»Gehst du jetzt nicht ein bisschen zu weit, Lydia? Es ist doch wohl ganz natürlich, dass ein Sohn seinen Vater liebt. Wenn er es nicht täte, wäre das höchst widernatürlich.«
»In dem Fall wären die meisten Mitglieder dieser Familie – widernatürlich! Ach, lass uns nicht streiten! Verzeih mir. Ich weiß, ich habe deine Gefühle verletzt. Glaub mir, Alfred, das wollte ich wirklich nicht. Ich bewundere dich ungemein für deine, deine – Treue. Loyalität ist heutzutage so selten. Sagen wir, ich bin eifersüchtig, in Ordnung? Frauen sind ja angeblich immer eifersüchtig auf ihre Schwiegermütter – warum also nicht auch mal auf ihre Schwiegerväter?«
Sanft legte er einen Arm um sie.
»Manchmal solltest du deine Zunge im Zaum halten, Lydia. Du hast überhaupt keinen Grund zur Eifersucht.«
Rasch drückte sie ihm einen reumütigen Kuss aufs Ohrläppchen, eine zärtliche Liebkosung.
»Ich weiß. Trotzdem, Alfred, ich glaube, auf deine Mutter wäre ich nie auch nur im Entferntesten eifersüchtig gewesen. Ich wünschte, ich hätte sie gekannt.«
»Sie war eine arme Kreatur«, sagte er.
Seine Frau sah ihn neugierig an.
»So hast du sie also wahrgenommen – als eine arme Kreatur. Das ist ja interessant.«
Versonnen antwortete er:
»Eigentlich habe ich sie nur krank in Erinnerung. Oft mit Tränen in den Augen …« Er schüttelte den Kopf. »Sie hatte kein Feuer.«
»Wie seltsam …«, murmelte Lydia, ihn noch immer anstarrend, leise vor sich hin.
Doch als er ihr einen fragenden Blick zuwarf, schüttelte sie den Kopf und wechselte schnell das Thema.
»Da wir nicht erfahren sollen, wer unsere geheimnisvollen Gäste sein werden, gehe ich jetzt nach draußen und mache meinen Garten fertig.«
»Es ist sehr kalt, Liebes, ein schneidender Wind.«
»Ich packe mich warm ein.«
Sie ging hinaus. Alfred Lee, nun allein im Zimmer, runzelte leicht die Stirn und blieb eine Weile regungslos stehen, ehe er an das große Fenster am hinteren Ende des Raumes trat. Entlang der gesamten Längsseite des Gebäudes erstreckte sich eine Terrasse. Dort tauchte nach wenigen Minuten Lydia auf, einen flachen Korb im Arm und in einen dicken Wollmantel gehüllt. Sie stellte den Korb ab und machte sich an einem quadratischen, leicht erhöhten Steinbecken zu schaffen.
Ihr Mann beobachtete sie ein Weilchen. Schließlich verließ er das Zimmer, holte sich Mantel und Schal und trat durch eine Seitentür auf die Terrasse. Auf dem Weg zu Lydia kam er an mehreren anderen Steinbecken vorbei, alles Miniaturgärten, die sie mit ihren geschickten Fingern angelegt hatte.
Einer stellte eine Wüstenlandschaft dar, mit feinem gelbem Sand, einer kleinen Palmengruppe aus grünem Blech und einer Kamelkarawane mit ein oder zwei winzigen Araberfiguren. Daneben standen ein paar primitive Lehmhütten aus Knete. Dann gab es einen italienischen Garten mit Terrassen und formal gestalteten Beeten voller Blumen aus farbigem Siegelwachs. Als Nächstes kam eine Polarlandschaft mit Eisbergen aus grünen Glasscherben und einer kleinen Gruppe Pinguine. Und es gab auch noch einen japanischen Garten mit zwei wunderschönen verkrüppelten Bäumchen, kleinen Gewässern aus Spiegelglas und aus Knete modellierten Brücken.
Schließlich stand er neben ihr und sah ihr bei der Arbeit zu. Sie hatte ein Stück blaues Papier genommen und mit Glas abgedeckt. Darum herum waren Steinbrocken aufgehäuft. Gerade schüttete sie aus einem kleinen Beutel Kieselsteine dazu und legte einen Strand an. Zwischen den Felsen standen kleine Kakteen.
»Ja, genau so soll es sein, ganz genau so«, murmelte Lydia vor sich hin.
»Und was stellt dein neuestes Kunstwerk dar?«, fragte Alfred.
Sie fuhr zusammen, denn sie hatte ihn nicht kommen hören.
»Das? Oh, das ist das Tote Meer, Alfred. Gefällt es dir?«
»Sieht ganz schön öde aus. Müsste die Vegetation nicht etwas üppiger sein?«
Sie schüttelte den Kopf.
»So stelle ich mir das Tote Meer vor. Es ist tot, verstehst du …«
»Es ist aber nicht so schön wie manche deiner anderen Landschaften.«
»Es soll auch gar nicht besonders schön sein.«
Auf der Terrasse erklangen Schritte. Ein älterer, weißhaariger Butler kam leicht gebeugt auf sie zu.
»Mrs George Lee ist am Telefon, Madam. Sie lässt fragen, ob es Ihnen genehm wäre, wenn sie und Mr George morgen mit dem Zug um 17 Uhr 20 einträfen.«
»Ja, sagen Sie ihr, das sei uns recht.«
»Danke, Madam.«
Der Butler eilte davon. Lydia sah ihm nach, und ihr Gesicht bekam einen sanften Ausdruck.
»Der gute alte Tressilian. Was für eine Stütze er uns doch ist! Ich weiß gar nicht, was wir ohne ihn täten.«
Alfred stimmte ihr zu.
»Er ist noch von der alten Schule. Fast vierzig Jahre ist er schon bei uns. Er ist uns allen blind ergeben.«
Lydia nickte.
»Ja. Er ist wie ein treues altes Faktotum aus einem Roman. Ich glaube, er würde das Blaue vom Himmel herunterlügen, um jemanden aus der Familie zu schützen!«
»Das glaube ich auch … Ja, das glaube ich auch«, sagte Alfred.
Lydia strich das letzte Stück ihres Kieselstrands glatt.
»So«, sagte sie. »Das wäre hergerichtet.«
»Hergerichtet?« Alfred machte ein verdutztes Gesicht.
Sie lachte.
»Für Weihnachten, du Dummerchen! Für diese sentimentale Familienfeier, die vor der Tür steht.«
IV
David las den Brief. Dann knüllte er ihn zusammen und warf ihn beiseite. Schließlich holte er sich das Knäuel zurück, glättete es und las die Zeilen noch einmal.
Seine Frau Hilda beobachtete ihn wortlos. Sie sah den zuckenden Muskel (oder war es ein Nerv?) an seiner Schläfe, das leichte Zittern der feinen, langen Hände, die nervösen Zuckungen seines ganzen Körpers. Als er die blonde Locke, die ihm ständig in die Stirn fiel, zur Seite strich und Hilda mit seinen hübschen blauen Augen ansah, war sie bereit.
»Hilda, was sollen wir tun?«
Hilda zögerte einen Augenblick, ehe sie antwortete. Sie hatte das Flehen in seiner Stimme gehört. Sie wusste, wie abhängig er – eigentlich schon immer, seit ihrer Hochzeit – von ihr war, wusste, dass sie seine Entscheidung höchstwahrscheinlich maßgeblich und unwiderruflich beeinflussen konnte. Doch genau aus diesem Grund hatte sie Skrupel, irgendetwas Endgültiges zu sagen.
Mit einer Stimme, die so sanft und beruhigend klang wie die einer erfahrenen Kindergärtnerin, sagte sie:
»Das kommt darauf an, was du von der Idee hältst, David.«
Hilda war eine stattliche Person, nicht schön, aber auf gewisse Weise doch anziehend. Irgendwie erinnerte sie an eine Frau auf einem niederländischen Gemälde. Irgendwie hatte ihre Stimme etwas Warmes, Einnehmendes. Irgendwie wirkte Hilda stark, verfügte über eine verborgene Vitalität, die schwache Menschen anzieht. Eine gut gepolsterte, pummelige Frau mittleren Alters, weder clever noch intelligent, aber irgendwie hatte sie etwas, was man nicht ignorieren konnte. Kraft! Hilda Lee besaß eine innere Kraft!
David erhob sich und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Sein Haar zeigte praktisch noch keinen grauen Schimmer. Er wirkte sonderbar knabenhaft. Sein Gesicht hatte die milden Züge eines Ritters in einem Burne-Jones-Gemälde. Es erschien ein wenig unwirklich …
»Du weißt, was ich davon halte, Hilda. Das musst du doch wissen«, sagte er mit schwermütiger Stimme.
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Aber ich habe es dir doch gesagt, immer und immer wieder! Wie ich das alles hasse, das Haus und die Landschaft und alles! Das weckt nichts als schmerzliche Erinnerungen in mir. Jeden Augenblick, den ich dort verbrachte, habe ich gehasst! Wenn ich daran denke, wie sehr sie dort gelitten hat, meine Mutter …«
Seine Frau nickte mitfühlend.
»Sie war so lieb, Hilda, und so geduldig. Wie sie, oft mit Schmerzen, dalag, sich aber dreinschickte und alles erduldete. Und wenn ich dann an meinen Vater denke« – sein Gesicht verfinsterte sich –, »wie er ihr das Leben zur Hölle machte, wie er sie demütigte, mit seinen Liebschaften prahlte, ihr ständig untreu war und sich überhaupt keine Mühe gab, es vor ihr zu verbergen.«
»Sie hätte es sich nicht gefallen lassen dürfen«, erwiderte Hilda Lee. »Sie hätte ihn verlassen müssen.«
Mit einem leisen Vorwurf in der Stimme sagte er:
»Dazu war sie zu gut. Sie hielt es für ihre Pflicht zu bleiben. Und außerdem war es ihr Zuhause – wo hätte sie denn hingehen sollen?«
»Sie hätte sich ein eigenes Leben aufbauen können.«
»Damals doch nicht!«, entgegnete David gereizt. »Du verstehst das einfach nicht. So etwas taten Frauen damals nicht. Sie fanden sich mit ihrem Schicksal ab. Nahmen es geduldig hin. Außerdem musste sie ja auch an uns denken. Selbst wenn sie sich von meinem Vater hätte scheiden lassen, was wäre dann geschehen? Wahrscheinlich hätte er wieder geheiratet. Vielleicht hätte er eine zweite Familie gegründet. Unsere Interessen wären vermutlich unter die Räder gekommen. Das musste sie doch alles abwägen.«
Hilda schwieg.
»Nein, sie tat das Richtige. Sie war ein Engel, eine Heilige! Sie hat bis zum Schluss ausgeharrt, ohne zu klagen.«
»Wohl nicht ganz ohne zu klagen, sonst wüsstest du doch nichts davon, David!«, erwiderte Hilda.
Sein Gesicht hellte sich auf, und er sagte leise:
»Ja, sie hat mir einiges anvertraut. Sie wusste, wie sehr ich sie liebte. Als sie starb …«
Er hielt inne und fuhr sich mit den Händen durchs Haar.
»Hilda, das war furchtbar, einfach entsetzlich! Diese Trostlosigkeit! Sie war noch recht jung, sie hätte wirklich nicht sterben müssen. Er hat sie umgebracht – mein Vater! Er war für ihren Tod verantwortlich. Er brach ihr das Herz. Damals beschloss ich, nicht länger unter seinem Dach zu leben. Ich sagte mich von ihm los, ließ alles hinter mir.«
Hilda nickte.
»Das war sehr vernünftig«, sagte sie. »Du hast genau das Richtige getan.«
»Vater wollte, dass ich im Betrieb arbeite. Dazu hätte ich jedoch zu Hause wohnen müssen. Das hätte ich nicht ertragen. Ich verstehe nicht, dass Alfred das aushält – wie er es all die Jahre ausgehalten hat.«
»Hat er sich denn nie dagegen aufgelehnt?«, fragte Hilda neugierig. »Ich dachte, du hättest einmal erzählt, er habe irgendeine andere Laufbahn aufgegeben.«
David nickte.
»Alfred sollte zur Armee. Vater hatte schon alles arrangiert. Alfred, der Älteste, sollte in irgendein Kavallerie-Regiment eintreten. Harry sollte, genau wie ich, im Betrieb arbeiten. George sollte in die Politik.«
»Aber die Rechnung ging nicht auf?«
David schüttelte den Kopf.
»Harry hat alles kaputt gemacht! Er war immer furchtbar chaotisch. Machte Schulden, steckte ständig in irgendwelchen Schwierigkeiten. Eines Tages verschwand er dann mit mehreren Hundert Pfund, die ihm nicht gehörten, und hinterließ lediglich ein paar Zeilen mit der Nachricht, dass ein Bürostuhl nichts für ihn sei und er sich die Welt ansehen wolle.«
»Und ihr habt nie mehr etwas von ihm gehört?«
»O doch, das haben wir!« David lachte. »Sogar ziemlich oft! Von überall auf der Welt hat er um Geld telegrafiert. Und im Allgemeinen bekam er es auch!«
»Und Alfred?«
»Vater zwang ihn, die Armee sausen zu lassen, zurückzukommen und im Betrieb zu arbeiten.«
»Und das ging ihm gegen den Strich?«
»Anfangs sehr. Er hasste es regelrecht. Vater schaffte es jedoch immer wieder, Alfred um den kleinen Finger zu wickeln. Ich glaube, er steht noch heute völlig unter Vaters Pantoffel.«
»Und du – konntest entkommen!«, sagte Hilda.
»Ja. Ich ging nach London und studierte Malerei. Vater gab mir sehr deutlich zu verstehen, dass ich, sollte ich meine Zeit mit so einem Unfug vergeuden, zu seinen Lebzeiten einen kleinen monatlichen Zuschuss bekäme und nach seinem Tod überhaupt nichts. Ich sagte, das sei mir egal. Er nannte mich einen Kindskopf, und das war es dann! Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
»Und du hast es nie bereut?«, fragte Hilda sanft.
»Nein, ganz bestimmt nicht. Mir ist klar, dass ich es mit meiner Kunst zu nichts bringen werde. Ich werde nie ein großer Künstler sein, aber wir beide sind doch glücklich in dem Cottage hier – wir haben alles, was wir brauchen, jedenfalls das Lebensnotwendige. Und wenn ich sterbe, nun, dann bekommst du meine Lebensversicherung.«
Er hielt kurz inne, ehe er fortfuhr:
»Und jetzt das!«
Er schlug mit der Hand auf den Brief.
»Es tut mir leid, dass dein Vater diesen Brief überhaupt geschrieben hat, wenn er dich so aufregt«, sagte Hilda.
David redete weiter, als hätte er sie überhaupt nicht gehört:
»Mich zu bitten, meine Frau zu Weihnachten mitzubringen, den Wunsch zu äußern, dass wir Weihnachten alle zusammen feiern, eine geeinte Familie! Was soll das bedeuten?«
»Muss es denn etwas anderes bedeuten als das, was dasteht?«
Er sah sie fragend an.
»Ich meine«, sagte sie lächelnd, »dein Vater wird alt. Langsam keimen in ihm sentimentale Gefühle für seine Familie auf. So etwas kommt vor, verstehst du.«
»Ja, vielleicht«, sagte David zögernd.
»Er ist ein alter Mann, und er ist einsam.«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu.
»Du willst, dass ich hinfahre, stimmt’s, Hilda?«
»Es wäre doch schade, ihm eine solche Bitte abzuschlagen«, erwiderte sie langsam. »Sicher, ich bin altmodisch, aber was spricht dagegen, zu Weihnachten Friede und Wohlgefallen zu stiften?«
»Nach allem, was ich dir gerade erzählt habe?«
»Ich weiß, Liebling, ich weiß. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Das ist alles lange her und vorbei.«
»Für mich nicht.«
»Nein, weil du es einfach nicht auf sich beruhen lässt. Du hältst die Vergangenheit am Leben, bewahrst sie im Gedächtnis.«
»Ich kann sie nicht vergessen.«
»Du willst sie nicht vergessen – das meinst du doch, David.«
Sein Mund wurde zu einem dünnen Strich.
»So sind wir Lees nun einmal. Wir merken uns Dinge jahrelang, grübeln darüber nach, halten die Erinnerungen wach.«
Mit einem Anflug von Ungeduld blickte Hilda zu ihm hinüber.
»Sollte man darauf etwa stolz sein? Finde ich nicht!«
Nachdenklich und eine Spur reserviert sah er sie an.
»Treue hat für dich also keine große Bedeutung, Treue gegenüber dem Andenken eines Menschen?«
Hilda erwiderte:
»Ich finde, die Gegenwart zählt, nicht die Vergangenheit! Die Vergangenheit muss vergehen. Wenn wir versuchen, die Vergangenheit am Leben zu erhalten, verzerren wir sie letztendlich. Dann überhöhen wir sie, sehen sie aus einer falschen Perspektive.«
»Ich kann mich noch ganz genau an jedes Wort und jede Begebenheit damals erinnern«, sagte David leidenschaftlich.
»Ja, das solltest du aber nicht, Liebling! Das ist nicht natürlich! Du siehst diese Zeit nämlich mit den Augen eines Jungen, statt mit dem besonneneren Blick eines erwachsenen Mannes auf sie zurückzuschauen.«
»Und was würde das für einen Unterschied machen?«, fragte David.
Hilda stockte. Sie wusste, dass es unklug wäre fortzufahren, aber andererseits wollte sie unbedingt noch ein paar Dinge loswerden.
»Ich glaube«, sagte sie, »du siehst in deinem Vater den Schwarzen Mann! Wenn du ihm heute begegnen würdest, dann würdest du wahrscheinlich erkennen, dass er ein ganz gewöhnlicher Mensch war, vielleicht ein Mensch, dessen Leidenschaften mit ihm durchgingen, ein Mensch, dessen Leben alles andere als untadelig war, aber eben doch einfach nur ein Mensch – und kein Unmensch, kein Monstrum!«
»Das verstehst du einfach nicht! Wie er meine Mutter behandelt hat …«
»Es gibt«, entgegnete Hilda ernst, »eine Art von Duckmäuserei, von Unterwürfigkeit, die weckt in einem Mann die niedrigsten Instinkte, während er, wenn er auf Mut und Entschlossenheit träfe, möglicherweise ein ganz anderer Mensch wäre!«
»Du willst also sagen, dass es ihre Schuld war …«
Hilda unterbrach ihn.
»Nein, natürlich nicht! Es steht für mich außer Frage, dass dein Vater deine Mutter sehr schlecht behandelt hat, aber eine Ehe ist schon etwas Besonderes, und ich bezweifle, dass ein Außenstehender – selbst ein aus dieser Ehe hervorgegangenes Kind – das Recht hat, über sie zu urteilen. Und außerdem können deine ganzen Ressentiments deiner Mutter nicht mehr helfen. Das ist alles vorbei, liegt weit hinter dir! Geblieben ist ein alter, gebrechlicher Mann, der seinen Sohn bittet, über Weihnachten nach Hause zu kommen.«





























