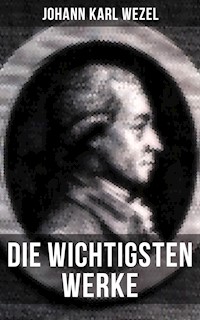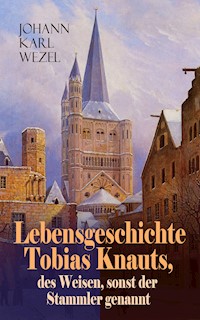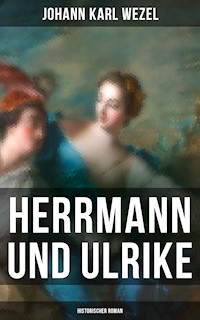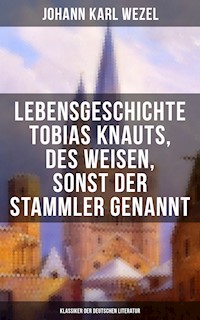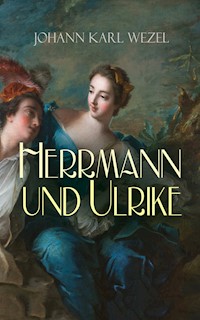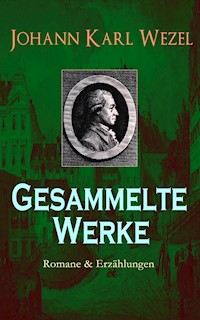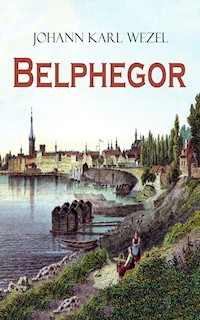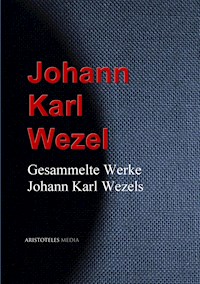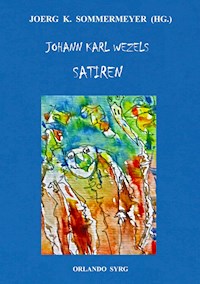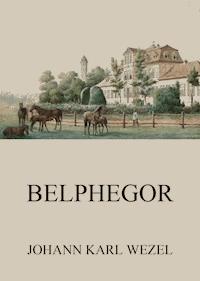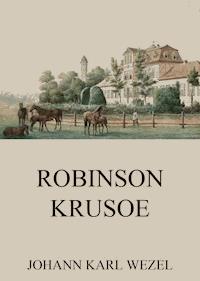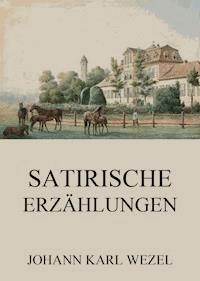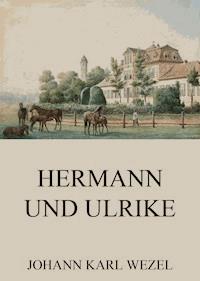
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein tragikomischer Roman um den Standesunterschied zwischen der armen, adligen Ulrike und dem in sie verliebten bürgerlichen Hermann.
Das E-Book Hermann und Ulrike wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1309
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann und Ulrike
Johann Karl Wezel
Inhalt:
Johann Karl Wezel – Biografie und Bibliografie
Hermann und Ulrike
Vorrede
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Fünfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Siebenter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Achter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Neunter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Zehnter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Elfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Zwölfter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Anhang
Hermann und Ulrike, J. K. Wezel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639761
www.jazzybee-verlag.de
Johann KarlWezel– Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Dichter, geboren am 31. Oktober 1747 in Sondershausen, verstorben ebenda am 28. Januar 1819, wo sein Vater fürstlicher Mundkoch war. Auf der dortigen Schule, besonders von dem gelehrten Konrad Böttiger gehörig vorbereitet, bezog er 1764 die Universität Leipzig und wohnte mit Gellert, von diesem hochgeehrt, in einem Hause. 1769 wurde er vorläufig Hofmeister in der Lausitz, bis er größere Reisen nach Berlin, Hamburg, London, Paris und endlich nach Wien antrat. Hier war er dann eine Zeitlang Theaterdichter und erwarb sich die Gunst Josephs II., der ihn aufforderte, in Wien zu bleiben und als Zeichen seiner besonderen Gunst ihm eine große, goldene Medaille verehrte. W. zog sich jedoch nach Leipzig zurück. Da sich aber 1784 bei ihm Spuren einer Geisteskrankheit zeigten, lebte er seit 1786 wieder in Sondershausen, einsam, ohne jeglichen Umgang und bedürftig, sich währendem von den Ersparnissen, durch fleißige schriftstellerische Arbeiten mühsam erworben, erhaltend. Menschenfreunde nahmen sich seiner an und vereinigten sich zu einer Gesellschaft, welche ihn 1800 zu seiner Genesung nach Hamburg zu dem bekannten Arzt Hahnemann brachte, welcher sich zu seiner Wiederherstellung erboten hatte. Allein dieser erklärte ihn bald für unheilbar und veranlasste seine Rückkehr nach Sondershausen. Von dieser Zeit an schienen zwar lichte Augenblicke seinen verfinsterten Geist zu erhellen, doch kehrten Freude am Leben und am menschlichen Umgang nicht wieder bei ihm ein; obwohl körperlich gesund lebte er still in täglicher Ordnung, nicht ohne zeitweilige Beschäftigung mit Lesen und Schreiben dahin, bis er am 28. Januar 1819 nach nur wöchentlicher Krankheit schmerzlos verschied. – Er schrieb eine beträchtliche Anzahl von Lustspielen, Früchte des kurzen Frühlings seines Geistes, deren leichte Beweglichkeit ihm nicht minder Beifall verschaffte, wie andere seiner Schriften, die sein wissenschaftliches Bemühen verrieten (so z. B. der „Versuch über die Kenntniß des Menschen“, 1784 und 1785), aber das ihm gezollte Wohlwollen befriedigte ihn nicht nur nicht, sondern versetzte ihn in eine bittere Stimmung und erregte endlich eine nicht zu befriedigende Eitelkeit, immer mehr ausartend, ihn abwärts ziehend bis zum entschiedenen Wahnsinn.
Ueber die älteren günstigen Urtheile seiner geistigen Erzeugnisse vgl. Jördens in dem Lexicon deutscher Dichter und Prosaisten, 5. Bd.; Meusel, 8. u. 21. Bd.; Ludloff’s Aufsatz: Wezel als Schriftsteller, in d. Gemeinnütz. Blättern f. Schwarzburg, 1808 u. 1810; Eschenburg’s Beispielsammlung z. Theorie u. Litteratur d. schönen Wissenschaften, 7. Bd.; Franz Horn in: Die Poesie u. Beredsamkeit d. Deutschen v. Luther bis z. Gegenw., 3. Bd.; Hesse, Verzeichniß geborner Schwarzburger, 20. St., Rudolstadt, Schulprogr. 1829. – Ueber Wezel’s spätere Schicksale: (Heß) Durchflüge durch Deutschland etc., 1. Bd. und „Nachflug“ dazu: Wezel seit seinem Aufenthalt in Sondershausen v. Z. N. Becker, Erfurt 1799; Gerber’s neues Lexic. d. Tonkünstler, Bd. 4; Blumröder, Ztg. f. d. eleg. Welt 1805 u. 1812; Teutonia 1819; Leipziger u. Jenaer Lit.-Ztg. 1819 (63. Stck., Intelligenzbl. Nr. 14); Allgem. Anzeiger 1828; Thuringia 1841, Nr. 12 u. a. – Mehrere Manuscripte Wezel’s werden auf der fürstl. Regierung in Sondershausen aufbewahrt, so auch Wezel’s Leben von Ludloff in Sondershausen, das u. a. auch Briefe Wezel’s an den Rector Konrad Böttiger enthält.
Hermann und Ulrike
Vorrede
Der Roman ist eine Dichtungsart, die am meisten verachtet und am meisten gelesen wird, die viele Kenntnisse, lange Arbeit und angestrengte Übersicht eines weitläuftigen Ganzen erfodert und doch selbst von vielen Kunstverwandten sich als die Beschäftigung eines Menschen verschreien lassen muß, der nichts Besseres hervorbringen kann. Ein Teil dieser unbilligen Schätzung entstund aus dem Vorurteile, daß Werke, wovon die Griechen und Römer keine Muster und worüber Aristoteles keine Regeln gegeben hat, unmöglich unter die edleren Gattungen der Dichtkunst gehören könnten: zum Teil wurde sie auch durch die häufigen Mißgeburten veranlaßt, die in dieser Gattung erschienen und lange den Ton darinne angaben; denn freilich, eine Menge zusammengestoppelter übertriebner Situationen zusammenzureihen; gezwungene unnatürliche Charaktere ohne Sitten, Leben und Menschheit zusammenzustellen und sich plagen, hauen, erwürgen und niedermetzeln zu lassen: oder einen Helden, der kaum ein Mensch ist, durch die ganze Welt herumzujagen und ihn Türken und Heiden in die Hände zu spielen, daß sie ihm als Sklaven das Leben sauer machen; ein verliebtes Mädchen durch mancherlei Qualen hindurchzuschleppen; Meerwunder von Tugend und schöne moralische Ungeheuer zu schaffen: ein solches Chaos von verschlungenen, gehäuften, unwahrscheinlichen Begebenheiten, Charaktere, die nirgends als in Romanen existierten und existieren konnten, solche Massen ohne Plan, poetische Haltung und Wahrscheinlichkeit zu erfinden, bedurfte es keines Dichtergenies und keiner dichterischen Kunst.
Der Verfasser gegenwärtigen Werkes war beständig der Meinung, daß man diese Dichtungsart dadurch aus der Verachtung und zur Vollkommenheit bringen könne, wenn man sie auf der einen Seite der Biographie und auf der andern dem Lustspiele näherte: so würde die wahre bürgerliche Epopöe entstehen, was eigentlich der Roman sein soll.
Das bisher sogenannte Heldengedicht und der Roman unterscheiden sich bloß durch den Ton der Sprache, der Charaktere und Situationen: alles ist in jenem poetisch, alles muß in diesem menschlich, alles dort zum Ideale hinaufgeschraubt, alles hier in der Stimmung des wirklichen Lebens sein. Die Regeln, die man für jenes gegeben hat, paßten auch auf diesen, wenn sie nur nicht bloß willkürliche Dinge beträfen: aber die wirklichen Regeln, die sich auf die Natur, das Wesen und den Endzweck einer poetischen Erzählung gründen, sind beiden gemein: was man bisher zu Regeln des epischen Gedichts machte, ging bloß die Form und Manier an und waren alle bloß von der Homerischen abgezogen.
Die bürgerliche Epopöe nimmt durchaus in ihrem erzählenden Teile die Miene der Geschichte an, beginnt in dem bescheidenen Tone des Geschichtsschreibers, ohne pomphafte Ankündigung, und erhebt und senkt sich mit ihren Gegenständen: das Wunderbare, welches sie gebraucht, besteht einzig in der sonderbaren Zusammenkettung der Begebenheiten, der Bewegungsgründe und Handlungen. In dem gewöhnlichen Menschenleben, aus welchem, sie ihre Materialien nimmt, nennen wir eine Reihe von Begebenheiten wunderbar, die nicht täglich vorkömmt: die einzelnen Begebenheiten können und müssen häufig geschehen – denn sonst wären sie nicht wahrscheinlich –, aber nicht ihre Verknüpfung und Wirkung zu einem Zwecke. So verhält es sich auch mit dem Wunderbaren der Handlungen: wir schreiben es ihnen alsdann zu, wenn sie entweder aus einer ungewöhnlichen Kombination von Bewegungsgründen und Leidenschaften entstehen oder in dem Grade der Tätigkeit, womit sie getan werden, zu einer ungewöhnlichen Höhe steigen. Je höher der Dichter dieses Wunderbare treibt, je mehr verliert er an der Wahrscheinlichkeit bei denjenigen Lesern, die das nur wahrscheinlich finden, was in dem Kreise ihrer Erfahrung am häufigsten geschehen ist: aber dies ist eine falsche Beurteilung der poetischen Wahrscheinlichkeit, die allein in der Hinlänglichkeit der Ursachen zu den Wirkungen besteht. Der Dichter schildert das Ungewöhnliche, es liege nun in dem Grade der Anspannung bei Leidenschaften und Handlungen oder in der Verknüpfung der Begebenheiten und ihrer Richtung zu einem Zwecke; und dies Ungewöhnliche wird poetisch wahrscheinlich, wenn die Leidenschaften durch hinlänglich starke Ursachen zu einem solchen Grade angespannt werden, wenn die vorhergehende Begebenheit hinlänglich stark ist, den Zweck zu bewirken, auf welchen sie gerichtet sind. Dies ist der einzige feine Punkt, der das Wunderbare und Abenteuerliche scheidet.
Der Verfasser kann unmöglich in einer Vorrede die Ideen alle entwickeln, die ihn bei der Entwerfung seines Plans leiteten, und wie er seine beiden vorhin angegebnen Absichten zu erreichen suchte: er muß es auf das Urteil der Kunsterfahrnen ankommen lassen, ob sie in seinem Werke Spuren antreffen, daß er mit Wahl und Absicht verfuhr. Er wählte eine Handlung, die den größten Teil von dem Leben seiner beiden Helden einnahm, um sich die Rechte eines Biographen zu erwerben: aber er wählte unter den Begebenheiten und Handlungen, die diesen größten Teil des Lebens ausmachten, nur solche, die auf seine Haupthandlung Beziehung oder Einfluß hatten, um ein poetisches Ganze zu machen.
Jedes poetische Ganze hat zween Teile – die Anspinnung, Verwickelung und Entwickelung der Fabel: die Exposition und stufenweise Entwickelung des Hauptcharakters oder der Hauptcharaktere. Auf diese beiden Punkte muß der Blick des Dichters bei der Anordnung beständig gerichtet sein, um zu beurteilen, welche Charaktere er nur als Nebenfiguren behandeln, wie er sie stellen und handeln lassen soll, daß sie auf die Hauptperson ein vorteilhaftes Licht werfen, ihre Charaktere durch Kontrast oder bloß graduale Verschiedenheit heben und anschaulich machen; um zu beurteilen, wie er die Szenen stellen soll, daß die vorhergehenden die folgenden mittelbar oder unmittelbar vorbereiten und alle auf den Hauptzweck losarbeiten; welche er gleichsam nur im Schatten lassen, nur flüchtig und kurz übergehen und welche er in das größte Licht setzen und völlig ausmalen soll; wie er sie so ordnen soll, daß jede mit der nächsten mehr oder weniger kontrastiert, und wie er dieses Mehr oder Weniger so einrichten soll, daß er Einförmigkeit und gezwungene Symmetrie verhindert.
Um sich diese und so viele andre Pflichten zu erleichtern, vereinigte der Verfasser alle Mittel, die dem Dichter verstattet sind – Erzählung und Dialog, worunter man auch den Brief rechnen muß, der eigentlich ein Dialog zwischen Abwesenden ist. Ob er ein jedes am rechten Orte, dem poetischen Effekte gemäß, gebraucht und den eigentlichen Dialog und die Erzählung gehörig ineinander verflößt hat, kann nur der Leser beurteilen, der hierinne kompetenter Richter ist. Wer ihm Fehler anzeigt und sich so dabei benimmt, daß er mit Nachdenken gelesen und mit Einsicht geurteilt zu haben scheint, wird ihn durch eine solche, mit Gründen unterstützte Anzeige so sehr verbinden als durch den uneingeschränktesten Beifall: wer aus geheimer Abneigung gegen den Verfasser oder aus Tadelsucht auf sein Buch schlechtweg schmäht und das Geradeste am schiefsten findet, wird erlangen, was er verdient – Verachtung.
Viele Leser erlassen dem Romanschreiber gern alle mögliche poetische Vollkommenheiten, wenn er sie nur durch eine Menge seltsamer Begebenheiten unterhält, worunter eine mit der andern an Abenteuerlichkeit streitet, und die Personen recht winseln, brav küssen und oft sterben läßt: solche Leser werden bei dem Verfasser ihre Rechnung nicht sehr finden; denn er geht mit den Küssen außerordentlich knickerig um und steigt nie zu einer großen Quantität, um ihren Wert und Effekt nicht abzunutzen. Keine von seinen Personen wird bis zum Wahnsinne melancholisch, keine ist so sanft und schmelzend, als wenn sie nur ein Fluidum von Tränen wäre. Überhaupt hat der Verfasser die Ketzerei, daß er den raschen, von Sanftheit temperierten Ton in der Menschheit liebt und die butterweichen Seelen, die fast gar keine Konsistenz haben, schlechterdings entweder belachen oder verachten muß; auch glaubt er daher, daß es für die Stimmung unsers Geistes zuträglicher wäre, wenn wir mit unsern Romanen wieder in den Geschmack der Zeiten zurückgingen, wo der Liebhaber aus Liebe tätig wurde und nicht bloß aus Liebe litt, wo die Liebe die Triebfeder zum Handeln, zu Beweisung großer Tugenden wurde, Geist und Nerven anspannte, aber nicht erschlaffte.
Andre Leser verlangen bloß Muster der Tugend oder, wie sie es nennen, die Menschheit auf der schönen Seite zu sehen: der Verfasser hat allen Respekt für die Tugend und möchte sie, um sich in diesem Respekte zu erhalten, nicht gern zur alltäglichen Sache machen: er findet, daß diese kostbare Pflanze in unserer Welt nur dünne gesäet ist, und will sich also nicht sosehr an dem Schöpfer versündigen und seine Welt schöner machen, als er es für gut befand.
Endlich suchen einige in einem Romane und auf dem Theater die nämliche Erbauung, die ihnen eine Predigt gibt, und wollen gern, wenn sie das Buch zumachen, das moralische Thema samt seinen Partibus wissen, das der Herr Autor abgehandelt hat. Für diese hat der Verfasser der gegenwärtigen Geschichte am meisten gesorgt; denn aus jeder Zeile können sie sich eine Moral ziehen, wenn es ihnen beliebt.
Wzl.
Erster Teil
Erstes Kapitel
Im Jahre nach Erschaffung der Welt, als die Damen kurze Absätze und niedrige Toupets, die Herren große Hüte und kleine Haarbeutel und niemand leicht Gold auf dem Kleide trug, der nicht wenigstens Silber genug in der Tasche hatte, um es bezahlen zu können, wurde auf dem Schlosse des Grafen von Ohlau ein Knabe erzogen, der bei dem Publikum des dazugehörigen Städtchens nicht weniger Aufmerksamkeit erregte und in den langen Winterabenden nicht weniger Stoff zur Unterhaltung gab als Alexander, ehe er auf Abenteuer wider die Perser ausging. Graf und Gräfin, deren Liebling er einige Zeit war, nannten ihn Henri, seine Eltern Heinrich und das ganze Städtchen den kleinen Herrmann, nach dem Geschlechtsnamen seines vorgeblichen Vaters – seines vorgeblichen, sage ich; denn sosehr die körperliche Ähnlichkeit mit ihm es wahrscheinlich machte, daß er sein wahres, echtes Produkt sein möchte, und sowenig auch der erfahrenste Physiognomist auf den Einfall gekommen wäre, eine andere wirkende Ursache zu vermuten, so hatte doch jedermann die Unverschämtheit, trotz jenes wichtigen Grundes ihn seinem Vater völlig abzuleugnen, und zwar aus der sonderbaren Ursache – weil der Sohn ein feiner, witziger, lebhafter Knabe wäre und gerade soviel Verstand als sein Vater Dummheit besäße.
Freilich war wohl diese Ursache etwas unzureichend, einem armen Sterblichen seine ehrliche Geburt abzusprechen; auch gab der alte Herrmann nichts weniger zu, als daß er dumm sei, und bewies sehr häufig durch die Tat, daß er sich hierinne nicht irrte: gleichwohl hätten sich die Leute eher bereden lassen, nicht mehr an den Kobold zu glauben, als den jungen Herrmann für den rechtmäßigen Sohn des alten Herrmanns zu erkennen. Indessen, so genau alles, alt und jung, in dieser Behauptung übereinstimmte, so verschieden wurden die Meinungen, wenn es darauf ankam, die Entstehung des Knabens zu erklären; und wenn man alles, was darüber gedacht und gesagt worden ist, sorgfältig aufbewahrt hätte, so würde eine solche Sammlung ungleich mehr Drucker und Setzer ernähren als alle Träumereien der Philosophen. Einige, die des Sonntags zweimal in die Kirche gingen und darum billiger dachten als andre, die wöchentlich nur eine Predigt hörten, nahmen doch seinem Vater nicht die ganze Ehre des Anteils an der Erzeugung seines Sohns, sondern gestunden mit einem weisen Achselzucken, daß ihm vielleicht die eine Hälfte angehören könnte: allein es wird vermutlich weltkundig sein, daß ein gelehrter Akademist die Unmöglichkeit einer solchen Entstehung sonnenklar dargetan hat, und die Anhänger jener Meinung werden mir daher vergeben, daß ich diesem Manne, der den Homer, Virgil und die sämtlichen Erzväter des Alten Testaments auf seine Seite zu bringen weiß, eher Glauben beimesse als ihnen – Leuten, die nie ein griechisches Wort gesehen haben.
»Der Herr Major im letzten Kriege mag ihn wohl zurückgelassen haben«, sagten andere Leute, die sich etwas besser auf Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit verstunden.
»Er ist ein Sohn von dem Herrn Grafen«, zischelte sich jedermann ins Ohr, der auf die Gunst neidisch war, die die Herrmannische Familie von dem Grafen genoß; und dieses war das ganze Städtchen. – Tausend ähnliche besser und schlechter gegründete Vermutungen erzählte man sich als Wahrheiten, vertraute man sich mit geheimnisreicher Miene. Wenn in den kühlen Abendstunden des Sommers zwo Nachbarinnen vor der Tür beisammensaßen, wenn sich zwo Freundinnen am Brunnen trafen, bei dem Spinnrocken oder der Kaffeetasse plauderten, war zuverlässig der kleine Herrmann ihr Gespräch. Wer aber unter allen am sichersten der Wahrheit zuviel weder zur Rechten noch zur Linken gehen wollte, der versicherte schlechtweg – der kleine Herrmann ist ein Hurkind.
Natürlicherweise muß mir unendlich viel daran liegen, daß diese Meinung nicht unter meinen Lesern Glauben gewinnt, da der Kunstgriff, den Helden seiner Geschichte aus einer Galanterie entstehen zu lassen, seit des alten Homers Zeiten schon so abgenutzt ist, daß sich ein honneter Dichter schämen muß, etwas mit Hurkindern zu tun zu haben. Es ist eine auf Urkunden gegründete Wahrheit, daß der alte Herrmann den Dienstag nach Misericordias unter priesterlicher Einsegnung das Recht empfing, einen Sohn zu zeugen, und daß seine innig geliebteste Frau Ehegattin ihn den vierten Advent des nämlichen Jahres gegen Sonnenuntergang mit einem Wohlgestalten Knäblein erfreute, welches zugestoßener Schwachheit halber in derselben Nacht die Nottaufe empfing; und dieses war der Herrmann, dessen Geschichte ich erzähle. Wer nach einem so einleuchtenden Beweise noch eine Minute zweifelt, muß entweder mich oder meinen Herrmann hassen.
Zweites Kapitel
An einem sehr heißen Sommertage, gerade als die Sonne in den Krebs treten wollte, ging der Graf Ohlau, seine Gemahlin am Arme und in Begleitung seiner sämtlichen Domestiken, überaus prächtig in der neuangelegten Lindenallee spazieren, welches er jeden Sonntag bei heiterem Wetter zu tun pflegte. Das ganze Städtchen, das seine Liebe zur Pracht kannte, paradierte alsdann auf beiden Seiten der Allee in den auserlesensten Feierkleidern: Männer und Weiber, Kinder und Eltern machten eine Gasse auf beiden Seiten und sahen mit gaffender Bewunderung das starre goldreiche Kleid ihres hochgebornen Herrn Grafen nebst einem langen Zuge von reicher Liverei durch die doppelte Reihe gravitätisch dahinwandeln. Nero konnte nicht grausamer zürnen, wenn er auf dem Theater sang und diesen oder jenen Bekannten unter den Zuschauern vermißte, als der Graf Ohlau, wenn bei diesem sonntäglichen feierlichen Spaziergange jemand von den Einwohnern des Städtchens fehlte: ob er gleich einen solchen Verächter seiner Hoheit nicht, wie jener Heide, köpfen ließ, so war doch allemal in so einem Übertretungsfalle auf einen heftigen Groll und bei der nächsten Gelegenheit auf eine empfindliche Rache zu rechnen. Obgleich zuweilen die Sonne so brennende Strahlen auf die Versammlung warf, daß die kahlen Köpfe der Alten wie Ziegelsteine glühten, daß die weißgepuderten Parücken der Ratsherren von der geschmolzenen Pomade mohrenschwarz und die schönen schneeweißen Mädchengesichter rotbraun und mit Sommersprossen und Blattern von der Hitze gezeichnet wurden, so wagte es doch niemand, solange sich der Graf in der Allee aufhielt, den Schatten zu suchen: man schwitzte, ächzte und ward gelassen zum Märtyrer des herrlichen Kleides, das der Graf zu begaffen gab. Er selbst machte sich mit der nämlichen Standhaftigkeit zum Opfer seines Stolzes, und seine Gemahlin – mehr aus Gefälligkeit gegen ihn als aus eigner Neigung – steckte sich jedesmal in einen großen Fischbeinrock und ein schweres reiches Kleid, um die Herrlichkeit seines Spazierganges vermehren zu helfen.
Die Last dieser Feierlichkeit war noch keinen Tag so drückend gewesen, daß der Graf sie nicht hätte ertragen können: doch itzt, am gemeldeten Sonntage, schoß die Sonne bei ihrem Eintritte in den Krebs so empfindliche Strahlen, die wie Pfeile verwundeten. Die Augen der Zuschauer waren matt und blickten mit schwacher Bewunderung auf das apfelgrüne Kleid, in dessen Stickerei die Silberflittern wie ein gestirnter Himmel glänzten und die Folie mit allen Farben des Regenbogens spielte: Jedermann lechzte und dachte, empfand und sagte nichts als: »Das ist heiß!« Der Graf wedelte sich unaufhörlich mit dem musselinen Schnupftuche das Gesicht, blies um sich und seufzte einmal über das andere seiner Gemahlin zu: »Das ist heiß!« Die Frau Gräfin ging geduldig an seiner Seite unter dem rottaffetnen Sonnenschirme mit glühendem aufgelaufenen Gesichte und klopfendem Busen, wo große Schweißtropfen wie die Perlen eines starken Morgentaues standen, zerrannen und in kleinen Bächen hinabliefen, atmete tief und keuchte nach ihrem Gemahle hin: »Das ist heiß!« Laufer, Heiducken, Jäger und Lakaien, so stolz sie sonst in ihren Galakleidern daherschritten, schlichen mit gesenkten Häuptern mutlos und schmachtend hinterdrein und brummten einander, ein jeder mit seinem Lieblingsfluche, zu: »Das ist heiß!« Es war nichts anders übrig, als der Sonne nachzugeben und dem Schatten zuzueilen.
Gerade mußte sich es treffen, daß unter der schattichten Linde, wo der Graf mit seinem Gefolge Schutz suchte, der kleine Herrmann mit einigen seiner Kameraden sein gewöhnliches Spiel spielte: er war König, teilte Befehle aus, die die übrigen vollziehen mußten, und saß eben damals mit völliger Majestät und Würde auf der Bank unter der Linde, um einem Paar Abgesandten Audienz zu geben. Sobald sich der Graf dem Baume näherte, liefen die erschrocknen Abgesandten davon, nur der kleine König blieb, in die Hoheit seiner Rolle vertieft, mit gravitätischem Ernste sitzen. Die Mutter, die in der Ferne gegenüberstand, biß sich vor Ärger über die Unhöflichkeit ihres Sohnes in die Lippen, und der Vater hub schon mit Zähneknirschen und einem unwilligen »Du sollst es kriegen« sein Rohr drohend in die Höhe. Die Gräfin lächelte über die Unerschrockenheit, mit welcher sie der Knabe erwartete, und sagte freundlich zu ihm: »Rücke zu, mein Kleiner!« – »Nein, das kann ich nicht!« antwortete der Knabe. »Ich muß in der Mitte sitzen; denn ich bin König, und Sie sind nur Graf.« – Man lachte und gab, aus Ehrerbietung gegen seine königliche Würde, seinem Verlangen nach.
Ohne langes Besinnen fuhr er in seiner Rolle fort und gab mit der nämlichen Dreistigkeit, womit er seine Gespielen beherrscht hatte, auch dem Grafen Befehle, und weil dieser nicht für nötig erachtete, sie zu vollstrecken, so versicherte ihn der kleine Monarch, daß er sich einen bessern Untertan in ihm versprochen hätte, und drohte ihm für seinen Ungehorsam die fürchterlichsten Strafen an. Die Gräfin, die sehr bald merkte, daß alle diese Ideen, ob es gleich nur Kinderspiel war, dem Stolze ihres Gemahls widrig wurden, suchte den Knaben auf etwas andres zu lenken und bat ihn, seine Majestät einmal beiseitezusetzen und ihr ein paar Blumen zu pflücken. Pfeilschnell sprang er von der Bank hinweg, setzte sich ins Gras, pflückte Blumen, und band mit dem sorgfältigsten Fleiße ein sehr zierliches Bukett, das er der Gräfin mit dem verliebten Anstande eines Schäfers und einem Handkusse überreichte, nebst der galanten Versicherung, daß er sie sehr lieb habe. – »Mein Sohn«, sagte die Gräfin darauf, »du wirst einmal ein großer Mann oder ein großer Narr werden.« – »Ach«, erwiderte der Knabe mit kindischer Naivität, »mit dem großen Narren hat's keine Not: das will ich wohl bald werden, wenn ich nur erst ein großer Mann bin.« –
Gräfin.Hast du denn Lust, ein großer Mann zu werden?
Der Kleine.Ja, das werd ich; und weiter nichts!
Gräfin.Auch ein großer Narr?
Der Kleine.Nein, das ist meine Sache nicht. – Das ist einer (setzte er hinzu und wies mit dem Finger auf den Grafen). Steifigkeit und Gezwungenheit müssen auf jede richtig gestimmte Seele einen unmittelbaren widrigen Eindruck machen; sonst hätte unmöglich diesem kleinen Schwätzer ein so kindischer Sarkasmus, so voll der bittersten Wahrheit, entwischen können. Der Graf fühlte ihn mit Widerwillen, und es tat ihm sehr wehe, daß er nicht zürnen konnte, weil ihn ein Kind gesagt hatte: seine Gemahlin, die seinen Stolz und seine zeremoniöse Eitelkeit innerlich sehr mißbilligte und sich nur nicht offenherzig gegen ihn herauszulassen getraute, freute sich im Herzen über den Vorwitz des Bubens und ermahnte ihn zur Behutsamkeit und zum Respekte in seinen Ausdrücken, vielleicht gar in der boshaften Absicht, seine Unverschämtheit noch mehr zu reizen. »Was hast du denn an mir auszusetzen?« fragte der Graf mit hastigem Tone, um seine Empfindlichkeit zu verstecken.
Der Kleine.Sehr viel! – Warum ziehen Sie sich denn so warm an? itzt in der Hitze? Sehn Sie! das ist gescheit angezogen! – (wobei er seine kleine rotstreifichte Leinwandjacke auseinanderzog und von der Luft durchwehen ließ).
Die Gräfin verbarg eine boshafte Freude hinter dem Fächer und machte ihm den Einwurf, daß sich eine solche Kleidung nicht für den Grafen schicke.
Der Kleine.Warum denn nicht? Wenn sie sich für mich schickt?
Die Gräfin.Und du bist doch ein König!
Der Kleine.Oh, Sie sind eine scharmante Frau: ich habe Sie wahrhaftig recht lieb, das können Sie glauben. Wenn ich groß bin, will ich Sie heiraten.
Die Gräfin.Du mich? – Ich habe ja schon einen Mann.
Der Kleine.Ja – (wobei er den Grafen mit schiefem, verächtlichen Blicke vom Kopf bis zu den Füßen übersah) – den hätt ich nicht genommen.
Die Gräfin.Warum denn nicht?
Der Kleine.Weil er so viel Silber auf de Rocke hat.
Die Gräfin.Du wirst also vermutlich kein Silber tragen, wenn wir einander heiraten?
Der Kleine.Also wollen Sie mich? – Geben Sie mir Ihre Hand darauf!
Die Gräfin.Hier ist sie. – Warum, bist du denn aber dem Silber so gram?
Der Kleine.Weil es zu geputzt aussieht.
Die Gräfin.Ich merke also wohl, du bist kein Liebhaber vom Geputzten.
Der Kleine.Gar nicht! Wenn ich auch einmal ein großer Mann bin, geh ich doch nicht anders wie itzo.
Die Gräfin.Was für ein großer Mann denkst du denn zu werden?
Der Kleine.Das weiß ich selber noch nicht recht. Sonst wollt ich immer ein König werden: aber das gefällt mir nicht mehr. Ich will lieber zur See gehen und Länder entdecken.
Die Gräfin.Da wirst du mich bald zur Witwe machen.
Der Kleine.Ja, wenn ich Sie heirate! – (Vor Freude tat er zwei große Sprünge bei diesen Worten.) – Da bleib ich lieber zu Hause bei Ihnen und werde recht gelehrt – recht erstaunend gelehrt! Hernach müssen die Leute aus der ganzen Welt zu mir kommen und mich sehen wollen: die Königin aus Saba muß zu mir kommen: da lös ich ihr Rätsel auf.
Die Gräfin.Die gute Frau ist schon lange tot.
Der Kleine.Es wird doch wohl eine andre wieder dasein. Die bringt mir dann große Geschenke – Gold, Silber, Weihrauch.
Die Gräfin.Du bist ja kein Liebhaber von Gold und Silber.
Der Kleine.Ach, ich behalte nichts davon: ich schenke alles wieder weg, alles.
Die Gräfin.Das ist edelmütig. – Ich dächte, so ein munterer Bursch wie du ginge lieber in den Krieg.
Der Kleine.Nein, das ist gar nicht meine Sache.
Die Gräfin.Warum nicht?
Der Kleine.Das Pulver macht schmutzige Hände: die Soldaten sehen mir alle zu wild aus; und im Kriege wird man ja totgeschossen!
Die Gräfin.Du mußt die andern totschießen, damit sie dich nicht totschießen können.
Der Kleine.Ich sollte jemanden totschießen? – Das könnt ich nicht. Das tät mir so weh, als wenn meine Mutter eine Henne abschlachtet. – Ich kann gar kein Blut sehn – (setzte er mit leisem Tone und halbem Schauer hinzu).
Die Gräfin.Bist du so mitleidig?
»Ach«, seufzte der Knabe, und Tränen standen ihm in den dunkelblauen Augen, »ich kann gar nicht sterben sehn! Auch keinen Menschen, dem etwas weh tut! Der lahme Görge hier in der Stadt – wenn ich den mit seiner Stelze kommen sehe –, ach, da geh ich allemal in eine andere Gasse, daß ich nicht vor ihm vorbei muß.« – »Dort kömmt die Kutsche!« unterbrach der Graf freudig ihr Gespräch, der unterdessen voller Ungeduld, wie auf Feuer, dagesessen und nach der lange verschobnen Ankunft des blauen Staatswagens geseufzt hatte.
Bei seinem Vergnügen an der Pracht spielten Kutschen und Pferde keine geringe Rolle: er verschrieb sich alle mögliche Risse von Staatskarossen und den sämtlichen übrigen Arten von Wagen, und niemand durfte ihm leicht ein merkwürdiges Fuhrwerk oder Pferdegeschirr nennen, ohne daß er nicht den Auftrag bekam, eine Zeichnung davon zu schaffen. Keine Schmeicheleien und kein Geld wurden dabei gespart, den Zeichner und Kommissionar zur Beschleunigung seines Wunsches aufzumuntern: empfahl sich einer unter den erhaltnen Rissen durch unwiderstehliche Schönheiten, so wurde er ausgeführt, und jedesmal, wenn so ein neues Werk vollendet und zum ersten Male gebraucht wurde, empfing das ganze Schloß einen Schmaus, wie andere Leute zu geben pflegen, wenn sie ein Haus gebaut haben. Schade war es nur, daß die herrlichen Gebäude allemal aus einem doppelten Grunde unbrauchbar und meist auch ziemlich abgeschmackt waren: seine Leidenschaft für die Pracht zog Schönheit und Geschmack so wenig zu Rate, daß jedes Fleckchen, von der Decke bis zur Radeschiene, von dem äußersten Ende der Deichsel bis zu der äußersten Spitze des letzten Eisens hinter dem Kasten, mit Gold beklebt werden mußte, wofern es andere Ursachen nur im mindsten zuließen: auf der andern Seite wollte sein Geiz – wovon ihm eine starke Dosis zuteil geworden war – jenen prächtigen Kunstwerken die Dauerhaftigkeit einer ägyptischen Pyramide geben und riet ihm, sie so massiv, so plump bauen zu lassen, daß selten eine Kutsche nach geendigter Schöpfung mit weniger als acht Pferden von der Stelle gebracht werden konnte. Dieselben Ursachen machten auch seine Pferdegeschirre zu wahren Meisterstücken des schlechten Geschmacks: sie waren alle so schwer, daß unter der kostbaren Last die armen Rosse ihres Lebens nicht froh wurden und meistens zwei Tage eine Entkräftung fühlten, wenn sie einmal eine Stunde lang in ihrem ganzen Schmucke an so einem vergoldeten Hause gezogen hatten. Bei einer solchen Bewandtnis ist es kein Wunder, daß der Herr Graf während der vorhergehenden Unterredung seiner Gemahlin mit dem kleinen Herrmann so lange auf den blauen Wagen warten mußte, ob er gleich beinahe schon angespannt war, als der Spaziergang eröffnet wurde: das ungeheure Gebäude konnte bei der gewaltigen Hitze nicht anders als in dem Tempo eines gemeinen Mistwagens fortbewegt werden, und noch blieben die niedergeschlagnen Pferde alle sechs Schritte einmal stehen, um auszuschnauben.
Endlich langte die blaue fensterreiche Karosse bei der Linde an: sechs Perlfalben zogen sie unter einem blausamtnen, mit goldnen Tressen und unzählbaren Schnallen gezierten Geschirre; sie hingen traurig den schöngeflochtnen, mit goldnen Rosen geschmückten Hals und fühlten ihr glänzendes Elend so stark, daß sie nicht einmal die funkelnde Quaste auf dem Kopfe schüttelten. Graf und Gräfin stiegen hinein, und ohne daß man es gewahr wurde, wie ein Wind, wischte der kleine Herrmann hinter ihnen drein – pump! saß er da, dem hochgebornen Paare gegenüber. Der Graf erschreckte ihn zwar durch die auffahrende Frage: »Was willst du hier?« – allein der Knabe antwortete ihm unerschüttert: »Ich will einmal sehn, wie sich's in so einem Wagen fährt.«
Unterwegs machte er sehr oft die Anmerkung, daß diese Art zu fahren für ihn erstaunend langweilig wäre, bezeugte auch zuweilen ein großes Verlangen, aus dem Kasten herauszugehn, und da ihn die Gräfin zur Ruhe vermahnte, versicherte er, daß er nur aus Liebe zu ihr sich so lange darinne zurückhalten ließe.
Allmählich begann der zweite Akt des Spaziergangs. Wenn der Graf sich bei dieser Sonntagskomödie mit der ganzen Kommun seiner Residenz einige Zeit von der Sonne hatte sengen und brennen lassen, erschien gewöhnlich, wie itzo, eine von seinen schwerfälligen Staatskutschen, worinne er mit der Langsamkeit einer Leichenbegleitung durch die Alleen eines Lustwäldchens fuhr: die ganze Stadt folgte ihm alsdann zu Fuß auf beiden Seiten und hinten nach, und jeder Knabe hatte die Erlaubnis, ein Band, ein Schnupftuch oder jede andre Sache, die weich genug war, um keine Beulen zu machen, wenn sie einen Kopf traf, in den Wagen zu werfen. Nach geendigter Spazierfahrt sammelte der Kammerdiener alle hineingeworfnen Lappen in einen Korb, trat mit ihm mitten auf den Schloßhof, die Stadtjugend stellte sich in einem Zirkel um ihn, und sobald der Graf das Fenster öffnete, fing er an, ein Band, ein Tuch nach dem andern in die Höhe zu halten und nach dem Eigentümer desselben zu fragen: wer sich dazu bekannte und sein Recht aus gültigen Gründen beweisen konnte, erhielt bei der Rückgabe etwas Geld: waren die Ansprüche so verwickelt und zweifelhaft, daß sich der Kammerdiener ohne Verletzung seines Richtergewissens nicht zu entscheiden getraute, so mußte der Zweikampf den Ausschlag tun: die Kompetenten traten in die Mitte des Kreises, rangen miteinander, und wer den andern zuerst niederwarf, besaß das Band und den damit verbundenen Preis ungestört bis in alle Ewigkeit, wenn er auch gleich dem Überwundnen gehörte. Während der Austeilung wurde ein Faß voll Bier, in Bereitschaft gesetzt, auf einen kleinen Wagen geladen; und hatte jedes Band seinen Besitzer gefunden, so spannte sich ein Trupp Knaben daran und zog ihn, Musik voraus, in den herrschaftlichen Garten, wo in einem, alten Pavillon die Mädchen warteten, um mit ihnen gemeinschaftlich den Abend unter Tänzen und Liedern hinzubringen. Sehr oft sah der Graf mit seiner Gemahlin ihren jugendlichen Ergötzlichkeiten zu, wenigstens waren doch auf allen Fall die Eltern zugegen, um Unordnungen vorzubeugen und durch ihre Gegenwart Reizungen zu unterdrücken, welche der Tanz leicht erweckt.
Der kleine Herrmann, der aus Liebe zur Gräfin die ganze Fahrt hindurch bis zur Ankunft auf dem Schlosse in der Kutsche ruhig ausgehalten hatte, bat sich die Erlaubnis aus, bei der darauffolgenden Preisausteilung die Stelle des Kammerdieners zu vertreten: und auf Zureden seiner Gönnerin bewilligte ihm der Graf seine Bitte. Er sammelte die zahlreichen Bänder und Tücher aus dem Wagen mit eilfertiger Geschäftigkeit zusammen und trat mit dem völligen feierlichen Anstande eines Richters, unter der Begleitung des Kammerdieners, der Korb und Geld neben ihm hertrug, in den Kreis seiner erstaunten Kameraden. Sie murmelten zwar einander einige kleine Höhnereien zu, daß ihresgleichen über sie erkennen sollte: allein Graf und Gräfin öffneten das Fenster, und man schwieg. Der neue Richter schwenkte ein Band in die Luft, fragte, wem es gehörte, gab es dem ersten, der mit einem deutlichen »Mir« antwortete, aber kein Geld, verfuhr mit den übrigen ebenso, und niemand bekam Geld. Der Kammerdiener, dieser neuen Praxis ungewohnt, wollte ihm ins Amt greifen; die ganze versammelte Jugend wurde schwürig und wollte die alte Prozeßordnung hergestellt wissen: doch die Gräfin rief: »Laßt ihn nur machen!« – und man mußte sich beruhigen. Als der Korb ausgeleert war, befahl er einem jeden nach der Reihe, seine eingelösten Bänder zu zählen, und wer die meisten hatte, bekam das wenigste Geld: ein einziger Knabe, der nur eins in den Wagen geworfen und auch nur eins zurückgefodert hatte, erhielt den höchsten Preis – gerade so viel, als alle übrige zusammen. Natürlich mußten die andern über ihre getäuschte Unverschämtheit unwillig werden, und weil kein Mittel zu einer größern Rache vorhanden war, schimpfte, schmähte, verspottete man die neue Weisheit des Richters: der Kammerdiener, dem es auch nicht anstund, daß der Knabe klüger sein wollte als er alter Mann, suchte ihn anzuhetzen und in einen Streit zu verwickeln, wo er notwendig den kürzern ziehen würde. »Leid es nicht«, zischelte er ihm leise zu: allein er bekam nichts als die stolze Antwort: »Das schadet mir nichts, ich bleibe dennoch, wer ich bin« – und so wanderte unser kleiner Herrmann voll edlen Bewußtseins nach dem Zimmer des Grafen.
Der Empfang von seiten der Gräfin war ungemein lebhaft und freundlich, und selbst ihr Gemahl fühlte in dem Verfahren des Knaben bei der Preisausteilung so etwas, das mehr als einen gemeinen Geist voraussetzte. Sie lobten ihn beide, beschenkten ihn, und der Graf gab sich selbst die gnädige Mühe, ihn mit hoher Hand in seinen Staatszimmern herumzuführen; denn nach seinen Begriffen war es die größte Gnadenbezeugung, wenn er jemandem Gelegenheit gab, ihn in seiner Pracht zu bewundern. – »Wie gefällt dir das alles?« fragte der Graf. – »Ganz wohl«, erwiderte der Knabe; »nur das viele Gold kann ich nicht leiden.« – »Was möchtest du nun am liebsten unter allen diesen Sachen haben?« fing die Gräfin an. – »Nichts als das!« antwortete der Kleine und wies auf ein Porträt der Gräfin.
Die Vorstellung – ›ich gefalle‹ – verbreitet über weibliche Nerven jederzeit so eine eigne lebhafte Behaglichkeit, daß ihr ein Frauenzimmer auch bei einem sechsjährigen Knaben nicht widerstehen kann: die Gräfin ging, ohne ein Wort zu sagen, in ihr Zimmer und kam mit einem Miniaturgemälde zurück, das sie ihrem Lieblinge – denn das war er nun völligzum Geschenk überreichte. – »Wenn dir«, sagte sie, »die Frau auf dem großen Gemälde hier so wohlgefällt, so will ich dir ihr Porträt im kleinen geben: behalt es zu meinem Andenken!« – Der Knabe tat einen freudigen Sprung, seine ganze Miene wurde Vergnügen, er küßte das Bild etlichemal und bat um ein Band: die Gräfin vertröstete ihn bis zur Zurückkunft in ihr Zimmer: hurtig machte sich der galante Bube sein Knieband los, zog es durch das Öhr des Porträts und hing es um den Hals. – »Mein Orden ist tausendmal schöner als Ihrer«, sprach er zum Grafen und drückte das Bild so fest an die Brust, daß die Gräfin sich nicht enthalten konnte, ihm für diese unschuldige Schmeichelei einen derben Kuß auf die runden roten Backen zu drücken.
Man öffnete die beiden Flügel der Tür: der Graf erblickte die Spieltische in völliger Bereitschaft: »Zum Spiel«, rief er und bot seiner Gemahlin die Hand, die sie ungern annahm, weil sie sich von ihrem kleinen Liebhaber trennen sollte. Zugleich gab er einem Laufer Befehl, den Knaben zu seinen Eltern zurückzubringen: das war ein Donnerschlag für den armen Verliebten. Er schluchzte, ging niedergeschlagen und langsam zur Gräfin, faßte ihre Hand, küßte sie und brach in lautes Weinen aus: die Dame ward durch die kindische Betrübnis so gerührt, daß ihr eine Träne über die Wange herabrollte: mit hastiger Bewegung riß sie den weinenden Knaben zurück, gab ihm zween recht feurige Küsse, reichte mit einem Seufzer dem versilberten strotzenden Herrn Gemahle die Hand und ging an den Spieltisch.
Die Mutter erwartete ihn an der Tür, als er mit dem Laufer angewandert kam, und empfing ihn mit lautem Jubel über das Glück und die Gnade, die ihm heute widerfahren wäre, und belud seinen Überbringer mit so vielen untertänigsten und alleruntertänigsten Danksagungen dafür, daß sie einen Maulesel nicht schwerer hätte bepacken können. Desto mehr war der Vater wider sie und seinen Leibeserben aufgebracht; er hielt es schlechterdings für eine Beschimpfung seiner Familie, daß sein Sohn sich zu dem Grafen drängte, und wollte ihn kraft der väterlichen Gewalt, zu seinem Besten, mit einer nachdrücklichen Züchtigung bestrafen, wenn nicht die Mutter noch zu rechter Zeit hinzugesprungen wäre und den armen Jungen unter dem ausgeholten Rutenhiebe weggerissen hätte. – »Mag er mich schlagen!« sagte der kleine Heinrich; »hab ich doch mein liebes Bild« – und dabei küßte er das Porträt der Gräfin.
Dies war, beiläufig gesagt, der Zeitpunkt, wo das Stadtpublikum an der ehelichen rechtmäßigen Zeugung des Knaben zu zweifeln anfing.
Drittes Kapitel
Die Gräfin, die – wie man bereits gemerkt haben wird – mehr eitel als stolz war, fand in der kindischen Liebe des kleinen Herrmanns soviel Schmeichelndes, daß sie nach aufgehobner Tafel, als sie ihr Gemahl auf ihr Zimmer gebracht hatte, das Gespräch sogleich auf ihn lenkte. Sie bestand darauf, daß man einem so vielversprechenden Subjekte eine beßre Erziehung verschaffen müßte, als er bei seinen Eltern haben könnte, und tat deswegen den Vorschlag, ihn auf das Schloß zu nehmen und den Unterricht und die Aufsicht des Lehrers mitgenießen zu lassen, den man ohnehin für die kleine Ulrike – eine arme Schwestertochter des Grafen – bezahlte. Ihr Gemahl machte zwar Einwendungen, und darunter eine, die weiser war als alle, die er gewöhnlich zu machen pflegte: er besorgte nämlich, daß man den Knaben durch eine vornehme, seinem Stand und Vermögen nicht angemeßne Erziehung nur unglücklich machen werde. »Wir geben ihm«, sagte er, »eine Menge Bedürfnisse, die er in seiner Eltern Hause nie würde kennenlernen; wir fachen seinen Ehrgeiz nur noch mehr an, da er schon für sich stark genug ist, durch den beständigen Umgang mit dem andern Geschlechte wird seine natürliche Empfindlichkeit erhöht, er wird weichlich, wollüstig und vielleicht gar ein Geck. Haben Sie nicht seinen übermäßigen Stolz bemerkt? – Wenn man sieht, daß er Ihr Liebling ist, wird ihm jedermann schmeicheln, um Ihnen zu schmeicheln, und in zwei Jahren ist sonach er der verdorbenste, aufgeblasenste und unerträglichste Bursch, der niemanden in der Welt achtet als sich selbst. Ihre Güte ist auf alle Fälle zuversichtlich sein Unglück. – Es geht schlechterdings nicht«, setzte er mit seinem gewöhnlichen peremtorischen Tone hinzu.
Der Graf machte sehr oft dergleichen gute oder schlechtere philosophische Anmerkungen und Einwendungen bei jeder Gelegenheit, aber niemals im eigentlichen Ernste, um zu widerlegen oder die vorgeschlagene Sache zu hindern, sondern bloß aus Räsoniersucht, um seinen vorgeblichen Verstand zu zeigen: räumte man ihm daher seine Einwürfe als unüberwindlich ein, so war nichts leichter, als ihn unmittelbar durch diese stillschweigende Anerkennung seiner Überlegenheit zu der nämlichen Sache zu bereden, die er bestritten hatte. Seine Gemahlin kannte alle feste und schwache Plätze seines Charakters so genau, daß sie eine Karte davon hätte zeichnen können, und gestand ihm deswegen in dem vorhabenden Falle mit betrübter Verlegenheit zu, daß es freilich unmöglich sei, so starke und vernünftige Gegengründe zu entkräften. – »Man muß also darauf denken«, setzte sie hinzu, »wie man den Burschen auf eine weniger gefährliche Art unterstützt.«
»Aber«, fiel ihr der Graf ins Wort, »man kann es ja versuchen: merkt man, daß er durch seinen Aufenthalt bei uns verschlimmert wird, so schickt man ihn wieder zu seinen Eltern. Aber freilich, liebe Gemahlin, Sie sind schwach: wenn Sie einmal etwas lieben, dann fällt es Ihnen schwer, sich davon zu trennen: Ihre Liebe wird gleich zu heftig.«
»Freilich wohl, gnädiger Herr!« antwortete die Gräfin seufzend und zupfte mit einiger Verlegenheit an ihrem Kleide. »Ich erkenne wohl, wie sehr Sie recht haben, daß meine Liebe die Leute meistens verdirbt: ich fühle meine Schwäche in diesem Punkte. – Wir wollen den Burschen lassen, wo er ist.«
»Aber«, nahm der Graf mit einer kleinen Hastigkeit das Wort, »warum wollen Sie es denn nicht versuchen, wenn Sie Ihr Vergnügen dabei finden? – Wollen Sie zuweilen eine kleine freundschaftliche Warnung von mir annehmen, im Falle, daß Sie zu weit gehen –«
Die Gräfin.O mit Freuden, gnädiger Herr! Sie wissen, wie willig ich mich von Ihnen leiten lasse, wie gern ich Ihre Vernunftgründe zugebe, daß ich leicht von etwas abstehe, wenn Sie es mißbilligen –
Der Graf.Ja, ich kenne Ihre Güte –
Die Gräfin.Nennen Sie das nicht Güte, gnädiger Herr! Pflicht, Schuldigkeit ist es. Ich schätze mich glücklich genug, daß ich fähig bin, die Richtigkeit und Billigkeit Ihrer Einwendungen und Befehle einzusehen: auf keinen andren Verstand als auf diesen mache ich Anspruch.
Der Graf.War denn Ihre Absicht, daß der Knabe bei uns auf dem Schlosse wohnen sollte?
Die Gräfin.Meine Absicht war es allerdings; denn eine doppelte, so ganz entgegengesetzte Erziehung –
Der Graf.Würde ihn nur verderben! Was er in den paar Stunden, die er sich bei uns aufhielt, Gutes lernte, würde er den übrigen Teil des Tages bei seinen Eltern wieder vergessen; die Fehler, die er bei uns ablegte, würde er dort wieder annehmen. Sein Vater ist ohnehin etwas ungeschliffen. Das täte gar nicht gut: wenn er einmal besser erzogen werden soll, so muß er von der Lebensart seiner Eltern gar nichts mehr zu sehen bekommen. Zudem wäre mir's auch unangenehm, ihn unter uns zu leiden, wenn er hernach wieder mit seinesgleichen, mit gemeinen Jungen auf der Gasse spielen und herumlaufen dürfte.
Die Gräfin.Ihre Bedenklichkeiten sind völlig gegründet: es läßt sich nicht das mindeste dawider einwenden. – Ich will mir die Grille wieder vergehen lassen: der Junge mag bleiben, wo er ist. –
»Aber wozu denn?« rief der Graf mit ereiferter Güte. »Ich will dem Haushofmeister befehlen, daß er –«
Die Gräfin.Ich bitte Sie, gnädiger Herr! Verursachen Sie sich meinethalben nicht die Beschwerlichkeit, einen Jungen um sich zu sehn, der Ihnen freilich anfangs nicht mit der gehörigen Ehrerbietung begegnen wird. –
Der Graf.Das besorge ich eben. Er hat noch keine Manieren, ist auch wohl zuweilen ungezogen: aber ich denke, er soll sich durch unsern Umgang bald bilden.
Die Gräfin.Das hoff ich! – Mir sollte die Sorge für seine Erziehung ein süßes Geschäfte sein. –
Nach einer kleinen tiefsinnigen Pause setzte sie traurig und mit nassen Augen hinzu: »Da mir das Glück keine eignen Kinder zu erziehen gibt, muß ich die mütterlichen Vergnügen an fremden genießen.«
»Aber«, warf ihr der Graf ein, »Sie werden sich zu sehr an den Knaben fesseln, sich zu sehr mit ihm abgeben und dadurch eine unendliche Last auf sich laden.«
Die Gräfin.Meine Last dabei wäre sehr gering: allein für Sie, gnädiger Herr, könnte sie größer sein, als ich wünschte. -Es mag unterbleiben.
Der Graf.Nein doch! Sie sollen sich schlechterdings meinetwegen kein Vergnügen versagen.
Die Gräfin.Und ich will schlechterdings kein Vergnügen genießen, das Ihnen nur eine mißvergnügte Minute machen könnte. Wollte ich doch, daß ich nicht so unbescheiden gewesen wäre. Ihnen von meinem unüberlegten Einfalle etwas zu sagen!
Der Graf.Ihr Einfall muß befriedigt werden: ich geb es nicht anders zu.
Die Gräfin.Gnädiger Herr, ich müßte mir selbst Vorwürfe machen, wenn ich aus Unbesonnenheit Ihre Güte so mißbrauchte –
Der Graf.Ich will nun, ich will.
Nunmehr war er auf den Punkt gebracht, wohin er sollte: er sagte die letzten Worte mit so einem auffahrenden positiven Tone, daß nur noch eine Gegenvorstellung nötig war, um ihn zornig zu machen. War er einmal unvermerkt dahin geleitet, daß er die Sache selbst verlangen und befehlen mußte, die er anfangs bestritt und im Grunde sehr ungern sah, so hatte die Gräfin zuviel Feinheit, um seinen Stolz bis auf das Äußerste zu treiben und einen wirklichen Zorn abzuwarten, sondern sie ergab sich nunmehr mit anscheinendem Widerwillen. -»Ich unterwerfe mich Ihrem Befehle«, sprach sie mit einer tiefen Verbeugung und küßte ihm ehrerbietig die Hand: »Sie können meiner Dankbarkeit gewiß sein und ebensosehr meiner Folgsamkeit, sobald Ihnen Ihre Güte nur die mindeste Beschwerlichkeit –« »Denken Sie nicht mehr daran!« unterbrach sie ihr Gemahl. »Ihr Vergnügen und das meinige können nie ohneeinander sein. –«
Er sagte gleich darauf mit der verbindlichsten Freundlichkeit gute Nacht und trieb die Verbindlichkeit so weit, daß er unmittelbar nach seiner Ankunft in seinem Zimmer bei dem Ausziehen dem Kammerdiener Befehl gab, noch denselben Abend zu dem Einnehmer Herrmann zu gehen und ihm zu melden, daß er sich morgen früh um sieben Uhr vor des Grafen Zimmer einfinden solle.
Die ganze Herrmannische Familie lag schon in tiefem Schlummer: der Hausvater schnarchte bereits so lieblich und mit so mannigfaltigen Veränderungen alle Oktaven durch, daß die arme Ehegattin an seiner Seite nicht fünf Minuten zusammenhängenden vernünftigen Schlummer zuwege bringen konnte. Eben war es ihr geglückt, alle Hindernisse zu überwältigen und in einen sanften erquickenden Schlaf dahinzusinken, als der Kammerdiener des Grafen an der Tür rasselte, und da er diese verschlossen fand, an die niedrigen Fensterladen so emphatisch mit geballten Fäusten anpochte, daß die beiden Eheleute vor Schrecken im Bette weit in die Höhe prellten. Halb aus Scham, halb aus Furchtsamkeit wollte die erwachte Frau das Fenster nicht öffnen, sondern stieß den wieder eingeschlafenen Gemahl so heftig in die Rippen, knipp ihn in die Wangen und paukte ihm endlich so derb auf der Brust herum, daß sich der arme Mann mit einem erstickenden Husten aufrichtete und ein schlaftrunknes »Was gibt's?« herauszukrächzen anfing, als der ungeduldige Kammerdiener mit verdoppelter Stärke an den Laden donnerte. Urplötzlich raffte sich der Mann in der Betäubung auf, rannte an das Fenster, rieß den Laden auf, faßte den Abgesandten des Grafen bei dem Kopfe und schüttelte ihn mit so lebhaftem Grimme, daß er vor Schmerz laut zu heulen anfing. – »Ich bin's ja«, rief er einmal über das andre und nannte seinen Namen. – »So? sind Sie's?« rief Herrmann voller Erstaunen. »Hier haben Sie Ihre Haare wieder.« – Er hatte dem armen kahlköpfigen Alten in der Hitze der vermeinten Beleidigung fast das ganze kleine Toupet ausgerissen und lieferte es ihm, wie er's zwischen den Fingern hielt, unbeschädigt wieder aus. Natürlich konnte eine so gewaltätige Szene nicht ohne Wortzank ablaufen: beide stritten und schimpften, bis sich die Frau vom Hause einfand, ihren Mann vom Fenster wegzog und sich höflich bei dem Kammerdiner nach seinem Verlangen erkundigte: er richtete seine Botschaft aus und ging mit einer angenehmen Ruh, sein ausgerauftes Toupet in der Hand, nach dem Schlosse zurück.
Unbekümmert, ob dieses hohe Verlangen des Grafen nach der Gegenwart des alten Herrmanns Gnade oder Ungnade für ihn bedeuten möchte, legte er sich wieder ins Bette und brummte nicht wenig, daß man ihn um einer solchen Kleinigkeit willen in dem Schlafe störte. Seine Ehefrau hingegen, die den Wert der Botschaft besser fühlte, warf sogleich ihren kattunen ziegelfarbnen Nachtmantel um sich, zündete Licht an und war schon von so großen Gedanken schwanger, daß ihr beide Backen von Erwartung glühten. Sie wollte ihre Mutmaßungen ihrem Manne mitteilen, aber da war keine Antwort. Als eine sorgsame Hausfrau holte sie das feinste Hemde ihres Mannes herbei, nähte daran zwei starre ungeheure Manschetten, wo auf einem musselinen Grunde große Tulpen und Rosen in einem Relief von dickem. Zwirne prangten. Oft ruhte die Nadel, und oft rückte in vielen Minuten die Arbeit nicht um einen Stich weiter; denn die geschäftige Einbildungskraft unterhielt die gute Frau mit einer solchen Menge Aussichten, Gnadenbezeugungen und Lobsprüchen über das Verhalten ihres Sohns – der nach ihrer Meinung den verlangten Besuch veranlaßt haben mußte –, mit so herrlichen Szenen künftiger Größe und künftigen Wohlseins, daß sie sogar in der Selbstvergessenheit zweimal die Arbeit unter den Tisch fallen ließ; und der Nachtwächter meldete eben grunzend unter ihrem Fenster, daß es zwölfe geschlagen habe, als sie den letzten Knoten machte. Darauf ergriff sie das beste Kleid in ihres Mannes Garderobe, jagte den Staub mit lauten Stockschlägen heraus und bürstete so lange, bis sich kein Fäserchen mehr darauf blicken ließ. Die letzte und beschwerlichste Arbeit war noch übrig: die Stutzperücke mußte beinahe ganz umgeschaffen werden: Hoffnung und Freude gaben ihren Händen ungewöhnliche Geschicklichkeit, sie schlugen meisterhafte Locken: alle gelangen auf den ersten Wurf, als wenn sie ein schöpferisches Dichterfeuer belebte, und nunmehr wurde, in Ermangelung des Puders, durch ein Sieb auf die schöne Frisur in so reichlichem Überflusse Mehl gestreut, daß der stattliche Stutz in der schlecht erleuchteten Stube wie ein Morgenstern glänzte. Wirklich fing auch schon die Morgendämmrung an, als sie mit Wohlgefallen den letzten Blick auf ihre Arbeit warf und zum Bette zurückkehrte.
Die Ruhe war unmöglich: ihre Gedanken ließen sie nicht einschlafen: kaum krähte der Hahn zum zweiten Male, als sie wieder aufsprang, um den übrigen Staat für ihren Mann in Bereitschaft zu setzen. Sie weckte ihn und machte indessen Anstalt zum Kaffee.
Herr Herrmann dehnte sich dreimal mit einem lauten Stöhnen und stund auf, achtete weder des schöngepuderten Stutzes noch der blumenreichen Manschetten, noch des übrigen wohlgesäuberten Putzes, ob er gleich ausgebreitet vor seinen Augen dalag, sondern zog seine gewöhnliche Alltagskleidung an, einen grautuchnen Überrock und graue wollne Strümpfe, kämmte sein Haar in eine große Rolle, wie es ihm von sich selbst zu fallen beliebte, und pfiff dabei ein sehr erbauliches ›Wach auf mein Herz und singe‹.
Die Frau brachte den Kaffee, und der Ärger erstickte den ›Guten Morgen‹, den sie schon halb ausgesprochen hatte, als sie ihren Mann in seiner schlechten Alltagsmontur erblickte: sie ward bleich, zitterte, setzte den Kaffee auf den Tisch, stemmte die Arme in die Seiten, wollte sehr pathetisch in Verwundrung und Vorwürfe ausbrechen und – verstummte: der Ärger schnürte ihr die Kehle zu. Sie ging hinaus in die Küche und weinte bitterlich. Indessen schenkte sich ihr Ehegatte ein und pfiff dabei sein Morgenlied so munter und so durchdringend hell wie ein Gimpel, schlürfte einen Schluck aus der Tasse und pfiff weiter. Wie unsinnig lief er mit abwechselndem Fluchen und Pfeifen in der Stube herum, störte alles um, wo eine Tabakspfeife versteckt sein konnte, stieß an den Perückenstock, daß der schöne Stutz über das saubere braune Kleid herunterstürzte und auf seinem ganze Wege, wie ein ausgeschütteter Mehlsack, eine dicke Wolke von sich blies: eine Flasche mit einem Reste vom gestrigen Abendtrunke rollte nach langem Taumeln über den Tisch hin und ließ eine große See von Bier zurück, ehe sie auf den Fußboden herabsprang und in kleine Scherben zerbrach.
Das Geräusch der zerbrechenden Flasche rief die erschrockne Ehefrau in die Stube: sie trat betrübt, mit roten aufgelaufenen Augen herein, als eben ihr wütender Gemahl das treffliche Hemde zusammengedrückt in der Faust hielt und, ohne sich zu bedenken, in die Biersee gerade hineinwarf. – »Ach!« rief die Frau an der Tür aus, und ein Strom von Tränen brach ihr aus den Augen. Ohne ihren schmerzhaften Seufzer wahrgenommen zu haben, drehte sich der Mann und lief hastig auf sie zu. – »Nillchen, Nillchen!« schrie er, »wo ist meine Pfeife?«
Die Frau konnte ihm mit nichts antworten als mit Tränen und einem doppelten – »Ach!«.
»Nillchen, was ist dir denn?« fragte er und suchte in dem Tischkasten. – »Was ist dir denn?«
Die Frau.Ach! du wirst mich noch vor der Zeit ins Grab bringen.
Der Mann.Schaff mir nur erst meine Pfeife! – Ich dich ins Grab? – Warum denn, Nillchen?
Die Frau.Du fragst noch? – Sieh nur, was du gemacht hast! dann brauchst du gewiß nicht mehr zu fragen.
Der Mann.Was hab ich denn gemacht, Nillchen? -Ja, etwas umgeworfen! die Flasche zerbrochen! Warum tust du alle die Sachen nicht an ihren rechten Ort?
Die Frau.So? – Erst sitz ich die ganze Nacht auf und breche mir den Schlaf ab; und hernach bin ich gar noch schuld daran, wenn du, wie ein Heide, alles zerschlägst und verdirbst?
Der Mann.Du hast nicht geschlafen? – Warum denn, Nillchen?
Die Frau.Warum denn als deinetwegen? – Hab ich denn nicht gesessen und genäht, daß mir das Blut aus den Nägeln hätte springen mögen? –
»Da liegt's, das schöne Hemde!« fuhr sie nach einer Pause schluchzend fort und wischte sich mit der Schürze die Augen. – »Da liegt's! ich kann's vor Jammer gar nicht ansehen!«
Der Mann.Ja – und mein schönes braunes Kleid – ach Zeter! wer hat denn das so entsetzlich zugerichtet? Das sieht ja aus, als wenn's im. Mehlkasten gesteckt hätte. Kehr es doch, Nillchen!
Die Frau.Daß ich eine Närrin wäre! Wer den Unflat gemacht hat, salva venia, der mag ihn wieder wegkehren.
Der Mann.Wer hat's denn getan? – Doch wohl der Junge? Die Brut hat niemals die Gedanken beisammen.
Die Frau.Ja, der Junge! der gute Junge hat die Gedanken besser beisammen als der Vater.
Der Mann.Wär ich's gewesen?
Die Frau.Wer denn sonst? – Ich habe an der Perücke gekämmt, daß mir der Arm noch wehe tut: wer sieht's ihr nun an? – Ich möchte dir sie gleich ins Gesicht werfen.
Der Mann.Spaße nicht, Nillchen.
Die Frau.Ja, ich und der Spaß, wir kämen wohl zusammen! -Was willst du denn nun machen, du alter Schmaucher? Du wirst doch nicht in der häßlichen Kutte zum Grafen gehen wollen? Was würde denn der Herr sprechen?
Der Mann.Mag er sprechen, was er will. Wenn ich ihm so nicht gut genug bin, so mag er mich lassen, wo ich bin: ich verlange ja nicht nach ihm.
Die Frau.Schäme dich, Adam! so eine hohe Gnade!
Der Mann.Ich mag keine von ihm. Ich habe so lange ohne sie gelebt –
Die Frau.Adam, sei doch nicht so griesgramicht! Sei ja hübsch freundlich gegen den Herrn Grafen! bücke dich fein tief und antworte nicht immer so kurzweg, wie du zu tun pflegst! Daß du ja nicht so schlechthin ›Ihr Diener‹ zum Grafen sprichst: er nimmt's sehr übel, wenn man nicht ›untertäniger Diener‹ sagt.
Der Mann.Nillchen, ich will sagen, wie mir's gefällt. Ich tue dem Grafen meine Arbeit redlich, und er gibt mir dafür mein Brot: außerdem bin ich weder sein untertäniger noch sein gehorsamer Diener; aber sein Diener bin ich – denn er bezahlt
mich dafür –, nicht ein Haarbreit mehr noch weniger!
Die Frau.Es ist aber doch einmal Mode –
Der Mann.Ach was Mode! die Mode gehört für die Narren: genug, ich gebe mich für nichts Schlechteres aus, als ich bin. – Mache mir den Kopf nicht warm, Nillchen! ich bin so heute nicht aufgeräumt, daß ich meine Pfeife nicht habe.
Die Frau.Du hast itzt keine Zeit zum Rauchen. Wenn du nun mit dem Tabaksgeruche zum Grafen kämst –
Der Mann.Mag er sich die Nase zuhalten, wenn ihm mein Geruch nicht ansteht! Ich verlange nicht von ihm, daß er sich nach mir richten soll: aber ich werde mich auch nicht nach ihm richten. Das wäre der erste, der's so weit bei mir brächte.
Die Frau.Zieh dich nur allgemach an –
Der Mann.Anziehen? Wozu denn? – Nicht eine Faser! Wenn ich mir in dem Rocke nicht zu schlecht bin, so werd ich's dem Grafen wohl auch nicht sein.
Die Frau.Du alter Adam! man hat doch nichts als Schande von dir.
Der Mann.Nillchen, Nillchen, nicht zuviel geschwatzt! -»Ist es denn nicht wahr«, schluchzte die Frau mit halb weinendem Tone. »Ich werde gewiß noch vor Ärger über dich sterben.«
Der Mann.Sei kein Narr, Nillchen!
Die Frau.Wenn ich nur schon tot wäre! – (Dabei brach sie in völliges Weinen aus.) – Ich muß mich ja in die Seele schämen, wenn die Frau Gräfin meinen Mann so einhergehen sieht wie einen schmutzigen Pudel –
Der Mann.Nillchen, es klopft jemand. –
Nillchen öffnete die Tür, und es trat ein abermaliger Bote vom Herrn Grafen herein, der ihn mit Ungeduld erwartete. Er nahm Hut und Stock und ging, ohne ein Wort zu sagen, fort, ob ihm gleich seine Frau mit Tränen um den Hals fiel und ihn um Gottes willen bat, sie und die ganze Familie nicht durch seine schlechte Kleidung zu entehren.
Tränend ging sie an das Fenster, sah durch die Scheibe dem Starrkopfe nach und bedachte nunmehr erst, daß sie ihm nicht hätte widersprechen sollen, um ihn dazu zu bewegen, was sie wünschte. Nicht weniger war sie nunmehr wegen seiner Aufführung bei dem Grafen besorgt.
Der Graf bat ihn mit ungewöhnlicher Herablassung, daß er ihm und seiner Gemahlin die Erziehung seines Sohns überlassen möchte, und stellte ihm, statt der Bewegungsgründe, die große Liebe und Gnade der Gräfin für den Knaben und die wichtigen Vorteile vor, die diesem in Ansehung seines künftigen Glücks daraus zuwachsen würden: er suchte seinen Eigennutz und Ehrgeiz in das Spiel zu ziehen und führte ihm zu Gemüte, daß er ohne die mindsten Unkosten auf diese Weise einen Sohn erhalten werde, der alle Stadtkinder an Bildung, Wissenschaft und guten Manieren übertreffe. Der alte Herrmann stand unbeweglich da, beide Hände übereinander auf den Knopf seines knotichten Stocks gelegt, die eine hinterste Spitze seines großen Hutes zwischen den zwei Vorderfingern der linken Hand. – »Nein«, sagte er endlich trocken, als ihn der Graf fragte, was er zu tun gesonnen wäre-»nein, daraus wird nichts. Wer den Jungen gemacht hat, wird ihn auch erziehen. Mein Sohn soll kein Schmarotzer bei Grafen und Edelleuten werden. Wenn er soviel lernt wie ich, daß er sich sein Brot notdürftig verdienen kann, da hat er genug: nach den übrigen Fratzen soll er mir nicht eine Hand aufheben. –«
»Aber ihn an seinem Glücke, an seiner Bildung zu hindern ist doch sehr unvorsichtig« – wandte ihm der Graf ein.
»Bildung hin, Bildung her!« fiel ihm Herrmann mit auffahrendem Tone ins Wort. »Mit dem Kopfe an die Wand wollt ich ihn rennen, daß er krepierte, wenn so ein Scheißkerl aus ihm würde, so ein geputzter grinsender Tellerlecker, der um die Vornehmen herumkriecht und ihnen den Dreck von den Händen küßt. – Pfui! daß dich der Henker holte!«
Der Graf.Es ist ja doch besser, daß er nicht so roh bleibt wie sein Vater. –
Herrmann.Roh! das bin ich, das will ich sein, und wer mich nicht so leiden kann, der mag mich lassen, wo ich bin. Ich habe in meinem Leben keinem vornehmen Narren aufgewartet. Ich habe das Meinige auf Schulen und Universitäten getan und weit mehr als mancher, der mit sechs Pferden fährt und wunder denkt, was er für ein großer Götze ist. Weil ich nicht um Sterne und Ordensbänder herumspringen und vornehmen Speichel lecken wollte, wurd ich freilich nur Einnehmer in einer hochgräflichen Herrschaft: aber ich mache mir einen Quark aus allen den Titeln und den großen Aufschneidereien. Ich will Vornehmen ehrlich und redlich arbeiten, und sie sollen mich dafür bezahlen; und dann hundert Schritte vom Leibe! So denk ich, und so soll mein Junge auch denken.
Der Graf.Es ist schade um das Kind, daß es so einen ungeschliffenen Vater hat.
Herrmann.