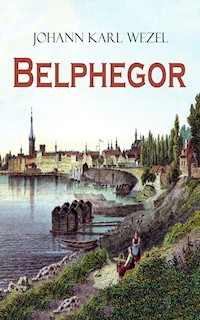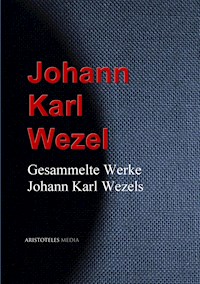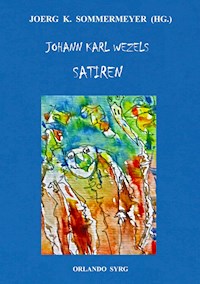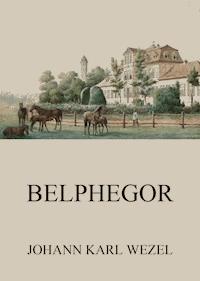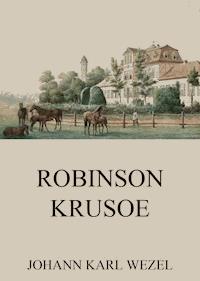
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wezels bereits 1779 erschienene Bearbeitung des Defoe-Klassikers um den schiffbrüchigen Robinson ist ein Klassiker der Literaturgeschichte.
Das E-Book Robinson Krusoe wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robinson Krusoe
Johann Karl Wezel
Inhalt:
Johann Karl Wezel – Biografie und Bibliografie
Robinson Krusoe
Vorrede
Erster Teil
Zweiter Teil
Geschichte der Kolonie
Robinson Krusoe, J. K. Wezel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639778
www.jazzybee-verlag.de
Johann KarlWezel– Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Dichter, geboren am 31. Oktober 1747 in Sondershausen, verstorben ebenda am 28. Januar 1819, wo sein Vater fürstlicher Mundkoch war. Auf der dortigen Schule, besonders von dem gelehrten Konrad Böttiger gehörig vorbereitet, bezog er 1764 die Universität Leipzig und wohnte mit Gellert, von diesem hochgeehrt, in einem Hause. 1769 wurde er vorläufig Hofmeister in der Lausitz, bis er größere Reisen nach Berlin, Hamburg, London, Paris und endlich nach Wien antrat. Hier war er dann eine Zeitlang Theaterdichter und erwarb sich die Gunst Josephs II., der ihn aufforderte, in Wien zu bleiben und als Zeichen seiner besonderen Gunst ihm eine große, goldene Medaille verehrte. W. zog sich jedoch nach Leipzig zurück. Da sich aber 1784 bei ihm Spuren einer Geisteskrankheit zeigten, lebte er seit 1786 wieder in Sondershausen, einsam, ohne jeglichen Umgang und bedürftig, sich währendem von den Ersparnissen, durch fleißige schriftstellerische Arbeiten mühsam erworben, erhaltend. Menschenfreunde nahmen sich seiner an und vereinigten sich zu einer Gesellschaft, welche ihn 1800 zu seiner Genesung nach Hamburg zu dem bekannten Arzt Hahnemann brachte, welcher sich zu seiner Wiederherstellung erboten hatte. Allein dieser erklärte ihn bald für unheilbar und veranlasste seine Rückkehr nach Sondershausen. Von dieser Zeit an schienen zwar lichte Augenblicke seinen verfinsterten Geist zu erhellen, doch kehrten Freude am Leben und am menschlichen Umgang nicht wieder bei ihm ein; obwohl körperlich gesund lebte er still in täglicher Ordnung, nicht ohne zeitweilige Beschäftigung mit Lesen und Schreiben dahin, bis er am 28. Januar 1819 nach nur wöchentlicher Krankheit schmerzlos verschied. – Er schrieb eine beträchtliche Anzahl von Lustspielen, Früchte des kurzen Frühlings seines Geistes, deren leichte Beweglichkeit ihm nicht minder Beifall verschaffte, wie andere seiner Schriften, die sein wissenschaftliches Bemühen verrieten (so z. B. der „Versuch über die Kenntniß des Menschen“, 1784 und 1785), aber das ihm gezollte Wohlwollen befriedigte ihn nicht nur nicht, sondern versetzte ihn in eine bittere Stimmung und erregte endlich eine nicht zu befriedigende Eitelkeit, immer mehr ausartend, ihn abwärts ziehend bis zum entschiedenen Wahnsinn.
Ueber die älteren günstigen Urteile seiner geistigen Erzeugnisse vgl. Jördens in dem Lexicon deutscher Dichter und Prosaisten, 5. Bd.; Meusel, 8. u. 21. Bd.; Ludloff’s Aufsatz: Wezel als Schriftsteller, in d. Gemeinnütz. Blättern f. Schwarzburg, 1808 u. 1810; Eschenburg’s Beispielsammlung z. Theorie u. Litteratur d. schönen Wissenschaften, 7. Bd.; Franz Horn in: Die Poesie u. Beredsamkeit d. Deutschen v. Luther bis z. Gegenw., 3. Bd.; Hesse, Verzeichniß geborner Schwarzburger, 20. St., Rudolstadt, Schulprogr. 1829. – Ueber Wezel’s spätere Schicksale: (Heß) Durchflüge durch Deutschland etc., 1. Bd. und „Nachflug“ dazu: Wezel seit seinem Aufenthalt in Sondershausen v. Z. N. Becker, Erfurt 1799; Gerber’s neues Lexic. d. Tonkünstler, Bd. 4; Blumröder, Ztg. f. d. eleg. Welt 1805 u. 1812; Teutonia 1819; Leipziger u. Jenaer Lit.-Ztg. 1819 (63. Stck., Intelligenzbl. Nr. 14); Allgem. Anzeiger 1828; Thuringia 1841, Nr. 12 u. a. – Mehrere Manuscripte Wezel’s werden auf der fürstl. Regierung in Sondershausen aufbewahrt, so auch Wezel’s Leben von Ludloff in Sondershausen, das u. a. auch Briefe Wezel’s an den Rector Konrad Böttiger enthält.
Robinson Krusoe
Vorrede
Sehr zufälligerweise kam ich auf den Einfall, daß ich im vorigen Jahre eine Umarbeitung des englischen Robinsons für die pädagogischen Unterhandlungen unternahm, und noch unerwarteter komme ich itzt dazu, daß ich die diesmaligen Meßwaren mit einem Robinson Krusoe vermehre.
Herr Campe pries zu Ende des vorigen Jahres in einer weitläuftigen Anzeige den Robinson als eine Panazee wider alle Seelengebrechen an und empfahl ihn besonders als ein treffliches Mittel wider das herrschende Empfindsamkeitsfieber, das er dadurch in seinem Keime bei jungen Seelen zu ersticken hoffte. Ich hatte bisher den englischen Abenteurer für einen guten ehrlichen Kauz gehalten, der durch seine sonderbaren Schicksale und durch eine eigne Mischung von Zaghaftigkeit und Mut, von Einfalt und Klugheit, von Gutherzigkeit und Grausamkeit belustigen könnte; mit Erstaunen wurde ich nunmehr inne, daß ich, ohne es zu wissen, ein wahres schriftstellerisches Arkanum besaß, und da ich das Recht der ersten Besitznehmung darauf hatte, so konnte ich mir unmöglich ein so wichtiges Verdienst um unsre Nation von einem andern wegnehmen lassen, sondern eilte um soviel mehr, das angepriesne Wundermittel je eher, je lieber in die Hände des Publikums zu bringen.
Um indessen allen Verdacht der Marktschreierei zu vermeiden, will ich ganz demütig bekennen, daß ich weder meinem noch irgendeinem Robinson auf der ganzen weiten Welt so eine große Wirkung zutraue, wie die Heilung einer Nationalkrankheit erfoderte; ich glaube nicht einmal, daß er Kindern zu einem Verwahrungsmittel wider die falsche Empfindsamkeit dienen kann, wenigstens würde er wider Natur und Beispiel nicht viel vermögen, und die gegenwärtige Empfindsamkeit ist kein gemachtes, bloß von gewissen Schriften veranlaßtes, sondern größtenteils ein natürliches Übel. Ihre erste hauptsächlichste Ursache liegt in dem verderbten Stoffe der Körper, in der Lebensart, in den Nahrungsmitteln, in den Sitten; alles dieses zielt darauf ab, die Eingeweide, den wahren Quell der Empfindsamkeit, durch Überspannung und Ruhe zu schwächen, ihnen eine unregelmäßige Reizbarkeit mitzuteilen und sie für die leiseste Berührung jeder Idee empfindlich zu machen; die gehäufte Anzahl hypochondrischer und hysterischer Personen, die daraus entstund, erzeugte zuerst die teutsche Empfindsamkeit. Je unmäßiger in einer Stadt Kaffee getrunken wird, je mehr dabei die Einwohner durch städtische Familienkriege, steife, ungesellige Sitten, Stolz oder andre Ursachen sich in die Zimmer einkerkern, leckerhafte, reizende, schlaffmachende Speisen und Getränke genießen, nichts als trockne gesellschaftliche Vergnügungen kennen, je mehr Empfindsamkeit wird unter ihnen herrschen. Nun kömmt es darauf an, welche Art von Ideen und Büchern am meisten im Umlaufe sind: liest man viel Gebetbücher und theologische Schriften, so bekömmt die Empfindsamkeit das Kleid der Bigotterie, des Fanatismus, der Andacht; liebt man moralische Bücher voll Tugend, Menschenfreundlichkeit und Mitleid, dann nimmt sie den Mantel der Tugend um; stehen Romane und Liebesgeschichten in Ansehen, so mischt sich die leidige Liebe ins Spiel, und Ärzte und Buchhändler können uns also berichten, wie hoch an jedem Orte der Thermometer der Empfindsamkeit steht und welches ihr stadtübliches Modekleid ist – Religion, Tugend oder Liebe. Diese Hauptquelle der Empfindsamkeit können auch nur Ärzte und solche Personen hindern, die durch ihr Beispiel Einfluß auf Sitten und Lebensart haben; die Schriftsteller haben nichts getan, als daß sie ihre Richtung auf einen andern Gegenstand leiteten. Sonst war die teutsche Empfindsamkeit Pietismus; Youngs »Nachtgedanken« machten sie zu poetischer Andächtelei; die Richardsonschen Romane, diese Galerien von idealen Charaktern und moralischen Gemeinplätzen, verwandelten sie in moralische Engbrüstigkeit; »Yoricks empfindsame Reisen« gebaren uns einen Namen für eine längst existierende Sache und wirkten mehr auf die Schriftsteller als auf die Leser, weil der Mann den losen Streich gespielt und mit seiner Empfindsamkeit Witz verbunden hatte; endlich wurde sie durch melancholische Geschichten und süßlichte Romane zu melancholischer und tändelnder Liebe. Der Hang zur Empfindsamkeit liegt in der Stimmung des teutschen Geistes: je mehr die Art des Verstandes, die vom Witze modifiziert wird, in unsern Schriften sich ausbreitet, je mehr werden sich auch bei den Lesern die Federn des Kopfes anspannen und jener Hang zur Empfindsamkeit vermindert, wenigstens in ein vernünftigeres Gleis gebracht werden. Daß es der Mühe wert ist, einige Saiten des Nationalgeistes anders zu stimmen, wird jeder leicht begreifen, der mehr denkt als empfindet: durch Verstand und Witz haben bisher alle Nationen mit ihrer Literatur geglänzt, durch Empfindung noch keine.
Etwas kann also unstreitig der Schriftsteller beitragen, das schädliche Übergewicht der Empfindsamkeit zu schwächen: die affektierte geißle er mit dem unbarmherzigsten, bittersten Spotte, daß sie vor seinem Gelächter flieht wie der Satan vor einem Gebetbuche; die unaffektierte, die aus dem Charakter entstund und durch Lektüre eine oder die andre Richtung bekam, in ihre gehörigen Grenzen allmählich bei der Nation und ihren einzelnen Mitgliedern zu bringen, schreibe er Bücher, die das einzige Gegengift dawider enthalten – Verstand und Witz, gebe uns Gemälde des wahren menschlichen Lebens und allen seinen Werken eine solche Mischung von Verstand und Empfindung, wie sie die Natur in wohltemperierten Seelen angeordnet hat.
Um bei der aufwachsenden Jugend der Nachahmung vorzubauen und in ihnen eine adäquatere Stimmung des Geistes vorzubereiten, weiß ich kein ander Mittel, als den Grundsatz zu befolgen, auf welchen ich die ganze Erziehung zurückzubringen gesucht habe: »man entwickle alle Kräfte in dem besten Ebenmaße, so sehr es die persönliche Beschaffenheit und politische Lage bei einem jeden Subjekte zulassen.« – Dies ist das Geschäfte des Pädagogen; will der Schriftsteller auch das Seinige zu diesem Behufe tun, so muß er's freilich durch ein Buch bewerkstelligen, das die Menschen von der Passivetät zur Tätigkeit hinzieht; aber Robinson ist dazu viel zu schwach. Es muß ein Buch sein, das an Einbildungskraft, Witz, Verstand und Dichtergeist allen die Waage hält, die die Empfindsamkeit ausgebreitet haben; das ein Beispiel großer, edler, aufstrebender Tätigkeit enthält, wie sie jeder Jüngling nachahmen kann; das die Triebfeder der menschlichen Größe, die Ehre, anspannt; ein Beispiel voll Nerven, Geist, starker, männlicher Empfindung; ein Charakter, aus den zwei Hauptelementen einer großen Seele, aus hoher Denkungsart und gefühlvollem Herze, zusammengesetzt, ohne die mindeste idealische Vollkommenheit, mit Schwachheiten und Gebrechen beladen, aber eine Seele voll Gleichgewicht; dieser Charakter muß durch eine Reihe von wahrscheinlichen Begebenheiten ohne alle Abenteuerlichkeit hindurchgeführt werden, immer stolpern, oft durch die Übertreibung seiner guten Eigenschaften fallen, dem Untergange und sogar dem Verbrechen sich dadurch nähern und durch seinen wirksamen, starken, männlichen Geist sich wieder emporreißen, mit Leidenschaft, Phantasie, Menschen und Schicksal kämpfen und doch mit unerschütterlichem Ausharren zu seinem letzten Zwecke hindurchdringen – zu dem Zwecke, durch nützliche Geschäftigkeit auf einen beträchtlichen Teil seiner Nebenmenschen auf eine Art zu wirken, wie sie in unsrer Welt und bei unsrer Verfassung möglich ist. Nur ein solches Buch, aus unsrer gegenwärtigen Welt geschöpft, das uns Sitten, Leidenschaften, Menschen und Handlungen mit ihren Bewegungsgründen nicht nach moralischen Grundsätzen, sondern aus der Erfahrung darstellt; das dem Jünglinge ein wahres Bild von dem menschlichen Leben, dem Spiel der Leidenschaften, Begierden, Wünsche und Torheiten, von den betrügerischen Täuschungen der Einbildungskraft und Empfindung, dem Glück, das sie geben, und dem Unheile, das sie stiften, mit einnehmenden, aber nicht übertriebnen Farben vorzeichnet und jungen Leuten eine Menschenkenntnis verschafft, die sie später mit ihrem Schaden durch eigne Erfahrung erwürben; das die Tugend nicht wie eine Feenkönigin und das Laster nicht wie einen Teufel malt, sondern jene als ein schwaches, gebrechliches, artiges, aber zärtliches Weibchen und dieses wie einen gleißenden Betrüger, der Gewalt braucht, wo keine List hilft – nur ein solches auf den Ton der wirklichen Welt gestimmtes Buch, sage ich, kann den erschlafften Nerven der Seele eine andre Spannung allmählich geben, insofern dies ein Buch vermag. Die Kraftmänner, die itzo, dem Himmel sei Dank! vor Überspannung eingeschlafen zu sein scheinen, hatten zwar auch die Absicht, die Nationalstimmung männlicher und straffer zu machen, aber die Tätigkeit, die sie am meisten durch ihr eignes tolles Beispiel predigten, war Fieberhitze, Streiche in die Luft, renommistische Tapferkeit und keine von Verstand und Ehre geleitete Kraft.
Robinson, in seinen rechten Gesichtspunkt gestellt, in welchem ich ihn auch bearbeitet habe, ist eine Geschichte des Menschen im Kleinen, ein Miniaturgemälde von den verschiedenen Ständen, die die Menschheit nach und nach durchwandert ist, wie Bedürfnis und zufällige Umstände einen jeden hervorgebracht und in jedem die nötigen Erfindungen veranlaßt oder erzwungen haben, wie stufenweise Begierden, Leidenschaften und Phantasien durch die äußerliche Situation erzeugt worden sind. In der Geschichte selbst habe ich diese Stufen der Entwicklung deutlich angegeben und hineinzubringen gesucht, so sehr der Plan des Originals es erlaubte. Es scheint nicht, daß Defoe diese philosophische Idee eigentlich dabei gehabt hat, und sein Schatten wird mir vergeben, daß ich ihm etwas andichte, woran er vielleicht nicht dachte. Zusammendrängung der Geschichte, ihre Richtung auf den vorhin genannten Zweck, Erfindung, Anordnung und Kolorit einiger Naturszenen, Umbildung einiger Begebenheiten, Ton und Gang der Erzählung sind alle Verdienste um meinen Abenteurer, auf welche ich mit Recht Anspruch machen kann; das übrige gehört seinem ersten Verfasser.
Als ein Lesebuch für Kinder betrachtet, welches seine erste Bestimmung war, könnte man vielleicht zweifeln, ob der Ton allemal der Fassungskraft des kindischen Alters angemessen sei, besonders wenn man ihn mit der Schreibart vergleicht, in welcher gegenwärtig viele Schriftsteller mit den Kindern reden; allein, ob ich gleich das Kinderpublikum bei der Ausarbeitung nicht vor Augen gehabt habe, so glaube ich doch, daß man auch zu diesem Behufe mein Büchelchen gebrauchen kann. Menschen von gewöhnlichen Fähigkeiten dürfen von Rechts wegen vor dem zehnten, zwölften Jahre nicht zur Lektüre als Zeitvertreib angehalten werden, wofern sie nicht ein besondrer Trieb zu dieser Art des Vergnügens hinzieht, sonst entstehen Stubengucker, Kabinettsphilosophen, die die Dinge nicht nach den natürlichen Eindrücken auf ihre Organe, sondern nach gelernten Vorurteilen schätzen, vorzüglich da die Bücher selten etwas anders als Sammlungen von Vorurteilen sind. Bewegende Spiele, die Blut und Lebensgeister in Umtrieb bringen und die Lebhaftigkeit der sinnlichen Werkzeuge stärken, müssen der Zeitvertreib des ersten Alters sein und nur dann das eigne Lesen allmählich dazu gemacht werden, wenn die Seelentätigkeit zu erwachen und mit der körperlichen zu streiten pflegt; alsdann muß man sich in den Streit mischen und ihn zum Vorteil der erstern zu lenken suchen, den Körper zum gehorsamen Gehülfen erniedrigen und dem Geiste auch bei dem Vergnügen die Oberhand verschaffen. Für dieses Alter war also mein Robinson zunächst bestimmt, und sein Gebrauch sollte bis zu den Jahren reichen, wo der Jüngling mit den Leidenschaften und ihren mancherlei Folgen, mit dem Spiele des menschlichen Herzens und der Welt, den Sitten, Charaktern und Handlungsarten der Menschen bekannt werden soll, und diese Bekanntschaft sollten ihm die eigentlich sogenannten Romane verschaffen.
Bücher für diese ersten Jahre der Lektüre – vom zwölften bis zum achtzehnten – müssen auf der einen Seite die Reflexion erwecken und den Kopf mit Factis versorgen, welches bekanntlich die Elemente der menschlichen Erkenntnis sind, auf der andern solche Leidenschaften mit ihren guten und schlimmen Folgen schildern, die die Natur in diesem Alter entwickelt. Kinder und Jünglinge sollen nicht lebendige Moralen, sondern nur moralisch klug werden, und zu diesem Endzwecke kenne ich kein ander Mittel, als daß man ihnen Affekten und Leidenschaften in der Ordnung darstellt, wie sie die Natur in ihnen aufweckt, und ihnen das Gute und Schlimme ihrer Wirkungen anschaulich zeigt; nun mag sie der junge Mensch fühlen, mag mit ihnen streiten und kämpfen, so sehr es seine Natur will, und mehr oder weniger Schaden dabei leiden, wie es die Stärke und Schwäche seiner Vernunft, die größre oder geringere Heftigkeit seiner Begierden zuläßt. Gemälde der Liebe dem Jünglinge verwehren ist, gelinde gesprochen, Mangel an Einsicht und eingeschränkter Blick, aber ihn vor aller einseitigen Kenntnis dieser Leidenschaft bewahren, ist Klugheit und Notwendigkeit. Man ist daher sehr eilfertig und verlangt von dem Dichter, daß er diesem Übel abhelfen und keine einseitigen Schilderungen machen soll, ohne zu bedenken oder zu wissen, daß einseitige Schilderungen, besonders in kleinen Werken, wie im Drama, unentbehrliches poetisches Bedürfnis sind. Der Zweck, worauf der Dichter arbeitet, ist der beste poetische Effekt, und er gebraucht dazu die Mittel, die ihn nach seiner Einsicht hervorbringen. Daß sein nach dieser Regel entstandnes Werk zufälligerweise diesem oder jenem Subjekte Schaden tut, dafür kann er so wenig als der liebe Gott, der Leidenschaften, Schmerz und Mangel zu Triebfedern der nützlichsten Tätigkeit, aber auch für manchen zur Ursache des Unglücks und des Lasters machte. In größern Werken, wie in Romanen, kann man schon etwas begehrlicher von dem Dichter fodern, nicht daß er den poetischen Effekt dem moralischen Endzwecke aufopfern, sondern daß er sie beide vereinigen soll, wo er kann. Kein Ding auf dieser Erde ist allgemein schädlich oder nützlich: ob es eins von beiden werden soll, hängt von der Beschaffenheit des Menschen ab, welcher eine Wirkung von ihm empfängt. Wie kann aber der Dichter darauf denken, ob nicht hie und da ein schwachköpfichter, schwachherziger oder verderbter Jüngling sein Buch in die Hand nimmt und es zu seinem Schaden liest? Auch die unschädlichste Speise wird in einem Körper voll verdorbner Säfte zu Gift und einem schwachen Magen ungesund. Der Dichter liefert ein Stück Welt, und der Moralist darf ihn nur dann zur Rechenschaft ziehen, wenn sein Gemälde in Rücksicht auf die Ursachen und Folgen der Handlungen, Charaktere und Leidenschaften nicht treu ist; wenn er einen Mann, den er uns durch seinen Verstand als ehrwürdig vorgestellt hat, das Laster empfehlen oder die Wollust den Geist schärfen und den Leib stärken läßt, dann verschreie man ihn als einen Lügner, der die Natur und seine Leser belogen hat; aber daß er den Rachsüchtigen in den Augenblicken der Rache Vergnügen fühlen, den Verliebten sich in Freude berauschen läßt, das kann ihm niemand verargen, weil das Gegenteil nicht in der Natur wäre. Sein Publikum sind Männer von gesundem Verstande und gesundem Herze, und der Pädagog ist ungerecht, wenn er ihm ein andres unterschiebt; er kann in kleinen Werken nur einseitige Schilderungen geben, und der Pädagog übersieht das Bedürfnis und die Einschränkung der dichterischen Kunst, wenn er ihn darüber tadelt. Es ist des Erziehers Sache, aus diesen verschiedenen einseitigen Gemälden die vollständige Kenntnis seines Zöglings zu bilden; auf ein Gedicht, eine Erzählung, ein Drama, das Liebe, Melancholie, Empfindsamkeit usw. auf der einnehmenden glänzenden Seite darstellt, lasse er in der Lektüre seines Untergebenen unmittelbar ein andres folgen, das diese Dinge auf der Rückseite zeigt, wie sie das Leben verbittern, Verwirrung und Unordnung in dem menschlichen Leben verbreiten, die Glückseligkeit untergraben, und der junge Mensch muß sehr dumm oder schon sehr verderbt sein, wenn er sich nicht in aller Stille bei sich eine kleine Klugheitsregel daraus zieht. Moralische Güte kann kein Pädagog und kein Dichter in Subjekten entwickeln, in welche die Natur keine Anlagen dazu legte, aber eines Grades von moralischer Klugheit sind alle fähig, können alle von Dichtern und Pädagogen lernen, die ihnen von Menschen und Welt vollständige Kenntnis geben.
Mit ebenso vieler Unbilligkeit rücken Laien in der Kunst den Dichtern den Gebrauch der törichten und lasterhaften Charaktere vor; sie übersehen, daß Kontrast eins von den obersten poetischen Hülfsmitteln ist und daß ein Werk, dem es in Leidenschaften, Situationen und Charaktern ganz daran fehlte, notwendig unschmackhaft sein müßte. Aber auch von der moralischen Seite betrachtet, ist es für Junge und Alte höchst schädlich, Laster und Torheit vor ihnen zu verbergen und sie nur in Gesellschaft moralischer Drahtpuppen und tugendhafter Weisen zu bringen; den Schaden auseinanderzusetzen wäre für eine Vorrede zum Robinson zu lang; ich habe mich ohnehin durch mein Geplauder von der Hauptabsicht verloren, warum ich sie schrieb, und den Einwurf nicht gehoben, den man wider die Brauchbarkeit meines Büchelchens zur Kinderlektüre machen könnte.
Es ist eine durchaus falsche Maxime, die sich auf eine ebenso falsche Beobachtung gründet, wenn man behauptet, daß man für Kinder anders schreiben soll als für Erwachsene, auch in der Erzählung und nicht bloß bei Sachen des Verstandes. Man muß für alle Alter deutlich und mit Geschmack schreiben, und ich begreife nicht, warum ein kraftloser, wäßrichter, schlechter Stil, voll ekelhafter Wiederholungen und tätschelnder Ausdrücke dem Kinderverstande angemessener sein soll. Bei den meisten Kinderbüchern sollte man glauben, daß sie von Kindern und nicht für Kinder geschrieben wären; wir töten den guten Geschmack im Keime, gewöhnen sie an das Schlechte und verderben sie durch solche elende Sprache so sehr als durch den vorgekauten Brei, womit wir sie von den Ammen stopfen lassen. Der Knabe muß schlechterdings in einem Buche, das er liest, nicht alles verstehen; er frage, sinne oder suche nach, Prudens interrogatio, dimidium scientiae. Solange uns ein Wort, eine Idee, eine Sache nicht durch ihre Fremdheit rührt, haben wir kein Interesse, sie kennenzulernen, und ohne dieses Interesse hilft weder Erklärung noch sonst ein Hülfsmittel; auch ist die vorgebliche Deutlichkeit der itzigen Kindersprache eigentlich Weitschweifigkeit und also der deutlichen Vorstellung völlig hinderlich.
Robinsons Familie stammte ursprünglich aus Teutschland her: sein Vater war aus Bremen gebürtig, verließ seinen Geburtsort, um sich in England niederzulassen, erwarb sich in diesem Lande viel Vermögen durch den Handel und wählte die Stadt York zum Aufenthalte für den Rest seines Lebens. Hier heiratete er, und aus seiner Ehe entstand der berühmte Seefahrer, dessen Geschichte itzo jedermann erfahren soll, der meiner Erzählung zuzuhören Lust hat. Die Familie der Mutter hieß Robinson; unser Held nannte sich mit dem vereinigten Namen seiner beiden Eltern Robinson Kreuzner, und die Engländer, diese großen Namenverderber, schufen daraus einen Robinson Krusoe.
Der junge Robinson wurde für die Rechtsgelehrsamkeit bestimmt, allein sein Unternehmungsgeist gab ihm einen so starken Hang zum Leben eines Seefahrers, daß ihn die vernünftigsten Vorstellungen und dringendsten Bitten seiner Eltern von einer so mühevollen gefährlichen Laufbahn nicht abzubringen vermochten. Sein Vater hielt ihm tägliche Ermahnungen, daß er den Vorteil, in einem ruhigen wohlhabenden Mittelstande geboren zu sein, nicht verschmähen sollte. – »Nur dieser Stand«, sagte er ihm oft, »ist zur wahren Glückseligkeit ausgesondert, dahingegen die höhern und niedern Klassen die Übel des menschlichen Lebens unter sich teilen. Der Große wird von Leidenschaften, Projekten, künstlichen Bedürfnissen und künstlichen Leiden gequält; der Landmann, der Handwerker, der Fabrikant kämpft mit den Beschwerlichkeiten körperlicher Arbeit, oft mit Mangel und beständig mit der Ungewißheit des Unterhalts. Der Große wird durch Bequemlichkeit und Überfluß zu tausend Ausschweifungen verleitet, die seine Kräfte, seinen fröhlichen Mut, sein Leben verzehren; die Unbekanntschaft mit dem Elende macht ihn hart, unempfindlich, zu Freundschaft und Wohlwollen weniger geneigt; er seufzt unter Zwang und Langeweile, wenn sie ihm die Gewohnheit auch noch so erträglich macht, und über der unaufhörlichen Bemühung, sich nach andrer Denkungsart zu richten, verliert er selbst seine eigne. Ungesunde, durch Sitzen oder Anstrengung entkräftende Beschäftigungen vergiften in den niedern Ständen das Leben und stecken das Gemüt mit schlechten, unfreundlichen Gesinnungen an. Ein Mittelmann, der Vermögen genug besitzt, um der Abhängigkeit zu trotzen, wenn sie zu schwer drückt, der in seinen Schicksalen wohl Ebbe und Flut, aber nie Sturm und Ungewitter leidet, ist dieser nicht glücklicher als die übrigen? Er hat soviel Leidenschaft und Unglück, als nötig ist, um das Leben nicht tot, fade und lästig zu machen, und selten von beiden so viel, daß es ihn zu Boden schlagen könnte.«
Diese halb wahren und halb falschen Vorstellungen hörte der Sohn gelassen an, glaubte alles und beharrte in seiner Neigung. Er beredte seine Mutter, daß sie ihm bei dem Vater die Erlaubnis auswirken sollte, dem Hange zum Seeleben zu folgen, und da der Alte auch ihren Bitten sich unbeweglich widersetzte, so drang der unbesonnene Jüngling mit der Tollkühnheit eines Wagehalses durch Hindernisse, die er nicht anders wegräumen konnte: er entlief seinen Eltern und ging mit dem ersten Schiffe, das sich ihm darbot, von Hull, wohin er geflüchtet war, nach London, um daselbst Gelegenheit zu wichtigen weiten Fahrten zu finden. Die Angst über einen kleinen Sturm, der dem unerfahrnen Burschen ein großer tobender Orkan zu sein schien, bestrafte ihn den Tag nach seiner Abreise für einen gewagten Entschluß, dessen Gefährlichkeit er nunmehr sehr lebhaft fühlte; allein die wüste Gesellschaft, unter welcher er sich befand, ersäufte seine Reue in Punsch und Branntewein; man sprach ihm Mut ein, und die Herzhaftigkeit, die ihm fehlte, mußte ihm der Trunk verschaffen.
Einige Tage darauf erfuhr er eine noch härtere Bestrafung: ein viel größrer Sturm erhob sich mit solcher Gewalt, daß man das schwache und schwerbeladne Schiff den Wellen überlassen und sich auf einem Boote retten mußte. Als ein Bettler, abgerissen, von Gefahr und Angst entkräftet, mußte der unerfahrne Jüngling zu Fuß nach London gehn; selbst diejenigen, die ihn vorher zu dem Seeleben aufgemuntert hatten, rieten ihm itzo davon ab, weil sie weniger Standhaftigkeit und Kraft in ihm fanden, als dieser Beruf fodert – nichts half! Begierde überwog bei ihm die Stärke so sehr, daß er noch itzt dem Rate, zu seinem Vater zurückzukehren, nicht folgte; er wankte einige Zeit, und die Scham vor seinen Eltern und Anverwandten bewegte ihn endlich, sich auf ein Schiff zu begeben, das nach der afrikanischen Küste bestimmt war.
Der Herr des Schiffes, auf welchem er nach Afrika ging, veranlaßte ihn durch die Freundschaft, die er für ihn sogleich nach dem Anfange ihrer Bekanntschaft faßte, zur Unternehmung dieser Reise; von der Lebhaftigkeit und Gesprächigkeit des jungen Menschen eingenommen, bot er ihm freie Fahrt an und die Erlaubnis, eine kleine Summe zu einem Handel mit Kleinigkeiten anzulegen, die sich an der Küste von Guinea mit Vorteil absetzen lassen. Robinson trieb mit Beihülfe einiger Anverwandten vierzig Pfund Sterlinge auf und brachte dafür bei seiner Rückkunft ohngefähr dreihundert Pfund zurück. Er gewann die Zuneigung und das Vertrauen des Schiffkapitäns und erlangte auf dieser Reise durch ihn viele Kenntnisse in der Mathematik, Schiffahrt und Sternkunde.
Die Reise ging ohne alle widrige Zufälle vonstatten; so vieles Glück und so vieler Gewinst spornte ihn an, eine zweite zu wagen, aber zu seinem Unglücke! Die größten Widerwärtigkeiten vereinigten sich, seinen seemännischen Mut zu erschüttern. Wer wird hier nicht sogleich einen Seeräuber kommen sehn, der ihn in die türkische Gefangenschaft bringt? – Getroffen! Zwischen den Kanarischen Inseln und der Küste von Afrika fand sich bei Anbruch des Tages ein Korsar aus Sale ein und machte mit allen Segeln Jagd auf das Schiff, mit welchem Robinson reiste. Der Kapitän hielt es für klüger, einem Räuber zu entfliehen als zu widerstehen, und segelte so schnell, als möglich war, von ihm hinweg, doch alle Schnelligkeit half nicht länger als bis nachmittags gegen drei Uhr, wo der Türke so nahe kam, daß man sich zum Streite rüsten mußte. Der Bösewicht wollte das Schiff von hintenzu angreifen, aber durch ein Versehen traf seine erste Kanonade die rechte Flanke; man beantwortete sie mit acht Kanonen, man feuerte auf beiden Seiten lange mit Kanonen und Flinten, der Räuber ersah seinen Vorteil, sechzig von seinen Leuten warfen sich in das angegriffene Schiff und richteten unter Mastbäumen und Tauen mit ihren Äxten eine schreckliche Verwüstung an. Man schoß zwar die beschnittnen Feinde tapfer wider die Köpfe, allein sie behielten doch bei aller Gegenwehr die Oberhand; sie hatten das Schiff mastlos und unbrauchbar gemacht, es mußte sich ergeben, und Robinson wurde nebst seinen übrigen Gefährten als Gefangner nach Sale geführt.
Die Leser, die vorhin die Ankunft des Seeräubers so richtig mutmaßten, werden gewiß nunmehr ganz schreckliche Behandlungen in dieser Gefangenschaft erwarten, aber da irren sie sich: es geht unserm Robinson ziemlich gut darinne. Freilich ist er aus einem Kauf- und Handelsmanne zum Sklaven geworden, aber er wird doch nicht mit den übrigen Gefangnen zur Residenz des Kaisers geschleppt, sondern der Kapitän des Raubschiffes behält ihn als einen jungen muntern Burschen für seinen Anteil von der Beute.
Robinson, dem sein neuer Zustand sehr wenig behagte, machte schon Entwürfe zur Flucht, nachdem er kaum darein versetzt war. Er hoffte zuverlässig, daß ihn sein neuer Herr, wenn er auf Streifereien ausging, mit sich zur See nehmen würde; alsdann war doch wahrhaftig nichts leichter möglich, als daß ein spanisches oder portugiesisches Kriegsschiff den Korsaren bald oder spät in seine Gewalt bekam, und so hatte Robinsons Sklaverei ein erwünschtes Ende – aber nichts von dem allen geschah. Der neue Herr nahm ihn nicht mit sich zur See, wurde von keinem spanischen oder portugiesischen Kriegsschiffe überwältigt, und Robinsons Sklaverei nahm kein erwünschtes Ende, sondern er mußte zu Lande bleiben, das Gärtchen seines Herrn bauen und alle andre ökonomische Verrichtungen im Hause tun; kam der Kaper von seinen Wanderungen zurück, so mußte Robinson in der Kajüte schlafen und das Schiff bewachen.
Sooft er diese Schildwache hielt, so oft dachte er auch auf die Flucht, aber mit allem Nachdenken war kein Mittel dazu auszusinnen, weil er keinen Mitsklaven hatte, der seine Sprache verstand und die Ausführung seines Vorhabens mit ihm teilen konnte; für sich allein wagte er nichts zu unternehmen und mußte also ganze zwei Jahre in diesem Zustande ohne Rettung und Hoffnung aushalten.
Endlich wurde die Gelegenheit für ihn günstiger. Sein Herr war unglücklich gewesen, hatte kein Geld, um sein Schiff auszurüsten, und war also genötigt, länger als gewöhnlich auf dem Lande zuzubringen. Da auf diese Weise sein Krieg mit den Menschen ruhen mußte, so zog er wider die Fische zu Felde und fuhr wöchentlich etlichemal in dem kleinen Boote auf den Fang aus; Robinson und ein junger Mohr begleiteten ihn alsdann, und weil sich der erste sehr geschickt und eifrig im Fischen bewies, so faßte er soviel Zutrauen zu ihm, daß er ihn mit einem Mohren von seiner Anverwandtschaft zuweilen aussandte, um ihm ein Gericht für seinen Tisch zu fangen.
Auf einer solchen Fahrt wurden sie von einem so dichten Nebel überfallen, daß sie die Küste nicht erkennen konnten und einen Tag und eine Nacht auf dem Meere zubrachten; als er verschwand, sahen sie sich wenigstens eine Meile vom Lande entfernt und ruderten mit desto größrer Arbeit und Gefahr nach ihm zurück, weil der Wind heftig zu blasen anfing. Seit diesem Zufalle tat der Kapitän keinen Zug wider die Fische mehr, ohne sich mit Kompaß und Mundvorrat zu versorgen, und ließ zu diesem Endzwecke das große Boot des Schiffes, auf welchem Robinson gefangen wurde, zurechtmachen, eine Kajüte darauf bauen und darinne Schränke für Branntewein, Reis, Kaffee und andre Lebensmittel anbringen.
Eines Tages fiel es ihm ein, mit einigen Mohren von seiner Bekanntschaft auf diesem Boote eine Lustfahrt zu halten, und er ließ deswegen starke Vorräte hineinschaffen, nebst drei Flinten und einer hinlänglichen Menge Pulver und Blei, um Seevögel zu schießen, wenn das Fischen sie nicht mehr belustigte. Als Robinson seinem Befehle gemäß alles in Bereitschaft gesetzt und die Gesellschaft im Boote lange erwartet hatte, kam sein Herr allein, berichtete ihm, daß seine Freunde die Partie wieder abgesagt hätten, und gab ihm den Auftrag, mit den gewöhnlichen zween Begleitern, seinem Verwandten und einem jungen Mohrensklaven, auszufahren und etwas für das Abendessen zu fangen, das seine Freunde bei ihm einnehmen wollten. – Halt! dachte Robinson bei sich, itzt wirst du entwischen können; hier hast du ein kleines Fahrzeug mit so vielen Vorräten in deiner Gewalt, was braucht es weiter? –
Er nahm seine Maßregeln diesem Entschluß gemäß, beredete den Anverwandten des Kapitäns, einen Korb voll von ihrem Zwiebacke und einige Flaschen frisches Wasser hineinzuschaffen, unter dem Vorwande, daß sie die Vorräte ihres Herrn nicht anrühren dürften, wenn sie etwa ein Unfall wie letzthin zu weit vom Lande entfernte. Robinson trug heimlich noch andre Bedürfnisse, eine Hacke, Wachs, Stricke und was er nur fortbringen konnte, hinein. Auch tat er den Vorschlag, Flinten und Pulver herbeizuschaffen, damit sie zu ihrem eignen kleinen Vergnügen eine Jagd mit Seevögeln halten könnten; der Bursche argwohnte nichts Böses und willigte mit Freuden darein. Eine Weile vom Hafen machte man den Anfang zu fischen, doch Robinson überredete dem Mohren, daß hier die Fische noch zu schlecht wären, und bewegte ihn, eine Stunde weiterzufahren. Als sie stillhielten und der Anverwandte des Kapitäns im Vorderteil des Bootes stand und sich langweilig umsah, übergab Robinson dem kleinen Mohrensklaven das Ruder und ging zu jenem hin, als wenn er etwas neben ihm suchen wollte, ergriff ihn bei den Füßen und stürzte ihn glücklich über Bord. Der Mohr schwamm wie eine Ente, kam an das Boot heran und bat inständigst, daß er ihn wieder einnehmen möchte, doch Robinson hielt ihm eine Flinte entgegen und sagte ihm drohend: »Ich habe dir kein Leides getan, schwimme zum Ufer, da das Meer ruhig ist! Näherst du dich meinem Bord, so fährt dir diese Kugel durch den Kopf, denn ich bin fest entschlossen, meine Freiheit zu suchen.« – Der Mohr wollte die Wahrhaftigkeit der Drohung nicht auf die Probe stellen, sondern lenkte sogleich um und schwamm dem Ufer zu und wird vermutlich gesund angelangt sein, wenn er nicht unterwegs ertrunken ist.
Robinson vergaß der Menschlichkeit aus zu großem Verlangen nach Freiheit und war beinahe willens, sich des andern Mohren auf die nämliche Weise zu entledigen, doch besann er sich noch zu rechter Zeit und versuchte erst die Güte. – »Xuri«, sprach er zu dem Knaben, »wenn du mir getreu bist, will ich dein Glück machen; lege die Hand auf dein Gesicht und schwöre mir Treue bei dem Mahomet und dem Barte seines Vaters! Oder ich werfe dich wie jenen Beschnittnen ins Meer.« – Der Knabe lächelte furchtsam, streichelte ihm voller Unschuld die Hand, bat um sein Leben und schwur bei dem Mahomet und seines Vaters Barte, ihm treu zu sein und ihn allenthalben zu begleiten, wohin er es verlangte.
Um dem Kapitän eine falsche Richtung zu geben, wenn er ihm vielleicht nachsetzte, schiffte er geradeaus, solange er dem schwimmenden Mohr im Gesichte war, und folgte alsdann dem Winde, der nach Süden blies und ihn zu Ländern voll grausamer Negern und wilder Tiere führte, wo er nicht eine Minute auf Gottes festen Erdboden treten durfte, wenn er nicht von einem unter beiden aufgezehrt sein wollte. Er und sein Begleiter ruderten mit allen ihren Armen, der Wind war so günstig und das Meer so ruhig, daß sie am folgenden Tage nachmittags um drei Uhr sechzehn Minuten schon wirklich hundertundfunfzig Meilen von Sale entfernt und weit auf dem Gebiete des Kaisers von Marokko waren; der Kapitän tu es ihnen nach, wenn er sie einholen will! Gleichwohl hatte Robinson an dieser Entfernung zu seiner Sicherheit noch nicht genug, er landete nirgends, legte nirgends vor Anker, sondern setzte seinen Lauf ununterbrochen fünf Tage lang fort.
Itzt wagte er sich zum ersten Male in die Nähe der Küste, lief gegen Abend in einen kleinen Meerbusen ein und warf den Anker aus mit dem Vorsatze, bei dem Einbruche der Nacht hinüberzuschwimmen und das Land zu untersuchen, aber diesen Vorsatz gab er bald auf. Kaum begann die Dunkelheit, als vom Lande her ein fürchterliches Brüllen, Heulen und Schreien ertönte, welches nach aller Wahrscheinlichkeit eine Abendmusik von wilden Tieren war. Das barbarische Konzert wurde so entsetzlich, daß der arme kleine Mohr vor Schrecken zitterte und furchtsam sich an Robinsons Arme anklammerte, als wenn die wilden Tiere insgesamt schon in vollem Marsche auf ihn losgingen. Robinson sprach ihm Mut zu und stärkte seine Herzhaftigkeit mit einem Glase Branntewein, welches dem Knaben soviel Tapferkeit einflößte, daß er mit aller Gewalt den Ungeheuern den Krieg ankündigen und sie mit der Flinte vor den Kopf schießen wollte; aber wie bald verschwand diese Unerschrockenheit, als er im Wasser ein starkes Plätschern hörte, welches nichts anders befürchten ließ, als daß die Ungeheuer seine Ausfoderung annahmen und schon im Anzuge wider ihn waren! Nicht lange, so brach die Freude, womit sich die Scheusale im Meere herumwälzten, in so schreckende brüllende Töne aus, daß den beiden Abenteurern in ihrem Boote die Haare auf dem Kopfe starr emporstiegen, die Herzen im Leibe wie Schmiedehämmer pochten und alle Glieder wie Espenlaub zitterten. Das war ein Brüllen! ein Brüllen, daß sich die Sterne am Himmel hätten fürchten mögen! Das Geräusch im Wasser näherte sich dem Boote immer mehr, und ob sie gleich in der Dunkelheit nichts deutlich erkennen konnten, so blies doch aus den schnaubenden Nasenlöchern des kommenden Tieres ein so heftiger Wind auf sie her, daß sie daraus auf seine außerordentliche Größe mit vieler Gewißheit schlossen. Der kleine Xuri glaubte sich schon halb verschlungen, drückte sich fest an seinen Gefährten an und ließ nicht einen Augenblick von seinen Händen ab. – »Fliehen, fliehen!« sprach er leise mit bebender Stimme. »Den Anker hurtig herauf und dann fort! damit uns der gräßliche Löwe nicht frißt.« – Robinson versicherte ihn, daß dies nicht nötig sei, holte eine Flinte und feuerte sie los – weg war das Ungeheuer! Eilends schwamm es dem Ufer zu, und bei dem Schusse, einem in diesen Gegenden vielleicht noch nie gehörten Schalle, brüllte und heulte vom Ufer und tiefer aus dem Lande ein allgemeines Chor, wobei beiden vor Entsetzen die Gedanken im Kopfe stillstunden und das Blut in den Adern gefror.
So gefährlich es war, sich ans Land unter so fürchterliche Einwohner zu wagen, so verlangte es doch schlechterdings der Mangel an frischem Wasser. Nach einer bangen schlaflosen Nacht überlegten sie am folgenden Morgen, was sie tun sollten. – »Gib mir einen Krug!« sprach der kleine Xuri mit kindischer Gutherzigkeit. »Ich will allein gehn und Wasser suchen.« – »Warum das?« fragte Robinson. – »Damit die wilden Tiere nur mich fressen und du mit dem Leben davonkömmst«, war Xuris Antwort. – Robinson wurde von seiner treuherzigen Einfalt und Liebe gerührt, gab ihm Zwieback und ein Glas voll Stärkung des Mutes wie gestern und trat den Weg mit ihm gemeinschaftlich an, beide mit Flinten und Wasserkrügen beladen.
Robinson wollte das Boot nicht aus dem Gesichte verlieren und wagte sich also nicht weit; doch der kleine Mohr, dem sein Mut durch den Branntewein gewaltig gewachsen war, lief in eine Öffnung, die tief in das Land hinein ging, in vollem Trabe hinab, und einige Minuten darauf kam er im Galopp wieder zurück, daß Robinson glaubte, er werde von einem Wilden verfolgt, und deswegen ihm zu Hülfe eilte; allein bei seiner Annäherung wurde er mit Vergnügen gewahr, daß ihm der Bursche freudig ein totes Tier entgegenhielt, das er geschossen hatte. Es sah einem Hasen ähnlich, die Farbe und die größre Länge der Beine ausgenommen, und gab in der Folge eine gute Mahlzeit; aber noch viel mehr Freude verursachte beiden das Glück, daß Xuri auf diesem Wege einen Quell entdeckt hatte, ohne einen wilden Menschen oder ein wildes Tier zu erblicken.
Nachdem sie mit frischem Wasser reichlich versorgt waren, hielten sie sich nicht länger an einem Orte auf, der von keinem Menschen bewohnt zu sein schien. Da Robinson keine Instrumente hatte, um die geographische Breite desselben zu beobachten, vermutete er bloß, daß es der unbewohnte Strich zwischen den Ländern des Kaisers von Marokko und Nigritien sei, den die Negern aus Furcht vor den Mohren verlassen haben und die Mohren wegen seiner Unfruchtbarkeit nicht bewohnen mögen; sonach ist er der Sammelplatz der Löwen, Tiger und Leoparden geblieben und wird von niemandem besucht als von den Mohren, die heerweise zu Tausenden wider die Ungeheuer, die ihn besitzen, auf die Jagd ausziehen.
Sie kehrten in der Folge oft ans Land zurück, um Wasser einzunehmen, und fanden an der ganzen Küste hin keine Spur von menschlichen Bewohnern. Als sie an einem Morgen in der Frühe aus dieser Absicht an einer Erdspitze vor Anker legen wollten und den Anwachs der Flut erwarteten, um höher von ihr getrieben zu werden, empfing Robinson plötzlich von seinem kleinen Gefährten einen Stoß in die Seite, wobei er ihn leise bat, sich von dem Ufer eilends zu entfernen. Robinson sahe nach der Erdspitze hin, auf welche der Finger des Mohren wies, und erblickte einen ungeheuern Löwen, auf dem Sande im Schatten schlafend. Er befahl dem Knaben im Scherz, ans Land zu gehen und das Tier zu töten; dem Buben wurde bei dem Befehle angst und bange, und schon der Gedanke, daß er sich mit einem solchen Geschöpfe einlassen sollte, machte ihn so furchtsam, daß er zur Kajüte flog. Robinson lud alle seine drei Flinten, eine jede mit einem Paar Kugeln, und zielte nach dem Kopfe des Löwen; der Schuß traf die rechte Pfote, welche die Schnauze bedeckte; brüllend sprang das Ungeheuer auf, setzte sich nieder und sah ernsthaft auf die hängende zerschoßne Pfote. Robinson ergriff augenblicklich die zweite Flinte und war so glücklich, den Löwen in den Kopf zu treffen, daß er niederstürzte, zuckend sich wälzte und verschied. Sobald er tot war, bekam der kleine Xuri Herz; er bat um Erlaubnis, ans Land zu schwimmen und ihm vollends den Rest zu geben; ohne sie abzuwarten, warf er sich, die dritte Flinte in der Hand, ins Wasser, kletterte am Ufer hinauf, setzte dem Löwen sein Gewehr auf den Kopf und schoß, daß ihm der Dampf aus den Nasenlöchern herausfuhr. Mit dieser Heldentat noch nicht zufrieden, wollte er ihm schlechterdings den Kopf abhauen und holte deswegen eine Axt; weil er aber zu dieser Unternehmung zu schwach war, begnügte er sich mit einer Klaue, die er triumphierend ins Boot herüberbrachte; doch war sein Zorn gegen das Tier einmal so groß, daß er auch damit nicht vorliebnehmen, sondern ihm das Fell abziehen wollte. Robinson glaubte, es brauchen zu können, und ging den Vorschlag ein; geschäftig sprang Xuri auf dem toten Löwen herum und zog die Haut mit einer Erbitterung herunter, als wenn er sich dadurch für seine vorige Furcht an ihm zu rächen suchte. Die Haut wurde auf dem Dache der Kajüte ausgebreitet, von der Sonne getrocknet und diente zu einer herrlichen Matratze.
Erst am zehnten Tage nach diesem Abenteuer wurden sie Menschen an der Küste gewahr, schwarze nackte Figuren, die am Ufer standen und neugierig das Boot vorbeigehen sahen. Robinson wollte auf sie zurudern, doch Xuri riet ihm unablässig das Gegenteil, aus Furcht, von ihnen gefressen zu werden; seine Furcht wurde nicht geachtet und das Boot nach dem Ufer hingelenkt. Bei ihrer Annäherung nahmen sie wahr, daß sie alle unbewaffnet waren, einen einzigen ausgenommen, der einen kleinen Stock in der Hand führte, den Xuri für eine tödliche Lanze ausgab, womit sie weit, weit werfen könnten. Robinson sprach zu den Leuten durch Zeichen und foderte in dieser stummen Sprache etwas zu essen von ihnen; sie winkten ihm, daß er still halten und ihre Rückkunft erwarten sollte. Sie eilten sogleich tief ins Land hinein und kamen in einer halben Stunde mit einigen Stücken getrockneten Fleisches wieder, welches sie vom Ufer darboten. Nun hatte keiner von den beiden Seefahrern das Herz, es ihnen abzunehmen, und die Negern ebensowenig Mut, es sich von den Fremden abnehmen zu lassen; nachdem sich beide Teile lang mißtrauisch angesehen hatten, ergriffen die Schwarzen endlich den weisen Entschluß, legten das Fleisch auf die Erde nieder und entfernten sich davon. Wie ein Pfeil fuhr nunmehr Xuri voller Herzhaftigkeit auf dem Wasser hinüber und holte das Geschenk; sobald er im Boote damit angelangt war, rückten die Schwarzen wieder vorwärts ans Ufer.
Robinson konnte ihnen für ihre Güte nichts geben als Zeichen des Dankes, und indem sie miteinander komplimentieren, siehe! da stürzen sich plötzlich von den nahen Bergen zwei Tiere herunter, die einander aus Liebe oder Wut verfolgen. Die nackten wehrlosen Neger, besonders die Weiber, entflohen mit Furcht und Geschrei, nur der Mann mit der Lanze blieb unerschrocken stehen. Die Tiere jagten sich ins Meer und wälzten sich spielend herum; Robinson zielte mit einer Flinte nach dem nächsten und traf es; das Tier sank unter, kam wieder empor, rang mit dem Tode, wollte das Ufer erreichen und starb unterwegs, das andre entfloh bei dem Knalle. Nicht weniger erschraken die Schwarzen über den Schuß; sie konnten vor Beben nicht weiter fliehen, sondern fielen zur Erde, als wenn er sie getötet hätte. Sehr spät faßten sie wieder Mut, stunden auf und wagten sich schüchtern ans Ufer, nachdem ihnen Robinson lange gewinkt hatte. Kindisch freuten sie sich, als sie das Wasser mit dem Blute des Tieres gefärbt sahen, huben die Hände voller Verwundrung gen Himmel und wagten sich langsam herab, es aufzusuchen. Voller Vergnügen schleppten sie es auf das Trockne und fingen an die Beute zu zerlegen; sie rissen mit einem spitzigen Holze die Haut auf und wollten durchaus, daß Robinson die Hälfte des Fleisches annehmen sollte; er verbat seinen Anteil sehr freundlich, weil er kein Leopardenfleisch zu essen gewohnt war, und behielt sich die Haut vor. Aus Erkenntlichkeit, daß er ihnen eine so vortreffliche Mahlzeit verschafft hatte, brachten sie ihm viele von ihren Lebensmitteln, Wurzeln und eine Art von Körnern, die dem Roggen nicht unähnlich sahen, und auf sein Verlangen nach Wasser trugen zwei Weiber in einem irdenen Gefäße, das an der Sonne getrocknet zu sein schien, eine große Menge herbei, wovon Xuri drei Flaschen voll herüberholte.