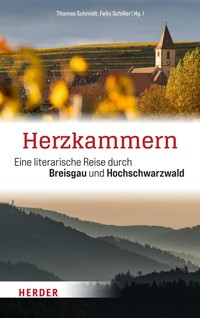
Herzkammern E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Herzkammer«, »Notherberge«, »himmlische Landschaft«: Breisgau und Hochschwarzwald waren für viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Rückzugs- und Erholungsort, Sehnsuchtsraum und Inspirationsquelle: von Grimmelshausen bis Hesse, von Kaschnitz bis Wohmann, von Tschechow bis Scholem Alejchem. In 70 Beiträgen prominenter Autorinnen und Autoren vermisst dieses Buch die reiche Literaturlandschaft in Südbaden und wirft unerwartete Schlaglichter auf Texte und ihre Entstehung. Multimedial erweitert wird es durch eine digitale Literaturkarte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Redaktion: Katharina Richterin Zusammenarbeit mit Maximilian Merz
Titelseite
Thomas Schmidt / Felix Schiller (Hg.) in Verbindung mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Herzkammern
Eine literarische Reise durch
Breisgau und Hochschwarzwald
Inhalt
Kurzbeitrag
Literarische Dauerausstellung
Die namentlich nicht ausgewiesenen Kurzbeiträge stammen von Katharina Richter und Thomas Schmidt.
Auf einen Blick. Die Literaturkarte des Landkreises
Die Karte präsentiert all jene Orte und deren Autorinnen und Autoren, über die es in diesem Buch einen eigenen Beitrag gibt. Diese Städte, Gemeinden und Personen und viele weitere, die v. a. in den Essays Erwähnung finden, sind über das Personen- und Ortsregister im Anhang zusätzlich vernetzt.
Geleitwort
Es ist uns eine große Freude, Sie mit diesem Buch auf eine Reise durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald – eine der literarisch reichsten Regionen Deutschlands – einladen zu können. Von seinen malerischen Landschaften – vom Markgräflerland über den Breisgau bis hin zu Glotter-, Dreisam-, Hexen-, Höllen- und Münstertal – haben sich zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller inspirieren lassen und Werke geschaffen, die weit über unseren Landkreis mit seinen 50 Städten und Gemeinden hinaus ein Publikum fanden und finden. Auch bedeutende Begegnungen und weitreichende Ereignisse der Literaturgeschichte haben hier, umschlossen von Kaiserstuhl, Feldberg, Schauinsland und Belchen, stattgefunden: in einer Gegend, in der Region und Welt, Mundart und Poesie ganz nah beieinander liegen und in der viele ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse zusammenfinden.
Auf solche Begegnungen, auf das Unerwartete und Unbekannte eröffnet dieser Reiseführer faszinierende Perspektiven und stellt dabei immer wieder die Bedeutung der Literatur für unsere demokratische Gesellschaft heraus, etwa indem er deren politische Facetten oder die mannigfachen Spuren jüdischer Kultur freilegt. So führt dieses Buch auf eine Entdeckungsreise, die weit über die üblichen Pfade hinausgeht, auch über die touristischen. Es ist ein Leuchtturmprojekt, das die Vielschichtigkeit unseres Landkreises herausstellt und so die sprachlichen und künstlerischen Dimensionen unserer Landschaften und unserer Orte zum Strahlen bringt.
Für dieses topografische Lesebuch mit digitaler Erweiterung danken wir den Herausgebern Thomas Schmidt und Felix Schiller ganz herzlich; und Ihnen, den Leserinnen und Lesern, wünschen wir große Freude und Neugierde beim Entdecken und Erleben.
Dr. Christian AnteDorothea Störr-Ritter
Dr. Christian AnteDorothea Störr-Ritter
Herzkammern erkunden. Zur Benutzung dieses Buches
Thomas Schmidt / Felix Schiller
Wenn Marie Luise Kaschnitz das Dorf Bollschweil zur »Herzkammer der Heimat« erhebt, sprechen daraus Zuneigung, ja Liebe, und die Gewissheit einer beschützten Geborgenheit. Doch in einer Herzkammer kann es auch zum Flimmern kommen. Dann droht Gefahr. Dann zerstieben alle Sicherheiten. Die Literatur hat genau für diese Ambivalenzen ein Sensorium: Ihre Orte können ein sicheres Refugium sein und zugleich existenzielle Gefährdungen zur Sprache bringen.
Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verdichten sich solche Ambivalenzen in hohem Maße, nicht zuletzt, weil diese Region für zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus allen Himmelsrichtungen Rückzugsraum, aber auch Exilort war, Erholungsgebiet, aber auch Identifikations- und Projektionsfläche, und weil die literarischen Spuren in ihrer Dichte hier kaum hinter literarischen Ballungszentren wie Heidelberg, Tübingen oder Weimar zurückstehen. Wie Kaschnitz hier ihre »Herzkammer« hatte, so fand ihr Freund Peter Huchel hier eine »Notherberge«, Kurt Heynicke einen »behaglichen Abgrund«, René Schickele eine »[h]immlische Landschaft« und Vladimir Nabokov eine »bergige Fremde«, die ihn »näher« an sein Zuhause bringt. Es sind diese facettenreichen, pointierten und auch gegenläufigen Perspektiven, mit denen dieses Buch das literarische Gedächtnis der Region und ihr kulturelles Profil sichern und erweitern will – auch ideologische Irrwege und politische Verbrechen in den Blick nehmend. Damit ist dieses Buch – obgleich geografisch sortiert und seine Leserinnen und Leser nachdrücklich zu Erkundungen vor Ort einladend – kein Reiseführer im klassischen Sinne. Es möchte ein Lesebuch sein, das bleibt, das überall gelesen werden kann und auf eine imaginäre Reise in die Kulturgeschichte dieser besonderen Landschaft mitnimmt.
Um der Vielseitigkeit und Vielstimmigkeit der Gegend gerecht zu werden, haben wir mehr als 30 Personen zu Beiträgen eingeladen, jede und jeder von ihnen der Region in Südbaden, ihrer Kultur und ihrer Literatur verbunden. Mit seinen ganz individuellen Einzelbeiträgen zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern, zu Texten und Museen vermisst das Buch die literarische Landkarte südlich, westlich und östlich der Stadt Freiburg. Es stellt außergewöhnliche, mitunter unbekannte literarische Ereignisse vor, umreißt prägende Schaffensphasen, wirft Schlaglichter auf die Entstehung mancher Werke und widmet sich auch jenen Aspekten von Literatur und Kultur, die zu wenig beachtet, zur Seite gedrängt und im öffentlichen Raum oftmals nicht oder nur unzureichend sichtbar sind – wie internationalen und interkulturellen Einflüssen und Begegnungen, Autorinnen avant la lettre oder der politischen Reich- und Tragweite der Literatur.
An wenigen Stellen überschreitet der Band die Grenzen des Landkreises: etwa um den wichtigsten Erinnerungsort für den literarischen Patron ganz Badens, Johann Peter Hebel, im nahen Wiesental einzubeziehen oder um die schreibenden Beginen im Kloster Adelhausen zu Wort kommen zu lassen, das ehemals vor den Mauern Freiburgs lag. Freiburg selbst, das geistige Zentrum der Region, liegt nicht im Landkreis. Die bedeutende Universitätsstadt, die einen eigenen Band füllen würde, ist mit einem Essay zu den Wechselbeziehungen mit dem Landkreis eingebunden.
Wie ist der Band aufgebaut? Längere Beiträge und mit gekennzeichnete Spotlights tasten nacheinander den Raum ab: vom Kaiserstuhl nach Süden bis Müllheim, von dort an den Schwarzwaldaufstieg, weiter nach Norden an die Stadtgrenze Freiburgs und dann nach Osten in den Schwarzwald bis zum Schluchsee. An den Orten sind die Beiträge chronologisch geordnet und gegebenenfalls um Informationen zu sehenswerten literarischen Dauerausstellungen erweitert. Überwölbt wird der Band von sechs ortsunabhängigen Essays zu übergeordneten Themen, die das literarische Geschehen hier geprägt haben und prägen. Eine Karte des Landkreises erleichtert die Orientierung und ermöglicht ebenso wie das Personen- und Ortsregister gezielte Suchen nach den vielen Querverbindungen zwischen den Beiträgen. Lektüretipps laden ›Zum Weiterlesen‹ ein.
Querverbindungen entstehen aber auch auf digitale Weise. So reichert die ›Digitale Literaturkarte Baden-Württemberg‹ (→ S. 276) mit ihrer multimedialen, sich ständig aktualisierenden und erweiternden Datenbank das analoge Medium Buch an und macht diesen Reiseführer zu einem hybriden Erlebnis. So lässt sich bequem – unterwegs oder auch von zuhause aus – auf Videos, Tondateien oder zusätzliche Bilder zugreifen, die die Themen dieses Bandes erweitern und vertiefen: z. B. auf Filmsequenzen, die Marie Luise Kaschnitz in ihrer »Herzkammer« Bollschweil zeigen, oder auf Interviews mit Zeitgenossen, Politikern und Wissenschaftlern.
Entstanden ist der Band in einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt und der im Deutschen Literaturarchiv Marbach angesiedelten ›Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg‹, die den deutschen Südwesten im Auftrag des Landes als außergewöhnliche Literaturlandschaft profiliert.
Aktuelle literarische Veranstaltungen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und seiner näheren Umgebung (https://www.literaturland-bw.de/events-lkbh)
Jan Merk / Katharina Richter / Thomas Schmidt
»Den Blick zum Belchen gewendet«
Zur Geschichte und Atmosphäre einer literarischen Landschaft
Vom Belchen aus wacht Johann Peter Hebel über die Geschicke des Markgräflerlandes, des Breisgaus und des Hochschwarzwaldes. Er ist der literarische Schutzpatron Südbadens. Als der 31-jährige Präzeptoriatsvikar – Hilfslehrer würde man heute sagen – im Jahr 1791 mit seinem Freund Hitzig den vierthöchsten Gipfel des Schwarzwaldes erklomm, war eine solche Wanderung noch sehr ungewöhnlich. Eine Tourismuskultur mit Karten, Wegweisern und Ortsbeschreibungen gab es damals noch nicht einmal im Ansatz. Hebel und Hitzig mussten sich im unwegsamen Gelände auf einen Führer verlassen. Ganz abgesehen von einer Gefährdung durch Wegelagerer, machte man sich damals verdächtig, wenn man längere Strecken ohne Pferd oder Kutsche zurücklegte. Wer nämlich vor 1800 aus freien Stücken die Reise zu Fuß wählte, verletzte die Konventionen der Ständegesellschaft. Die Fußreise war damals Sache der unteren Schichten, zuallererst der Handwerksgesellen, denen die Zunftordnungen eine mehrjährige Abwesenheit von ihrem Heimatbezirk verordneten, aber auch der Kleinhändler, Hausierer, Tagelöhner – und der Nichtsesshaften. Hebel und Hitzig waren in gewisser Weise Vorläufer, denn sie deuteten das Wandern zu einem Aufbruch ins Unbekannte um, zu einer freien Form der Weltbegegnung und der naturnahen Selbstbildung.
War die Wanderung für Hebel aus sozialen Gründen eine heikle Angelegenheit, so deren Steigerung ins Bergwandern auch aus infrastrukturellen und vor allem aus physiologischen. So etwas konnte er noch nie erlebt haben, nicht nur, was die faszinierenden Ausblicke, sondern auch, was das körperliche Erleben betraf. Nach mehr als 30 Kilometern Fußmarsch noch fast 1000 Höhenmeter zu überwinden, war in einer Zeit, in der die Mediziner einen gemäßigten Umlauf der Säfte empfahlen, ein unüblicher Grenzgang. Der Alpinismus hatte eben erst begonnen. Sein Anfang wird gemeinhin auf das Jahr 1786 gesetzt und mit der Erstbesteigung des Montblanc verbunden, den die beiden Freunde fünf Jahre später bei guter Sicht vom Belchen aus gesehen haben könnten; ebenso wie das Straßburger Münster ganz im Norden, mit dem Hebel den Berg mehrfach verglich: 1805 vermerkte der Dichter nach dem Besteigen des Münsters, er sei soeben »auf dem Belchen aller Kirchthürme« gewesen, und im gleichen Atemzug nannte er den Belchen »das Straßburger Münster aller Berge«.
In seinem Hymnus ›Ekstase‹macht Hebel den Belchen gar zur »erste[n] Station von der Erde zum Himmel« und erhebt ihn zum »Altar« der Freundschaft. Dieses Gedicht zeigt, wie tiefgreifend die Wandererfahrung für Hebel gewesen sein muss. Hier haben sich ungeahnte körperliche Extremerfahrungen und intensive sinnliche Eindrücke zu einem rauschhaften, quasireligiösen Naturerleben verbunden. Von nun an hatte Hebel »den Blick zum Belchen gewendet«.
Kurz nach der »Belchenwallfahrt« mit Hitzig wird Hebel als Lehrer an jenes Karlsruher Gymnasium berufen, an dem er selbst gelernt hatte und dessen Leitung er später übernehmen sollte. Dort, weit vom Belchen entfernt, wird sein Aufstieg zum Professor, Rektor, Prälat der Landeskirche und Abgeordneten der Ersten Kammer des Landtages beginnen. Dort wird auch seine Karriere als Schriftsteller einsetzen und ihm durch die ›Biblischen Geschichten‹, durch das ›Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes‹, vor allem aber durch die ›Alemannischen Gedichte‹ einen Platz auf dem »Parnaß« der deutschen Literatur einbringen, wie Goethe es formulierte.
In Hebels alemannischen Versen wird der Belchen gar zum wichtigsten Orientierungspunkt: im Gedicht ›Die Vergänglichkeit‹, das zu den einzigartigen Werken der deutschen Literatur gezählt werden kann. Es ist ein Nachtgedicht in Mundart, geschrieben im damals anspruchsvollsten Metrum für Gespräche, im Blankvers; ein Lehrgedicht über die letzten Dinge, in dem jedoch nicht zwei Weise debattieren, sondern ein Bauer seinem Sohn schonungslos die Unbeständigkeit alles Seienden vor Augen führt. Zuletzt werde die ganze Erde zerstört sein und der »Bueb« von einer verborgenen Stadt im Himmel hinuntersehen und zu einem wie selbstverständlich anwesenden Freund sagen: »Lueg, dört isch d’Erde gsi, und selle Berg / het Belche gheiße« (Sieh, dort ist die Erde gewesen, und dieser Berg / hat Belchen geheißen). Obgleich der Berg also seinen Namen verloren hat, liefert er auch nach dem Weltenbrand, bei dem die christliche Jenseitsvorstellung auf unorthodoxe Weise im Hintergrund bleibt, den zentralen Bezugspunkt. Der Belchen ist Hebels Berg, ein Berg der Gelassenheit, ein Berg der Freundschaft, ein Berg der Hoffnung und des Trostes. Durch Johann Peter Hebel wurde der Belchen zum literarischen Hausberg einer ganzen Region.
1791: Es war ein Abenteuer. Es war mühsam. Es wurde zum Glücksgefühl. Nie zuvor hatte Hebel so etwas getan. Er hatte den Belchen bestiegen. Folgt man heute seinem Weg auf den Berg, kann man – wie er damals – den Blick frei schweifen lassen: von den stets schneebedeckten Alpengipfeln und der großen Stadt Basel, in der Hebel geboren wurde, im Süden über die Vogesen gegenüber, die mit dem Grand Ballon auch ihren Belchen haben, bis hin zum »Belchen aller Kirchthürme«, dem Straßburger Münster, das sich im Norden hinter dem Kaiserstuhl zeigt. Und weiter über den ganzen Hochschwarzwald mit seinem höchsten Berg, dem Feldberg, auf dem das von Hebel ebenfalls bedichtete Flüsschen Wiese entspringt.
Wie Hebel auf dem Belchen, so machte Vladimir Nabokov auf dem Feldberg eine intensive Höhenerfahrung, als er 1925 – aus Stalins Sowjetreich exiliert – die 1493 Meter erklomm und in den großen Schwarzwaldtannen seine russische Heimat wiedererkannte. Edmund Husserl hingegen, der große Philosoph und Lehrer Martin Heideggers, ließ weiter nördlich, im hoch gelegenen St. Märgen, frei von körperlicher Belastung, seine Gedanken schweifen und entwickelte in der Sommerfrische seine phänomenologische Philosophie weiter. In Bollschweil, südlich von Freiburg und am Ausgang des Hexentals, hatte Marie Luise Kaschnitz, die Grande Dame der deutschen Nachkriegsliteratur, ihre »Herzkammer der Heimat«. Mit ›Beschreibung eines Dorfes‹ ebnete die Weitgereiste dem Ort, aus dem ihre Familie stammt, einen Platz in der Literaturgeschichte; und sie lässt die Landschaft, ja die gesamte oberrheinische Tiefebene auf eine völlig neue Weise lebendig werden: »wenn sich die Gebirge wie ängstliche Hunde gegen den Boden drücken, während die Könige des Flachlandes, Mais, Weizen und Tabak, ihre Häupter erheben«. Auch René Schickele machte aus der Rheinebene Literatur. Bei ihm, einem der – ganz in Hebels Sinne – weltoffensten und tolerantesten Autoren, die hier, im Kurort Badenweiler nämlich, ihre Spuren hinterlassen haben, werden »[d]as Land der Vogesen und das Land des Schwarzwaldes« zu »zwei Seiten eines aufgeschlagenen Buches«, das der Rhein nicht trennt, sondern wie ein »Falz« verbindet.
Badenweiler als weitbekannter Kurort für Atemwegserkrankungen zog die Weltliteratur an. 1904 starb hier der berühmte Dramatiker Anton Tschechow an Tuberkulose; 1900 hatte den jungen Stephen Crane bereits dasselbe Schicksal ereilt. Mit seiner Tschechow-Gedenkkultur wird der Ort zu einem literarischen Zentrum des Markgräflerlandes: Hermann Hesse kurierte sich dort ab 1909; René Schickele und Annette Kolb zogen nach dem Ersten Weltkrieg ganz dorthin. Eine kleine Maler- und Dichterkolonie bildete sich – mit Blick auf Frankreich, sodass nach 1945 sogar das Künstlerpaar Ré und Philippe Soupault mehrmals aus Paris kam, um die Vorzüge des milden Klimas zu genießen.
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der auf der Karte zwei Lungenflügeln ähnelt, die das geistige Zentrum Freiburg umschließen, ist eine Region des Wortes, des Erzählens, des Buches – eine Region der Literatur. Bereits im Mittelalter finden sich hier – nicht zuletzt wegen der vielen Klöster – bedeutende literarische Zeugnisse: Nonnen wie Anna von Munzingen verfassten Chroniken im Geiste der Mystik; Brunwart von Augheim versuchte sich in Neuenburg am Hohen Minnesang, und Jörg Wickram schuf am Kaiserstuhl mit dem ›Rollwagenbüchlein‹ launige Erzählungen, die damals die Kutschfahrt zu verkürzen halfen. Im ersten deutschsprachigen Roman der Weltliteratur, Grimmelshausens ›Simplicissimus‹, wird die Belagerung von Breisach im Dreißigjährigen Krieg erzählt und die Region zwischen Schwarzwald und Rhein damit auch literarisch auf den konfliktreichen Weg in die Neuzeit gebracht. Die Revolution von 1848 hinterlässt in den Büchern von Amalie Struve, die ihrem Mann, dem Revolutionsführer Gustav Struve, im Badischen zur Seite stand, ihre Spuren. Wie kein Zweiter registrierte der Erfolgsschriftsteller Heinrich Hansjakob, durch 1848 geprägter radikaler Demokrat, Pazifist und freigeistiger katholischer Geistlicher mit antisemitischen Ressentiments, um 1900 den Einbruch der Moderne in den beschaulichen Schwarzwald. Zur Zeit des Nationalsozialismus versteckten sich die spätere Hebelpreisträgerin Lotte Paepcke und der renommierte Publizist Benno Reifenberg vor den Schergen des Regimes im Hochschwarzwald, während der damals hochdekorierte Hermann Burte in Reden und Mundart-Gedichten die NS-Ideologie feierte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges suchte der expressionistische Lyriker Kurt Heynicke, der die Region von Ferienaufenthalten kannte, in Merzhausen Zuflucht vor den Bombardements auf Berlin. Er blieb bis zu seinem Lebensende und ließ seine Stücke sogar in alemannischer Mundart aufführen. Die ebenfalls vor den Bomben geflohene Hamburgerin Ingeborg Hecht, die ihren Vater im Holocaust verlor, setzte sich hier im Südwesten ihr Leben lang für die Erinnerung an die NS-Verbrechen ein, und sie erschloss sich durch ihre kulturgeschichtlichen Bücher über Badenweiler, Staufen und Müllheim den Breisgau und das Markgräflerland. Der Bibliothekar und Schriftsteller Erhart Kästner nutzte dann Ende der 1960er Jahre das kunst- und intellektuellenfreundliche Klima Staufens, um sich nach Ende seines Wolfenbüttler Direktorats dort ein Haus zu bauen. Mit seiner Hilfe fand wiederum der in der DDR überwachte und isolierte Lyriker Peter Huchel hier eine »Notherberge« im Exil. Kurz zuvor war es an der Grenze des Landkreises, in Todtnauberg, zu einem viel beachteten Treffen zwischen Paul Celan und Martin Heidegger gekommen. Und dem Schriftsteller und Wissenschaftler Dietrich Schwanitz gelang es um 2000 sogar – gut zwei Jahrhunderte, nachdem der Sturm und Drang Shakespeare im nahen Straßburg an den Oberrhein geholt hatte –, dem großen Dramatiker hier, nämlich im Hartheimer Salmen, einen festen Ort zu geben. In Hartheim, in Badenweiler, in Bollschweil, in Müllheim und auch in Staufen zeigen literarische Dauerausstellungen, dass diese Region in Südbaden eine der opulentesten literarischen Gegenden Europas ist.
Autorinnen und Autoren gaben dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und seinen Orten viele Attribute: »Herzkammer« (M. L. Kaschnitz), »Notherberge« (P. Huchel), »Elementarlandschaft« (Th. Troll), »behaglicher Abgrund« (K. Heynicke). Sie haben diese Landschaft aber auch unterschiedlich kommentiert: etwa wenn Gustav Schwab in seinen wirkungsmächtigen ›Wanderungen durch Schwaben‹ (1837), einem Pionierwerk des Reiseführergenres, über das durch den Schwarzwald nach Freiburg führende Höllental schreibt, dort habe »der schwarze Dämon dieses Passes, der übrigens ein unschuldiger Waldgeist ist, von Viertelstunde zu Viertelstunde ein einladendes Wirtshaus hingezaubert«. Dem widerspricht ein Jahrhundert später der schwäbische Mundartdichter Thaddäus Troll: Der Schwarzwald sei »kein Produkt des Tourismus. Er integriert den fremden Gast.«
Die landschaftlich so verschiedene Region mit ihrer früh blühenden Rheinebene, den Rebhügeln und Terrassen am Kaiserstuhl und den im Winter wunderbar verschneiten, dann aber lange auf den Frühling wartenden Schwarzwaldtälern beherbergt unzählige, ebenso charakteristische literarische Orte: vom Schluchsee, den Joseph Victor von Scheffel ein »Alpenidyll im Schwarzwald« nannte, über den jüdischen Friedhof in Sulzburg, zu dem der Student Peter Huchel mit seinem Freund Hans Arno Joachim gewandert ist, bis hin zum Staufener Gasthaus ›Löwen‹, in dem sich der historische Doktor Faust mutmaßlich in die Luft gesprengt hat.
Der Landkreis war und ist eine Region der Erholung und des Abstands, des Rückzugs und des Nachdenkens, des Altwerdens und Jungbleibens, des konzentrierten Lesens und Schreibens, des freien Planens, des Abschiednehmens, aber auch des Sesshaftwerdens. Mit dem Namen des Landkreises ist es jedoch eine schwierige Sache.
Johann Peter Hebel nannte sich selbst einen ›Schwarzwälder im Breisgau‹ und tastete den Raum in seinem gleichnamigen Gedicht auch ab. Bis heute überlagern und ergänzen sich hier verschiedene Räume und Raumbezeichnungen. Der Name Breisgau-Hochschwarzwald bildet im deutschen Südwesten eine der Ausnahmen. Entstanden durch die Verwaltungsreform 1973 aus Teilen der ehemaligen Landkreise Müllheim, Neustadt und Freiburg-Land, wurde für den neuen Kreis eine Bezeichnung nach Landschaften gewählt – nicht, wie sonst überwiegend üblich, nach dem Verwaltungssitz, der hier ja exterritorial in Freiburg liegt, und auch nicht nach einem ehemaligen Herrschaftsgebiet, das die Ausdehnung des neuen Kreises in etwa hätte widerspiegeln können.
Um 1800 nutzte Hebel in seinem Gedicht noch ganz selbstverständlich den (damals) großräumigen Landschaftsbegriff Breisgau, der im frühen Mittelalter als eine der alemannischen Gau-Bezeichnungen am Oberrhein entstanden war, angrenzend an den Albgau, den Aargau jenseits des Rheins in der Schweiz oder den Sundgau im Elsass. Die Gaue waren keine einheitlichen Herrschaftsräume, und folglich wurden Orte aus ganz unterschiedlichen Herrschaften landschaftlich zum Breisgau gerechnet. Hebel selbst platziert im Gedicht ›Die Wiese‹ deren Quelle »an dem Feldberg im Breisgau«. Bereits um 1640 war im Werk des berühmten Kupferstechers Matthäus Merian über Badenweiler zu lesen: »Ligt im Brisgow / zwischen Freyburg und Basel / unnd gehöret in die obere Marggraffschafft Baden«. Und eine der ersten Lesegesellschaften der Region entstand im Jahr der Französischen Revolution, 1789, in »Müllheim im Breisgau«, das seit 2023 offiziell den Namen ›Müllheim im Markgräflerland‹ trägt. 1844 notierte der Archivar und Historiker Joseph Bader: »Das heutige Markgrafenland ist Theil des Breisgaues, welcher sich zur Zeit der alten Gauverfassung in Gestalt eines länglichen Vierecks von Säckingen und Basel hinab erstreckte bis über Kenzingen und Elzach.«
Erst mit dem Aufkommen kleinräumigerer Landschaftsbegriffe im 19. und 20. Jahrhundert ging eine Verengung des Namens Breisgau auf das Gebiet rund um Freiburg einher. Die neue Entwicklung dieser Termini basierte nicht zuletzt auf dem Ziel patriotischer Autoren wie Bader, jenseits der bis dato allein vorherrschenden politischen Geschichtsschreibung zu Herrschern und Territorien, Kriegszügen und Friedensschlüssen andere Aspekte in den Blick zu nehmen: So wurden auch die Lebensbedingungen und Prägungen von Bewohnerinnen und Bewohnern einer Region durch geografische, klimatische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse herangezogen – etwa durch den Gegensatz zwischen kargem Schwarzwald und fruchtbarem, verkehrsgünstig gelegenem Rheintal sowie durch kulturelle Faktoren wie Religion, Sitten und Bräuche.
Auf einen solchen Gegensatz, mehr noch: auf eine wirkliche Grenze war Hebel auch auf dem Belchen gestoßen. Hier trafen das katholische, von den Habsburgern regierte und die Region dominierende Vorderösterreich mit seinem Verwaltungssitz Freiburg und der protestantische, eher dörflich geprägte Südteil der Markgrafschaft Baden-Durlach aufeinander. Bis heute sieht man es auf dem Belchen an den alten Grenzsteinen und auch an den Wappenfarben vieler Orte: gelb und rot hier, rot und weiß dort. Wie sehr diese Gegensätze die Wahrnehmung bestimmten, drückte Bader in zeitgenössischen Kategorien aus: »[N]ichts konnte auffallender constrastiren, als eine Gruppe Markgräfler neben einer Gruppe österreichischer Breisgauer; Haltung, Gesichtsbildung, Kleidertracht, Mundart und Ausdrucksweise – Alles war hier charakteristisch verschieden von dort!«
Bader war es auch, der 1844 die Bezeichnung Markgräflerland prägte; noch ein Jahr zuvor hatte er das Kindheitshaus Hebels in Hausen im Wiesental vorgestellt, ohne diesen Begriff zu verwenden: »Unter dem Markgräfler-Lande versteht man die ehemaligen Herrschaften Sausenberg, Röteln und Badenweiler, welche den südwestlichen Breisgau umfassten«. Baders Text zeigt auch, wie neu der Name, wie unsicher sein Gebrauch noch war, verwendet er doch auf drei Druckseiten bedeutungsgleich die Fügungen »Markgräfler-Land«, »Markgrafen-Land« und »Markgräfische Gegenden«. Mit seiner Wortschöpfung hat Bader der Herkunftsregion Hebels einen sich erstaunlich rasch durchsetzenden, bis heute identitätsstiftenden Namen gegeben.
Während der Name Schwarzwald bereits in mittelalterlichen Quellen in lateinischer Form, als silva nigra, auftaucht, ist der Begriff Hochschwarzwald deutlich jünger. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nutzten Wintersport- und Luftkurorte diesen Namen für ihre touristische Werbung. Ehe sich der Name eindeutig auf die Landschaft rund um das Feldbergmassiv bezog, waren viele Jahrzehnte lang unterschiedliche regionale Abgrenzungen, bis hin zu den Höhenzügen des Nordschwarzwaldes mit Hornisgrinde und Kniebis, gebräuchlich.
Heute finden sich die vielen Landschaftsbegriffe klar definiert innerhalb offizieller Naturraumgrenzen wieder. Weite Teile des Hochschwarzwaldes und des Breisgaus gehören zum gleichnamigen Landkreis – mitsamt dem nördlichen Markgräflerland, das es aber trotz vehementer Interventionen nicht in den Landkreisnamen geschafft hat. Für die eine oder andere literarische Konstellation ist es nicht unwichtig, sich die Geschichte der politischen Territorien und deren soziale, religiöse und kulturelle Unterschiede zu vergegenwärtigen, auch wenn die Grenze auf dem Belchen, die Hebel einst als maßgeblich wahrgenommen haben muss, heute eine schlichte Verwaltungsgrenze zwischen den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald ist. Wenn dieses Buch die literarische Landschaft des Letzteren vermessen soll, dann kann es aber davon ausgehen, dass sich die Literatur zwar zuweilen an vielen Grenzziehungen abarbeitet, aber glücklicherweise nicht an administrative oder politische Grenzen hält.
Zum Weiterlesen
Manfred Bosch (Hg.): Oberrheingeschichten. Tübingen 2010.
Dorothee Philipp / Jost Grosspietsch u. a. (Hg.): Kunst. Thermen. Wein. Entdeckungsreisen durch das Markgräflerland. Lindenberg 2011.
Thomas Schmidt: Johann Peter Hebel und der Belchen. Marbach / N. 2019 (Spuren 90).
Jan Merk: Markgräflerland. Die Erfindung eines identitätsstiftenden Landschaftsbegriffs im frühen 19. Jahrhundert. In: Geschichtsverein Markgräflerland e. V. (Hg.), Sonderband ›Das Markgräflerland‹. Schopfheim 2024.
1
Von Rollwagen und Shakespeare-Gemälden
Vom Kaiserstuhl über Breisach nach Hartheim
Der kleine Hans Sachs vom Oberrhein
Jörg Wickram schrieb in Burkheim wohl den ersten deutschsprachigen Roman
Werner Witt
Jörg Wickram zog 1555 vom aufstrebenden elsässischen Colmar über den Rhein in das nur wenige Kilometer entfernte beschauliche Städtchen Burkheim am Kaiserstuhl mit nur einigen hundert Einwohnern, um dort seine Stelle als Stadtschreiber anzutreten. Als uneheliches Kind blieb ihm in Colmar der Aufstieg in öffentliche Ämter verwehrt, obwohl sein Vater Patrizier war, ihn als Sohn anerkannte und ihm ein stolzes Vermögen vererbte. Trotz vieler Hindernisse und ohne akademische Weihen war Wickram sehr gut gebildet, verstand Latein, kannte die theologischen Debatten, besaß Fähigkeiten in Malerei, Literatur und Musik. Letztendlich erreichte er als Schriftsteller eine solche Bekanntheit, dass sogar der große Nürnberger Hans Sachs seine Texte las. In jungen Jahren hatte er Kunstmaler gelernt. Unzählige Theaterstücke führte er auf, viele selbst verfasst. Sein erfolgreichstes Werk aber wurde ›Das Rollwagenbüchlein‹, eine erste unterhaltsame und belehrende Sammlung von Kurzgeschichten in deutscher Sprache, die es über die Jahrhunderte bis in unsere Zeit hineingeschafft hat, immer wieder neu verlegt zu werden. Zunächst 67 und in späteren Ausgaben 111 Schwänke fasst Wickram zusammen. Er griff dabei auf ältere Sammlungen zurück wie die des Franziskanerpredigers Johannes Pauli von 1522, übernahm einige Geschichten aus mündlicher Überlieferung und fügte Personen und Alltagsszenen hinzu, die er in Colmar und Burkheim beobachtet hatte. Er setzt damit eine Erzähltradition fort, die im Mittelalter begann und ihre Blüte in der frühneuzeitlichen Literatur fand. Dummköpfe aller Art treten darin auf, Säufer, lüsterne Pfarrer, schlitzohrige Bauern und Ehebrecher. Sie alle erleben ihr blaues Wunder, werden zu einem besseren Leben bekehrt oder sollen dem Publikum als abschreckendes Beispiel dienen. Einen Predigerton wie in älteren Schwänken pflegte Wickram trotz erzieherischer Absicht nicht. Das von ihm selbst illustrierte Original erlebte bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts 16 Auflagen.
Wickram versprach im Vorwort zum ›Rollwagenbüchlein‹, auf »schampere und schändliche Wort« zu verzichten. Die Sprache im ›Rollwagenbüchlein‹ wird dem allerdings in keiner Weise gerecht
Ob Wickram und seine Ehefrau Anna von einem Fischer im Boot über den Rhein übergesetzt wurden oder ob sie mit dem Rollwagen, wie man damals Pferdekutschen nannte, den langen und mühseligen Landweg über Breisach gewählt haben, wissen wir nicht. Der Rhein um Burkheim war zu jener Zeit ein gefährlich mäanderndes Gewässer. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Auch die ärmlichen Fischerhäuschen sind verschwunden. Durch die Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert hat Burkheim seinen unmittelbaren Kontakt mit dem Fluss verloren. Heute markiert der Rhein die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. In Wickrams Gepäck steckte damals jedenfalls eine kleine Sensation, die erst einige Jahrhunderte später von der literarischen Welt auch als solche anerkannt wurde. Nur zwei Jahre nach seiner Ankunft in Burkheim wurde 1557 in Straßburg der erste deutschsprachige Prosaroman veröffentlicht: ›Der Goldfaden. Eine schöne alte Geschichte‹, ein Abenteuerroman mit Liebesgeschichte, einem rätselhaften Löwen, Rittern und Edelmännern und einem Helden, der vom verlassenen Kind zum Burgherrn aufsteigt, sich dabei als mutig und edel erweist, weshalb er schließlich das Herz des Burgfräuleins erobert – der Löwe immer treu an seiner Seite. Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein wurde von dem Buch kaum Notiz genommen. Auf ihrer Suche nach unverfälschten historischen Geschichten entdeckten erst die Romantiker den noch ganz im Rittermilieu spielenden Roman wieder und waren derart begeistert, dass sie ihn analog zu der Märchensammlung der Brüder Grimm oder der Volksliedersammlung ›Des Knaben Wunderhorn‹ zum Ausgangspunkt einer Sammlung von Volksromanen nach älteren Ausgaben machen wollten. Wickrams ›Goldfaden‹ galt ihnen als Kronzeuge solcher Volksdichtungen. Auch diesmal gaben die Brüder Grimm die Anregung, und Clemens Brentano übertrug den ›Goldfaden‹ ins Hochdeutsche. Das Buch erschien 1809 – verziert mit Vignetten von Ludwig Emil Grimm – im Verlag Mohr und Zimmer in Heidelberg. Doch die Gruppe um Brentano zerstritt sich, und so blieb ›Der Goldfaden‹ die erste und einzige Ausgabe in der Reihe.
Wickrams Gesamtwerk ist in einer wissenschaftlich fundierten dreizehnbändigen Ausgabe überliefert. Von seiner Biografie indes ist wenig bekannt: Es gibt keine Abbildungen, kaum Informationen über seine Familie, und auch sein Sterbedatum kann nur über die Neuauflage seines Buchs ›Tobias‹ aus dem Jahr 1562 rekonstruiert werden, die den Autor als verstorben führt. Nicht mal der Ort des Grabs in Burkheim ist überliefert.
Ein Wickram-Rundgang durch dieses mittelalterliche Städtchen führt durchs Stadttor hindurch zur Schlossruine des einstigen Pfandherrn Lazarus von Schwendi, der vermutlich die Tokajer-Rebe von seinen Feldzügen mitbrachte, weiter übers Kopfsteinpflaster, auf Badisch Rhin-Wacken, zum zentral gelegenen ›Haus zu den fünf Türmen‹, dem schönsten und bekanntesten Fachwerkhaus Burkheims. Hinter einem der Fenster hatte sehr wahrscheinlich Jörg Wickram seine Amtsstube. Eine schmale Gasse und der Saal im Rathaus wurden nach ihm benannt. Und so hat Jörg Wickram doch seine Spuren hinterlassen:
Es liegt ein Städtlein im Breisgau, da haben sie einen Brauch oder Gewohnheit, dass man alle Fronfasten oder Quatember einem Bürger die Schlüssel zu der Pforten befiehlt zu verwahren; der muss dann allweg abends und morgens, so man die Pforten auf- oder zutut, zugegen sein und demnach die Schlüssel vermög des Eids, so er darüber getan, wieder verwahren.
Das ›Haus zu den fünf Türmen‹, die auch auf dem Burkheimer Stadtwappen zu sehen sind
Neben seinen zahlreichen Texten und Zeichnungen ist der Nachwelt außerdem noch eine besondere Erinnerung an ihn erhalten geblieben: die ›Colmarer Liederhandschrift‹, die umfangreichste Sammlung von Meisterliedern aus dem 14. / 15. Jahrhundert, heute im Besitz der Bayerischen Nationalbibliothek. Wickram hatte bereits 1546 durch seine ab 1530 erschienenen literarischen Werke einen so großen Reichtum erworben, dass er sich den Kauf dieser Sammlung leisten konnte und sogar ein Jahr später in Colmar eine Meistersingschule gründete. Nicht nur wegen seines Wirkens als Stadtschreiber in Burkheim also, sondern auch wegen seiner literarischen Porträts des Kleinbürgermilieus Colmars ist es deshalb nicht vermessen, Wickram als kleinen Hans Sachs vom Oberrhein zu bezeichnen.
Zum Weiterlesen
Jörg Wickram: Das Rollwagenbüchlein. Hg. Werner Witt. Tübingen 2010.
Clemens Brentano: Der Goldfaden. Eine schöne alte Geschichte. Heidelberg 1986.
Werner Witt: Georg Wickram und Burkheim am Kaiserstuhl. Marbach / N. 2021 (Spuren 125).
Heroischer Brückenkampf bei Breisach
Das Kriegsgeschehen von 1638 in Grimmelshausens ›Simplicissimus Teutsch‹
Dieter Martin
Ob Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen wirklich dabei war, als die Kaiserliche Armee des Grafen Johann von Götz im Herbst 1638 – inmitten des Dreißigjährigen Krieges – verzweifelt versuchte, die von protestantischen Truppen unter Herzog Bernhard von Weimar belagerte Festung Breisach zu befreien, ist nicht bekannt. Wie bei anderen Passagen seines genau dreißig Jahre später, zur Herbstmesse 1668 erschienenen Romans ›Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch‹, des Barockbuches schlechthin, gibt es auch zur effektvoll ans Ende des 4. Buchs gerückten Schilderung des Kampfs um eine »Schiffbrücke« bei Breisach keinen Beweis dafür, dass der Verfasser dieses ersten deutschsprachigen Romans der Weltliteratur das Dargestellte persönlich erlebt hat. Vorsicht ist daher geboten: Allzu oft sind Grimmelshausen-Leser und -Forscher seinen authentisch wirkenden Beschreibungen erlegen und haben Literatur und Leben vorschnell in eins gesetzt, um dann zu erfahren, dass etwa die Schilderung der Schlacht bei Wittstock (1636) aus der Übersetzung eines englischen Romans stammt, der seinerseits eindrücklich von einem frei erfundenen Gefecht erzählt.
Auch bei der Belagerung, dem versuchten Entsatz und der Kapitulation der Festung Breisach, die wegen ihrer exponierten Lage am Rhein als uneinnehmbar galt, ist die Quellenlage unklar. Zwar spricht manches dafür, dass der damals noch nicht zwanzigjährige Grimmelshausen beim Grafen von Götz diente, als dieser, wie der Roman chronologisch zutreffend referiert, im Frühjahr 1638 »Westphalen quittiren / und am Ober-Rheinstrom wegen Breysach wider den Fürsten von Weymar agiren muste«. Doch war Grimmelshausen, als er sein Werk im Frieden, wohl während seiner Zeit als Verwalter und Gastwirt in Gaisbach bei Oberkirch oder auf der benachbarten Ullenburg, zu Papier brachte, keineswegs nur auf seine Erinnerung angewiesen. Vielmehr konnte er sich ebenso gut in gedruckten Büchern über die damaligen Ereignisse rückversichern. Zur Kriegsgeschichte Breisachs stand ihm sogar eine besonders reiche Überlieferung zur Verfügung, waren die monatelange Aushungerung und schließliche Eroberung der Festung doch schon damals ein Medienereignis ersten Ranges. Die militärgeschichtlichen Fakten der höchst aufwendigen Belagerung, deren topografische Herausforderungen Matthäus Merians Kupferstich zeigt, ließen sich in dem von Grimmelshausen gerne genutzten ›Theatrum Europaeum‹ ebenso nachlesen wie eindringliche Klagen über die bis zum Kannibalismus reichende Hungersnot, die den Widerstand Breisachs letztendlich brach.
Die realen Vorlagen der »Schiffbrücke«, auf der das im Roman geschilderte Gefecht spielt, sind im Ausschnitt von Matthäus Merians Stich (1670) mit den Buchstaben C und D bezeichnet
Dass Grimmelshausen den Kampf um Breisach im 4. Buch seines Romans leitmotivisch nutzt und den nach Villingen geflüchteten Helden durch »einen grossen Umbstand von Bürgern und Soldaten« ausfragen lässt, »wie es vor Breysach stünde«, entspricht also genau der Bedeutung, die das Schicksal der Festung für die Zeitgenossen hatte. Wohl ganz unhistorisch ist dagegen die von Grimmelshausen erfundene Figurenkonstellation: Der Held und Ich-Erzähler Simplicissimus begegnet in dieser Phase des Romans zwei alten Bekannten wieder, seinem Freund Herzbruder und dessen Todfeind Olivier – da Grimmelshausen diesen beiden Figuren und ihren Lebensgeschichten einigen Anteil an der Erzählung gibt, verkompliziert er die Geschichte und spaltet den Blick auf die Belagerung Breisachs in mehrere Perspektiven auf. Simplicissimus wird nämlich, kaum hatte Herzbruder ihn als »Freyreuter« in der kaiserlichen Armee untergebracht, »von den Weymarischen gefangen« genommen: »[S]o war ich auch prædestinirt / Breysach belägern zu helffen«. Erstaunlicherweise erhält er von seinem neuen Herrn einen Pass, um seine in Lippstadt zurückgelassene Frau zu besuchen, wird aber – in wiederum rasantem Glückswechsel – schon bei Endingen am Kaiserstuhl von dem Wegelagerer Olivier überfallen. Dieser möchte Simplicissimus von seinem machiavellistischen Treiben, dem egoistischen »kriege[n] vor sich selbst«, überzeugen: »Sey versichert Bruder / wenn unserer zehentausend wären / daß wir morgenden Tags Breysach entsetzen […] wolten.« Dazu kommt es nicht, weil Olivier nach Erzählung seiner mörderischen Vita erschlagen wird und Simplicissimus die Chance nutzt, um sich mit Oliviers Beute nach Villingen abzusetzen. Dort trifft er erneut auf Herzbruder, der nun aber – Fortuna hat ihr Rad weitergedreht – auf die Hilfe seines Freundes angewiesen ist. Denn auf kaiserlicher Seite hatte Herzbruder, »als ob ichs allein hätte vollenden wollen«, »den andern zum Exempel« den Kampf um eine Behelfsbrücke angeführt, über die man Breisach mit frischem Proviant versorgen wollte. Wie aber die Kaiserlichen Ende Oktober 1638 den Brückenkampf aufgeben mussten, so unterliegt auch Herzbruder, freilich reich versehen mit Beweisen seines Kampfesmutes und Gottvertrauens: »[U]nter den ersten Angängern« habe er »dem Feind auch am ersten auff der Brücken das Weiß in Augen« gesehen, habe im heroischen Rückzug Wunden am ganzen Körper davongetragen, sei »vor todt in Rhein geworffen« worden, habe in »solchen Nöthen […] zu Gott« geschrien und »seine Hülff« auch tatsächlich erfahren, da ihn »der Rhein […] ans Land« gespült und er bei »Soldaten-Weibern […] Mitleiden« gefunden habe.
Der erschütternde Bericht, der Simplicissimus dazu bewegt, das von Olivier stammende Geld zu Herzbruders Heilung einzusetzen – diesem Beweis genug, »daß der liebe Gott mich noch nit verlassen« und ihm »statt eines Engels« den Freund »geschickt« habe –, mag auf persönlichem Erleben beruhen oder nicht. Das muss man nicht entscheiden, um dennoch wahrzunehmen, dass der Roman aus der Kriegserzählung, die gerade wegen ihres intensiven Lokalbezugs zu Breisach so authentisch wirkt, exemplarische Einsichten gewinnt: Die beiden Figuren, zwischen denen der Held hin- und hergeworfen wird, geben eindringliche Beispiele für die Macht des Schicksals in kriegerischen Zeiten, für die einmal positiv, einmal kritisch bewerteten Optionen individuell-heroischen Handelns im kollektiven Wirrsal des Krieges sowie für den Wert von freundschaftlicher Treue und Gottvertrauen in tiefster Not.
Porträts von Grimmelshausen und seiner Familie sind nicht überliefert. Die Medaillons auf seinem ›Ewig-währenden Calender‹ (1670) mögen als Ersatz dafür gelten





























