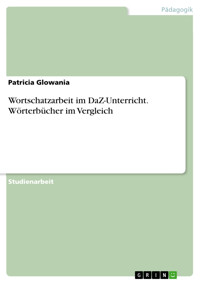Heterogenität in Schulklassen. Konzeption und Nutzen der „StartBox“ als Verfahren der Schuleingangsdiagnostik E-Book
Patricia Glowania
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Didaktik - Allgemeine Didaktik, Erziehungsziele, Methoden, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Institut für Erziehungswissenschaften), Veranstaltung: Diagnostik für Lehrkräfte, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Eintritt in die Schule stellt für Kinder und ihre Eltern einen wichtigen Schritt dar. Die Vorstellung aber, dass die Schulanfänger beim Schulstart „eine homogene Altersgruppe mit gleichen Startbedingungen bilden“ ist längst keine Realität mehr. Heterogenität, differenzierter Unterricht, aber auch Inklusion - dies alles sind Begriffe, an denen kein Lehrer vorbeikommt. Aus schulpädagogischer Sicht ist es von immenser Bedeutung, sich mit diesem Thema zu befassen. Die Klassengemeinschaft kann sich zusammensetzen aus Jungen und Mädchen deutscher und nichtdeutscher Herkunft, Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber auch mit besonderen Begabungen. Die Kinder können aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus kommen und bringen unterschiedliche familiäre Lebensbedingungen mit. Eine Schulklasse wird demnach von Heterogenität geprägt. Ziel muss sein, allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Besonderheiten und Bedürfnissen gerecht zu werden und sie bestmöglich zu begleiten und zu fördern. Um sich auf die individuellen Lernausgangslagen der Schulanfänger einzustellen, gibt es immer mehr Verfahren und Tests, die versprechen darüber Aufschluss zu geben. Mit einem dieser Verfahren, der „StartBox“, werde ich mich in dieser Hausarbeit kritisch auseinandersetzen. Diese soll laut Kartonaufschrift, eine „Diagnostik zur Lernausgangslage von der Anmeldung bis zum Schulbeginn“ ermöglichen. Ziel wird sein, das Verfahren und die Ergebnisse der „StartBox“ zu untersuchen und die Informationen und Ergebnisse des Verfahrens daraufhin zu überprüfen, ob sie für eine anknüpfende Förderung genutzt werden können. Die Hauptfragestellung lautet demnach: Welche Möglichkeiten zur begründeten Förderplanung bietet die Anwendung des diagnostischen Verfahrens „StartBox“? Zur differenzierten Einordnung der Begriffe soll es im zweiten Kapitel um die Diagnostik am Schulanfang gehen: es wird ein kurzer historischer Abriss der Begriffe „Schulreife“ und „Schulfähigkeit“ gegeben, aber auch die Begriffe Schuleingangsdiagnostik, pädagogische Diagnostik und Förderung sollen bestimmt und erläutert werden. Zudem soll geklärt werden, was mit der Erhebung der Lernausgangslagen von Schulanfängern gemeint ist. Im dritten Kapitel wird dann die „StartBox“ mit ihrer Konzeption und Zielsetzung vorgestellt. Danach soll untersucht werden, wie geeignet die „StartBox“ im Hinblick auf die derzeitige Diagnosesituation ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Diagnostik am Schulanfang
3.) Die „StartBox“
4.) Analysen zur Anwendung der „StartBox“
5.) Fazit
Literatur-/ Quellenverzeichnis
1.) Einleitung
Der Eintritt in die Schule stellt für Kinder und ihre Eltern einen wichtigen Schritt dar. Endlich sind die Kinder „reif“ für die Schule und kommen, im Großen und Ganzen, mit den Anforderungen des Unterrichts und des Schulalltags zurecht – so oder ähnlich können Gedanken und Vorstellungen von Schulanfängern und ihren Eltern aussehen. Die Vorstellung aber, dass die Schulanfänger beim Schulstart „eine homogene Altersgruppe mit gleichen Startbedingungen bilden“ (Knörzer 2000, S. 154) ist längst keine Realität mehr. Heterogenität, differenzierter Unterricht, aber auch Inklusion - dies alles sind Begriffe, an denen kein Lehrer und keine Lehrerin vorbeikommt. Aus schulpädagogischer Sicht ist es von immenser Bedeutung sich mit diesem Thema zu befassen. Die Klassengemeinschaft kann sich zusammensetzen aus Jungen und Mädchen deutscher und nichtdeutscher Herkunft, Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber auch mit besonderen Begabungen. Die Kinder können aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus kommen und bringen unterschiedliche familiäre Lebensbedingungen mit. Kurz: die Kinder machen „in ihrer vor- und außerschulischen Lebenszeit kaum vergleichbare, sondern unterschiedliche Lebenserfahrungen“ (Knörzer 2000, S. 154) – „bereits zu Schulbeginn bestehen gravierende Unterschiede zwischen den Kindern“ (Christiani 2004, S. 14). Eine Schulklasse wird demnach von einer Heterogenität geprägt. Ziel muss sein, allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Besonderheiten und Bedürfnissen gerecht zu werden und sie bestmöglich zu begleiten und zu fördern.
Um sich auf die individuellen Lernausgangslagen der Schulanfänger einzustellen, gibt es immer mehr Verfahren und Tests, die versprechen darüber Aufschluss zu geben. Mit einem Verfahren, der „StartBox“, werde ich mich in dieser Hausarbeit kritisch auseinandersetzen. Diese soll laut Kartonaufschrift, eine „Diagnostik zur Lernausgangslage von der Anmeldung bis zum Schulbeginn“ (StartBox 2003) ermöglichen. Ziel der Hausarbeit wird sein, das Verfahren und die Ergebnisse der „StartBox“ zu untersuchen und die Informationen und Ergebnisse des Verfahrens daraufhin zu überprüfen, ob sie für eine anknüpfende Förderung genutzt werden können. Die Hauptfragestellung lautet demnach: Welche Möglichkeiten zur begründeten Förderplanung bietet die Anwendung des diagnostischen Verfahrens „StartBox“?
Zur differenzierten Einordnung der Begriffe soll es im zweiten Kapitel um die Diagnostik am Schulanfang gehen: es wird ein kurzer historischer Abriss der Begriffe „Schulreife“ und „Schulfähigkeit“ gegeben, aber auch die Begriffe Schuleingangsdiagnostik, pädagogische Diagnostik und Förderung sollen bestimmt und erläutert werden. Zudem soll geklärt werden, was mit der Erhebung der Lernausgangslagen von Schulanfängern gemeint ist. Im dritten Kapitel wird dann die „StartBox“ mit ihrer Konzeption und Zielsetzung vorgestellt. Hierzu werden das Manual und die „StartBox“ selbst mit ihren Inhalten und Materialen als Grundlage dienen. Im nächsten Kapitel soll eine Verknüpfung der vorangegangenen Kapitel stattfinden: Wie geeignet ist die „StartBox“ im Hinblick auf die derzeitige Diagnosesituation? Abschließend soll die Ausgangsfragestellung und ihre Beantwortung besonders zum Tragen kommen: Welche Möglichkeiten zur begründeten Förderplanung bietet die Anwendung des diagnostischen Verfahrens „StartBox“? Zudem sollen mögliche offene Fragen geklärt werden und gegebenenfalls weiterführende Überlegungen erarbeitet werden.
2.) Diagnostik am Schulanfang
Fällt heute der Begriff „Diagnostik am Schulanfang“, so hat sicher jeder eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Viele denken an die Untersuchung beim Schularzt, das Hüpfen auf einem Bein, das Zeichnen verschiedener geometrischer Figuren oder das Aufsagen der eigenen Adresse. Andere gehen vielleicht von einem bestimmten Alter aus, welches dazu berechtigt in die Schule zu gehen. So verschieden die Vorstellungen sind, so sehr hat sich auch der Begriff „Schuleingangsdiagnostik“ in der Vergangenheit verändert.