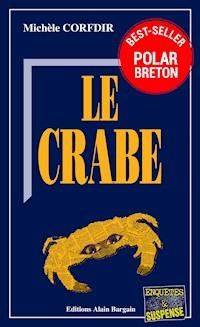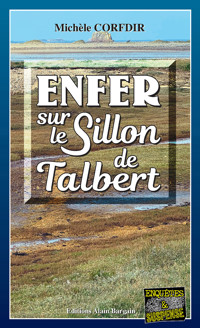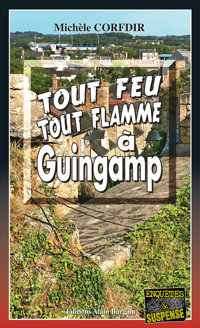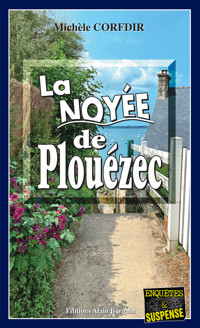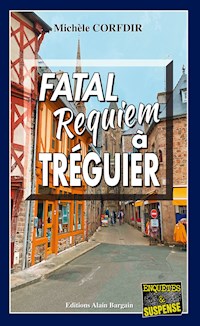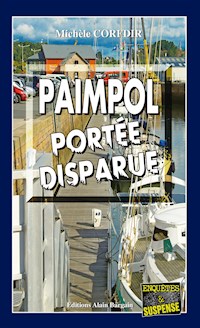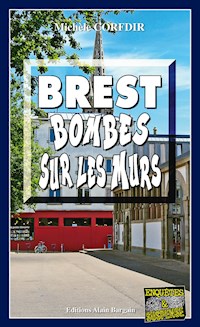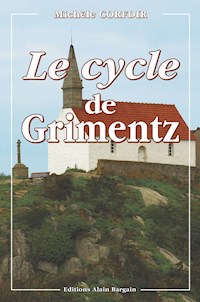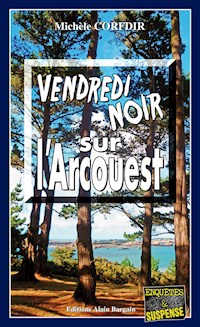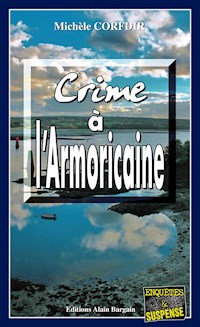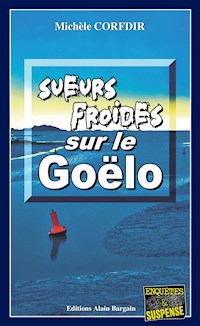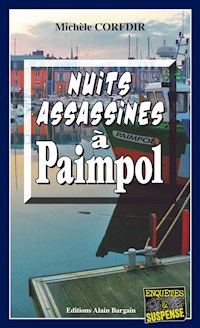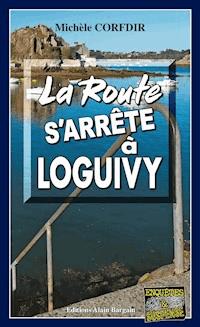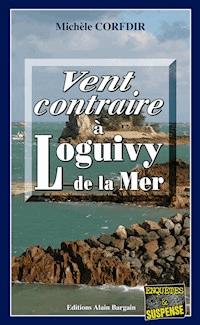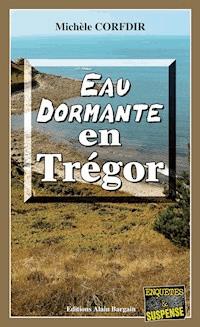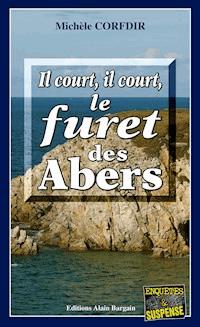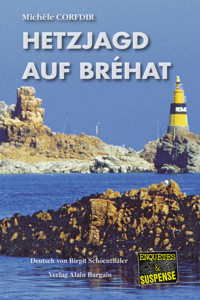
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Bretagne-Krimi aus dem Côte d’Armor
- Sprache: Deutsch
"Auf der Insel Bréhat zu Beginn des Pfingstwochenendes: Das Wetter ist herrlich und das Meer glitzert in der Sonne. Touristen strömen auf die Insel und das Geschäft läuft wieder an. Auch für Esther Mahé steht die schöne Jahreszeit unter einem glücklichen Vorzeichen. Alle Zimmer ihres Gästehauses in Kersal sind belegt und nach den Monaten winterlicher Einsamkeit kehrt endlich wieder Leben ein.Doch auf Bréhat schlägt das Wetter oft unerwartet schnell um und im Schutz des undurchsichtigen Nebels kann alles geschehen... Ohne jegliche Vorwarnung wird Esther Mahé Opfer eines sorgfältig ausgeklügelten Racheplans. Ein grausamer Vergeltungsschlag, der sich die Inselverhältnisse Bréhats und den ewigen Rhythmus der Gezeiten erbarmungslos zunutze macht."
ÜBER DIE AUTORIN
"Michèle Corfdir ist gebürtige Schweizerin und ausgebildete Lehrerin. 1972 erhielt sie den Preis der Schweizer Dichter französischer Sprache. Als Autorin veröffentlicht sie Erzählungen für Jugendliche, Kurzgeschichten für Zeitschriften und Kriminalromane.
Bereits seit über zwanzig Jahren lebt sie an der Nordküste der Bretagne, und in dieser landschaftlichen Umgebung spielen auch ihre Thriller."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchcover
Titelseite
Michèle Corfdir ist Autorin von 22 Kriminalromanen in französischer Sprache.
Originaltitel: Chasse à corps à Bréhat
Der vorliegende Roman dient einzig dem Zweck der Unterhaltung. Sämtliche Ereignisse, sowie die Aussagen, Gefühle und das Verhalten der Protagonisten sind frei erfunden. Sie stehen in keinerlei Bezug zur Realität und wurden lediglich für die Romanhandlung erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen oder real existierenden Ereignissen wäre reiner Zufall.
ERSTE STUNDEFLUT
Bréhat, Freitag, der 21. Mai
“EINE INSEL, archaischen Welten entsprungen, von Natur aus kalt und unentwegt dem Wind ausgesetzt. EINE INSEL, die den blauen Wellen nicht nur ihre rostig anmutenden Felsen überlässt, sondern ihnen auch ihre Buchten hilflos ausliefert.
EINE INSEL, deren Strände der Ozean mit seinen betörenden Wellen umspielt, und wo weiche, schlüpfrige Wesen angespült werden. In der warmen Sonne verenden Algen und Seeanemonen, durchsichtige Garnelen und einige Krabben, die sich bis hierher verirrt haben.
EINE INSEL, die sich immer wieder über ihren eigenen Anblick wundert, wenn sie sich bei auflaufender Flut zusammenzieht und im Ebbstrom ihre Fühler nach und nach wieder ausstreckt. Nur wenn die Flut die kontinuierlichen Strömungen unterbricht und für einen Moment das Geschrei der Vögel und der Atem der Zeit aussetzen, wirkt sie wie ein vergessener Kieselstein inmitten der Unendlichkeit von Himmel und Wasser…”
Esther Mahé blickte von ihrem Buch auf. Der Dichter, der diese Zeilen verfasste, hatte die Insel Bréhat bestimmt nie kennengelernt. Schließlich lebte er irgendwo im Indischen Ozean. Doch seine Herkunft tat nichts zur Sache. Sein Text beschrieb alle Inseln und erzählte von allen Meeren. Allerdings, fand Esther, verschwand beim Klang seiner Worte die Inselrealität hinter einem Scheinbild.
Die junge Frau legte das Buch auf das niedrige Mäuerchen, auf dem sie saß und das zwischen der Terrasse und dem Garten bis zum Strand hinabführte. Ihr Blick schweifte über die vom offenen Meer überflutete Bucht, die Baie de la Corderie. Im Speisesaal hatte die Wanduhr gerade zwölf Uhr geschlagen. Die Terrassentür stand offen und im Haus herrschte eine ungewöhnliche Ruhe. Sonst hätte sie sie bestimmt nicht gehört. In Kersal, wo die Stille ständig durch das Rauschen der Wellen, vom Wind oder der Anwesenheit von Menschen gestört wurde, war Ruhe äußerst selten.
Aber heute Mittag schimmerte das Meer friedlich vor sich hin. Eine winzige Brise verbreitete den Duft des spektakulär blühenden Ginsters, der hinten im Garten wuchs. Esther schloss die Augen und streckte ihr Gesicht den wärmenden Sonnenstrahlen entgegen.
Es war überraschend warm für die Jahreszeit. Wenn das Wetter hielt, würden am Pfingstwochenende zahlreiche Touristen nach Bréhat strömen, eine Art Vorgeschmack auf die Sommerferien. Esther freute sich darüber. Von der Nebensaison, den öden Wegen, den menschenleeren Geschäften und den geschlossenen Häusern hatte sie mehr als genug. Außerdem war es höchste Zeit, dass das Geschäft wieder anlief! Ihr Bankkonto war fast leer und es kam nicht in Frage, die Kosten für die Renovierung des Anwesens mit Bernards Gehalt zu begleichen. Sie hatten gemeinsam beschlossen, hier Gästezimmer einzurichten.
Der ehemalige Bauernhof Kersal war einst von Bernard Mahés Eltern bewirtschaftet worden und eignete sich wunderbar für seine neue Bestimmung. In dem Teil des Gebäudes, der früher als Stall und Scheune diente, befanden sich heute der Speisesaal und die Gästezimmer der Touristen. Der bescheidenere Westflügel war für die persönliche Nutzung von Esther und Bernard umgebaut geworden. Der ehemalige Stall und der Westflügel des Bauernhauses standen nicht nebeneinander, sondern waren in einem weiten Winkel aneinandergebaut. Während der hintere Teil verglast und als Wintergarten angelegt worden war, befand sich vor der Vorderseite eine große Terrasse mit Blick auf den Garten und den Strand.
Der Umbau des alten Bauernhauses hatte sich von Anfang an ausgezahlt. Das Haus war von Mai bis September stets ausgebucht. Die bretonische Exotik hatte Hochkonjunktur und die Lage von Kersal direkt am Meer faszinierte die Besucher, denn hier konnte man das tägliche Schauspiel der Gezeiten hautnah miterleben.
Das Anwesen befand sich zwar im nördlichen Teil der Insel und somit ziemlich weit vom Ort entfernt, doch daran schien sich niemand zu stören. Ganz im Gegenteil! Die Abgeschiedenheit verlieh dem Aufenthalt einen Hauch von Abenteuer, etwas Ungewöhnliches, das vielen gefiel.
Trotz einiger Unannehmlichkeiten, die die Vermietung von Gästezimmern bei sich zu Hause gezwungenermaßen mit sich brachte, hatte Esther ihre Entscheidung nie bereut. Ohne die Anwesenheit der Touristen und die damit verbundene Arbeit hätte sie die langen Momente der Einsamkeit, die der Beruf ihres Mannes mit sich brachte, nicht ausgehalten. Bernard war Handelsmatrose und fuhr auf Langfahrt. Er war bei einer großen Ölgesellschaft angestellt und drei von vier Monaten abwesend.
Esther atmete tief ein. Der süße Geruch von Ginster, vermischt mit dem Geruch von Seegras, das am Ufer trocknete, stieg ihr in die Nase und wurde mit jedem Atemzug intensiver. Sie fühlte sich wohl. Die Landschaft von Bréhat wirkte immer noch magisch auf sie. Auch die Touristen, die etwas später ankommen würden, wären begeistert, das wusste sie. Der Wind, die Blumen, das Meer, die Sonne… Nur wenige Menschen konnten sich dem Charme Bréhats entziehen. Esther selbst war ihm erlegen, als sie hier sechs Jahre zuvor an Land gegangen war.
Heute fragte sie sich manchmal, ob sie Bernard oder die Insel geheiratet hatte. Wahrscheinlich beide, denn damals war alles unteilbar miteinander verbunden gewesen… der Mann, sein Boot, das Meer, die Insel, Kersal.
Im Laufe der Jahre hatte sich ihre Sicht der Dinge jedoch geändert und nun betrachtete Esther das Leben nicht mehr auf dieselbe Art und Weise.
Geblendet von der Reflexion des Lichts auf der Wasseroberfläche blinzelte sie, streckte sich ausgiebig und fand, es sei Zeit, ins Haus zu gehen. Das Mäuerchen hinter sich lassend, stand sie auf, überquerte die Terrasse und betrat den Wintergarten. In diesem Raum empfing Esther ihre Gäste. Sie öffnete ihren altmodischen Schreibtisch und sah die Liste der sechzehn Personen durch, die sie heute empfangen würde. Sie waren alle Mitglieder eines Chors, des Ensemble Vocal de l’Orbe. Der Chor war auf Tournee in der Bretagne und gab heute Abend in der Kirche von Bréhat das Abschlusskonzert. Aus praktischen Gründen hatten die Sänger beschlossen, die Nacht auf der Insel zu verbringen.
«Es liegt uns allen am Herzen, dass wir bei Einheimischen unterkommen», hatte die Organisationsbeauftragte des Chores gesagt, die die Unterkunft telefonisch gebucht hatte. «Das ist meistens netter und außerdem billiger. Die Touristeninformation in Paimpol hat uns einen Prospekt zur Verfügung gestellt, in dem ich Ihr Gästehaus gefunden habe. Es gefiel uns am besten, und deswegen rufe ich Sie an.»
«Das ist sehr nett von Ihnen. Aber wie viele sind Sie eigentlich? Mein Haus ist nicht sehr groß und ich befürchte, dass…»
«Wir sind sechzehn. Fünfzehn Sänger plus der Chorleiter.»
«Oh, dann kann ich Ihnen zusagen. Ich verfüge über eine ausreichende Anzahl an Zimmern, um Sie alle unterzubringen.»
«Danke. Unsere Ankunft ist für Freitag, den einundzwanzigsten Mai nachmittags geplant. Dann haben wir auch genügend Zeit, Bréhat zu besichtigen. Am nächsten Tag fahren wir am frühen Morgen wieder ab. Ist Ihnen das so recht?»
«Wunderbar. Eine Frage noch… Bevor wir eine feste und endgültige Vereinbarung treffen, würde ich gerne einige, sagen wir, geografische Details klären, damit Sie nicht überrascht sind.»
«Ja?»
«Wie kommen Sie her?»
«Wir sind gewöhnlich mit einem Kleinbus unterwegs.»
«In diesem Fall fahren Sie zur Pointe de l’Arcouest. Sie liegt fünf Kilometer von Paimpol entfernt. Hier befinden sich die Anlegestelle und der Parkplatz, auf dem Sie Ihr Fahrzeug abstellen müssen, da der Autoverkehr auf der Insel verboten ist. Anschließend fahren Sie mit dem Schnellboot über den Chenal du Ferlas. Das dauert nur zehn Minuten, keine Zeit, um seekrank zu werden! In Port-Clos gehen Sie an Land. Dann kommt ein Fußmarsch. Von dort aus dauert es nämlich über eine halbe Stunde, bis sie Kersal erreichen. Ich glaube, das ist ein Detail, das eventuell problematisch werden könnte…»
«Machen Sie sich da keine Sorgen! Wir alle sind begeisterte Wanderer und lieben die Natur und wilde Landschaften sehr.»
«In diesem Fall sind Sie bei uns genau richtig, denn Kersal liegt ziemlich weit von der Ortschaft entfernt. Dieser Teil der Insel ist am wenigsten bewohnt… Wenn Sie auf eine Landkarte schauen, werden Sie feststellen, dass Bréhat eigentlich aus zwei Inseln besteht, einer nördlichen und einer südlichen. Sie sind durch eine von Vauban gebaute Steinstraße miteinander verbunden, man nennt sie Pont ar Prat. Unser Anwesen befindet sich auf der Nordinsel mit Blick auf das Meer.»
«Etwas Besseres kann man sich nicht wünschen…»
«Wenn ich Ihnen den Mietvertrag zusende, lege ich eine Karte bei, mithilfe derer Sie Kersal ganz leicht finden werden.
Ach! Übrigens… In Port-Clos können Sie Ihr Gepäck einem der Fahrer der Minitraktoren anvertrauen. Er wird es hierher zu uns bringen. Es sind die einzigen Fahrzeuge, die auf der Insel erlaubt sind. Diese Möglichkeit könnten Sie doch nutzen!»
Esther warf einen Blick auf den Haufen von Koffern und Reisetaschen, der eine ganze Ecke des Wintergartens einnahm. Bereits am Morgen waren sie vom Fahrer des Minitraktors hier abgestellt worden. Er hatte ihr mitgeteilt, dass ihre Gäste das gute Wetter für eine Inselrundfahrt mit dem Schnellboot nutzten und früher als geplant in Kersal ankommen würden.
Nachdem Esther die Zimmerverteilung in ihr Register eingetragen hatte, ging sie in die Küche und untersuchte die Seespinnen, die ihr ein Fischer eine Stunde zuvor geliefert hatte. Sie waren noch lebendig. Esther beschloss, sie erst am späten Nachmittag zu garen. Wenn man sie lauwarm servierte, schmeckten sie am besten.
Esther hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihren Gästen das Abendessen anzubieten.
Die Restaurants auf der Insel waren weit entfernt. Wenn die Gäste sich in Kersal einmal niedergelassen hatten, waren sie von der Schönheit der Landschaft, dem wechselnden Licht und der milden Luft überwältigt. Sie hatten keine Lust mehr, auszugehen. Bei trübem Wetter steckten die wenigsten den Kopf nach draußen, wenn im Kamin ein gemütliches Feuer knisterte und das Essen vor Ort angeboten wurde. Was die Speisekarte betraf, hatte Esther sich nie den Kopf zerbrochen. Krabben, Seespinnen, manchmal eine Platte mit Meeresfrüchten. Brot, gesalzene Butter, Käse, dazu Cidre oder Muscadet. Wem diese Küche nicht zusagte, konnte woanders essen. Esther nahm es ihren Gästen nicht übel.
Die Schalentiere waren in Ordnung. Esther brachte sie in die Hinterküche, in einen dunklen, kühlen Raum, der hinter dem Haus lag und in dem sie ihre Vorräte aufbewahrte. Dann ging sie zu den Gästezimmern, um noch einen kurzen Blick darauf zu werfen.
Wie üblich war alles in Ordnung. Man konnte sich darauf verlassen, dass Mariannig Fourrier, die Hausangestellte, sich niemals einen Fehler erlauben würde! Manchmal wäre es sogar Esther lieber gewesen, sie würde einen weniger beispielhaften Job machen und wäre dafür etwas freundlicher. Seit Esther sie eingestellt hatte und trotz all ihrer Bemühungen, waren sie nie miteinander warm geworden. Mariannig war schweigsam und mürrisch, mit streng zurückgezogenem Haar und zusammengekniffenem Mund. Sie schien sich in ihrer Rolle als vorbildliche Angestellte zu gefallen und weigerte sich strikt, aus der Spur zu geraten. «War sie schon immer so?», hatte Esther ihren Mann einmal gefragt. «Du müsstest sie doch gut kennen. Ihr seid gleich alt und habt eure gesamte Kindheit gemeinsam auf der Insel verbracht.»
Bernard hatte verlegen gewirkt.
«Eigentlich war sie in jungen Jahren ziemlich lustig. Draufgängerisch und zäh wie ein Kerl.»
«Das ist sie immer noch! Mir ist bereits aufgefallen, wie leicht es ihr fällt, Möbel zu verschieben. Völlig mühelos… Und du sagst, sie sei lustig gewesen? Ich kann es kaum glauben… Was ist nur geschehen, dass sie sich so verändert hat?»
«Ich habe nicht die leiseste Ahnung!»
«Und bei anderen Menschen, macht sie da den Mund mehr auf?»
«Woher soll ich das wissen?», hatte Bernard sichtlich genervt erwidert. «Hör mal, wenn du nicht zufrieden bist, schick sie einfach wieder weg!»
«Natürlich nicht! Das wäre ungerecht. Außerdem würde ich nirgends eine solche Arbeitskraft finden. Aber sie könnte etwas weniger mürrisch sein…»
«Wäre es dir lieber, wenn sie dir die Ohren volljammern würde?»
«Du willst es nicht verstehen!» Esther fehlten die Worte. «Ich wünschte, sie würde ab und zu mit mir reden, mich einfach anders sehen… Ihre Augen sind eiskalt! Manchmal jagt sie mir fast Angst ein!»
Bernard stand auf und schob dabei seinen Stuhl geräuschvoll zurück.
«Du liebe Zeit, Esther, du machst dir zu viele Gedanken! Mariannig ist eine alleinstehende Frau in den Vierzigern. Sie lebt bei ihren Eltern, und die sind alt. Ihre Mutter ist invalide… Du weißt, was das bedeutet! Ein Mann in ihrem Bett würde ihr Verhalten zweifellos besänftigen!»
Esther seufzte und beschloss, Mariannig Fourrier aus ihrer Gedankenwelt zu verbannen. Bernard hatte Recht. Sie würde sich nicht weiter den Kopf zerbrechen, nur weil eine verbitterte alte Jungfer ihre Freundschaft ablehnte!
Sie ging zurück zum Wintergarten und stellte fest, dass sie bis zur Ankunft der Gäste noch eine gute Stunde Zeit hatte. Das reichte aus, um sich ans Klavier zu setzen. In der warmen Jahreszeit konnte sie ihrem Instrument nur wenig Zeit widmen. Einen Moment hier und da, gerade genug, um ihre Fingerfertigkeit aufrechtzuerhalten. Aber es war unerlässlich. Andernfalls würde sie bis zum Herbst, wo die Gäste seltener wurden und sie endlich wieder mehr Zeit zum Klavierspielen hätte, Rückschritte machen. Auch die Virtuosität musste gehegt und gepflegt werden, sonst verkümmerte sie wie die Blumen im Garten. Esther wusste das. Es kam nicht in Frage, dass sie jemals vernachlässigen würde, was sie sich jahrelang erarbeitet hatte.
Als im Wintergarten das Telefon klingelte, bog sie gerade in den kleinen Korridor ein, der zum Westflügel führte. Dort befand sich ihre Wohnung.
«Allôôô, Esther, bist du’s? Hier spricht Marcel Lefol…»
Die junge Frau stieß einen Ausruf der freudigen Überraschung aus. Der frisch pensionierte Fischermeister war ein guter Freund Bernards, der zusammen mit anderen Fischern den Berufsstand bei der Seefahrtsbehörde vertrat. Esther hatte schon länger keine Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen.
«Wie geht es dir, Esther? Auf dem Festland bekommen wir dich ja nicht gerade oft zu sehen…»
«Das wundert mich sehr», scherzte Esther. «Ich überquere den Ferlas mindestens einmal die Woche, denn ab und zu muss ich schließlich meine Einkäufe erledigen.»
«Und wie geht es deinem Mann?»
«Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis er seinen Urlaub antreten kann. Ich erwarte ihn in Kürze.»
«Wie schön für dich! Auch ich werde mich weniger um dich sorgen, wenn ich ihn in deiner Nähe weiß!»
«Ach! Wieso das?»
«Ich sage es dir ohne Umschweife: Yves Lebré wurde freigelassen. Er ist heute Morgen aus dem Gefängnis entlassen worden.»
Esther spürte, wie ihr Herz plötzlich anfing, stärker zu schlagen.
«Oh! Das… Ich dachte, er wäre acht Jahre eingebuchtet…»
«Auf Bewährung wegen guter Führung», erklärte Marcel Lefol und seufzte laut. «Der Vollstreckungsrichter hat es mir gerade mitgeteilt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Yves hier in der Gegend auftaucht. Zumindest gab er das bei seiner Haftentlassung an.»
«Ach du meine Güte…! Und du glaubst tatsächlich, dass… dass er seine Drohungen wahr machen will?… Alles, was er gegen Bernard, dich und die anderen gesagt hat?»
«Er ist zwar auf freiem Fuß, aber auf Bewährung. Er weiß sehr wohl, dass er beim kleinsten Fehltritt wieder hinter Gittern landet. Aber…»
«Aber was…?»
«Yves war schon immer ein Hitzkopf, er war völlig unberechenbar. Deshalb bin ich sehr froh, dass Bernard die nächsten Wochen in Kersal verbringen wird.»
Esther nickte, obwohl sie einige Zweifel hegte. Sie fragte sich, ob sich die Anwesenheit ihres Mannes auf die Lage tatsächlich positiv auswirken würde. Im Grunde genommen befürchtete sie genau das Gegenteil. Würde Bernards Anwesenheit nicht sogar Yves Lebrés Groll gegen diejenigen, die ihn in den Abgrund gestürzt hatten, wecken?
Andererseits war Yves weder auf der Insel noch in den umliegenden Häfen ein gern gesehener Gast, obwohl er früher viele Leute um sich geschart hatte, die für seine Angelegenheiten eingetreten waren. Das hatte bei seinem Prozess für viel Aufsehen gesorgt. Danach war seine Geschichte in allgemeiner Gleichgültigkeit versunken.
«Eines musst du mir versprechen, Esther», sagte Marcel Lefol abschließend. «Es wäre besser, heute Abend vor dem Schlafengehen die Fensterläden zu schließen und alle Türen des Hauses abzuschließen. Vergiss das nicht!»
Esther fing an zu lachen.
«Um meine Sicherheit brauchst du dir keine Sorgen zu machen! Rund fünfzehn Touristen werden heute hier übernachten. Außerdem: Warum sollte Yves mich angreifen? Ich habe ihm nichts getan.»
«Er könnte sich doch auf diese Weise an Bernard rächen…»
«Zu umständlich, zu kompliziert für einen Mann wie ihn!»
«Wer weiß…? Sollte er je auftauchen, ruf’ auf jeden Fall sofort Olivier Hérard an. Er wohnt auf der anderen Seite der Bucht, und es würde nicht lange dauern, bis er bei dir wäre.»
«Okay. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass du ein wenig übertreibst, Marcel! Ich bin hier in Kersal absolut sicher.»
Esther plauderte noch einige Minuten mit Lefol, dann legte sie auf.
Sie setzte sich an ihr Klavier und vertiefte sich in Bachs sechste Partita.
***
Olga… Die alte Olga, die immer nur meckert. Die ständig an den Strippen ihres Geldbeutels herumzieht. Die das ganze Jahr über die gleichen Klamotten trägt. Die ihren glatten, grauen Haarschopf zwischen zwei Spiegeln stehend regelmäßig selbst schneidet, um das Geld für den Friseur zu sparen. Die nichts von einem Computer wissen will, aber nicht etwa, weil sie etwas gegen Internet oder Textverarbeitung hätte, sondern weil sie sich weigert, das Geld auf eine so dumme Art und Weise zum Fenster hinaus zu werfen. Also schleppt sie weiterhin ihre antike Underwood-Schreibmaschine mit sich herum und tippt ihre Artikel und Nachrichten mit lautem metallischem Klappern ab.
Olga Verkof war am Vortag in Bréhat angekommen und betrachtete düster das alte Fischerhaus Ti Avel, das seit über vierzehn Jahren ihr Zuhause war. Alt, wurmstichig, heruntergekommen, einen unangenehmen Schimmelgeruch verströmend und schwarz vor Feuchtigkeit. Abgeblätterte Tapeten, Salzausblühungen an den Wänden, Fenster mit losen Rahmen, eine wackelige Treppe… Es wäre an der Zeit, das Haus zu renovieren, dachte Olga und wusste genau, dass sie es nicht tun würde… Dabei hätte sie es sich weiß Gott leisten können, mit ihren Sparbüchern, Wertpapieren und Aktien sowie Goldmünzen, die sich im Tresor ihrer Bank stapelten.
Ein Geizkragen! Das war sie. Alles darf rein, aber nichts darf raus. Ihr Haus war eine Einbahnstraße. Wenn ein triftiger Grund sie dazu zwang, sich in die Gegenrichtung zu bewegen, erlitt sie schier unmenschliche Qualen. Arbeiten und den Lohn einstreichen. Nach dem Einstreichen horten. Horten und sicher sein, dass alles da ist, wo es hingehört. Ein ganzer Berg von Geld war da, und er verlieh ihrem Leben Gewicht… Er war der Ballast, verschaffte ihr eine Verankerung im Leben… Vielleicht auch Sicherheit? Nein, gar nicht! Dieser Haufen Geld war einfach etwas Unantastbares, das man weder anstechen noch umlagern durfte.
Olga zuckte mit den Schultern und zog den Reißverschluss ihres Hosenschlitzes hoch, der sich hartnäckig immer wieder öffnete. Seit dem Morgen schon arbeitete sie daran, die Schandtaten, die der Winter an ihrem Haus begangen hatte, zu reparieren. Sie hatte in jedem Zimmer Luftentfeuchter aufgestellt, die Fenster geöffnet, für Durchzug gesorgt und die Vorhänge gewaschen, von denen die Hälfte die Wäsche nicht überstanden hatte und nun zerrissen auf den Wäscheleinen trocknete. Zum Glück hatte Olga daran gedacht, auf Vorrat andere Vorhänge zu kaufen. Schon im Januar hatte sie sie günstig in einem Kaufhaus im Schlussverkauf erstanden. Olga würde sie aufhängen, sobald sie die selbstklebenden Gummidichtungen ausgetauscht hätte, die zur Abdichtung der Fenster dienten. Nach monatelangem schlechtem Wetter erfüllten die vorhandenen ihren Zweck nicht mehr.
Jedes Jahr, wenn sie auf Bréhat ankam, erlitt Olga einen Schock. Der schlechte Zustand ihres Hauses erschütterte sie zutiefst. Dann rappelte sie sich auf und unternahm jedes Jahr dieselben Instandhaltungsarbeiten. Es dauerte drei oder vier Tage, bis der Schimmelgeruch wie durch ein Wunder verschwand und sie sich an die abblätternde Farbe und die Feuchtigkeitsspuren unter den Fenstern gewöhnt hatte. Irgendwann nahm sie sie nicht mehr wahr. Sie hörte die Holzdielen nicht mehr quietschen und fand die richtigen Bewegungen, um klemmende Türen so aufzustoßen, als würden sie gar nicht klemmen. Dann fühlte sie sich endlich wieder zu Hause in ihrer Sommerresidenz. Die Hausarbeit vergaß sie wie im Handumdrehen und widmete sich dem Schreiben und dem Angeln.
Seit der Insolvenz ihrer Zeitung war Olga im Vorruhestand und verbrachte ihre Tage nach eigenem Gutdünken.
Doch seltsamerweise hatte die Freiheit ihr Leben nicht angenehmer gemacht. Fehlende Verpflichtungen waren schwieriger zu bewältigen, als sie es angenommen hatte. Innerhalb von zwei Monaten hatte Olga nicht mehr zu Wege gebracht als drei Kurzgeschichten. Der Artikel, den sie verfasst hatte, erschien ihr stümperhaft!
Früher hatte sie eine Menge Arbeit aus Paris mitgebracht: Publikationsprojekte, Reportagen, die organisiert werden wollten und Hintergrundartikel, die umgeschrieben werden mussten. Kurzgeschichten schrieb sie in einem Zuge und nahm sich vor, sie im darauffolgenden Winter zu veröffentlichen. Aber dieses Jahr trieb sie in einer süßlichen, übelkeitserregenden Unbestimmtheit, die so unangenehm war wie eine beginnende Seekrankheit. Wenn Agnes bereit gewesen wäre, sie zu begleiten, wäre es vielleicht… Freudlos lachte Olga auf. Es hatte sich herausgestellt, dass man nicht zu viel von ihr erwarten durfte, besonders, wenn sie keinen Nutzen daraus ziehen konnte! Und hier auf Bréhat war es schlicht unmöglich, persönliche Verbindungen spielen zu lassen. Die Prominenten, die auf der Insel wohnten, verschanzten sich hinter den Mauern ihrer Anwesen, hielten strengste Anonymität ein und wollten auf keinen Fall von kleinen Emporkömmlingen wie Agnes Donzel belästigt werden!
Olga seufzte. «Keine Arbeit, außer der, die ich mir selbst ausdenke… Keine Braut, weil ich mit meinem Aussehen kaum eine Chance habe, eine zu finden. Ach, wenn ich nur einmal das tun könnte, was die anderen tun… Mit Rentnern vögeln, die nichts lieber täten.» Olga erschrak vor Ekel und beschloss, ihre düsteren Gedanken schnurstracks zu bekämpfen und sich in die Arbeit zu stürzen. Sie nahm die Rolle mit dem Klebeband aus der Verpackung und öffnete mit einer Schere bewaffnet das Fenster des Wohnbereichs. Sie begann mit der rechten oberen Ecke. Als die Dichtung am Falz klebte, zog sie das Schutzband ab, das sich bis zu ihren Füßen hin einringelte.
Es war eine leichte, ja sogar angenehme Arbeit. Das Wetter war schön! Das im Schein der Sonne glitzernde Meer tröstete sie. Olgas Boot, die Kenavo, lag an ihrem Ankerplatz in der Corderie-Bucht. Es war ein solides, sechs Meter langes Boot, ein Canot vom Typ Paimpol, mit dem sie den ganzen Sommer über in der Gegend um Bréhat, dem Plateau des Sirlots und dem Plateau de la Horaine kreuzte… Manchmal fuhr sie sogar bis nach Barnoïc, wenn die Makrelenschwärme oder die Wolfsbarsche gerade anfingen zu beißen und bis dorthin schwammen.
Olga kannte die Umgebung der Insel so gut wie die alten Fischer. Die zerklüftete Küste, die Untiefen von La Moisie… Die ineinanderfließenden Strömungen waren Teil eines Spiels, dem sie sich seit fast fünfzehn Jahren mit Leidenschaft hingab, ein Spiel mit dem Meer, dem Wind und den Fischen… «Im Grunde genommen sind die anderen Fischer meine Spielkameraden», sagte sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen. Wie erstaunt waren sie gewesen, als sie im ersten Jahr beobachtet hatten, wie Olga ihre Reusen auslegte, ihr Trammelnetz hob oder sich zielstrebig aufmachte und aufs Meer hinausfuhr. Aber sie hatten sich schnell daran gewöhnt. In Wathosen und Ölzeug und mit ihrer Grenadierfigur unterschied sie sich ohnehin nicht von den Männern.
Als Olga mit dem Anbringen der Dichtung fertig war, schloss sie das Fenster. So zusammengepresst haftete die Abdichtung perfekt an den Fensterrahmen. Kein Luftstrom zog hindurch. Ab jetzt würden sich die Vorhänge nicht mehr gespenstisch aufgebläht bewegen, wenn der Wind anfing zu wehen.
Sie warf einen Blick auf die Uhr und beschloss, das Mittagessen ausfallen zu lassen. Heute Morgen hatte sie feststellen müssen, dass ihr die Jeans vom letzten Jahr nicht mehr passte und sich vorgenommen, auf der Stelle mit einer Diät anzufangen.
Um den Magen zu besänftigen, schluckte sie ein großes Glas kaltes Wasser und ging nach oben. Auch dort mussten in beiden Zimmern die Fenster abgedichtet werden. Von einem der Fenster hatte man einen wunderbaren Blick auf die Baie de la Corderie, vom anderen auf die Nachbarhäuser Kersal, Lan Vras und Pen Crec’h, das auf einer Anhöhe liegende Anwesen der Familie Rouxel.
Wenn sie fertig wäre, würde sie aufs Meer hinausfahren und eine kleine Runde drehen. Gerade mal lange genug, um den Motor ein wenig laufen zu lassen und sich zu vergewissern, dass der Rumpf noch wasserdicht war. Das Boot bereitete Olga keine großen Sorgen. Die Kénavo hatte in Olivier Hérards Schuppen überwintert. Er hatte das Boot vor ihrer Rückkehr gewartet und wieder zu Wasser gelassen.
Trotzdem… Olga würde eine kleine Ausfahrt machen. Nicht lange. Sie wollte tief durchatmen, die frische Meeresluft genießen… Um ihre Angelausrüstung würde sie sich morgen kümmern. Das hatte keine Eile. Beim Einkaufen im Ort hatte sie sich am Morgen bereits erkundigt: Die Makrelen hatten die Bucht noch nicht erreicht.
Ein alter Fischer hatte ihr zugeflüstert, dass man bereits nach der nächsten großen Flut mit etwas Glück vielleicht ein paar von ihnen fangen könnte… Vorausgesetzt, die Trawler würden die Fischschwärme nicht dezimieren, weil sie zu nah an der Küste fischten.
***
Jérôme Rouxel richtete sein Fernglas durch die nach Westen ausgerichtete Fensterfront auf die Fahrrinne des Flusses Trieux. Die ersten Fischerboote fuhren gerade in die Fahrrinne hinein. Er hatte sie schon so oft beobachtet, dass er sie alle an ihrer Silhouette und den Farben ihres Rumpfes erkannte. Nur die Namen kannte er nicht. Sein Großvater hatte ihm versprochen, dass sie einmal gemeinsam bei Springflut nach Loguivy fahren würden, denn da würden die meisten Schiffe im Hafen liegen und sie könnten sie aus der Nähe betrachten. Aber der Junge wusste genau, dass weder seine Mutter noch sein Großvater sich dazu durchringen würden, auf den Kontinent zurückzukehren, wenn sie sich einmal für die Sommerzeit auf Bréhat niedergelassen hatten. Beide hassten den Lärm, die Autos und die vielen Menschen auf den Straßen.
Jérôme in gewisser Weise auch… Nur nicht aus demselben Grund. Eher wegen der Blicke, die die Leute ihm zuwarfen. Oh, er verstand sehr wohl, dass ein elfjähriger Junge, der an einen Rollstuhl gefesselt war, nur Mitleid oder Unbehagen hervorrufen konnte! Deshalb zog er es vor, sich nicht von Pen Crec’h wegzubewegen. Wenn er Lust hatte, hinauszugehen, reichte ihm die Gegend um den Signalmast vollkommen aus, und kaum ein Spaziergänger verirrte sich bis hierher.
Aber er hatte einen Lieblingsplatz, an dem er den größten Teil seines Tages verbrachte, nämlich das große Zimmer, das extra für ihn unter dem Dachboden eingerichtet worden war. Jerôme liebte diesen Ort. Er erreichte das Zimmer mithilfe eines elektrischen Lifts, der mit großem Aufwand entlang des Treppengeländers installiert worden war. Sein Rollstuhl musste lediglich daran befestigt werden, und Jérôme konnte ohne fremde Hilfe hinauf oder hinunter fahren. Dank der großen Fenster, die einen Teil des Daches ersetzt hatten, genoss das Kind einen atemberaubenden Blick auf die Corderie-Bucht, die Trieux-Mündung und den gesamten Archipel von Bréhat. Von seinem Turmzimmer aus konnte Jérôme sogar die Nachbarhäuser und das Kommen und Gehen ihrer Bewohner beobachten. Auf der Nordseite befand sich ein Fenster mit Blick auf den Signalmast und die Wiese, auf der seit kurzem ein Esel weidete, ein Geschenk seines Großvaters.
«Es ist höchste Zeit, dass du von deinem Hochsitz heruntersteigst, mein Junge!
Man kann das Leben nicht verstehen, indem man die Welt nur durch ein Fernglas beobachtet. Man muss sich ihm stellen! Ich hoffe, dass Mathurin, so heißt dein Esel, dir dabei helfen wird. Es ist ein Zugesel, Jérôme, und er wurde sogar als solcher abgerichtet. Der Karren wird in etwa zehn Tagen geliefert. So hast du genug Zeit, dich an das Tier zu gewöhnen. Ihr werdet ganz bestimmt gute Freunde sein…!»
Jérôme war sprachlos gewesen. Dann hatte er stotternd gefragt:
«Großvater, was ist denn ein Zugesel?»
«Du magst deinen Rollstuhl nicht besonders und ich kann dich verstehen. Deine Mutter und ich haben uns daher überlegt, dass du ihn bei deinen Ausflügen durch einen Eselskarren ersetzen könntest. So kannst du dich nach Belieben fortbewegen, ohne dass irgendjemand deine Behinderung auf den ersten Blick erkennen könnte. Außerdem sind die kleinen Wege der Insel wunderbar für diese Art der Fortbewegung geeignet.»
Jérôme hatte seinen Großvater mit großen runden Augen angesehen. Der Gedanke, Abraxas – so hatte er seinen Rollstuhl getauft – stehen zu lassen, erschien ihm unpassend und furchtbar beängstigend. Der Rollstuhl diente ihm schon so lange als schützender Kokon. Er war an ihn gewöhnt und konnte ihn leicht manövrieren. Warum sollte er sich in gewagte Abenteuer stürzen? Und das in einem wenig stabilen, von einem Tier gezogenen Karren, von dem er nicht einmal sicher war, ob er es überhaupt unter Kontrolle hätte?
Hilflos schüttelte er den Kopf.
«Nein, das ist keine gute Idee… Ich würde es niemals wagen…»
«Mal sehen… Meinst du nicht…? Ein bisschen mehr Mut, mein Junge! Man kann alles lernen, man muss nur ein bisschen guten Willen aufbringen! Dein Esel wurde sehr gut abgerichtet, das habe ich dir schon gesagt. Zuerst musst du dir ein paar Kenntnisse aneignen und dann geht’s los! Du schaffst das schon!»
Die Augen immer noch fest an sein Fernglas gedrückt, beobachtete Jérôme einen kleinen Kutter, der gerade an Roc’h Kervarec vorbeigefahren war. Das war der Pétrel Olivier Hérards, ein Fischer, der direkt gegenüber auf der anderen Seite der Bucht wohnte. Jérôme beobachtete, wie der Kutter sich dem Ankerplatz näherte und sich anschickte, dort anzulegen. Als der Junge ihm mit den Augen folgte, entdeckte er plötzlich ein Boot, das am Vortag noch nicht da gewesen war.
«Die Kénavo! Das bedeutet, dass Olga da ist. Cool! Dann kann ich sie ja bald mal besuchen…»
Jérôme mochte diese Nachbarin. Sie war schroff, hässlich und oft schlecht gelaunt, aber er konnte ihr alles erzählen, was ihm durch den Kopf ging, Schimpfwörter, Spott, sogar die vulgärsten Witze, die man sich vorstellen konnte… Nicht wie zu Hause, wo er seine Zunge ständig im Zaum halten musste! Und es gab noch etwas anderes, etwas wirklich Außergewöhnliches. Die dicke Olga schien niemals mitbekommen zu haben, dass er behindert war! Kein Wort über Abraxas! Kein einziges! Olga schien dem Rollstuhl nicht mehr Bedeutung beizumessen als natürlichen Attributen wie eine große Nase oder eine Brille – Details, auf die anzuspielen unhöflich gewesen wäre.
«Komm rein oder geh weiter, aber bleib nicht auf der Türschwelle stehen!», waren ihre Worte gewesen, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Sie war nicht einmal aufgestanden, um ihm durch die Tür zu helfen! In ihrem Haus war alles dunkel und alt. Es roch auch nicht besonders gut. Die Stühle waren bunt zusammengewürfelt, überall lag Staub und auf der Spüle stand ein Haufen schmutziges Geschirr… Aber sie hatten sofort angefangen, sich wie gute Freunde zu unterhalten. Vom Angeln, von ihrem Boot und von ihrer Schreibmaschine.
«Sind Sie Schriftstellerin?»
«Na ja… So was in der Art.»
«Benutzen Sie keinen Computer?»
«Als ich in Paris bei einer Zeitung arbeitete, schrieb ich meine Artikel auf einem PC. Es ging nicht anders. Wie alle anderen musste ich es wohl oder übel lernen. Und du, magst du Computer?»
«Ich liebe sie!»
«Hast du einen Computer?»
«Ja, bei mir zu Hause, in Laval. Aber hierher darf ich ihn nicht mitnehmen.»
«Wieso das?»
«Weil ich zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe. Mein Großvater sagt, dass ich mich wenigstens in den Ferien mit etwas anderem beschäftigen soll.»
«Und womit beschäftigst du dich?»
«Ich habe meine Modellschiffe, Hanteln und andere Sachen fürs Krafttraining, eine Sammlung von Figuren, die ich bemale, und ich habe ein Fernglas. Ich beobachte alles, was in der Umgebung passiert. Ich kenne Sie schon lange! Ich weiß, dass Sie jeden Tag angeln gehen und dass Sie ab und zu Fahrrad fahren, aber nicht oft.»
«Tatsächlich? Und warum hast du mich dann nicht früher besucht?»
Verlegen hatte das Kind den Blick abgewandt. Er hatte sich nicht getraut, ihr zu verraten, dass sie in den Augen seiner Familie keine Person war, mit der man sich traf. Da Jérôme kein Wort über die Lippen gebracht hatte, hatte Olga auch nicht weiter auf eine Antwort bestanden.
Jérôme schwenkte sein auf einem Stativ befestigtes Fernglas, bis das Haus von Olga Verkof in seinem Blickfeld erschien. Die Fensterläden waren offen und die Tür ebenfalls. Plötzlich erblickte er seine alte Freundin an einem der Fenster im ersten Stock.
«Was macht sie denn da? Fliesen putzen, Fensterrahmen streichen? Das würde mich schwer wundern…» Er versuchte, die Einstellung des Fernglases feiner zu stellen, konnte aber nicht erkennen, womit Olga gerade beschäftigt war. Es wurde Zeit, rauszugehen und die paar hundert Meter Weg zwischen Pen Crec’h und Ti Avel hinter sich zu bringen. «Ich kann ihr auch von dem Esel und dem Eselskarren erzählen, von Olivier, der versprochen hat, mich an einem schönen Tag mit aufs Meer zu nehmen, von Esther, die mir das Klavierspielen beibringen möchte, und von der alten Louise Lozac’h, die gerade völlig durchdreht…»
Doch als er seinen Rollstuhl am Treppengeländer befestigte, läutete unten die Glocke. Es gab Mittagessen. Sein Besuch bei Olga würde ein wenig warten müssen.
ZWEITE STUNDE
Esther hielt die letzten Takte von Schuberts Impromptus leicht zurück, wie ein Gespann, das man sanft zum Stehen bringt. Dann setzte sie den Schlussakkord. Als es wieder still wurde, rieb sie sich mechanisch die Hände, drehte ihren Klavierhocker und wandte der Tastatur den Rücken zu.
Seit fast einer Stunde hatte sie sich ganz der Musik hingegeben. Sie konzentrierte sich, sie bemühte sich. Zunächst die Partita von Bach und dann Schubert. Solange sie spielte, dachte sie an nichts anderes, aber sobald ihre Finger nicht mehr über die Tasten glitten, wanderten Esthers unruhige Gedanken zu Yves Lebré zurück.
Nachdem im Juni 1994 das Urteil gefallen war, hatte er laut durch den Gerichtssaal gerufen: «Glaubt nicht, dass hiermit alles vorbei ist! Wenn ich meine Strafe abgesessen habe, seht ihr mich wieder, jeder von euch! Ich kann warten!» Mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger deutete er auf den hinteren Teil des Saals, dorthin, wo die Gruppe der Fischer stand. Hinterher schleuderte er Schimpfwörter, bis der überforderte Richter den Gendarmen ein Zeichen gab und sie ihn von der Anklagebank fortbrachten.
«Er wird sich schon beruhigen», hatte Bernard nach dem Prozess gesagt, während er und seine Frau mit dem Auto nach Arcouest zurückfuhren. «Zeit genug hat er, um das alles zu verdauen… Aber dass er acht Jahre bekommen würde, hätte ich nicht gedacht!»
«Darüber hättest du früher nachdenken sollen. Du hast ihn nicht gerade geschont!», hatte Esther erwidert.
«Ich habe unter Eid ausgesagt! Ich habe das berichtet, was ich gesehen habe. Es wäre nicht richtig gewesen, anders zu handeln.»
«Okay… Nur als die Anklage dich nach seinem Charakter fragte, hättest du… Ich meine, es war nicht notwendig, so viele Details zu liefern.»
«Alles, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit! Yves ist ein bissiger und aggressiver Kotzbrocken, der überall, wo er hinkommt, Unruhe stiftet. Es vergeht kein Treffen, keine Diskussion, bei der er nicht sein Maul aufreißt. Keine Demonstration, bei der wir nicht auf ihn aufpassen müssen, bei der wir ihn nicht zurückhalten müssen. Er ist ein Provokateur, ein Vandale. Jedes noch so kleine Kämpfchen kommt ihm geradezu gelegen, er liebt es, seine Kraft mit jemandem zu messen! Er schadet jeder Initiative. Es ist unmöglich, ein Projekt zu einem positiven Ende zu bringen, wenn er dabei ist. Solidarität, vernünftige Lösungen, einmal gefallene Entscheidungen dann auch beachten… Yves weiß nicht einmal, was das ist!»
«Ja, vielleicht, aber…»
«Hör zu, Esther! Yves ist ein gefährlicher Typ. Es war nicht das erste Mal, dass er sein Messer zückte!»
«Ich weiß… Aber es handelte sich vor allem um eine ziemlich unglückliche Verkettung von Umständen und…»
«Der Richter hat das berücksichtigt. Auch die Ereignisse der letzten Wochen hat er berücksichtigt. Die Demonstrationen, unsere Aktionen in den Markthallen von Rungis und schließlich die Menschenmenge bei der Kundgebung in Rennes… All das ist Yves vielleicht zu Kopf gestiegen, aber es entschuldigt seine Tat doch nicht. Jean Le Men starb an einem Messerstich in den Bauch. Das ist alles, was zählt! Es ist eine Tatsache! Von den Plädoyers der Anwälte dürfen wir uns nicht erweichen lassen! Außerdem sind alle anderen Fischer auch dieser Ansicht.»
Bernard hätte niemals zugegeben, dass er möglicherweise zu weit gegangen war. So ließ Esther die Diskussion auf sich beruhen. Sie war jedoch weiterhin der Meinung, dass Bernard Yves Lebré nicht so hätte belasten dürfen, wie er es getan hatte. Eine Schlägerei am Ende einer Demonstration, die aus dem Ruder lief… Die Klinge eines Messers, die plötzlich in eine andere Richtung abdriftete, als hätte sie die Orientierung verloren und schließlich einen tödlichen Stich verursachte… Hätten die Ohren des Richters nur die Tatsachen zu hören bekommen, wäre das Urteil zweifellos weniger streng ausgefallen.
Die junge Frau drehte erneut ihren Klavierhocker und saß wieder vor der Tastatur. Automatisch legte sich die rechte Hand gewohnheitsgemäß auf die Tasten und spielte ein paar Akkorde an. Esther fragte sich, ob sie Bernards unnachgiebigen und starren Charakter, seine ganze Persönlichkeit hätte ertragen können, wenn sie Tag für Tag an seiner Seite gelebt hätte… Und wenn nicht unerwartete Ereignisse ihr beider Leben radikal verändert hätten…
1995, ein Jahr nach der Verurteilung von Yves Lebré, hatte Bernard das Fischen aufgegeben. Sein altes Fischerboot hatte einen schweren Schaden erlitten, zu schwer für eine Reparatur.
Die Wirtschaftskrise hatte die ganze Branche erfasst und bot keinen ausreichenden Anreiz für den Kauf eines neuen Bootes. Schließlich hatte Bernard alles zum Schleuderpreis verhökert und war auf Handelsschifffahrt gegangen. Drei Monate auf See, ein Monat zu Hause. Jedes Wiedersehen fühlte sich an wie eine Verlobung, und dann nahte erneut die Trennung… Dieser Lebensrhythmus verwischte die Unterschiede der Charaktere und milderte die unvermeidliche Abnutzung des Zusammenlebens ab.
Esther hatte sich eine Beschäftigung suchen müssen, um die Einsamkeit, die schnell unerträglich geworden wäre, in Grenzen zu halten. Außerdem nahm die Musik nicht ihre gesamte Zeit in Anspruch. Damals kam sie auf die Idee, Touristen auf Bréhat eine Unterkunft anzubieten. Bernard hatte ihr Vorhaben voll und ganz unterstützt, denn er wusste genau, dass seine Frau es sonst nicht lange auf der Insel ausgehalten hätte. Manchmal erweckte Bréhat tatsächlich den Eindruck, wie ein verlassenes Floß vor der Küste zu treiben… menschenleer…
Nachdem die Restaurierung von Kersal abgeschlossen war, begann für Esther und Bernard ein neuer Lebensabschnitt, an den sich beide im Handumdrehen gewöhnt hatten.
«Hättest du nicht gerne ein Kind?», hatte eine der wenigen Freundinnen, die Esther auf Bréhat gefunden hatte, sie einmal gefragt.
«Das ist nicht mein Ding…», hatte sie geantwortet. «Ich habe keine mütterliche Ader.»
«Tatsächlich? Woher willst du das wissen?»
«Kinder langweilen mich und außerdem verfalle ich vor einem Kinderbettchen niemals in eine Art Ekstase. Das ist ein Zeichen.»
«Und Bernard?»
Esther brach in Gelächter aus.
«Dreimal darfst du raten…! Na ja… Ich schätze, er ist wie alle Männer! Er würde sich bestimmt über ein Kind freuen… Aber die meiste Zeit ist er sowieso nicht da, also überlässt er mir die Entscheidung.»
Die Freundin hatte verständnisvoll genickt.
«In gewisser Weise verstehe ich dich. Aber du bist jung, in ein paar Jahren wirst du vielleicht schon anders darüber denken.»
«Seither ist viel Zeit vergangen…», dachte Esther, während sie ihre Finger auf die Tastatur legte. «Aber Babys berühren mich noch immer nicht wirklich…». Ich habe keinen Draht zum Mutterinstinkt. Ich strebe nicht danach, Mutter zu werden, es bedeutet mir nichts… Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, und Bernard ist fast vierzig… Wir haben einen Lebensstil gefunden, der zu uns passt. Ich frage ihn nicht, was er während seiner Zwischenstopps macht. Und hier weiß niemand, wie ich manchmal meine Nächte verbringe…» Ein angedeutetes Lächeln huschte über Esthers Gesicht, dann stand sie auf und ging zum Fenster. Es schien ihr, als hätte sie Stimmen gehört.
Sie hatte sich nicht geirrt. Etwa fünfzehn Personen erschienen auf der Terrasse.
«Entschuldigen Sie, so früh haben Sie uns bestimmt noch nicht erwartet!», rief ein Mann mittleren Alters, der sich von der Gruppe löste und auf Esther zukam. «Aber wissen Sie… Heute Morgen beschlossen wir angesichts des herrlichen Wetters, das Passagierschiff um halb elf zu nehmen, das uns auch auf einen Ausflug rund um die Insel mitnahm.»
«Das war eine sehr gute Idee, es ist eine Spazierfahrt, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Man hat mich schon vorgewarnt, dass Sie früher als erwartet hier sein würden. Der Gepäcktransport. Ich habe schon auf Sie gewartet.»
«Prima. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle? Robert Racine, Président des Ensemble Vocal de l’Orbe. Und das sind die Mitglieder des Chors», sagte er und wandte sich den anderen Sängern zu. «Kommen Sie her, lassen Sie mich Ihnen alle vorstellen! Meine Frau Josiane, André Berthod, unser Chorleiter, Jean und Anne-Marie Borel, die Schatzmeister… Ingrid Chevel, die Initiatorin dieser Reise. Sie machte den Vorschlag, uns die Gegend um Paimpol zu zeigen und übernahm einen Großteil der Organisation.»
Leutselig zählte Robert Racine die Namen der anderen Chorsängerinnen und -sänger auf. Esther schüttelte jedem die Hand und hatte für jeden ein freundliches Wort. Dann ging sie zu einem lockeren Gespräch über, denn das, so wusste sie aus Erfahrung, war der schnellste und sicherste Weg, damit die Leute sich gleich wohlfühlten.
Nach ein paar Minuten waren alle entspannt und plauderten gleichzeitig in mehreren Gruppen, was das Zeug hielt. Das Stimmengewirr der lebhaften Gespräche schwoll an und wie so oft in dieser Situation begannen die Gäste, Esther über die Besonderheiten der Insel auszufragen.
«Wir wohnen auf dem Land und verstehen nichts vom Meer, und wenn der Meeresspiegel ständig steigt und wieder sinkt, ist das für uns ein echtes Ereignis!», meinte eine junge blonde Frau. «Heute Morgen haben wir am Hafenkai angelegt und ein Teil der Passagiere ist ausgestiegen. Eine Stunde später, nachdem wir die Insel umrundet hatten, war die Fahrrinne schon vollständig mit Wasser bedeckt!»
«Ich habe es dir gesagt, Sonja!», sagte ein kleiner bärtiger Mann, offensichtlich ihr Ehemann. «Das Meer stieg, es war Flut. Ich habe gehört, dass wir gerade um die Mittagszeit Hochwasser haben.»
Esther bestätigte mit einem Kopfnicken.
«Sagen Sie, könnten Sie uns erklären, was es mit Ebbe und Flut genau auf sich hat?», fragte eine grauhaarige Frau. «Wir wollen doch noch etwas dazulernen!»
«Natürlich, sehr gern… Das Meer steigt sechs Stunden lang, bis es seinen Hochwasserstand erreicht. Etwa zwanzig Minuten lang ist der Wasserstand gleich hoch und das Meer bleibt sozusagen flach. Wir nennen das l’étale. Bei Ebbe läuft das Wasser dann wieder sechs Stunden lang ab. Und es bleibt erneut zwanzig Minuten lang à l’étale. Dann beginnt alles wieder von vorne… Heute erreichte die Flut um zwölf Uhr sieben ihren Höchststand, um achtzehn Uhr dreißig haben wir Niedrigwasser und dann wieder Hochwasser um null Uhr neunundzwanzig.
Zwischen zwei Hochwasserständen vergehen also insgesamt etwas mehr als zwölf Stunden.»
«Das ist ja so präzise wie ein Uhrwerk!», staunte Jean Borel. «Woher wissen Sie denn die Uhrzeiten von Hoch- und Niedrigwasser so genau?»
«Ganz einfach, l’Horaire des Marées! Das ist ein Gezeitenkalender», antwortete Esther und zog eine kleine Broschüre aus ihrer Tasche. «Da steht alles drin, Tag für Tag. Die Uhrzeiten, der Tidenhub, der Koeffizient…»
«Tidenhub?»
«Der Tidenhub ist der Unterschied zwischen dem unteren und dem oberen Pegelstand. Außerdem sollte man wissen, dass die Bewegungen der Wassermassen nicht immer gleich sind. Das hängt mit dem jeweiligen Mond- und Sonnenstand zusammen. Wir haben etwa alle zwei Wochen eine grande marée, eine große Flut, und ebenso eine Nippflut. In Bréhat beträgt der Höhenunterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, also der Tidenhub, bei sehr großen Springfluten etwa zehn Meter.»
«Und heute? Steigt das Meer stark an?»
«Eher mittelmäßig. Der Koeffizient liegt bei vierundsechzig und der Tidenhub bei etwa sechs Metern.»
«Beeindruckend, findest du nicht, Christine?», sagte eine der Chorsängerinnen zu ihrer Nachbarin. «Aber birgt das nicht auch gewisse Gefahren?»
«Oh doch! Man muss sehr vorsichtig sein, vor allem, wenn man am Strand angeln geht. Jedes Jahr kommt es vor, dass ein paar unvorsichtige Spaziergänger irgendwo festsitzen. Und wenn Sie mit einem Boot aufs Meer hinausfahren, sollten Sie sich gut auskennen und auch nicht zu weit hinausfahren. Die Strömungen sind nicht nur gewaltig, sondern auch gefährlich.»