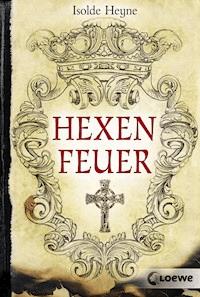
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker zum Thema Hexenverfolgung auch als eBook! Ein historischer Roman, der die Zeit der Inquisition authentisch und spannend schildert, für Leserinnen und Leser ab 13 Jahren. Morgen soll Barbara auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Sie ist unschuldig, doch niemand wird ihr zuhören. In ihrer letzten Nacht im dunklen Kerker durchlebt sie die fatalen Geschehnisse der vergangenen Monate noch einmal: die Gespräche mit ihrer Pflegemutter, die Eifersucht ihrer Ziehschwester, die aufkeimende Liebe zum jungen Martin Wieprecht und die Offenbarung, wer ihr wahrer Vater ist. Aber wird Martin sie retten können? Oder wird ihre Ziehschwester ihre Beschuldigung widerrufen? Barbara hofft auf das Licht des nächsten Morgens – und fürchtet es zugleich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EINS
»Nimm den Fluch von mir, du Hexe!«
Armgard stellte die flackernde Kerze auf einem Sims ab. Dann riss sie ihre Ziehschwester vom Strohlager hoch und zischte noch einmal: »Nimm diesen Fluch von mir, hörst du!«
Barbara wurde vom Wachslicht, das die Besucherin in das feuchte Gewölbe ihres Kerkers gebracht hatte, geblendet. Schützend hielt sie die Hände vor die Augen. Sie konnte kaum die Umrisse der Gestalt erkennen. Trotzdem wusste sie, wen der Wächter eingelassen hatte. Niemand sprach so befehlend und herrisch wie Armgard, die Tochter des Ratsherrn und Kaufmanns Heinrich Burger.
Es dauerte einige Herzschläge lang, bis Barbara sich an das Licht gewöhnt hatte. Ihre Augen suchten die des anderen Mädchens. »Ich bin keine Hexe«, sagte sie. »Und du weißt das besser als jeder andere Mensch. Was willst du hier? Warum störst du die Gebete meiner letzten Nacht?«
»Du betest?« Armgard lachte höhnisch. »Du hast mich verflucht. Nur du kannst es gewesen sein. Und jetzt fault mein Leib.« Der Hass in ihrer Stimme machte einem angstvollen Flehen Platz. »Wenn du morgen auf dem Scheiterhaufen brennst und der Fluch ist nicht von mir genommen, dann …«
»Dann?«, fragte Barbara. In ihr war die Ruhe eines Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Sie erhoffte sich auch von Armgard keine Rettung vor dem Flammentod, denn deren Hass war es gewesen, der sie in diesen Kerker und vor die Richter der Inquisition gebracht hatte. »Was ist dann?«, fragte sie noch einmal, da Armgard sich abgewandt hatte. Aber auch jetzt bekam sie keine Antwort.
Armgard ergriff die Kerze und drehte sich zu Barbara um. Sie ließ ihren Umhang von den Schultern gleiten und riss sich das Hemd entzwei. »Sieh her!«, schrie sie. »Sieh es dir an!«
Entsetzt wich Barbara zurück. Von den Brüsten bis über den Nabel hinweg war die Haut durch eitrige Geschwüre entstellt. Im unruhigen Schein der Kerze sah sie über diesem gepeinigten Körper Armgards Gesicht, sah die Angst in ihren Augen.
Hilf mir doch!, schien sie zu bitten. Aber es kam ihr nicht über die Lippen.
Barbara nahm ihr die Kerze aus der Hand und hielt sie nahe an Armgards Leib, um die Erkrankung zu betrachten. »Seit wann hast du diesen Ausschlag?«, fragte sie. Sie fragte so, wie sie es unzählige Male an Krankenbetten getan hatte, wenn ihre Hilfe verlangt worden war. Doch Armgard presste die Lippen aufeinander und schwieg. Barbara stellte das Licht auf den Mauervorsprung zurück, behutsam wie etwas Kostbares.
»Ich kann dir nicht helfen, wenn ich die Ursache nicht kenne. Also, sag mir: seit wann? Und sag die Wahrheit!«
Die Tochter des Ratsherrn Burger legte vorsichtig die Fetzen ihres Hemdes über den eiternden Ausschlag. Dann bückte sie sich und hob den Umhang vom Boden, um sich darin einzuhüllen. Sie wollte Zeit gewinnen. »Ist das so wichtig?«, fragte sie endlich.
Der lauernde Unterton ließ Barbara aufhorchen. »Ja«, antwortete sie fest. »Ich werde sonst nichts tun.«
»Du Hexe!«, fauchte Armgard. »Du weißt ganz genau, dass es seit der Nacht der schwarzen Messe …«
»Weiter!«, befahl Barbara. Aber sie hatte Mühe, ihre Erregung zu verbergen. Jetzt endlich würde sich ihr vielleicht die schreckliche Wahrheit offenbaren, die Verschwörung, deretwegen sie in wenigen Stunden den Scheiterhaufen besteigen musste. »Weiter!«, befahl sie ein zweites Mal, obwohl ihr die Stimme kaum gehorchen wollte. »Was haben sie damals auf deinen Leib gestrichen? Und warum hast du all das Entsetzliche getan?«
Armgard lehnte mit dem Rücken an den feuchten Steinen des Kerkers. Ihre Augen schimmerten in irrem Glanz. Sie hielt eine winzige Phiole in der Hand. »Hier!«, sagte sie. »Damit du siehst, dass ich es gut mit dir meine. Nimm den Fluch von mir und ich erspare dir den Scheiterhaufen. Es wirkt schnell und es schmerzt nicht.« Barbara rührte keinen Finger, um das Gift anzunehmen. Schließlich stellte Armgard das kleine Gefäß neben die Kerze auf den Sims. »Was verlangst du denn noch?«, fragte sie ängstlich.
»Die Wahrheit will ich wissen. Das ist alles.«
»Nein!«
»Dann vermag ich dir nicht zu helfen«, erwiderte Barbara ruhig.
»Frag mich.« Die Angst war für Armgard nicht mehr auszuhalten. »Los, frag mich schon!«
Barbara ließ sich Zeit. So also siehst du aus, Armgard Burger, dachte sie, wenn du nicht befehlen kannst, wenn die Angst dich schüttelt. Hast du damit gerechnet, als du mich den Henkern ausgeliefert und mich der Hexerei beschuldigt hast? Nun kommst du zu mir, damit ich dir helfe. Ausgerechnet zu mir! Was ist, wenn ich schweige? Du kannst mich zu nichts mehr zwingen.
Doch es drängte sie, endlich die Wahrheit zu erfahren. »Warum die schwarze Messe? Warum, Armgard?«
»Martin – er sah nur dich. Aber ich will ihn haben. Er gehört zu mir. Das war ausgemacht – mit Vater, hörst du!« Armgards Gestalt straffte sich wieder. In ihrer Stimme war Trotz, als sie weitersprach: »Der Pfaffe sagte, das Ritual sei das einzige Mittel, einen Mann zu binden. Und es musste das Blut eines ungetauften Kindes sein.«
»Das Kind des Gerbers«, murmelte Barbara. Sie schloss die Augen, entsetzt über so viel Grausamkeit und Aberglaube. »Und ausgerechnet du hast mich beschuldigt, eine Hexe zu sein. Ausgerechnet du.«
Armgard konnte die Stille, die entstand, nicht ertragen. »Nun weißt du es. Ich habe die Bedingung erfüllt. Also, hilf mir jetzt!«, fuhr sie Barbara an. »Du hast es versprochen.«
Barbara trat in den Lichtschein der Kerze. Sie lächelte. »Für deinen Ausschlag weiß ich Abhilfe. Aber Martin wird nie dein Mann werden.« Sie sprach die zwei Sätze stolz und fest aus, denn sie war sich sicher. Martin würde ihr treu bleiben, auch wenn sie morgen auf dem Scheiterhaufen brennen musste.
»Er wird mein Mann, verlass dich darauf!«, sagte Armgard leichthin.
Barbara trat dicht an sie heran und hielt ihr die linke Hand vor den Leib, ohne sie zu berühren. Sie schloss die Augen und stellte sich vor, wie sie Armgards makellosen Körper oftmals gesehen hatte, wenn sie im Weiher badeten. Dort, wo auch die Hütte der Trude stand, in die sie in jener Nacht gelockt worden war, als das Schreckliche geschah, dessen man sie beschuldigte. Für etwas, was Armgard getan hatte, sollte sie sterben.
Barbara lächelte, als sie dachte: Ja, ihr Leib soll wieder rein und schön sein wie früher. Der Ausschlag wird heilen, der Ekel wird bald vergessen sein. Und sie wird glauben, ich hätte einen Fluch von ihr genommen. Aber sie wird darunter leiden, dass Martin ihren Körper nie berührt. Das wird eine noch größere Demütigung für sie sein als dieser Ausschlag, der jetzt ihre Haut übersät.
Barbara öffnete die Augen und trat zurück. »Wenn du tust, was ich sage, wirst du in kürzerer Zeit von dieser Krankheit befreit sein, als der Mond braucht, sich zu vollenden.« Dann nannte sie einige Kräuter und deren Zubereitung.
»Nichts weiter? Nur darin baden und trinken?«
»Nichts weiter.«
Armgard blieb misstrauisch. »Belügst du mich auch nicht?«
»Nein. Ich schloss vorhin die Augen, um deinen Körper zu sehen, wie er gesund ist. Und so wird er wieder sein.«
»Du hast den Fluch zurückgenommen?«
Barbara schaute ihr ins Gesicht, da verstummte Armgard. Sie wollte nach der Kerze greifen, um zu gehen. Ihr war es unheimlich, dass die zum Tode Verurteilte so ruhig blieb.
»Das Wachslicht lass hier!«, bestimmte Barbara. Sie schob Armgards Hand beiseite. »Es wird mir die Entscheidung erleichtern, ob ich das Gift nehme oder den Scheiterhaufen wähle.«
Armgard warf einen trotzigen Blick auf den Sims, wo die Phiole im Schein der Kerze funkelte. Dann raffte sie ihren Umhang zusammen und verließ mit raschen Schritten den Kerker.
Barbara war froh, wieder allein zu sein. Die Stunden, die ihr noch blieben, wollte sie für sich haben. Die abergläubische Furcht Armgards, geboren aus ihrem schlechten Gewissen, belustigte sie jetzt beinahe. Doch sie wurde schnell wieder ernst, als sie daran dachte, welche Verbrechen der Aberglaube zum Gefährten hatte.
Für Armgards unerfüllbaren Wunsch nach einer Ehe mit Martin mussten zwei Menschen ihr Leben geben: das ungetaufte Kind der Gerbersleute und sie, Barbara.
Was sie vermutet hatte, war in diesem nächtlichen Gespräch bestätigt worden: Armgard hatte alles so eingefädelt, dass Barbara zu dem Ort der schwarzen Messe kommen musste. Auf ein Zeichen hin sollte sie die Hütte betreten, keinen Augenblick eher. Mit dem toten Kind in den Armen wurde sie dann von den Häschern der Inquisition gestellt. Barbara war sicher, dass Armgard auch ihnen einen Wink gegeben hatte.
Ein besserer Beweis für Hexerei war kaum denkbar. Damit hatte sich Armgard den Weg zu Martin frei machen wollen. Dabei war Martin ihr, Barbara, bereits durch das heilige Sakrament der Ehe verbunden.
Auch dieses Geheimnis werde ich morgen mit auf den Scheiterhaufen nehmen, dachte Barbara. Ich habe nicht gesprochen, selbst unter der Folter nicht.
War es das wert gewesen? Zumindest hätte es ihr Los nicht geändert, wenn sie versucht hätte, sich vor dem Tribunal der Inquisitoren durch Preisgabe ihrer Geheimnisse zu verteidigen.
Vor Gott konnte sie verantworten, was sie den Menschen verschwiegen hatte.
Sie setzte sich, den Rücken an die raue, feuchte Wand lehnend, auf das Stroh. Eine tiefe Ruhe kam über sie, als sie in das Licht auf dem Sims schaute. Noch war die Kerze kaum zwei Finger breit heruntergebrannt. Würde sie ihr noch bis zum Morgen Licht spenden?
Hoffnung und Mutlosigkeit hatten Barbara in den letzten Tagen abwechselnd befallen. Plötzlich hatte sie jetzt den Wunsch, am Licht der Kerze ablesen zu können, ob sie den kommenden Tag überleben werde.
Wenn das Licht reicht, bis der Tag anbricht, werde ich vor dem Scheiterhaufen bewahrt!
Sie wusste nicht, wie dieser Gedanke in ihrem Kopf entstanden war, aber sie klammerte sich daran wie an einen letzten Funken Hoffnung. Sie schaute in die Flamme, bis ihre Augen tränten und sie in einen seltsamen Zustand geriet, der sie nicht schlafen und nicht wach sein ließ. Sie hatte ein Gefühl von Leichtigkeit, als ob sie Zeit und Raum überwinden könnte. Menschen tauchten in ihrer Erinnerung auf, die seit Jahren in Vergessenheit abgesunken waren.
Das Licht der Kerze schuf eine Einheit von Vergangenem und Zukünftigem. Aber es verzehrte sich dabei. Mit jeder Stunde.
ZWEI
Fast zwei Jahrzehnte war es her, als ein Mann von hagerer Gestalt auf das nördliche Stadttor von Tiefenberg zuritt. Die Tage und Nächte an dieser Jahreswende waren bitterkalt. Hoher Schnee und eisiger Wind ließen das Vorankommen schwer werden. Es war kurz vor Mitternacht.
Der Torhüter spähte misstrauisch durch seine Luke. »Kein Einlass für Fremde!«, rief er nach draußen. »Komm zur Tageszeit wieder, wie es sich gehört.«
»Du kennst mich nicht?«, fragte der Mann, der durch seine Kleidung unschwer als Mönch auszumachen war. Auf der flachen Hand hielt er ihm eine Münze hin. »Nun kennst du mich aber.«
»Ja, Herr«, sagte der Wächter.
Es dauerte jedoch noch geraume Zeit, bis Johann von Rinteln durch eine niedrige Seitentür Einlass in die Stadt fand. Für eine weitere Münze war der Torhüter bereit, das Pferd des späten Ankömmlings in seine Obhut zu nehmen. Der Blick des Kirchenmannes verlieh der Bitte den nötigen Nachdruck.
Dem Torhüter war nicht verborgen geblieben, dass der andere unter der Kutte ein Bündel trug, das er sorgsam schützte. Die Münzen in der Hand, ein wahrlich gutes Entgelt für die späte Störung, ließen seine Zweifel jedoch rasch verstummen. Er überlegte nicht mehr, ob es richtig war, den Fremden einzulassen.
Der Wächter sah dem Mann nach, der sich in der Stadt auszukennen schien, denn er war ohne Frage auf dem richtigen Weg davongegangen.
Wenig später klopfte Johann von Rinteln an die Haustür des Kaufmanns Heinrich Burger.
Auch hier rief sein spätes Erscheinen Unsicherheit und Schrecken hervor. Gottfried, der alte Knecht, war wohl im ersten Schlaf gestört worden. Nur unvollkommen bekleidet, stand er in der Tür. Ihm brauchte sich der Besucher nicht vorzustellen, der Alte kannte ihn. »Mein Herr schläft schon«, sagte Gottfried. »Er wird zornig, wenn ich ihn wecke.«
»Wecke ihn trotzdem«, befahl Johann von Rinteln. »Ich habe nicht Zeit bis zum Morgen.«
Kopfschüttelnd stieg der Knecht die Treppe hinauf, nachdem er im Flur des stattlichen Hauses auf einem Leuchter Kerzen angezündet hatte.
Rinteln war es recht, dass er sich nach den Mühen der Reise erst ein wenig ausruhen konnte, bevor er dem Hausherrn gegenübertrat. Er rieb die Hände gegeneinander und ging auf und ab, um seine steifgefrorenen Glieder zu lockern. Hin und wieder warf er einen Blick auf das Bündel, das er auf einer Truhe abgelegt hatte.
Endlich kam Heinrich Burger die Treppe herunter. Er hatte sich in einen langen Pelz gehüllt, der ihn noch massiger erscheinen ließ, als er es ohnehin schon war. Rinteln in seinem dunklen Gewand wirkte dagegen schmal und asketisch. Burger fühlte den Unterschied wohl. Er wusste, dass er in seinem Hause der Überlegene war. Hocherhobenen Hauptes ging er auf den Besucher zu. Seine Begrüßung fiel herablassend und unfreundlich aus. »Muss ja einen besonderen Grund haben, wenn ein Mann wie du mich mitten in der Nacht aufsucht«, fügte er hinzu. »Also, was gibt’s, Pfaffe?« Burger lachte dröhnend. Er schien seinen Rausch noch nicht ausgeschlafen zu haben.
Johann von Rinteln war durch das beleidigende Verhalten nicht zu beeindrucken. Sein Körper spannte sich, als er erwiderte: »Es ist Zeit, dich an deinen Schwur zu mahnen, Heinrich Burger, an den Preis für mein Schweigen …«
Mit einem Satz, den man diesem behäbigen Mann nicht zugetraut hätte, war Burger ganz nahe bei dem Mönch. »Sei still!«, keuchte er. »Sei still!«
Rinteln hatte die Wirkung seiner Worte wohl berechnet. »Glaubst du, dass die Wände deines Hauses Ohren haben? Ich schweige, wenn du dein Versprechen hältst.«
Burger trat in den Schatten zurück. Er warf seinen schweren Pelz auf einen Hocker. Sein Atem war laut wie bei einem, der nach Luft ringen muss. »Was willst du von mir?«, fragte er endlich.
Trotz der spärlichen Beleuchtung sah Rinteln die Angst, die den anderen schüttelte. Er war zufrieden. »Sieh hin!«, befahl er ihm und wies auf das Bündel, das auf der Truhe lag.
Nur widerwillig beugte sich der Hausherr hinunter und zog die Tücher auseinander. Erschrocken wich er zurück, als ein klägliches Wimmern an sein Ohr drang. »Was soll das? Was soll dieses Kind hier?« Er richtete sich auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Rinteln faltete die Hände vor seiner Brust und ging im Flur auf und ab, ohne sofort zu antworten. Er wusste, dass er Burger dadurch noch unruhiger machte. Endlich sagte er: »Nimm an, dass ich dieses Kind vor deiner Haustür fand. Ausgesetzt von seinen Eltern, die sich nicht um dieses arme Würmchen kümmern können. Sie denken, dass du ein gottesfürchtiger Mensch bist, der ein guter Pflegevater …«
»Verdammt sollst du sein, Rinteln!«, fauchte Heinrich Burger. »Nimm dieses Balg wieder mit. Ich habe selbst ein Kind – vor wenigen Tagen wurde es geboren.«
Der Mönch ließ sich nicht einschüchtern. »Nun, desto wertvoller wird dir mein Schweigen sein, das deinem Sohn einmal sicher …«
Wieder unterbrach ihn Burger. »Sei endlich still. Es ist kein Sohn, eine Tochter ist’s. Aber so wahr es für dich einen Gott gibt, sie soll erzogen werden wie ein Sohn, der einmal all das übernimmt, was mir jetzt gehört.«
Spöttisch verzog Rinteln den Mund. »Da hast du dir ja viel vorgenommen. Umso leichter fällt es dir gewiss, dieses Mädchen zu einer keuschen Jungfrau erziehen zu lassen.«
Der andere beugte sich noch einmal über das Bündel und zog die Tücher so weit auseinander, dass er trotz der spärlichen Beleuchtung das Gesicht des Kindes erkennen konnte. »Deine Tochter?«, fragte er lauernd.
Rinteln war auf diese Frage vorbereitet. »Würde ich das Kind dann ausgerechnet deiner Obhut anvertrauen?«
Burger richtete sich wieder auf. »Nun gut. Ob hier noch eins mehr gefüttert wird – was macht das schon? Nur wissen möcht ich es.«
Johann von Rinteln ging nicht darauf ein. »Du erfährst von mir, was du wissen musst. Das Kind ist einen Tag nach dem Christfest geboren worden und auf den Namen Barbara getauft. Die Mutter starb bei der Geburt.«
»Barbara«, wiederholte Heinrich Burger. »Der Name bedeutet ›die Fremde‹. Und das wird sie auch bleiben. Es sei denn, sie hätte einen Vater.« Man merkte ihm an, dass er viel darum gegeben hätte, hinter das Geheimnis zu kommen. Was bewog den Mönch, sich in einer Weise für das Kind einzusetzen, die seinem Wesen nicht entsprach?
»Ich habe Grund, dafür zu sorgen, dass dieses Mädchen eine gute Christin wird. Das muss dir genügen«, antwortete Rinteln abweisend. Dann beugte er sich zu dem Kind hinunter und machte das Kreuzzeichen auf die winzige Stirn. Als er sich wieder aufrichtete, lag für einen Herzschlag lang ein warmer Glanz auf seinem sonst so harten Gesicht. »Erfülle die Pflicht der Nächstenliebe, Heinrich«, sagte er, »dann bist du meines Schweigens für immer sicher.«
Burger kratzte sich nachdenklich seinen vollen Bart. »Das hast du dir fein ausgedacht, Johann«, brummte er, und er nannte den Mönch nun auch beim Vornamen, so wie es früher unter ihnen üblich gewesen war. »Aber was ist, wenn das Mädchen nicht so wird, wie du es dir vorstellst? Was dann?«
Rinteln hob das Kind von der Truhe und legte es dem Kaufmann in den Arm. »Zwei Jahrzehnte lang bürgst du mir, bis ich dich deiner Pflicht enthebe. Ich werde in dieser Zeit nach meinem … Mündel schauen, ab und zu.«
Burger lachte höhnisch. »Mündel! Heißt das jetzt so?« Er rief nach der Magd und übergab ihr das Kind. »Leg’s zu dem anderen!«, befahl er barsch. »Aber verwechselt mir die Bälger nicht!« Dann schob er den Besucher in das große Zimmer rechts vom Eingang. Er stellte den Leuchter auf den Tisch und ließ sich schwer in einen Sessel fallen. Der Weinkrug stand noch auf dem Tisch. »Willst du dich nicht setzen und mir Bescheid tun?«, fragte er. »Ich lasse unterdessen dein Nachtlager richten.«
Der Mönch setzte sich zwar, aber man sah ihm an, dass er sich nicht auf längeres Verweilen einrichtete. »Ich bleibe nicht über Nacht. Man erwartet mich in Rom.«
Als sie tranken, trafen sich ihre Blicke.
»Sieh an, Rom. Du wirst es einmal weit bringen, Johann«, sagte Burger; in seiner Stimme klang Anerkennung mit. »Es wäre nicht klug, dich zum Feind zu haben.«
»Tu, was ich verlange, dann hast du nichts zu befürchten.« Rinteln nahm noch einen Schluck vom Wein, bevor er sich erhob. »Hüte dich aber vor Betrug, Heinrich Burger. Du weißt, dass ich dich vernichten kann.«
Der Hausherr brachte den späten Gast selbst zur Tür. »Wo erreiche ich dich, wenn was ist?«
»Ich werde wissen, wenn etwas ist«, erwiderte Rinteln. »Und denk immer daran: Du bürgst mir für das Kind.«
Heinrich Burger stand noch lange in der Haustür. Rinteln war in der Nacht verschwunden wie ein Spuk. Wäre nicht das Kind in seinem Hause zurückgeblieben, er hätte gedacht, sein Rausch hätte ihm all die Bilder und Gedanken eingegeben. Er befahl dem Knecht endlich, die Haustür wieder zu verriegeln. Von nächtlichem Besuch hatte er genug. Fröstelnd legte er den Pelz um, nahm eine Kerze aus dem Leuchter und stieg die Treppe hinauf. Dann überlegte er es sich und ging in das Zimmer seiner Frau. Blass und verstört fand er Katharina in ihrem Bett vor. Sie wagte nicht, ihm Fragen zu stellen. Seit sie ihm statt des erwünschten Sohnes eine Tochter geboren hatte, fürchtete sie seinen Zorn.
Burger winkte der Magd, den Raum zu verlassen. Als sie allein waren, sagte er: »Hör zu! Rinteln hat mir dieses Kind da gebracht. Es soll mit unserer Tochter erzogen werden.«
»Aber warum?« Katharina weinte. »Ich werde dir bestimmt noch einen Sohn gebären.« Ihre Stimme war flehend und voller Angst.
Der Mann lachte höhnisch. »Ich werde das Bett nicht mehr mit dir teilen. Eine Tochter genügt mir. Ich möchte auch nicht, dass darüber Gerede entsteht. Es hat seinen Grund.« Das erste Mal seit ihrer Geburt sah er seine Tochter an. »Sie wird so erzogen werden, dass mir der Sohn nicht fehlt. Aus dem anderen Kind mach du ein fügsames Weib. Das ist Rintelns Auftrag.«
»Ist das Kind getauft?«, fragte Katharina.
»Es heißt Barbara.«
»Barbara«, wiederholte sie. Und der Name des Kindes kam freundlich aus ihrem Mund.
Burger blieb nicht lange bei seiner Frau. Er hatte aber auch nicht die Ruhe, sich in dieser Nacht hinzulegen und zu schlafen. Rastlos wanderte er durch die Räume. Hatte er nicht schon Sorgen genug? Seine Frau hatte ihm eine Tochter geboren und der Arzt hatte ihm gesagt, ein weiteres Kind würde es kaum in seinem Hause geben. Nun würde der Streit um die Besitztümer erneut ausbrechen. Wie die Wölfe werden sie über mich herfallen und gierig mein Hab und Gut an sich reißen, dachte er. Rinteln hat mir gerade noch gefehlt! Er allein ist Zeuge gewesen, er allein weiß, wo mein Bruder ist – wenn er überhaupt noch lebt. Von allen wird er tot geglaubt, selbst von Katharina, die sonst nicht meine Frau geworden wäre.
Plötzlich ließ der Schreck seinen Schritt stocken. War dieses Kind, das Rinteln ihm gebracht hatte, etwa die Tochter Konrads, seines Bruders? Konnte es Erbansprüche erheben? Warum hatte Rinteln damals geschwiegen? Ihn stets im Unklaren gelassen? Johann von Rinteln, der einmal sein Freund gewesen war und der als Mann der Kirche mittlerweile mehr Macht und Einfluss hatte, als sein schlichtes Auftreten es vermuten ließ! Sein Schweigen musste Heinrich Burger teuer bezahlen.
Ruhelos schritt er in dieser Nacht durch sein großes Haus.
DREI
Das Flackern des Wachslichtes holte Barbara in die Gegenwart des Kerkers zurück. Ihre Gedanken waren einen weiten Weg in die Vergangenheit gegangen, hatten das, was sie in Bruchstücken nach und nach erfahren hatte, zu einem Ganzen gefügt, so als wäre sie dabei gewesen.
Sie lauschte in die Nacht, die kaum Geräusche hatte. Wie lange es wohl noch bis zum Morgen war?
Die Kerze war nur um ein kleines Stück heruntergebrannt. Es konnte nicht allzu viel Zeit vergangen sein, doch schien es Barbara, als wäre eine Ewigkeit verstrichen, seit Armgard in diesem Raum gestanden und ihren entstellten Körper entblößt hatte.
Sie schämte sich ihrer Gedanken, die sie Armgard gegenüber nicht mitleidig sein ließen. Sie dachte daran, wie stolz die Ziehschwester von Kindheit an auf ihren Körper war, der, schlank und straff, dem eines Knaben ähnelte. Wild und herrschsüchtig wuchs sie auf und ihr Vater lachte nur dazu.
Wenn Armgard Barbaras Fertigkeiten auch verspottete, manchmal war sie doch auf sie angewiesen. Niemand sonst im Hause konnte nämlich so gut Wunden heilen oder eine Medizin bereiten. Gleichgültig, ob Mensch oder Tier, Barbara wusste für jede Krankheit ein Kraut. Das hatte sich in der Stadt schnell herumgesprochen. Sie half denen, die sie darum baten, und machte keine Unterschiede, ob es sich um Arme handelte oder solche, die einen gelehrten Doktor hätten bezahlen können.
Manchmal reichte es schon, wenn sie beruhigend über die schmerzende Stelle strich. Dann spürten die Kranken die Wärme ihrer Hand und schworen darauf, dass Barbara Heilkräfte besitze.
Oft waren die beiden Ziehschwestern auf der nahe gelegenen Burg. Armgards Tante, die Schwester ihrer Mutter, war mit dem Grafen Hochstett verheiratet. Heinrich Burger, der die Verwandtschaft seiner Frau sonst verachtete, begünstigte den Aufenthalt seiner Tochter auf der Burg. Konnte er ihr auf diese Weise doch eine Erziehung bieten, die in der Stadt undenkbar gewesen wäre. Auch war es ihm nicht unlieb, wenn die Mädchen aus dem Hause waren. Und Mutter Katharina war kränklich und oft nicht in der Lage, sich den beiden zu widmen.
Barbara war gerne auf der Burg. Denn sie lernte viel von der Herrin des Hauses, Tante Elisabeth. Der Graf kümmerte sich kaum um Barbara, ihm war Armgard als Begleiterin lieber, wenn er zur Jagd ausritt. Und die Jagd mit dem Falken gehörte zu Armgards bevorzugten Beschäftigungen, wenn sie wochenlang dort zu Besuch waren.
Einmal sah Barbara sie bei den Falken stehen. Sie hatte den langen ledernen Handschuh übergestreift und warf ihren Lieblingsfalken in den Wind. Es war ein schönes Tier, das noch das Jugendgefieder trug. Diesen Falken wollte Armgard selbst abrichten und sie befasste sich mit ihm, sooft sie auf der Burg waren. Sie wollte ihn lehren, was er für die Jagd wissen musste.
Als Barbara hinzukam, rief Armgard stolz: »Sieh her, was er schon kann!« Sie schleuderte die Beute weit hinaus und lockte ihren Vogel: »Falco, komm!«
Immer wieder stieß er herunter und riss mit den Krallen tiefe Löcher in die Beute. Seine hellen Schreie erfüllten die Luft, sodass die anderen Falken und der Steinadler in ihrer Voliere unruhig wurden.
Mit den Falken um die Wette schrie Armgard. Sie war schön in diesem Augenblick, da sie mit dem Tier spielte. Barbara freute sich an dem Bild. Sie ging noch näher heran und Armgard reichte ihr einen Lederriemen, an dem ein Beutestück befestigt war.
»Versuche es auch!«, befahl sie.
Barbara wickelte den Riemen um ihr Handgelenk und tat, was sie schon viele Male bei Armgard beobachtet hatte. Aber der Falke dachte gar nicht daran zu gehorchen. Als ob er des Spiels überdrüssig sei, flog er ihr ein paarmal dicht über den Kopf und setzte sich dann auf ihren ausgestreckten Arm. Barbara zuckte zusammen, als sie die scharfen Krallen auf der nackten Haut spürte. Allerdings fühlte sie auch, dass der Vogel so sanft, wie es ihm nur möglich war, aufgesetzt hatte.
Armgard war unzufrieden. Sie lockte den Falken, doch der blieb sitzen. Vor Zorn über diesen Ungehorsam riss sie ihn mit ihrer ledergeschützten Hand von Barbaras Arm. Das Tier hinterließ tiefe Spuren seiner scharfen Krallen, weil es sich wild gegen die Behandlung wehrte. Es war nicht gewohnt, so unsanft angefasst zu werden.
Als Armgard ihm die Haube übergestreift hatte, schrie sie Barbara an: »Lass die Hände von meinem Falken! Er gehört mir. Ganz allein mir!«
Barbara sah ihr nach, wie sie mit raschen Schritten davonlief. Sie tupfte das Blut von ihrem Arm, dann ging sie in den kleinen Kräutergarten der Burg, der vor allem dank ihrer Pflege prächtig gedieh. Er schmiegte sich in einem schmalen Streifen an die Mauer. Einen ähnlichen hatte sie auch in der Stadt angelegt, obwohl dort viel weniger Platz war als hier. Nun suchte sie heilende Kräuter, damit sie ihre Wunde behandeln konnte.
Als sie am Abend in der Küche bei der Vorbereitung des Essens half, stürzte Armgard herein. »Was hast du mit dem Falken gemacht?«, schrie sie. »Du hast ihn verhext!«
Barbara blieb ruhig. Sie trocknete ihre Hände an einem großen Leinentuch. »Was ist mit ihm?«, fragte sie.
Armgard zerrte sie am Arm aus der Küche bis vor die Käfige, in denen die Vögel auf ihren Ständern hockten. Ihr Lieblingsfalke saß reglos da, und sosehr Armgard sich bemühte, seine Aufmerksamkeit zu erregen, er blieb teilnahmslos.
»Befreie ihn von seiner Krankheit!«, befahl Armgard. »Du hast ihn behext, also befreie ihn wieder davon!«
Barbara sah sie mit einem eigentümlichen Blick an. Wie Armgard dastand, herrisch den Arm ausgestreckt, glich sie eher einem jungen Mann als einem Mädchen. Freilich hatte sie auch wieder, zum Unmut der Burgherrin, Knabenkleidung angezogen. Barbara wischte sich unschlüssig die Hände an ihrem weiten Rock ab. Wenn sie nichts tat, würde Armgards Wut sich noch verstärken. Beschäftigte sie sich aber mit dem Tier, würde Armgard es als Beweis ansehen, dass sie den Falken verhext hatte. Dieser Aberglaube!
»Vorhin befahlst du mir«, sagte Barbara schließlich, »ich solle deinen Falken nie mehr berühren. Du weißt nicht, was du willst.«
Ärgerlich wandte sich Armgard wieder dem Vogel zu. Sie versuchte ihn von Neuem zu locken. Aber er drehte nicht mal den Kopf.
Da ging Barbara näher an das Tier heran. Sie strich behutsam über das Gefieder, dabei sprach sie leise Worte, die Armgard nicht verstand. Worte, die sanft waren und die beruhigten.
Barbara beschloss dann, in die Küche zurückzukehren.
»War das alles?«, schrie Armgard ihr nach.
Barbara drehte sich nicht um.
Zwei Tage später konnte Armgard das Tier wieder mit zur Jagd nehmen.
Die Sommerwochen auf der Burg gehörten zu den schönsten Zeiten in Barbaras Leben. Hier fühlte sie sich frei und hatte viel Zeit für ihre Gedanken. Gedanken, die mit den Jahren immer drängender wurden. In der Enge der Stadt konnte sie Armgard nicht gut ausweichen und war deren Launen ausgesetzt. Sie wehrte sich auch nicht gegen die Bosheit ihrer Ziehschwester, denn sie war sich bewusst, dass sie dankbar und demütig zu sein hatte.
Johann von Rinteln war der Einzige, der sich ihre Klagen anhörte und sie tröstete. Aber er kam selten. Barbara wusste, dass er sie zu den Burgers gebracht hatte. Mehr wusste sie jedoch nicht und sie litt unter den Andeutungen, unter den Gesprächen, die verstummten, sobald sie in die Nähe kam.
Wenn Rinteln Gast im Hause Burgers war, dann widmete er sich stundenlang seinem Findling, wie er Barbara manchmal scherzhaft nannte. Er erzählte ihr Geschichten von Heiligen, die mit Freuden ihre Leiden auf sich nahmen. Und Barbara nahm alles begierig in sich auf. Am liebsten hörte sie von seinen Reisen in ferne Länder, die er im Auftrag des Papstes unternahm. Rinteln merkte bald, dass sie klug war, und so machte er es sich zur Aufgabe, sie mehr zu lehren, als sie mit Armgard gemeinsam lernte. Er wies sie zudem an, oft zum nahe gelegenen Kloster zu gehen, damit sie von den Nonnen erfuhr, wie man heilende Kräuter sammelt und daraus Medizin gegen Krankheiten gewinnt.
Bei den Nonnen durfte Barbara auch alte Schriften lesen, die in Latein abgefasst waren. Sie verstand diese Sprache längst, sehr zum Unmut ihrer Ziehschwester, die sich gar nicht erst die Mühe machte, sie zu lernen. Und Heinrich Burger hatte sich daran gewöhnt, Barbaras Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn er als Kaufmann zu viel des Schriftlichen bewältigen musste. Das Mädchen tat dies gern, vor allem im Winter, wenn wenige Möglichkeiten blieben, sich vor Armgards schlechter Laune zu schützen. Saß Barbara bei einer schwierigen Arbeit in Burgers Zimmer, konnte sie sicher sein, dass die andere sie in Ruhe ließ. Heinrich Burger war der einzige Mensch, vor dem Armgard Respekt hatte.
Nicht nur des Lernens wegen ging Barbara oft und gern den Weg, der sie durch das Stadttor hinaus zum Kloster brachte. Sie fühlte sich bei den Frauen wohl, die fleißig und bescheiden waren und ihr viel beibrachten an Fertigkeiten, die im Hause Burgers wertvoll waren. Zu einer Nonne, die den Namen Angela trug, hatte Barbara ein besonders vertrautes Verhältnis. Ihr Alter konnte sie schwer einschätzen und sie hatte auch nie danach gefragt. Liebend gern saß sie mit Angela im Klostergarten unter alten Bäumen und sprach mit ihr.
An dem Tag, an dem Armgard sie wegen des kranken Falken der Hexerei bezichtigt hatte, lief Barbara den weiten Weg von der Burg zum Kloster. Sie rannte wie gehetzt den Burgberg hinunter und traf ganz erschöpft im Kloster ein.
Angela hörte sich an, was dem Mädchen so viel Kummer bereitete: die ständigen Demütigungen, die Zornesausbrüche ihrer Ziehschwester und nun auch diese Bezichtigung. Erregt erhob sie sich von der Bank, auf der sie mit Barbara gesessen hatte, und ging ruhelos auf und ab, schweigend, ohne ein Wort. Und Barbara wagte nicht, ihre Gedanken zu stören, denn oft genug sagte Angela verblüffend genau, was in der nächsten Zeit geschehen werde.
Als würde sie Zukünftiges bereits sehen, lag ein Schimmer großer Traurigkeit und Bestürzung auf ihrem Gesicht. »Kleine Schwester«, sprach sie leise, als sie sich wieder zu Barbara setzte. Und schützend legte sie den Arm um ihre Schultern. »Es ist schrecklich, was Armgard mit solch unbedachten Worten anrichten könnte. Und keinem ist es möglich, dich davor zu schützen, nicht einmal Johann von Rinteln. Weißt du, dass überall die Scheiterhaufen brennen? Nicht nur bei uns in den Städten, auch in anderen Ländern.«
Nein, davon hatte sie keine Ahnung. Sie lauschte mit Grauen, was Angela ihr berichtete.
»Möge Gott dich davor bewahren, Barbara, dass dich ein solches Schicksal trifft.«
Von dieser Stunde an schien es Barbara, als hätte sich mit dem Wissen um die Inquisition und deren Tätigkeit im Namen der Kirche und im Namen Gottes ein beklemmender Ring um ihr Herz gelegt. Der Klostergarten, der ihr bisher immer als ein Ort der Ruhe und der Erbauung erschienen war, machte ihr nun Angst.
»Weiß Johann von Rinteln dies alles auch?«, fragte sie. Angela senkte bejahend den Kopf.
»Warum hat er nie mit mir darüber gesprochen?«
»Warum sollte er Unruhe in dein Herz bringen? Das alles spielt sich bisher weit weg von hier ab.«
Barbara gab sich damit nicht zufrieden. »Es ist doch nicht recht, wenn Menschen auf Scheiterhaufen verbrannt werden, nur weil sie unter Folterqualen etwas gestehen, was sie gar nicht getan haben.« Sie verstummte vor Schreck. Zum ersten Mal in ihrem Leben trat etwas derart Unerhörtes an sie heran.
Mit Angela ging unterdessen eine Verwandlung vor, die das Mädchen schon mehrfach an ihr wahrgenommen hatte. Worte kamen von ihren Lippen, von denen sie nachher nichts mehr wissen würde: »Hexenfeuer – sie werden auch in dieser Stadt brennen – auf dem Richtplatz werden die Leute stehen und gaffen – wenn das Korn gelb ist – im nächsten Sommer – und auch dich, Tochter des Rinteln, werden sie in die Flammen zerren …«
Wenig später war Angela wieder wie sonst. Sie wusste nicht, welch schreckliche Prophezeiung sie in ihrer geistigen Abwesenheit ausgesprochen hatte.
Barbara hatte Mühe, ihr Entsetzen zu verbergen. Sie wollte mit der Nonne nicht darüber reden, um sie nicht zu beunruhigen. Aber ihrem Vormund musste sie davon berichten, weil Angela etwas gesagt hatte, was ihr genauso ungeheuerlich erschien wie die Vision, sie werde einmal in den Flammen auf dem Scheiterhaufen stehen.
Sie – die Tochter Rintelns?
Nein! Das war nicht denkbar, das durfte nicht sein. Rinteln war ein Mann der Kirche. Verstört verließ Barbara das Kloster. Am liebsten wäre sie jetzt in die Stadt zurückgezogen, zu ihrer Pflegemutter Katharina, die krank und schwach war und der ihre Hilfe guttun würde. Mutter Katharina hätte ihr vielleicht sagen können, was die Nonne mit ihrer Äußerung meinte, hätte sie vielleicht beruhigen können.
Damit sie mit all diesen wirren Gedanken im Kopf nicht Armgard in die Arme lief, die ein sicheres Gespür dafür hatte, wenn etwas anders war als sonst, machte Barbara einen Umweg an dem kleinen Weiher vorbei, an dem die Hütte der Kräutertrude stand. Die alte Frau saß draußen auf der Bank. Ihre sonst so fleißigen Hände ruhten.
»Gott zum Gruß!« Barbara setzte sich neben sie.
»Du solltest nicht so oft kommen«, sagte die Trude. »Armgard hat heute …« Sie brach mitten im Satz ab.
Aber Barbara ließ keine Ruhe und drängte mit Fragen, bis die alte Frau antwortete. »Sie wollte einen Zaubertrank von mir. Einen Liebestrank.«
Barbara lachte erleichtert. »So was gibt es doch gar nicht. Das hast du mir selbst immer wieder gesagt, Trude.«
»Sie glaubt es aber. Ich gab ihr ein harmloses Pulver.«
»Und wenn es nicht wirkt?«
»Dann wird Armgard sich rächen.«
Zum zweiten Mal an diesem Tag griff die Angst nach dem Mädchen. Spürbar pochte der Puls an ihrem Hals. »Sie ist sehr abergläubisch«, meinte sie schließlich. »Vielleicht hilft ihr der Glaube an das Mittel.«
»Ich kenne den, dem dieser Trank gilt«, erzählte die Kräuterfrau. »Der lässt sich von Armgard nicht durch einen Zauber zwingen. Der Martin ist ein guter Mensch.« Barbara achtete nicht auf den Namen dessen, den Armgard an sich ketten wollte. Bisher hatte ihr Herz in Gegenwart eines Mannes noch nie rascher geschlagen. Sie wollte sich auch nicht binden, solange sie, wie mit Rinteln ausgemacht, im Hause Heinrich Burgers lebte.
Was die Trude da berichtet hatte, war Barbara jetzt nicht weiter wichtig. Ihr brannte etwas anderes auf der Seele. Sie erhoffte von der alten Frau Trost, vielleicht auch eine Abschwächung der düsteren Prophezeiung.
Aber die Kräutertrude erschrak selbst zutiefst. »Armgard wird mich noch auf den Scheiterhaufen bringen«, flüsterte sie. Ihre welken Hände, die auf der groben Schürze lagen, zitterten. »Erinnere dich später daran, Barbara«, sagte sie. »Das, was ich dir beibrachte, hat nichts mit dem Teufel zu tun. Doch in Armgard wohnt der Teufel. Die Eifersucht treibt sie.«
Neben Barbara stand ein Körbchen mit getrocknetem Johanniskraut auf der Bank. In Gedanken versunken pflückte sie die Blüten von den Stängeln. Sie hatte der Kräutertrude im vorigen Sommer beim Sammeln geholfen. Johanniskraut war gut gegen so mancherlei Beschwerden. Besonders die Gerbersfrau bedurfte dessen, denn sie gebar jedes Jahr ein totes Kind, und sie wünschte sich nichts sehnlicher als eins, das sie in die Wiege legen konnte.
Gegen viele Krankheiten wusste Barbara ein Heilmittel oder wenigstens eins, das die Schmerzen linderte. An Hexerei hatte sie dabei nie gedacht.
Ihr kam das Erlebnis mit dem Falken wieder in den Sinn und sie erzählte davon.
»Der Falke saß auf meinem Arm, weil er traurig war. Armgard hatte ihn misshandelt. Bei mir hatte er Ruhe, und deshalb blieb er sitzen«, erklärte Barbara.
Die alte Frau nickte. »Diesmal war es nur der Falke. Aber wenn es ein Mann ist, der bei dir bleibt, während Armgard ihn begehrt – was dann?«
Mit dieser Frage wusste das Mädchen nichts anzufangen. Sie machte sich bereit, den Rückweg anzutreten.
Es war ein weiter Weg. Barbara war es nur recht, weil zu viele Gedanken in ihrem Kopf waren. Neue Gedanken und Fragen, auf die sie keine Antwort hatte.
VIER













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















