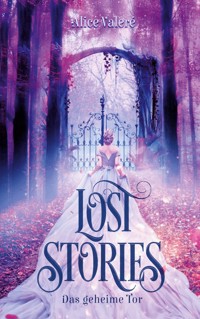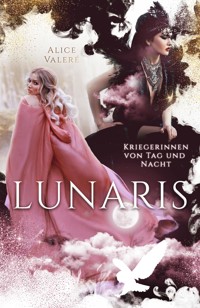4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Von der Göttin auserwählt nimmt Asuna an den Hexenspielen teil, jenem Ritual, das ihr den Vater nahm und nun auch sie zum Tode verurteilt. Ihre einzige Chance ist ein Bündnis mit dem begabten Hexer Sander, mit dem sie eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Doch zu vertrauen ist schwer, wenn jede Entscheidung leben oder sterben bedeutet. Denn in den weißen Wäldern lauern noch ganz andere Gefahren. Neben den dunklen Kreaturen, haben auch die Menschen die Jagd eröffnet. Wird Asuna die Herausforderungen der Spiele meistern und die Krone der Hexen erringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1.Auflage
Deutsche Erstausgabe Dezember 2024
Veröffentlicht über tolino media
ISBN: 9783759252067
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© Alice Valeré
Alle Rechte vorbehalten
Coverdesign: Juliane Buser – Grafikdesign (www.jb-grafikdesign.de)
Lektorat: Lektorat Detailteufel | Susanna Schober
Korrektorat: Lektorat Detailteufel | Susanna Schober
Impressum
Alice Valeré
c/o easy shop
K. Mothes
Schloßstraße 20
06869 Coswig (Anhalt)
Dieses Werk und seine Bestandteile sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die schriftliche Zustimmung der Autorin ist jede Verwertung des vollständigen oder auszugsweisen Inhalts unzulässig und strikt untersagt. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Verbreitung oder Vervielfältigung. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte, die du auf der letzten Seite als kurze Themenübersicht findest. Da diese mögliche Spoiler enthält, entscheide bitte selbst, ob du sie lesen möchtest.
Die Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Mach die Lektüre bitte von deinem persönlichen mentalen Gesundheitszustand abhängig und entscheide selbst, ob du die Warnung berücksichtigst.
Solltest du während des Lesens auf Probleme stoßen, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und Freunde, rede mit Psychologen oder suche professionelle Hilfestellen auf.
Ich wünsche dir viele schöne und spannende Lesestunden.
Alice Valeré
Verzweifelt presste ich die Hände auf meine Ohren und versuchte, die von draußen hereindringenden Schreie der jubelnden Dorfbewohner auszuschließen. Doch es war vergeblich. Immer wieder hörte ich den Namen des Siegers, welcher bei jeder Wiederholung eine neue Wunde hinterließ.
Artaris, schrien sie voller Begeisterung.
Ich wollte seinen Namen nicht hören, wollte nicht wahrhaben, was er bedeutete. Nichtsdestotrotz brüllten die Dorfbewohner ihn noch lauter, als würden sie meinen Widerstand spüren und versuchen, ihn damit zu brechen.
Vereinzelte Tränen rannen über meine schneeweiße Haut und tropften auf die an meinen Körper gepressten Knie.
Er war tot. Mein Vater war tot.
Wie ein Dolch bohrte sich die Erkenntnis tiefer und tiefer in mein Herz.
Noch immer sah ich seinen zuversichtlichen Gesichtsausdruck vor meinen Augen, hörte den beruhigenden Klang seiner Stimme, als er mir sagte, dass alles gut werden würde. Und ich naives, kleines Kind hatte ihm geglaubt.
Ich hätte ihn aufhalten müssen, ihm sagen müssen, dass er nicht an den Spielen teilnehmen durfte, weil ich ihn brauchte.
Doch dafür war es nun zu spät.
Er war fort. Und selbst die große Göttin konnte ihn mir nicht wiedergeben.
Mein Körper begann zu beben, wehrte sich gegen die Realität. Jeder Atemzug brannte in meiner Kehle und mich überkam das Gefühl zu ersticken.
Was sollte ich jetzt nur tun? In einer Welt ohne ihn zu leben, konnte ich mir nicht vorstellen.
Meine Mutter hatte mich nie verstanden, nicht so wie er. Sie war keine Hexe, sondern ein Mensch, der sich in einen Hexer verliebt hatte. Ihr war es schwergefallen, die Sitten und Bräuche zu verstehen, und zu akzeptieren, dass ihre eigene Tochter nicht wie sie war. Trotzdem liebte sie mich und hatte sich stets hingebungsvoll um mich gekümmert.
Vielleicht hatte ich auch deshalb gedacht, sie würde hier bei mir sein und mich trösten. Wir hatten beide einen geliebten Menschen verloren.
Ich verstand nicht, weshalb sie die Gesellschaft der Hexen suchte, obwohl sie selbst keine war. Sie müsste Hass empfinden für jene, die ihr die Liebe ihres Lebens gestohlen hatten und das nur, um einer Göttin zu folgen, die sich nicht um uns scherte.
Dass sie stattdessen dort draußen stand, mitten in der jubelnden Menge, und die große Mutter für einen neuen Sieger lobpreiste, war unbegreiflich.
Verzweifelt drängte ich mich noch tiefer in die kleine Nische unter der Treppe, und versuchte, mit der Dunkelheit zu verschmelzen. Wie konnte sie seinen Namen rufen, wenn sie doch genau wusste, dass der Preis für sein Leben uns Vater gekostet hatte?
Auch wenn ich noch sehr jung war, wusste ich doch, dass das falsch war. Sie hätte hier bei mir sein sollen, mit mir weinen müssen. Doch das tat sie nicht.
Als die Nachricht uns erreichte, hatten die Ältesten mir gesagt, dass ich stark sein müsste. Es sei der Wille der Göttin.
Aber was sollte das für ein Wesen sein, das meine Familie auseinanderriss und es auch noch für eine gute Tat hielt?
Sollten sie doch alle zur Hölle fahren. Ich brauchte keinen Sieger, keine Wächter und keine Göttin. Es würde mir auch ohne sie gelingen, eines Tages die größte Hexe aller Zeiten zu werden und meinen Vater mit Stolz zu erfüllen.
Heute war mein letzter Tag. Mein letzter Tag zu Hause, bei den Menschen, die ich liebte, und die mich liebten. Mein letzter Tag in diesem Leben, denn ich war mir sicher, bereits am nächsten Morgen tot zu sein.
Für einen Augenblick schloss ich die Augen, atmete tief durch und beschloss, mich meinem unausweichlichen Schicksal mutig entgegenzustellen.
Wie mein Vater sieben Jahre zuvor, würde ich meine Fähigkeiten als Hexe in den Spielen unter Beweis stellen. Zehn von uns hatte das Orakel dazu bestimmt, sich dieser Prüfung der Macht zu unterziehen. Zu meinem Leidwesen hatte es auch meinen Namen genannt und mich damit zum Tode verurteilt.
Ich war keine sonderlich begabte Hexe, eher talentiert darin, mit einem Dolch oder einem Schwert zu kämpfen, als meine Gegner mit Magie niederzustrecken. Anders als meine Altersgenossen, beherrschte ich lediglich die Fähigkeit, meine Umgebung zu manipulieren, jedoch nicht die Macht etwas zu erschaffen.
Ganz im Gegenteil zu meinem Vater, war ich eine Außenseiterin, die keine Chance auf den Sieg hatte. Eine Schande für meine Familie und das Geschlecht der Hexen.
In wenigen Stunden würde es auf dem Marktplatz nur so von Hexen und Hexern wimmeln, bis der Beginn der Spiele endlich eingeläutet wurde.
Ich hatte mich bereits vor dem Morgengrauen auf den vollkommen leeren Platz geschlichen, um noch einmal meine Gedanken schweifen zu lassen und die unbeschwerte Stille zu genießen, mit der es bald vorbei war.
Die Spiele veränderten alles. Familien wurden entzweit. Freunde wurden zu Feinden. Selbst Liebende konnten einander nicht mehr vertrauen.
Was einmal war, spielte keine Rolle mehr.
Wir würden gegeneinander kämpfen und sterben, bis nur noch einer übrig blieb, welcher im Heiligtum, tief verborgen in den weißen Wäldern, zum Sieger gekürt wurde. Was genau dort geschah, wusste keiner so genau. Jene, die die Spiele überlebt hatten, sprachen nicht darüber. Um genau zu sein, sprachen sie so gut wie gar nicht mehr, sondern zogen sich in die Einsamkeit zurück.
Niemand durfte sie auf die Geschehnisse ansprechen. Das wurde von den obersten Hexen streng verboten. Sie behaupteten, dass dieses Wissen allein den Teilnehmern gebührte und es eine Ehre sei, zu den Eingeweihten zu gehören.
In meinen Augen jedoch hatte das nichts mit Ehre zu tun. Sie wollten uns im Dunkeln lassen, damit man uns weiterhin wie ein paar dumme, blinde Schafe zur Schlachtbank führen konnte. Denn genau das waren wir. Opfer für die große Mutter.
Viele von uns lockte das Versprechen unermesslicher Macht als Preis für den Sieg. Eine Aussicht, die schon kleine Kinder von der Teilnahme an den Hexenspielen träumen ließ. Ich wünschte, ich könnte behaupten, das Versprechen sei eine Lüge, doch ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
Die Sieger zeigten sich nicht oft, aber wenn sie es einmal taten, dann schien die Luft wie elektrisiert und ein Blick genügte, um diese unheimliche Aura zu erkennen, die jeden von ihnen umgab. Sie brauchten keine Zaubersprüche, Rituale oder irgendwelche Hilfsmittel, um mächtige Magie zu wirken. Ein Atemzug von ihnen und selbst die kompliziertesten Zauber gelangen.
Es mochte seltsam klingen, doch obwohl die Spiele in erster Linie dazu dienten, einen Herrscher zu bestimmen, gab es sie alle sieben Jahre. Zum einen, weil nicht jeder von der Göttin auch dazu bestimmt wurde, zum König oder zu Königin gekrönt zu werden. Zum anderen auch, um eine Elite zu wählen, die uns beschützen sollte.
Ich hatte mich mehrmals gefragt, ob sie auch die verbotene Magie beherrschten und sogar die Toten durch einen einzigen Blick wieder ins Leben holen konnten. Leider hatte ich nie die Gelegenheit, einen von ihnen zu fragen.
Mein Blick flog über den großen Platz, der jetzt, wo kaum jemand hier war, trostlos und grau wirkte. Heute gab es keine Marktstände, an denen die verschiedensten Waren feilgeboten wurden.
Stattdessen war ich umringt von Fackeln, die man tief in den Boden getrieben hatte. Sobald die Zeremonie der Teilnehmer begann, würden sie entzündet werden und erst erlöschen, sobald wir starben.
Sanft strich ich über den kühlen Stein des riesigen Monolithen, der sich in der Mitte des Marktplatzes befand. Buchstabe für Buchstabe fuhr ich die darin eingravierten Namen nach, darunter auch den meines Vaters.
Auf dem emporragenden Steinblock vor mir waren alle Teilnehmer der Hexenspiele verzeichnet. Eine riesige Ansammlung von Toten. Opfer, wie das Orakel sie bezeichnete.
Vier Sieger weilten noch unter uns, nachdem im letzten Jahr der Älteste von ihnen, Tarek, unser König, gestorben war.
Velea, Nineb, Avra und Artaris lebten verteilt in ihren eigenen Heimatdörfern in einiger Entfernung rund um den weißen Wald. Sie galten als unsere Wächter und erhielten mit ihrer Magie den Schutzkreis, der unsere Heimat vor den Menschen verbarg. Doch ohne einen Herrscher waren wir geschwächt.
Auch deshalb war dieses Jahr alles anders. Keiner der vier Wächter war von der Göttin als Nachfolger auserwählt worden, weshalb alle Hoffnung auf den diesjährigen Spielen lag. Einer von uns musste sich als würdig erweisen oder wir wären gezwungen, die nächsten Jahre in dem Bewusstsein zu leben, dass jeder Tag der Letzte sein könnte.
Ich schnaufte abfällig.
Als ob ich das nicht ohnehin schon getan hätte.
Im Grunde war ich glücklich, dass keiner der Sieger im selben Dorf wie ich lebte. Denn seit den letzten Spielen schaffte ich es nicht, Artaris anzusehen. Er und mein Vater waren Freunde gewesen und in demselben Jahr für die Hexenspiele auserwählt worden. Doch nur er hatte überlebt.
Meine Mutter meinte, dass sie ihm nicht böse sei, sondern froh war, weil zumindest einer von ihnen überlebt hatte. Aber ich wusste, dass sie den Tod meines Vaters nie überwunden hatte. Manchmal hörte ich sie nachts leise weinen. Für mich versuchte sie stark zu sein, obwohl sie innerlich bereits zerbrochen war. Es gab Tage an denen sie trotz ihrer Bemühungen das Haus nicht verließ, weil sie den Schein nicht wahren konnte. An anderen, war ihr kaum etwas anzumerken. Doch ich wusste es. Ich sah den Schmerz in ihren Augen, weil ich denselben empfand. Mein Vater hatte ein Loch hinterlassen, das durch nichts zu füllen war.
Und nun musste auch ich an den Spielen teilnehmen, ohne die Aussicht darauf, lebend zurückzukehren. Natürlich wollte ich mich nicht einfach so geschlagen geben. Ich hatte einen Plan und würde bis zur letzten Sekunde kämpfen.
»Asuna«, rief eine mir vertraute Stimme meinen Namen quer über den Marktplatz. Ich drehte mich von dem Steinblock weg und sah, wie meine beste Freundin Mira auf mich zu gerannt kam. Schnaufend erreichte sie mich, stützte sich mit den Händen auf den Knien ab und atmet tief durch.
»Da bist du ja!«
»Was ist denn los?«, fragte ich mit einem halben Lächeln, amüsiert darüber, dass sie mich offenbar schon eine Weile gesucht hatte. Sie war eine eher chaotische Hexe, aber wir waren seit unserer Kindheit unzertrennlich gewesen. Und dafür war ich mehr als nur dankbar. Sie hatte mir nach dem Tod meines Vaters beigestanden und war die Einzige gewesen, die meine Wut und den Hass verstanden hatte.
Empört funkelte Mira mich an, richtete sich auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Was los ist?« Verärgert verengte sie die Augen zu Schlitzen. »Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich noch einmal mit meiner besten Freundin sprechen, bevor sie sich aus dem Staub macht, um die größte Hexe unserer Zeit zu werden«, verkündete sie völlig übertrieben.
Sie wusste genauso gut wie ich, dass ich nicht gewinnen konnte. Mira wäre eine bessere Teilnehmerin gewesen. Sie hätte eine wirkliche Chance gehabt, zu gewinnen, und das, obwohl sie dazu neigte, planlos zu handeln.
Als Kind hatte ich mir vorgenommen, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ihn sogar noch zu übertreffen. Und, wie auch immer das möglich sein sollte, ihn mit Stolz zu erfüllen. Aber heute waren diese kindischen Träume der bitteren Wahrheit gewichen.
»Du übertreibst schon wieder!« Ich musste mich anstrengen, mein zuversichtliches Lächeln aufrechtzuerhalten. Doch es fiel mir immer schwerer, je weiter die Zeit voranschritt. Mein Herz raste und ich spürte, wie die Nervosität langsam die Oberhand gewann.
Mahnend hielt Mira eine Hand in die Höhe. »Komm mir erst gar nicht damit, dass du keine Chance hättest. Ich glaube fest an dich.«
Sie hatte schon immer mehr in mir gesehen, als wirklich vorhanden war. Manchmal hatte mich das angespornt, doch im Augenblick funktionierte das nicht.
»Du hast die Namen der anderen Teilnehmer genauso gehört, wie ich.« Bei dem Gedanken daran, wem ich bald gegenüberstehen würde, schaffte ich es schließlich doch nicht länger, den Schein zu wahren, und ließ entmutigt die Schultern hängen.
Doch Mira schien das wenig zu beeindrucken. Sie zuckte nur mit den Schultern. »Na und?«
Fassungslos starrte ich sie an. »Na und? Die Hälfte von ihnen ist mindestens doppelt so stark wie ich.« Was nicht nur an ihrem Talent, sondern auch an ihrem Alter und den damit verbundenen Erfahrungen lag. Es spielte für die Göttin keine Rolle, wie viele Jahre jemand durchlebt hatte, ehe er auserwählt wurde. Manche wurden bereits in ihrer Jugend dazu bestimmt, teilzunehmen, andere wiederum erst viel später.
»Du übertreibst«, winkte Mira ab. »Du hast vielleicht zwei oder drei wirkliche Konkurrenten. Der Rest besteht aus einfältigen Trotteln, die nicht einen einzigen Tag in den Wäldern überleben.«
Automatisch ging ich die Namen noch einmal im Kopf durch und kam bei Weitem auf mehr als drei.
Mira sah mir an, dass ich ihrer Einschätzung nicht zustimmte. »Cyrian und Livia sind zugegeben sehr talentiert und werden versuchen, sich schnellstmöglich einen Weg frei zu bahnen«, überlegte sie laut. »Ihnen solltest du aus dem Weg gehen.«
Stöhnend rollte ich mit den Augen. »Danke für den Hinweis.« Nach Möglichkeit würde ich jeden von ihnen meiden und versuchen, so lange am Leben zu bleiben, wie ich konnte.
»Ich versuche, dir nur zu helfen!« Empört verschränkte sie die Arme vor der Brust.
»Ich weiß«, seufzte ich und dafür war ich ihr auch dankbar. Aber als seien Cyrian und Livia nicht schon gefährlich genug, gab es da ja auch noch einen weiteren Kandidaten, der meinen sicheren Untergang bedeutete. Zumindest befürchtete ich das.
Hoffnungslos sah ich meine Freundin an. »Selbst wenn ich Cyrian und Livia aus dem Weg gehe, bleibt da immer noch einer übrig.« Verbissen vermied ich es, seinen Namen zu nennen.
Die Göttin meinte es ohnehin nicht gut mit mir, da musste ich sie nicht auch noch provozieren. Sie hätte jeden auserwählen können, aber sie musste unbedingt mich nehmen. Und noch dazu musste sie ausgerechnet den Sohn eines Siegers auswählen, dessen Ego leider genauso groß wie seine Kräfte waren.
»Sander«, hauchte Mira seinen Namen sehnsuchtsvoll.
Bei dem Klang zuckte ich zusammen.
Wie oft wurde ich bereits verspottet, weil ich die einfachsten Zauber nicht hinbekam, während Sander alles ohne Anstrengung vollbrachte?
Während ich die Beleidigungen meiner Altersgenossen stets mit Fassung hingenommen hatte, waren es seine Blicke gewesen, die mich getroffen hatten. Für ihn war ich ein gefundenes Fressen.
»Ihr habt doch diesen Pakt geschlossen, richtig?«
Langsam nickte ich.
»Das ist wahr.« Ich wusste immer noch nicht genau, wie es eigentlich dazu gekommen war und wie ich mich darauf hatte einlassen können. Aber feststand, dass wir vereinbart hatten, einander zu beschützen. Obwohl ich noch immer glaubte, dass ich etwas Wichtiges übersehen hatte. Sander konnte kaum einen Vorteil aus dieser Vereinbarung ziehen und trotzdem hatte er ausgerechnet mir dieses Angebot unterbreitet.
Es war nicht unüblich, dass sich vor den Spielen, Allianzen bildeten. Doch für gewöhnlich geschah das unter den stärksten Teilnehmern, um einen letzten Vorteil zu gewinnen. Dass sich ein Favorit mit einer Verliererin wie mir abgab war seltsam. Immerhin starben die Schwachen zumeist gleich am Anfang.
Um mögliche Gefahren auszuschließen, hatte ich versucht, auf die genaue Formulierung unserer Vereinbarung zu achten. Aber ich wusste, dass Sander klug war.
»Und er hat wirklich versprochen, dir bis zum Ende der Spiele nichts zu tun?« Mira klang noch immer genauso ungläubig, wie in dem Moment, in dem ich ihr davon berichtet hatte.
»Darauf habe ich bestanden, ja.« Denn selbst, wenn nur wir zwei übrigblieben, konnte er mir nichts anhaben. Das hatte er geschworen.
Die Spiele endeten erst, sobald es einen Sieger gab. Was dieses kleine Versprechen für mich überlebenswichtig machte. Einen Kampf gegen Sander würde ich nicht gewinnen. Das konnte nicht einmal Mira bestreiten. Genau deshalb hatte ich bei unserem Pakt auch auf kleinere Details bestanden.
Genau genommen hatte Sander versprochen, keinen Zauber gegen mich zu richten und mich vor allen Gefahren zu beschützen. Das schloss sowohl die anderen Teilnehmer als auch die Kreaturen des Waldes ein.
Ich hingegen hatte keine Verpflichtungen, außer mit ihm gegen die anderen Teilnehmer zu kämpfen. Sander wollte mein Talent zum Spuren lesen genauso wie meine Begabung für die Manipulation meiner Umgebung ausnutzen, um die anderen Teilnehmer zu finden.
Doch das alles bedeutete nicht, dass ich ihm nichts antun durfte. Ganz im Gegenteil. Unsere Abmachung verbot es mir in keiner Weise, ihm nach dem Leben zu trachten. Die Frage war nur, ob ich überhaupt dazu imstande war.
»Dann weiß ich nicht, worüber du dir Sorgen machst.« Es erstaunte mich, dass Mira mich seit so vielen Jahren kannte und dennoch nicht sah, worin meine größte Angst bestand. Dabei war es offensichtlich.
Ich musste einem anderen Menschen das Leben nehmen, um meines zu retten.
Können wir über etwas anderes sprechen?«, bat ich Mira, weil ich nicht länger über Sander nachdenken wollte. Zumindest die letzten Stunden, die mir noch blieben, sollten nicht von meiner Sorge überschattet werden, vielleicht oder vielleicht auch nicht einen Fehler begangen zu haben.
Verlegen begann meine Freundin, die Hände zu kneten. »Natürlich. Hast du noch mal mit deiner Mutter gesprochen?«
Ich stöhnte. Mira schien heute ein Talent dafür zu haben, genau die falschen Themen anzuschneiden. Neben Sander war sie die zweite Person, über die ich ganz und gar nicht sprechen wollte.
An dem Tag, an dem das Orakel meinen Namen verkündete, hatte sie vor Verzweiflung geschrien. Seither war kein Tag vergangen, an dem sie nicht geweint hatte. Sie liebte mich und war die letzten sieben Jahre immer für mich da gewesen. Doch den Gedanken mich genauso zu verlieren, wie meinen Vater, ertrug sie nicht.
Früher hatte ich ihr vorgeworfen, meinen Vater nicht geliebt zu haben, weil sie der großen Mutter für Artaris Sieg gedankt hatte.
Doch heute verstand ich, dass sie es nur meinetwegen getan hatte. Genauso wie sie sich immer gewünscht hatte, dass ich nicht mit den Gaben einer Hexe gesegnet worden wäre. Denn dann hätte ich nicht an den Spielen teilnehmen müssen.
Sie gab sich selbst die Schuld daran, dass ich auserwählt worden war. Sie hielt es für eine Strafe, weil sie nur ein Mensch war und früher nicht an die Göttin geglaubt hatte.
»Nein. Es geht ihr zurzeit nicht gut.« Es war nicht so, dass ich ihren Schmerz und ihre Verzweiflung nicht verstand, aber ich konnte mich gerade nicht um sie kümmern. Jedes Mal, wenn ich sie ansah und ihr die Tränen in die Augen stiegen, wurde meine Angst vor den Spielen noch größer. Sie glaubte nicht daran, dass ich siegreich zurückkehrte. Genauso wenig wie ich.
Allerdings durfte ich nicht zulassen, dass ich vor Selbstmitleid verging, noch bevor die Spiele begonnen hatten. Wenn ich es tat, konnte ich mich genauso gut gleich im Fluss ertränken.
»An deiner Stelle wäre ich wütend. Sie suhlt sich in ihrem Leid, obwohl nicht sie es ist, die ihr Leben riskieren muss. Ihre Aufgabe wäre es, dir Mut zuzusprechen und für dich da zu sein.«
Ja, das hatte ich mir auch gewünscht. Aber ich wollte meine eigenen Qualen nicht über die anderer stellen. Deshalb hatte ich nichts gesagt und ihr keine Vorwürfe gemacht. Stattdessen hatte ich mich dazu entschieden, ihr aus dem Weg zu gehen, soweit es möglich war.
So wie ich es bereits seit Wochen tat, zwang ich mir ein Lächeln ins Gesicht, während ich nach Miras Händen griff.
»Dafür habe ich doch dich.« Was stimmte. Mira versicherte mir ständig, dass sie an mich glaubte und ich es ganz sicher schaffen würde. Wofür ich ihr mehr als nur dankbar war. Ohne sie hätte ich mich sicher schon in einem tiefen Erdloch versteckt.
Meine Freundin drückte meine Hände sanft und erwiderte das Lächeln. »Du bist nach wie vor mein Favorit. Auch wenn es um unseren hübschen Sander schade ist.«
Kopfschüttelnd entwand ich mich ihr, nur um sie gleich darauf in die Arme zu ziehen.
»Du bist die beste Freundin, die man sich nur wünschen kann. Auch wenn dein Interesse an Sander manchmal etwas krankhaft ist.«
Schon seit unserer Kindheit stellte sie ihm nach und versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Zu ihrem Leidwesen ohne Erfolg. Es schien, als würde er sie überhaupt nicht wahrnehmen. Je mehr sie sich bemühte, desto unsichtbarer wurde sie für ihn. Dabei war Mira einfach umwerfend schön. Ihre schwarzen Locken reichten ihr bis zur Hüfte und rahmten ihre schlanke Gestalt ein. Spätestens beim Blick in ihre dunkelblauen Augen schmolzen die Männer nur so dahin.
Wir waren vollkommen unterschiedlich. Mein Haar war hellblond, fast weiß und fiel in wirren Strähnen über meine Schultern. Die meiste Zeit gab ich mir keine Mühe, sie überhaupt zu kämmen, da sie ohnehin taten, was sie wollten.
Das Einzige, was ich an mir mochte, waren meine giftgrünen Augen, die denen meines Vaters ähnelten. Es war das Einzige, was mir von ihm geblieben war.
»Er ist aber auch ein Traum«, begann sie erneut zu schwärmen.
»Du bist hoffnungslos verloren.«
Wir lösten uns voneinander und sie schenkte mir ein gleichgültiges Schulterzucken.
»Und wenn schon. Es gibt schlimmere Sünden.«
Schon so oft hatte ich mir gewünscht, Miras Selbstbewusstsein zu haben. Oder wenigstens einen kleinen Teil davon.
Die Sonne stand inzwischen tief. Die Dämmerung würde bald einsetzen und den Beginn der Zeremonie einläuten. Unsicher verlagerte ich mein Gewicht von einem Fuß auf den anderen und sah zum äußeren Rand des Marktplatzes, an den nicht weit entfernt der weiße Wald angrenzte.
Die verschiedenen Arten von Laubbäumen, Büschen und Kräutern, die darin wuchsen, unterschieden sich kaum von gewöhnlichen Wäldern. Wären da nicht die weißen Blätter, die statt Grünen an den Bäumen wuchsen.
Laut den Überlieferungen wandelte die Göttin selbst einst durch diesen Wald. Erfüllt durch ihre Macht begannen die Pflanzen darin zu leuchten und erhielten besondere magische Eigenschaften. Die unterschiedlichsten Kreaturen, unter anderem auch wir Hexen, fanden hier ein Zuhause. Doch als die Menschen die Jagd auf die Göttin eröffneten und ihre sterbliche Hülle töteten, veränderte sich etwas. Das Leuchten schwand und stattdessen färbten sich die Blätter der Bäume vor Kummer weiß. Die Wesen, die zuvor friedlich im Wald zusammengelebt hatten, begannen sich zu bekriegen. Eine grauenhafte Dunkelheit ergriff Besitz von ihnen und unsere Vorfahren flüchteten, nachdem auch einige Hexen langsam der Finsternis verfallen waren. Doch sie kamen nicht weit. Denn nur hier, in der Nähe des weißen Waldes, konnten wir unsere wahre Kraft entfalten.
Jene, die sich zu weit entfernten, verloren ihre magischen Fähigkeiten und gebaren menschliche Kinder. Sie waren fortan gezwungen, fernab ihrer Heimat unter Fremden zu leben. Doch hatten sie damit nicht nur ihre Kräfte verloren, sondern auch einen Teil von sich selbst. Dieser Verlust entfesselte einen unbändigen Zorn in ihnen. Nicht nur auf sich selbst, sondern auf alles Magische, den sie sogar an ihre Kinder vererbten.
Laut den Legenden wurden aus ihnen die ersten Jäger.
Die Kräuter des Waldes haben bis heute eine besonders starke Wirkung und helfen uns Hexen dabei, mächtige Zauber auszuüben und selbst tödliche Krankheiten zu heilen.
Außerdem kann nur hier ein Auserwählter die Segnung der Göttin erhalten und zu unserem neuen König oder unserer neuen Königin werden.
Es würde das erste Mal sein, dass ich den weißen Wald nachts betrat. Eigentlich war das verboten, denn obwohl der Wald heilig war, lauerten bis heute unzählige Gefahren in seinem Inneren. Ganz besonders, sobald die Sonne ihre schützende Magie nicht länger ausübte.
»Ich sollte mich langsam auf den Weg machen«, verkündete ich wenig überzeugend. Obwohl ich nicht nach Hause wollte, musste ich noch ein paar Sachen packen, die ich mitnehmen würde.
Die Freude in Miras Gesicht erlosch und Kummer trat an ihre Stelle. »In Ordnung.«
Ich sah ihr an, dass sie mich am liebsten mitgenommen und versteckt hätte. Aber das hätte mir auch nicht geholfen. Sobald die Zeremonie begann, würde der Wald eine magische Anziehungskraft auf mich ausüben.
Es gab schon Teilnehmer vor mir, die sich weigern wollten, aber schließlich dennoch wie in Trance den Wald betraten.
Plötzlich riss Mira die Augen weit auf und begann in der grauen Tasche zu kramen, die ihr über der Schulter hängte.
»Das hätte ich fast vergessen«, sagte sie und zog ein kleines Bündel hervor. »Hier. Das ist für dich.« Auffordernd streckte sie es mir entgegen.
Kopfschüttelnd wich ich zurück. »Du musst mir nichts schenken.«
»Vergiss es. Du wirst das annehmen.« Ihr Blick wurde streng und ich wusste, dass sie mir keine Wahl ließ.
Ich mochte keine Geschenke. Es fühlte sich falsch an, etwas von jemand anderem anzunehmen, besonders wenn man kein Gegengeschenk hatte.
Außerdem stand ich nicht gern im Mittelpunkt.
Murrend murmelte ich ein Danke und griff nach dem Bündel. Ich faltete die dünnen Lagen Stoff auseinander und zum Vorschein kam ein kunstvoller Dolch aus Silber. Über seinen Griff und die Klinge rankten sich verschnörkelte Muster mit kleinen Symbolen darin. Er musste unvorstellbar alt und kostbar sein.
»Danke«, hauchte ich überwältigt. »Er ist wunderschön. Aber den kann ich nicht annehmen.«
»Du kannst und du wirst.«
Andächtig strich ich über den Griff. Was die Symbole bedeuteten, konnte ich nicht sagen, aber sie waren ganz eindeutig magisch. Ähnliche Zeichen befanden sich auf dem Monolithen neben uns. Von denen ich jedoch wusste, dass sie für Tapferkeit, Liebe und Opferbereitschaft standen.
»Der Dolch gehört meiner Familie schon seit Jahrhunderten. Einer unserer Vorfahren hat damit sogar die Spiele gewonnen«, verkündete sie und Tränen stiegen mir in die Augen. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, nicht zu weinen.
Ich hob den Kopf und legte all die Gefühle in meinen Blick, die ich nicht auszudrücken vermochte.
»Wird deine Familie ihn nicht vermissen?«
»Nein. Meine Eltern waren auch dafür, ihn dir zu schenken. Aber falls du ihn nicht behalten willst, kannst du ihn uns zurückgeben, wenn du wiederkehrst.« Sie deutete auf die Symbole. »Sie stehen für Glück, Gesundheit, Macht und ein langes Leben.«
Noch einmal zog ich sie in eine feste Umarmung und verbarg das Gesicht an ihrer Schulter. Ein Schluchzen stieg meine Kehle empor, das ich jedoch mit aller Kraft zurückdrängte.
Ein Beben ging durch Miras Körper und ich wusste, dass auch sie sich bemühte, stark zu bleiben. »Komm zurück, ja?«
»Versprochen«, flüsterte ich, obwohl ich wusste, dass ich dem Wald nicht entkommen würde.
Mit schleppenden Schritten durchquerte ich das Dorf, während ich den Dolch fest an meine Brust presste. Ich nahm kaum jemanden wahr, denn meine Gedanken kreisten immer wieder um das, was mir bevorstand. Der Abschied von Mira war mir schwergefallen, aber ich musste gehen. Wir würden uns noch ein letztes Mal kurz vor Beginn der Spiele sehen. Aus der Ferne. Denn ich würde vor allen als Auserwählte präsentiert werden, während sie in der Menge der Zuschauer unterging.
Mein Herz raste in meiner Brust und ich konnte mich kaum noch beruhigen. Aufregung und Panik jagten das Adrenalin durch meinen Körper. Der Wind strich über meine Haut und ich zitterte. Die Tage waren inzwischen angenehm, wenn auch nicht wirklich warm, aber die Nächte waren noch immer kalt. Zu dieser Zeit unter freiem Himmel zu übernachten, würde nicht leicht werden.
Langsam wanderte mein Blick hinauf zu der untergehenden Sonne.
»Hast du dich auch so gefühlt und es nach außen hin nur nicht gezeigt?«, wisperte ich kaum hörbar. Mein Vater war mutig gewesen, das stand außer Frage. Aber wenn ich gewusst hätte, ob er auch Angst vor den Spielen gehabt hatte, dann wäre es mir leichter gefallen, meine Panik zu akzeptieren. So fühlte ich mich schwach. Als würde ich ihn bereits jetzt enttäuschen.
Ich erreichte unsere Hütte, die nicht weit entfernt vom Marktplatz stand. Ein einfaches Holzhaus, dass mein Vater mit eigenen Händen errichtet hatte.
Es brannte kein Licht. Vermutlich war Mutter im hinteren Teil, dort wo sich die Küche befand.
Anders als die meisten Häuser hatte unseres zwei Stockwerke. Im oberen Teil lagen die Schlafzimmer. Im Unteren das Wohnzimmer, die Küche und ein kleiner Vorratsraum.
Vorsichtig, damit ich keine Geräusche machte, öffnete ich die Tür und linste nach drinnen.
»Asuna?«, rief Mutter sofort und ich seufzte. Meine Hoffnung, unbemerkt in mein Zimmer zu schleichen, löste sich mit einem Mal in Luft auf.
»Ja!?«, rief ich zurück und ging hinein.
»Komm bitte zu mir«, bat sie und statt wie geplant in mein Zimmer zu gehen, lief ich in die Küche, aus der ihre Stimme drang.
Ich durchquerte das Wohnzimmer, das direkt an den Eingangsbereich angrenzte und durch das man in die Küche gelangte. Eine einzelne Kerze stand auf einer Kommode und tauchte den Raum in ein schummriges Licht.
Der Duft nach frischem Brot, Kräutern und Gemüse stieg mir in die Nase. Was mich überraschte. Immerhin hatte ich fest damit gerechnet, meine Mutter weinend am Küchentisch vorzufinden. Doch stattdessen stand sie an der Feuerstelle vor dem großen Kessel und rührte darin. Obwohl das Herdfeuer bereits ein wenig Licht spendete und auch durch das große Fenster gegenüber noch ein paar letzte Sonnenstrahlen drangen, hatte Mutter die Kerzen in dem Kerzenleuchter entzündet, der auf dem Esstisch stand.
»Du bist spät«, stellte sie fest und drehte sich zu mir herum, während sie sich die Hände an ihrer weißen Schürze abwischte. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt, aus dem vereinzelte Strähnen herabhingen.
»Ich war mit Mira auf dem Marktplatz.« Unsicher stand ich im Türrahmen. Es kam mir vor, als sei ich im falschen Haus. Früher hatte Mutter jeden Tag gekocht und gebacken. Man hatte sie fast ausschließlich hier oder auf dem Marktplatz angetroffen. Aber nachdem ich als Teilnehmerin auserwählt worden war, hatte sie sich immer mehr zurückgezogen.
Jetzt schien es, als würde ich einen Blick in die Vergangenheit werfen.
»Setz dich. Du solltest etwas Essen bevor …«, sie brach ab und erstarrte. Sie bemühte sich, zumindest heute ihre Gefühle zu bändigen, obwohl es ihr nicht ganz gelang. Dennoch war es mehr, als ich erwartet hatte.
Langsam ging ich auf sie zu und setzte wieder dieses erzwungene Lächeln auf. Sie erwachte aus ihrer Starre und drehte sich schnell zu dem Kessel um, während ich am Tisch Platz nahm. Den Dolch legte ich dabei auf dem Tisch ab.
In Windeseile hatte sie zwei Schüsseln mit einer aromatisch duftenden Suppe gefüllt.
Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Schon als Kind hatte ich ihre Eintöpfe geliebt.
»Das riecht wunderbar«, lobte ich und brachte sie damit zum Lächeln. Nachdem sie eine Schüssel vor mir abgestellt und ihre eigene gefüllt hatte, nahm sie direkt neben mir am Kopfende des Tisches Platz. Genau dort, wo früher Vater gesessen hatte.
»Ich wollte dir eine Freude machen«, sagte sie und gab mir einen der zwei Holzlöffel, die sie mitgebracht hatte. Zufällig streifte ihr Blick dabei den auf dem Tisch liegenden Dolch und blieb einen Moment lang daran hängen. Ich wartete, auf eine Reaktion, aber nichts geschah. Sie fragte nicht einmal, woher ich so etwas Kostbares hatte. Wir waren zwar nicht arm, aber ein solches Kunstwerk konnten wir uns dennoch nicht leisten.
Vielleicht hoffte sie, dass ich selbst die Sprache darauf brachte. Oder sie wollte unseren letzten, gemeinsamen Moment nicht durch Neugierde kaputt machen.
Da mir selbst nicht nach Reden zumute war, entschied ich mich für Zweiteres und tat so als hätte ich ihren Blick nicht bemerkt.
Stillschweigend begannen wir zu Essen.
Es war schön. Auch wenn die Stille sich die ganze Zeit über bedrückend anfühlte. Zwischen uns stand meine ungewisse Zukunft, über die wir zwar nicht sprachen, aber die trotzdem allgegenwärtig war. Das hier war im Grunde meine Henkersmahlzeit. Ganz gleich wie lange ich im Wald überleben würde.
Nein! Ich durfte mich nicht selbst quälen. Stattdessen musste ich das hier genießen. Jeden Bissen, den ich von diesem köstlichen Eintopf zu mir nahm, genauso wie die Wärme, die vom Herdfeuer ausging.
Es war wichtig dankbar zu sein für das, was man hatte, ohne dabei dessen baldigen Verlust zu betrauern.
Nachdem wir aufgegessen hatten, erhob ich mich, wusch die zwei Schüsseln in einem Eimer mit Wasser ab und räumte sie in das kleine Regal neben der Feuerstelle.
Mutter saß noch immer am Tisch, mit dem Rücken zu mir und schwieg. Ihr Gesicht mochte ich nicht sehen können, aber ihre Haltung verriet, was in ihr vorging. Sie trauerte bereits jetzt um mich, obwohl ich noch hier neben ihr stand.
Es machte mich wütend und traurig zugleich, zuzusehen, wie sie in ihrem Kummer verging. Ihr Schmerz war groß, doch das war meine Angst ebenso.
Es fiel mir nicht leicht, über meinen Schatten zu springen und die Distanz, die sich in den letzten Wochen zwischen uns aufgebaut hatte, zu überwinden. Aber ich wollte mich nicht so von ihr verabschieden. Stumm und lieblos. Deshalb nahm ich all meinen Mut zusammen, ging zu ihr und umarmte sie von hinten.
»Danke«, hauchte ich und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Sie mochte mich in den letzten Wochen mit meinen Ängsten und Sorgen allein gelassen haben, aber zumindest jetzt, wo ich sie am meisten brauchte, war sie bei mir. Auch wenn sie ihre Gefühle nicht verbergen konnte.
Sanft legte sie ihre Hände auf meine Arme und ich senkte meinen Kopf auf ihrer Schulter ab.
»Mein kleines Mädchen. Es tut mir so schrecklich leid.« Sie lehnte ihren Kopf gegen meinen. »Du hast das nicht verdient.«
Und trotzdem war das mein Schicksal. Ob es uns gefiel oder nicht.
Als ich am Morgen aufgewacht war, hatte ich mir einen letzten, normalen Tag gewünscht. Das lästige Aufstehen bei Sonnenaufgang, den täglichen Gang zum Fluss, um Wasser zu holen, die ermüdenden Lektionen bei unserer Lehrerin, einen Ausflug auf den Marktplatz und ein Treffen mit Mira. Das alles hatte ich getan. Trotzdem hatte es sich anders angefühlt, weil ein dunkler Schatten jeden meiner Schritte verfolgt hatte.
Der Tag ging vorüber, ohne dass ich mich am Ende bereit fühlte. Doch die Zeit nimmt keine Rücksicht auf unsere Wünsche. Sie rennt davon, ganz gleich wie sehr wir versuchen sie aufzuhalten.
Noch einen letzten Kuss hauchte ich meiner Mutter auf die Wange, ehe ich mich von ihr löste und ohne ein weiteres Wort nach dem Dolch griff und aus dem Raum, die Treppe hoch, in mein Zimmer ging.
Auch hier brannte bereits das Licht einiger Kerzen, die Mutter aufgestellt haben musste. Ob sie das auch tun würde, wenn ich fort war?
Hastig schüttelte ich den Kopf. Ich musste die Ruhe bewahren und durfte mich nicht ablenken lassen.
Mir blieb kaum noch Zeit, weshalb ich mich beeilte und direkt zu der Kommode neben meinem Bett lief. Ruckartig zog ich den Lederbeutel daraus hervor, den ich mir extra gekauft hatte, und begann einige Sachen hineinzustopfen. Eine Decke, ein paar Feuersteine, eine Flasche, die ich zuvor mit Wasser gefüllt hatte und ein kleines Gefäß, in dem sich Eisenkraut befand. Es half dabei, bösartige Wesen fernzuhalten, was wohl nicht schaden konnte. Immerhin lebten im weißen Wald unzählige von ihnen. Zuletzt zog ich mir noch das dunkelblaue Kleid mit den langen Ärmeln an, das Mutter für mich genäht hatte. Dazu trug ich eine schwarze Hose, die mich hoffentlich warmhalten würde. Das Geschenk, das ich von Mira erhalten hatte, schnallte ich mir dabei mithilfe eines Gurtes um den Oberschenkel. Auch wenn ich hoffte, dass ich den Dolch nicht brauchte, sicherte ich mich lieber für alle Fälle ab.
Mehr oder weniger bereit, sah ich mich ein letztes Mal um und warf mir den Lederbeutel über die Schulter.
Bis auf die Kommode und das kleine Bett befand sich nur noch ein Regal mit Büchern in meinem Zimmer. Ich hatte überlegt, ob ich eines der Bücher mitnehmen sollte, entschied jedoch, dass sie mir wenig nützen würden. Auch wenn ich sie allesamt von meinem Vater bekommen hatte.
Bevor ich das Zimmer verließ, nahm ich noch den schwarzen Umhang vom Kleiderständer, den ich sonst zum Kräutersammeln trug, und schlüpfte hinein.
Danach schloss ich die Tür mit einem lauten Quietschen und ging die Treppe hinunter. An deren Ende wartete meine Mutter auf mich, in den Händen einen Laib Brot.
»Das habe ich für dich gebacken«, sagte sie und streckte es mir entgegen. Schweigend nahm ich es und verstaute es ebenfalls in dem Lederbeutel, ehe ich sie ein letztes Mal umarmte. Sie fuhr mir mit der Hand durch das lange Haar und gab mir einen Kuss auf die Stirn.
»Möge die Göttin mit dir sein.«
Bevor ich ihr sagen konnte, dass die große Mutter mich schon lange aufgegeben hatte, biss ich mir auf die Unterlippe und löste mich von ihr. Ein riesiger Kloß hatte sich in meinem Hals gebildet. Ich wollte keine schönen letzten Worte hören, sondern es einfach hinter mich bringen, bevor die Angst die Kontrolle über mich erlangte.
Ohne ein Wort des Abschieds drehte ich mich um und ging. Zurück zum Marktplatz und meinem Schicksal entgegen. Dabei vermied ich es, auch nur einen Blick zurückzuwerfen. Ich lief den Pfad entlang, der sich an den Häusern vorbeischlängelte. Es war dunkel geworden. Die Nacht war angebrochen und damit neigte sich mein letzter Tag dem Ende entgegen. Ob ich die Sonne noch einmal sehen würde, wusste allein die Göttin.
Nur in wenigen Häusern brannte das Licht einzelner Kerzen, was mir verriet, dass die meisten von ihnen sich bereits auf dem Weg zu dem Ritual befanden.
Schon aus der Ferne hörte ich ihre aufgeregten Stimmen. Es war ausgeschlossen, dass mein Herz noch schneller schlagen konnte. Trotzdem nahm es mit jedem Schritt, den ich tat, an Tempo zu, bis ich schließlich die große Ansammlung von Hexen und Hexern entdeckte. Der Klang der Trommeln verriet mir, dass die Zeremonie bald begann.
Wenn es nicht so zwecklos gewesen wäre, hätte ich spätestens jetzt die Flucht ergriffen.
Statt jedoch diesem Instinkt nachzugeben, straffte ich die Schultern und zwang mich weiterzugehen. Auf die Menge zu und durch sie hindurch. Ich wurde geschubst und gestoßen. Doch ich schaffte es bis ganz nach vorn in die erste Reihe.
Vor dem Monolithen stand eine Frau mit braunem Haar, das zu einem straffen Zopf gebunden war. Sie trug eine feine Robe in Schwarz und mit silbernen Verzierungen darauf. Eine Mondsichel, in deren Mitte ein kleiner Rabe prangte. Das Symbol unseres Dorfes.
Ihr Name war Magda.