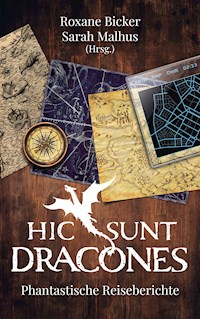
Hic sunt Dracones E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Durch Länder, Gewässer, Luft und Weltraum führen uns Expeditionen in unbekannte Gebiete. Immer dabei ist die Landkarte, auf der die Worte prangen: "Hic sunt Dracones" - hier sind Drachen! Eine Warnung, die beachtet werden sollte. Sonst kann es passieren, dass wir im Hort eines Drachen landen, auf einer einsamen Insel oder in einem Wurmloch, verloren in Zeit und Raum. 33 phantastische Reiseberichte machen das Reisen durch Welten, Zeiten und Ebenen zu einer Herausforderung, aber seid gewiss, noch haben wir immer den Heimweg gefunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hic sunt Dracones
Durch Länder, Gewässer, Luft und Weltraum führen uns Expeditionen in unbekannte Gebiete. Immer dabei ist die Landkarte, auf der die Worte prangen: »Hic sunt Dracones« – hier sind Drachen! Eine Warnung, die beachtet werden sollte. Sonst kann es passieren, dass wir im Hort eines Drachen landen, auf einer einsamen Insel oder in einem Wurmloch, verloren in Zeit und Raum.
33 phantastische Reiseberichte machen das Reisen durch Welten, Zeiten und Ebenen zu einer Herausforderung, aber seid gewiss, noch haben wir immer den Heimweg gefunden.
Die Münchner Schreiberlinge e.V.
sind ein Verein von engagierten, aufgeschlossenen Autor*innen.
Kennengelernt haben wir uns in Schreibkursen, Leserunden, Buchveranstaltungen und treffen uns seit Anfang 2017 regelmäßig einmal die Woche zum gemeinsamen
Austausch, Schreiben und Lesen.
Einige von uns haben bereits Bücher veröffentlicht, andere schreiben nur für sich und genauso vielfältig wie wir sind auch unsere Texte und Genres. Mehr zu uns und unseren Aktivitäten findest du in den Social Media. Hast du einen Bezug zu München und möchtest dich uns anschließen oder uns unterstützen? Hier findest du alle Informationen zu unserem Verein: www.muenchner-schreiberlinge.de
Dieses Buch enthält Inhaltswarnungen / Content Notes auf der letzten Seite gegenüber der Deckel-Innenseite. Siehe auch:www.muenchner-schreiberlinge.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Neopronomen
Dr. Carsten Gerhard
Essay: Ubi sunt dracones?
Marie Mönkemeyer
Hier gibt es Drachen
Cornelia Schulz
Wyvern und ihre (Un)Arten
Maria Seychaska
Terra Draconis
Saskia Dreßler
Der Preis der Neugierde
Serenity Amber Carter
Die Legende vom Goldenen Drachen
Britta Redweik
Zusammenkunft
Ronja Schrimpf
Auf der Suche nach der Menschlichkeit
Felicity Green
Drachenblut
Lukas Vautz
Aber Drachen gibt es doch gar nicht…
Roxane Bicker
Sphärenklänge
Sarah Malhus
Die OMAN-Gesellschaft
Helen Obermeier
Der einsame Berg
Natascha Eschweiler
Von Höhlen und modernen Drachen
E. S. Schmidt
Dracones.net
Manuela Krämer
Tabula Draconis, Münchner Ausgabe
Julian Gräml
Das Dorf der Drachen
Andreas Jung
Es gibt hier keine Drachen
Tala Jacob
Der Heilige Hain
Alisha Pilenko
Medusas Schlangenfrisur
Abdullah Doubli
Die Stadt unter der Stadt
Jon Barnis
Behind the doors
Iva Moor
Filix’ Knochen
Lena Richter
Wandel
Tino Falke
Der Weg nach El Hurrado
Dani Aquitaine
Echt
Michael Leuchtenberger
Wo ist Lex?
Iris Läster
Vom Leben in der Stadt
Francis Behrend
Herz aus Tinte
Juliane Weigel-Krämer
Am Ende finde ich dich
Isabell Hemmrich
Horror vacui
Lily Magdalen
Statt Knoblauch
Sophie Jenke
In den Tiefen
Stefan Khun
Intensive Intrigen
Danksagung
Die Autor
*
innen
Tags zu den einzelnen Geschichten
Inhaltswarnungen / Content Notes
Vorwort
Reisen heißt entdecken. Seit tausenden von Jahren gingen Menschen auf die Reise und schrieben dabei auf, was sie sahen und erlebten. Diese Berichte kann man noch heute lesen oder weiß zumindest von ihrer Existenz, zum Beispiel Pytheas von Massalia, der bis an die Grenzen der damals bekannten Welt reiste – und darüber hinaus.
In der jetzigen Zeit fällt es schwer, noch unbekannte Ecken auf unserem Planeten zu finden. Mit Google Earth können wir binnen Sekunden von New Yorks Straßen in das Empty Quarter springen, um anschließend im Pazifik kleinste Inselgruppen zu betrachten.
Wir wollten Neues aufspüren, durch die Augen anderer Welten sehen, die wir noch nicht kennen. Und so gingen wir auf die Suche und kamen mit 33 Geschichten zurück. 33 phantastische Reiseberichte, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch eine Sache in sich vereinen – eine Karte.
Die Reiseroute ist berechnet. Bitte folgen und nicht die Hände aus dem Wagen halten!
Neopronomen
Einige der Geschichten in dieser Anthologie nutzen Neopronomen– vielleicht wirst du darüber stolpern, deswegen sei an dieser Stelle kurz erklärt, was es damit auf sich hat.
Neopronomen (neue Pronomen) sind Wortschöpfungen zur geschlechtsneutralen Ergänzung der rein binären Pronomen »sie« und »er«.
Vorreiter hierfür war Schweden, wo bereits 1966 als geschlechtsneutrales Pronomen »hen« neben »hon« (m) und »han« (f) vorgeschlagen wurde und sich in den letzten Jahren so etabliert hat, dass es mittlerweile auch seinen Platz in Gesetzestexten findet. Auch das Englische bietet mit »they« ein neutrales Pronomen, das in der Singularform schon lange benutzt wird, um Menschen zu bezeichnen, deren Geschlecht unbekannt ist oder denen man keines zuweisen möchte.
In der deutschen Sprache ist es nicht ganz so einfach, eine einheitliche Lösung zu finden – wir befinden uns noch im Stadium des Experimentierens und erst die Zukunft wird zeigen, welche Variante sich durchsetzt.
Gebräuchliche Neopronomen sind: they, dey, sey, es, sier, xier, zae
Weitere Informationen zu Neopronomen gibt es bei
Illi Anna Heger (annaheger.de/pronomen) oder im
Nichtbinär-Wiki (nibi.space/pronomen)
Dr. Carsten Gerhard
Ubi sunt dracones?
I
Die Kartographen des Mittelalters hielten Drachen, Monster und anderes ungeheure Fabelgetier für immerhin so real, dass sie ihre Lebensräume auf Land- und Seekarten festhielten. Der »Hic sunt dracones«-Schriftzug, welcher der vorliegenden Anthologie seinen Namen gab, stammt von einem frühneuzeitlichen Globus, dem Hunt-Lenox-Globus, 1504. Doch das ist nur eines von zahlreichen Beispielen für die Erfassung von Drachen bei der mittelalterlichen Weltbeschreibung. Auf der berühmten Ebstorfer Weltkarte, der größten bekannten mappa mundi des Mittelalters, die rund zweihundert Jahre älter ist als der Hunt-Lenox-Globus, haben die Kartographen neben Ländern, Flüssen und Städten mit ihren Sehenswürdigkeiten auch verzeichnet, wo etwa die menschenfressenden Ungeheuer Gog und Magog leben – am kaspischen Meer im Nordosten, sicher verwahrt hinter Mauern, wo sie nach einer mittelalterlichen Erzählung Alexander der Große eingesperrt hatte. Gog und Magog, die Unheilbringer der biblischen Apokalypse, werden im europäischen Mittelalter mal als Monster, mal als feindliche Heerscharen vorgestellt. In den Alexanderromanen, die nach Überlieferungslage der meistgelesene weltliche Stoff im deutschen Mittelalter waren, wird berichtet, wie der antike Welteroberer Alexander der Große Gog und Magog bezwingt und hinter festen Mauern einsperrt. Die literarische Überlieferung war für die Kartographen der Ebstorfer Weltkarte so relevant, dass sie auf ihrer Weltkarte eben jenen Ort bezeichneten, wo die Ungeheuer Gog und Magog hinter Mauern gefangen waren.
Heilsgeschichtliche Überzeugungen, religiöse Weltdeutung und objektivierbares Orientierungswissen sind in der mittelalterlichen Kartographie vermengt. Gleiches gilt für Reisebeschreibungen dieser Zeit. Marco Polos Bericht von seiner Reise in den fernen Osten etwa überliefert detailliertes Faktenwissen über China und das Mongolenreich genauso wie magisch-abenteuerliche Begebenheiten. Solche wundersamen Vermischungen haben Zweifel daran genährt, ob der Weltenfahrer tatsächlich in China gewesen ist, wofür aber doch viele Kenntnisse sprechen, die Marco Polo nach heutigem Wissensstand nur aus eigener Anschauung erlangt haben konnte. Und so wie die Ebstorfer Kartographen Gog und Magog als real vorstellen, so berichtet auch Marco Polo von furchteinflößenden Drachen, die man in der chinesischen Provinz Caragian gewärtigen müsse. In Kapitel 118 beschreibt er ein zehn Schritt langes und zehn Palmen großes Monster, mit zwei Vorderbeinen, einem Löwenkopf und einer Nase wie ein Brot.
Irritiert den neuzeitlichen Menschen dieses Nebeneinander von Fiktion und Faktenwissen, so waren noch für Christoph Kolumbus Marco Polos Reisebeschreibungen eine vertrauenswürdige Quelle. Er besaß ein Exemplar von Il Milione, das er vielfältig mit Anmerkungen versah. Dieses selbstverständliche Nebeneinander von Fiktion und empirisch-objektivierbaren Daten in Reiseberichten sowie Kartenwerken zeigt, wie wichtig der mittelalterlichen Weltdarstellung die Absicherung von mündlicher und schriftlicher Überlieferung war. Sie stand gleichberechtigt neben Erfahrungs- und objektivierbarem Wissen.
II
Drachen erscheinen in der antiken und mittelalterlichen (auch außereuropäischen) Literatur und Kunst in vielen Formen. Meistens sind sie reptilienartige Tiere, immer wieder wird der Drache auch synonym als Schlange bezeichnet. Dabei haben Drachen zum Beispiel Flügel, können Feuer speien und sind oft todesgefährlich. Häufig werden sie, zumindest in westlichen Kulturkreisen, als Verkörperung des Bösen schlechthin oder als Chaosbringer gekennzeichnet (wobei es auch andere Zuschreibungen gibt).1 Sie stellen eine ominöse Bedrohung in einer gefahrvollen und komplexen Welt dar. Dem Drachen gegenüber steht der Held: Ob Siegfried, Alexander der Große, Dietrich von Bern oder der heilige Georg – viele mittelalterliche Helden bezwingen Drachen. Der Held ist ein gleichsam notwendiges Gegenstück zum Drachen, sein Bekämpfer und Bezwinger, und das nicht erst im Mittelalter, sondern schon in der Antike. Der mittelalterliche Held wird häufig durch einen Drachenkampf überhaupt erst initiiert. So übt der Held Schutz gegen die Bedrohung aus, besiegt das chaosbringende Untier und sichert damit die (Welt-)Ordnung.
III
Die Aufklärung erfasst, vermisst und vernetzt systematisch die Welt. Die Reiseberichterstattung leistet einen maßgeblichen Beitrag dazu. So liegen Reiseberichte auf der Rangliste der Buchproduktion im 17. und 18. Jahrhundert ganz weit vorn. Es ist ein Projekt der europäischen Aufklärung, durch die Summierung von Reiseberichtenso etwas wie eine Weltenzyklopädie zu erstellen. Die Bildungsreise sowie die öffentliche Berichterstattung darüber in Buchform wird gleichsam eine Verpflichtung für die Teilnehmenden am Projekt der europäischen Aufklärung, an dem auch Frauenmitwirken. So gehören zu den prominenten Reiseberichten des 18. Jahrhunderts aus der Türkei die Turkish Embassy Letters von Lady Mary Montague, die von 1716 bis 1718 in der Türkei und in Nordafrika als Gattin des englischen Gesandten lebt und in feinfühligen, kulturell ausgesprochen aufgeschlossenen Briefen in die Heimat von ihren Erlebnissen in der orientalischen Ferne berichtet.
Die aufgeklärte Reise führt in alle Welt. Die zentralen Geburtsund Gewährsstätten abendländischer Kultur in Italien sind besonders prominente Reiseziele, aber man reist auch in den Osten, nach Moskau, St. Petersburg, selbst nach Sibirien, nach Skandinavien, nach Griechenland natürlich, in die Türkei und den Orient. Georg Forsters Bericht von seiner Weltreise mit James Cook ist ein echter Bestseller, und auch Alexander von Humboldt legt von seiner bahnbrechenden Forschungsexpedition nach Südamerika selbstverständlich einen Reisebericht vor.
Drachen und drachenbezwingende Helden haben in diesen Reisebeschreibungen keinen Platz mehr. Die Welt ist vermessen und katalogisiert, Drachen wurden dabei keine gefunden. So wandelt sich der Drache nun zum Spektakel- und Abenteuerelement. Mozarts Zauberflöte beginnt 1791 sensationsbewusst und effektreich mit dem Auftritt einer Drachenschlange. Auch ist es nicht mehr ein starker Held, der das Untier bezwingt (der Held in der Zauberflöte fällt vielmehr aus Schreck vor dem Drachen erst einmal in Ohnmacht). Tamino wird sein Heldentum erst später beweisen, wenn er Sarastros Prüfungen durch Tugendhaftigkeit, Beständigkeit und Weisheit besteht: Der aufgeklärte Held besticht durch andere Tugenden und Taten als das Bezwingen von Drachen. So dauert es auch nicht mehr lange, bis Georg Wilhelm Friedrich Hegel den Helden an sich für historisch obsolet erklärt: »Im Staat kann es keine Heroen mehr geben, diese kommen nur im ungebildeten Zustande vor.«2 In einem aufgeklärten, auf Freiheit, Gleichheit und Recht aufgebauten Staatswesen braucht es den Helden als Garanten von Ordnung nicht mehr, so Hegel.3 Ohne Helden aber verliert auch der Drache seinen Schrecken und schrumpft schließlich auf die Größe einer Kokosnuss.4
IV
Zum Ende des 18. Jahrhunderts, als die Vermessung der Welt noch in vollem Gange ist, zieht der Mensch zunehmend auch aus,um beim Reisen nicht nur die Ferne, sondern sich selbst zu entdecken. Die bereiste Welt präsentiert sich zunehmend nicht mehr nur als Gegenstand vernünftiger Erfassung, sondern wird zur subjektiven Projektionsfläche ästhetischer Wahrnehmungen. Besonders eindrücklich lässt sich diese Ästhetisierung des Reisens an den deutschen Italienreiseberichten ablesen. Wie von Raffael gemalt erscheinen nun die Italienerinnen, die Beleuchtung des Himmels wie bei Lorrain oder Poussin, den locus amoenus erlebt das Subjekt als eine Erfüllung von horazischer Dichtung – Italien wird zum Sehnsuchtsort einer ästhetischen Grundhaltung, die sinnliches Erleben als Weltzugang legitimiert.
An der Ästhetisierung Italiens hat übrigens die Italienische Reise Goethes, der bis heute wohl prominenteste und meistgelesene deutsche Reisebericht, weniger Anteil als es das Klischee will. Zwar gibt es kaum einen Italienreisebericht der letzten zweihundert Jahre, der nicht en passant auch auf Goethes Reisebeschreibung Bezug nimmt. Tatsächlich ist aber der ästhetische Italienmythos eher im Zusammenwirken von Landschaftsmalerei und romantischer Italienliteratur (Bekenntnisse eines Klosterbruders, Titan, Sentimental Journey, Ardinghello etc.) geschaffen worden, als in Goethes Italienischer Reise stilbildend vorgeprägt. Im Gegenteil: Der alte Goethe, der die rund 30 Jahre alten Reisenotizen zur »Italienischen Reise« redigierte (das Werk wurde 1813 – 1817 redaktionell aus den alten Reisenotizen erstellt, die Reise selbst war in den Jahren 1786 – 1788 erfolgt), machte seinen Reisebericht eher zu einer Reflexion über die Möglichkeiten objektiver Weltwahrnehmung, anstatt zu einem Modell ästhetisierter Italiendarstellung. Insofern fällt das Werk aus der typischen Italienreisebeschreibung des 19. Jahrhunderts heraus und bleibt eher ein Exot. Die Bestätigung der eigenen Existenz als ästhetische bleibt dagegen ein zentrales Moment deutscher Italienreiseberichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis Rolf Dieter Brinkmann den Topos vom ästhetischen Lustort in »Rom, Blicke« (1979) unbarmherzig dekonstruiert. Doch auch wenn Brinkmann die Schönheit Roms zerschlägt–Drachen gibt es auch bei ihm nicht.
V
Wo sind die Drachen hin? Spätestens in der Corona-Pandemie hat die Öffentlichkeit eine verschwörungstheoretische Erzählung kennengelernt, nach der eine Schar außerirdischer Reptilien Menschengestalt (»Reptiloide«) angenommen habe und die Unterwerfung der Menschheit anstrebe.5 Reptiloide? Hic sunt dracones. Das echsenartige Wesen als Inkarnation des Bösen taucht unvermittelt wieder auf. Fast könnte man eine anthropologische Konstante vermuten – die böse Echse erscheint Menschen dort, wo die Welt als chaotisch (Chaos als Chiffre des Drachen) und diffus unheilschwanger wahrgenommen wird. Zur Wiederherstellung der Ordnung braucht es in einem solchen Weltzustand nach antagonistischer Logik einen Helden. In der Erzählung von den außerirdischen Reptiloiden ist dieser schon entsprechend ausgemacht, auch wenn er mittlerweile sein Amt eingebüßt hat: Donald Trump, ein Zwerg, der in abstrusen Heldengeschichten zu mythologischer Größe aufgeblasen wird. Heute muss man Drachen wegen ihrer vermeintlichen Bezwinger fürchten.6 Geholfen haben schon einmal: Vernunft und Verstand, Aufklärung als ein menschenfreundliches Projekt.
1 Timo Rebschloe, Der Drache in der mittelalterlichen Literatur Europas, Heidelberg,Universitätsverlag Winter, 2014
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Werke, Bd. 7, Frankfurt/M. 1986, S. 180.
3 Der Philosoph Dieter Thomä hat 2019 dafür plädiert, dass auch Demokratien ihre Helden brauchen. Der Soziologe Ulrich Bröckling dagegen bleibt bei der Absage ans Heldentum, vor allem aus Sorge vor Missbrauchbarkeit. In der Neuen Rundschau (Heft 1/2021) treten sie in eine briefliche Diskussion über ihre unterschiedlichen Perspektiven auf heutiges Heldentum. Dieter Thomä, Warum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus, Berlin 2019; Ulrich Bröckling, Postheroische Helden – Ein Zeitbild, Berlin 2020; Ulrich Bröckling und Dieter Thomä, Warum Helden? Ein Disput in Briefen, in: Die Neue Rundschau, 132. Jahrgang Heft 1, Frankfurt/M 2021, S. 7-27
4 In der Kinderbuchserie »Der kleine Drache Kokosnuss« ist ein kleiner Drache selbst Held vieler Abenteuer.
5https://www.galileo.tv/life/verschwoerungstheorie-kontrollieren-reptiloidedie-welt (abgerufen am 27.8.2021) und https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/chemtrails-reptiloide-eine-ex-verschwoerungstheoretikerinberichtet-15267921.html (abgerufen am 27.8.2021)
6 Übrigens sahen viele Zeitgenossen auch in Hitler einen »modernen Drachentöter«, wie der Historiker Heinrich August Winkler ausführt. Die ZEIT vom 10.4.1981, »Vom Drachentöter zur Droge«, Heinrich August Winkler, (https://www.zeit.de/1981/16/vom-drachentoeter-zur-droge/seite-2, Heinrich August Winkler)
Marie Mönkemeyer
Hier gibt es Drachen
Corussa riss die Tür der Studierstube auf. »Ich weiß jetzt, was ich kartografieren will.«
Im Lehnstuhl sah Magistra Petingra von ihrer Lektüre auf. »Guten Abend, Corussa. Ich nehme an, du sprichst von deinem Wunsch, in die Gilde aufgenommen zu werden?«
Selbstverständlich wusste Corussas Lehrerin, worum es ging. Schließlich lag ihre Schülerin allen in der Kartografierschule seit Wochen damit in den Ohren, wenn sie nicht arbeitete oder in der Kartothek nach etwas suchte, das sich als Aufnahmeprüfung in die angesehenste Gilde des Königreichs eignete.
»Ja.« Corussa streckte Magistra Petingra die beiden Kartenrollen hin: die aus dem Lehrregal und die, die sie vor drei Tagen im letzten Regal hinten links im oberen Kartensaal entdeckt hatte. »Hier, das ist völlig veraltet.«
Magistra Petingra legte das Buch zur Seite und stemmte sich hoch. »Dann zeig doch mal her.«
Corussa drehte die Lampe am Kartentisch höher und legte die beiden Rollen auf den Tisch, bevor sie ansetzte, die ältere möglichst behutsam auszurollen. Verflixt, fast hätte sie die Handschuhe vergessen! Sie zerrte an dem feinen Stoff, um ihn möglichst schnell über die Finger zu bekommen.
»Eins nach dem anderen«, sagte Magistra Petingra so beruhigend wie am erstem Tag der Ausbildung, als Tinte, Papier und Federmesser noch in weiter Ferne lagen.
Bei dem vertrauten Satz musste Corussa lächeln und atmete tief durch. Hektik stand einer Kartografin nicht gut zu Gesicht und führte nur zu Tintenflecken und Fehlern in der Karte. »Entschuldigt, Magistra.«
Ihre Lehrerin winkte ab. »Zeig mir einfach, was du hast.«
Vorsichtig rollte Corussa das ausgetrocknete Pergament auf dem Tisch aus. Mit angespannten Fingern strich sie über den verheißungsvollen Schriftzug, der das Ende ihrer Ausbildung und ihre Aufnahme in die Kartografiergilde sicherstellen könnte:
HIER GIBT ES DRACHEN
»Hm«, machte Magistra Petingra.
Die wenig enthusiastische Reaktion weckte Corussas Trotz. Sie wusste seit dem ersten Jahr in der Kartografierschule, dass der Hinweis auf Drachen früher bedeutet hatte, dass dort unbekanntes Gebiet lag oder Gefahren lauerten. Außerdem waren Drachen längst ausgestorben. Aber sie war ja noch gar nicht fertig!
»Ich weiß, was das früher hieß. Das hier …« Corussa rollte die zweite mitgebrachte Karte auf und klopfte auf das Papier. »… ist dieselbe Stelle auf einer neueren Karte. Aber keine Spur von irgendeiner Gefahr, nur ein paar langweilige Berge.«
Magistra Petingra seufzte. »Du weißt doch, nicht alle Warnungen waren berechtigt. Manchmal gab es dort nur langweilige Berge.«
»Ja«, murrte Corussa. Seit Gründung der Gilde vor 241 Jahren waren viele dieser metaphorischen–und angeblich auch ein paar echte–Drachen von den Karten verschwunden. Doch ein Gefühl sagte ihr, dass es dort mehr geben musste, wenigstens ein paar Klippen oder einen Wasserfall. Nicht einmal die Berge schienen Besonderheiten zu haben! »Aber was, wenn es anders ist? Wenn es doch etwas Gefährliches gibt?«
Magistra Petingra zog die linke Augenbraue hoch.
Corussa strich das geschwungene D von Drachen mit dem Finger nach und sortierte gedanklich noch einmal ihre Argumente. Wenn sie in die Gilde wollte, musste sie ihre Lehrmeisterin überzeugen. »Ich glaube, dass dort mehr als nur ein paar Berge sein könnten. Nicht unbedingt Gefahren, aber irgendetwas, das abwechslungsreicher ist als nur diese mickrigen Felsen hier. Deswegen will ich die Region erkunden und kartografieren und ich hoffe, dass das Ergebnis ausreicht, um in die Gilde aufgenommen zu werden. Denn selbst wenn es nur Berge gibt–was gut möglich ist –, könnten diese doch etwas gründlicher dokumentiert werden als hier.« Sie klopfte auf die armseligen Dreiecke, die irgendjemand mit schlampigem Pinselstrich auf die jüngere Karte gezeichnet hatte.
»Du glaubst?« Magistra Petingras Frage klang so trocken wie das Pergament der alten Karte.
»Ja, es ist so ein Gefühl.« Unter dem skeptischen Blick der Magistra begann es jedoch wie schlechte Tinte zu verblassen. »Aber vielleicht sind es auch nur Berge.«
Magistra Petingra nahm sich viel Zeit für die Betrachtung der beiden Karten, die Entscheidung für eine Aufnahmeprüfung in die Gilde musste schließlich wohl überlegt sein. Dennoch zupfte Corussa ungeduldig an ihren Handschuhen herum, sie konnte es kaum erwarten, ihre Sachen zu packen und aufzubrechen – oder auf der Suche nach neuem Prüfungsmaterial wieder in der Kartothek zu verschwinden.
Nach einer gefühlten Ewigkeit richtete sich die alte Kartografin wieder auf. »Also gut. Ich glaube nicht, dass dort etwas gefährliches ist, aber du hast recht, was die neuere Karte angeht. Diese hier könnte etwas Überarbeitung vertragen, darum werde ich deinen Vorschlag der übrigen Gildenleitung vortragen. Du kannst dich also auf den Weg machen. Solltest du in der vorgegebenen Frist eine neue, detailreichere Karte dieser Region vorlegen, werde ich sie prüfen und der Gildenleitung einen entsprechenden Vorschlag machen.«
»Danke!« Corussa strahlte. Jetzt hatte sie ein Jahr und einen Tag Zeit, um die wichtigste Karte ihres Lebens anzufertigen.
Corussa richtete den Blick nach oben, wo sich die Gipfel den Wolken entgegen streckten. Ein einzelner Greifvogel kreiste seit dem Mittag immer wieder träge am Himmel, doch die Flügelform und der merkwürdig schmale Schwanz waren ihr fremd. Die Kartografin kniff die Augen zusammen, um mehr zu erkennen, vielleicht eignete er sich als Randzier ihrer Aufnahmeprüfung. Doch der Vogel war zu weit weg.
Also betrachtete Corussa noch einmal die Form der Gipfel, um sie dann auf der Wachstafel in die Kartenskizze einzutragen. Platz gab es dafür allerdings längst nicht mehr und so quetschte sie eine Miniaturversion der Felsen in die freie Fläche des Sees, an dem sie vorgestern vorbeigekommen war. Sie musste endlich alles in die Karte eintragen, bevor sie trotz ihrer Beschriftungskürzel vergaß, wie genau die einzelnen Teile der Skizze zusammengesetzt wurden. Nicht, dass nachher der Wasserfall aufwärts lief, einen Fehler durfte sie sich nicht erlauben. Vor fünf Tagen war sie im letzten Dorf gewesen, seit gestern wurden die Bäume selten, entsprechend gering war ihre Hoffnung, hier oben noch auf eine Schäferhütte oder gar eine Siedlung zu stoßen. Aber morgen sollte doch wenigstens eine ruhige Felsnische oder vielleicht sogar eine kleine Höhle zu finden sein. Der Ort musste nicht einmal besonders groß oder bequem sein, Hauptsache so windgeschützt, dass sie ein paar Federstriche auf das Papier bringen konnte.
Corussa schrieb das aktuelle Datum und die entsprechenden Kartenkürzel neben die winzigen Felsen und verstaute die Tafel mit der kostbaren Skizze sorgfältig in der Schutzhülle. Morgen wartete die nächste Etappe. Sie wollte noch weiter nach oben, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Schließlich sollte ihre Karte diese abgeschiedene Region so wahrheitsgetreu und detailreich wie möglich abbilden und ihr die Aufnahme in die Gilde und damit ihre berufliche und gesellschaftliche Zukunft sichern. Davor warteten noch ein paar unbequeme Nächte unter selbst gebauten Schutzdächern aus Zweigen und Zeltplane auf sie, aber das war es wert.
Der Morgen kam grau und zu früh. Wolldecke und Kleidung waren klamm und das harte Brot erinnerte Corussa daran, wie sehr sie warmes Frühstück vermisste. Der Wind wehte von den schneebedeckten Gipfeln herunter und flüsterte vom Aufgeben.
»Nein!«, sagte Corussa laut. Wenn sie einmal in der Gilde war, konnte sie sich aussuchen, für wen sie welche Karten erstellte. Keine Auftragsarbeiten mehr im Namen ihrer Kartografierschule oder hundert Kopien desselben Waldstücks. Wer weiß, vielleicht würde sie sogar bei einer Entdeckungsreise oder in einer der Burgen als Hofkartografin anheuern. Bei ihrem Aufbruch hätte sie sich noch für eine Expedition entschieden, doch nach vier Monaten Reise erschienen ihr gemütliche Tage in einer Kartothek zwischen Pergament, Papier und Tintenfässern viel attraktiver. Aber erst brauchte sie diese Karte!
Corussa seufzte, packte ihre Sachen zusammen und machte sich erneut auf den Weg.
Der Greifvogel war nicht zu sehen, stattdessen krochen die grauen Wolken zunehmend von den Gipfeln herab und hüllten die Kartografin ein. Mit ihnen nahm der Wind zu. Er raunte und jaulte zwischen den Felsen, lockte mit der Aussicht auf Suppe und eine warme Decke in einem Gasthaus im Tal und drohte zugleich mit dem Sturz in steile Schluchten oder einem einsamen Tod im Geröllfeld. Er riss an Corussas Kleidung, und wären die Vorläufer ihres Kartenrucksacks nicht auf zahllosen Expeditionen erprobt worden, hätte eine heftige Bö ihr längst das Gepäck vom Rücken gezerrt. Corussa stemmte sich gegen den Wind, von etwas schlechtem Wetter ließ sie sich doch nicht aufhalten!
Die Wolken legten sich zwischen die aufragenden Felsbrocken und krummen Sträucher und türmten sich langsam zu feuchten Dunstgebirgen auf. Während der Wind angriffslustig heulte, als wollte er Corussa vertreiben, ging der Nebel heimlicher vor. Ganz langsam verhüllte er immer mehr vor der Kartografin, die nicht darauf achtete, dass ihre sichtbare Welt Schritt um Schritt schrumpfte.
Corussa blieb nur kurz stehen, um die Kapuze hochzuziehen, bevor sie weiterstapfte. Solange es unter ihren Füßen aufwärts ging, befand sie sich auf dem richtigen Weg. Das bisschen Nebel konnte ihr nichts anhaben!
Die Felswand bemerkte sie erst, als sie fast dagegen stieß.
Mit einem tiefen Seufzer stützte sich Corussa gegen den kalten, nassen Stein. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand! Eine Felswand hatte sie heute morgen nicht auf ihrem Weg gesehen. Also war sie im Nebel irgendwo abgebogen, aber in welche Richtung und wann? Es kam ihr vor, als liege der Morgen Stunden zurück, aber die Wolken verbargen Welt und Himmel und damit jeglichen Hinweis.
Eins nach dem anderen.
Corussa sah sich um. Graue Schwaden und Geröll in die eine Richtung. Graue Schwaden und Geröll in die andere Richtung. Nach drei Federlängen verschwammen Stein und Dunst miteinander zu einer unsicheren, wogenden Flut. Wann war der Nebel eigentlich so dicht geworden?
»Bücherwürmer und Tintenfresser!« Ihr Fluch klang kaum weiter als ihr Blickfeld.
Eine Kartografin verlief sich nicht! Sie ging sorgfältig und systematisch vor, damit genau das nicht passierte. Trotzdem stand sie hier unerwartet vor der Felswand und fühlte sich so verloren wie Papier neben einem umgestürzten Tintenfass. Das hätte nicht passieren dürfen! Sie hatte sich zu sehr beeilt, nicht mehr auf ihren Weg geachtet und dann noch dieser verdammte Nebel!
Corussa seufzte schwer. Hier, direkt vor einer feuchten Steinwand, konnte sie nicht bleiben. Sie musste weiter, irgendwohin. Vielleicht gab es eine Felsnische oder ein paar der krummen Bäume, wo sie auf besseres Wetter warten konnte. Dann würde sie ihren eigentlichen Weg wiederfinden.
Aber noch einmal durfte sie sich nicht verlaufen, also hielt sie sich an der Felswand fest wie an einer Windrose und setzte langsam einen Schritt vor den anderen.
An der Bergwand bot sie dem Wind weniger Angriffsfläche, dafür schlug er ihr immer wieder einzelne Wolkenwirbel ins Gesicht. Corussa stapfte verbissen weiter. Sie musste in Bewegung bleiben. In die nächste Nische würde sie sich vielleicht setzen, ausruhen und hoffen, dass es bald aufklarte. Aber noch nicht jetzt.
Die feste Wand unter Corussas Fingern wich zurück und verschwand vor ihr im graublauen Schatten. Schwarzer Fels, ein Überhang, ein Gebüsch oder doch nur eine düstere Nebelwolke?
Corussa wollte vorsichtig sein, die scheu aufflackernde Hoffnung schützen wie kostbare Goldfarbe, doch ihre Schritte wurden schneller.
Es war eine Höhle!
»Allen Mächten sei Dank!« Ohne zu zögern tauchte Corussa in den tintendunklen Eingang und ließ sich auf den Boden fallen. Wind und Nebelwolken blieben hinter ihr zurück, stattdessen umhüllte sie die Dämmerung der Grotte wie eine nächtliche Kartothek.
Corussa atmete tief durch, bis sie sich nicht mehr wie ein zu stark gespanntes Pergament fühlte, dann zog sie den Rucksack herunter. Ohne den Nebel erschien jedes ihrer Geräusche laut.
Gestern Abend hatte sie sich noch eine Höhle gewünscht und jetzt hatte sie durch Zufall eine entdeckt. Sie lachte auf. Erst verlief sie sich und dann stolperte sie fast über die ideale Gelegenheit, weiter an der Karte zu arbeiten. Das würde ihr niemand glauben! Aber sie konnte sich keinen besseren Ort vorstellen um abzuwarten, bis der Nebel dünner wurde.
Also, wenn es hier keine Raubtiere gab. Corussa lauschte und spähte in die dämmrige Tiefe, doch außer ein paar Felsbrocken konnte sie nichts erkennen. Sie war allein und hatte sämtliche Gefahren durch Wind und Nebel draußen zurückgelassen. Begeistert rieb sie sich die steifen Finger und packte aus. Endlich wieder zeichnen!
Im warmen Licht der Lampe sah die Höhle gleich noch etwas gemütlicher aus. Corussa arrangierte die Wachstafel und das metallene Reisetintenfass auf einen der Felsbrocken und überprüfte die Feder.
Vor dem Höhleneingang raschelte es. Sicher der Wind. Sie streckte und bog die Finger, um sie richtig aufzuwärmen und zog die weichen Kartenhandschuhe aus dem Gepäck.
Es raschelte erneut und dann kratzte etwas über den Stein.
Hatte der Wind einen Ast herein geweht? Corussa sah sich um und erstarrte.
Im Höhleneingang stand ein Drache.
Sie kniff ungläubig die Augen zusammen, doch als sie sie wieder öffnete, war das Wesen immer noch da.
Kaum größer als ein Kalb, doch die graublauen Schuppen, die gefalteten Flügel, der längliche Kopf mit Hörnern und der schlanke Schwanz … es musste ein Drache sein!
»Aber …« Corussa starrte die Kreatur an, während ihr langsam die Handschuhe aus den zitternden Händen glitten. Fing sie jetzt schon an zu halluzinieren? Vielleicht die Höhenluft? »Aber…es gibt doch gar keine Drachen …«
»Willst du damit sagen, es gibt mich nicht?«, fragte der Drache empört mit einer Stimme wie ein wilder Gebirgsbach.
»Ähm …« Corussa wusste nicht, was sie sagen sollte, in ihren Gedanken ging es zu wie in einer unaufgeräumten Kartothek. Das Wesen vor ihr wirkte sehr real. Aber die letzten Drachen waren doch vor 87 Jahren erschlagen worden. Und seit wann konnten sie sprechen und waren sie nicht viel größer?
»Es gibt mich nämlich sehr wohl.« Der Drache machte zwei Schritte in die Höhle hinein, seine Krallen kratzten über den Fels.
Corussa klappte den Mund zu, während ihre Fassungslosigkeit langsam einem triumphierenden Gedanken wich: Sie hatte Recht gehabt, ihrem Gefühl zu vertrauen! Der Hinweis auf der alten Karte stimmte. »Hier gibt es Drachen.«
»Ja«, sagte der Drache zufrieden. »Jetzt ist es angekommen.«
»Ich dachte nur, sie wären größer.« Corussa war immer noch nicht sicher, ob sie mit dem Drachen wirklich sprechen konnte.
»Hast du mich gerade klein genannt?« Ein Nebelwölkchen stieg aus den dunkelblauen Nüstern des Drachen. »Ich bin schon 70!«
»70?« Der Drache war doppelt so alt wie sie! Und ganz offensichtlich war er real und konnte sprechen. Selbst bei schlimmster Höhenkrankheit oder nach einer ganzen Flasche billigstem Vogelbeerschnaps würde sie sich keinen Drachen einbilden, der meckerte, weil man ihn für zu klein hielt.
»Ja. Damit bin ich wirklich kein Schlüpfling mehr!« Der Drache unterstrich seine Worte mit einer weiteren Nebelwolke.
»Wie alt werden Drachen denn?«, fragte Corussa langsam. Sie hatte keine Ahnung, was ein Schlüpfling war oder ob sie sich überhaupt mit dem Drachen unterhalten wollte. Aber interessant war es schon irgendwie, solange sie nicht als Abendmahlzeit endete …
»So 300. Wenn nicht irgendein stinkender Drachentöter auftaucht.«
Stinkend? Drachentöter waren große Helden! Also, zumindest hatte Corussa das bisher gedacht, so stand es in den Folianten der Historie und so wurde es kleinen Kindern erzählt.
»Also bin ich nicht mehr klein, sondern komplett ausgewachsen. Aber du hast offenbar noch nie einen Drachen gesehen.«
Corussa nickte. Drachen waren ausgestorben, sie kannte sie nur von alten Karten und Reliefen an Denkmälern, und das waren riesige, feuerspeiende Ungeheuer – keine hüfthohen, geflügelten Echsen in Plauderlaune.
»Menschen sind hier auch selten«, sagte der Drache großzügig.
»Ich weiß.« Schließlich war das einer der Gründe, warum Corussa diese Gegend erkundete.
Der Drache reckte den langen Hals und betrachtete die Wachstafel. »Den Wasserfall kenne ich.«
»Danke.« Corussa lächelte. Hatte er gerade ihre Arbeit gelobt?
»Wie eine Drachentöterin oder Hirtin siehst du nicht aus, also was machst du hier?«
»Ich bin Kartografin.«
Er wandte den Kopf von den winzigen Bergen im Wachs ab und Corussa zu. »Du machst eine Karte von den Bergen hier?«
»Ja.« Die Details über die Aufnahme in die Gilde sparte Corussa sich, sie bezweifelte, dass er das verstehen würde.
»Puh!« Er stieß eine kleine Wolke Nebel aus. »Das klingt gefährlich.«
»Gefährlich?« Jetzt war Corussa empört. »Kartografie ist Kunst! Es geht darum, die Welt so wahrheitsgetreu abzubilden wie möglich. Dann können andere mit diesen Karten reisen oder Streitigkeiten lösen oder einfach nur erfahren, wie es auf der anderen Seite eines Gebirges aussieht.«
»Also bin ich dann auf deiner Karte?«
»Ich werde auf meiner Karte eintragen, dass es hier Drachen gibt, selbstverständlich.« Was Magistra Petingra dazu sagen würde, wollte sich Corussa lieber nicht ausmalen, aber ihr Berufsstolz verlangte nach Wahrheitstreue. Und vielleicht würde ihr der Eintrag des Drachen auch eine glänzende Karriere sichern!
»Sag ich doch, gefährlich.« Der Drache klang verärgert. »Dann kann jeder Drachentöter das Ding nehmen und hierher kommen und dann werden wir alle sterben!«
»Aber ihr könnt euch doch wehren, Feuer spucken und so. Das kommt doch in jedem Bericht vor.« Corussa hob ihre Handschuhe vom Boden auf.
»Ha! Feuer spucken!« Der Drache legte den Kopf in den Nacken und stieß eine bläulich-weiße Flammenzunge aus, kaum größer als die einer Kartentischlampe. »Da, stärker geht nicht! Damit verletze ich höchstens eine Bergziege, aber ganz bestimmt keinen Drachentöter in dicker Rüstung. Und darum finde ich deine Karte gefährlich.«
Corussa schüttelte den Staub von ihren Handschuhen. Darüber hatte sie noch nie nachgedacht.
Diesmal klopfte Corussa an die Tür der Studierstube.
»Herein. «Magistra Petingra stand am Kartentisch und legte Feder und Lineal beiseite, als ihre Schülerin das Zimmer betrat. »Corussa, du bist schon zurück!«
»Ja, Magistra.« Corussa lächelte und streckte ihr die verkratzte Kartenhülle hin. »Ich habe etwas mitgebracht. Alles wahrheitsgetreu kartografiert, wie es sich gehört.«
Ihre Lehrmeisterin sah sie nachdenklich an. »Dein Entschluss steht fest, du willst in die Gilde aufgenommen werden?«
»Ja.« Corussa erwiderte den Blick fest.
Magistra Petingra nickte langsam und wies auf den Kartentisch. »Dann lass mal sehen.«
Corussa streifte die neuen Handschuhe über, die sie sich extra zwei Gassen vor der Kartografierschule gekauft hatte, und breitete das kostbare Papier auf dem Tisch aus. Ihre Lehrmeisterin beugte sich über die Karte und betrachtete sie lange, ihr Blick fuhr über die Berge, prüfte Strich, Abmessung und Proportion. Corussa wartete, während die Magistra kritisch Federschwünge und Flüsse beäugte. Ungeduld braute sich in ihr zusammen wie ein Herbststurm. War ihre Arbeit von fast sieben Monaten nun gut genug für die Aufnahme in die Gilde oder nicht? Schließlich hielt sie es nicht mehr aus.
»Ich habe mich geirrt.«
»Geirrt?« Magistra Petingra sah von der Karte auf.
»Ja«, sagte Corussa. »Ich habe alles getreulich kartografiert. Aber wie Ihr sehen könnt, sind dort wirklich nur langweilige Berge.«
»Ja, das kommt vor.« Ein Lächeln breitete sich über das Gesicht der alten Kartografin aus und ihre Augen strahlten wie die Morgensonne zwischen den Berggipfeln.
Unsicher erwiderte Corussa das Lächeln und wies auf ihre gewissenhaft gezeichnete Arbeit. »Sie sehen jetzt besser aus als auf der Vorgängerkarte, aber dennoch – es sind einfach nur Berge.«
»Ich weiß.« Magistra Petingra zwinkerte ihr zu. »Willkommen in der Gilde.«
Cornelia Schulz
Wyvern und ihre (Un)Arten
»Das war die dümmste Idee, die wir je hatten!« Fin wischte sich mit der Hand übers Gesicht. »Hast du eine Ahnung, wie sehr Mantikor-Erbrochenes stinkt?«
Aus dem Kiel der daumengroßen Phönixfeder, die sein Kollege Lev im Spaß oft Mobile Telefone nannte, erklang ein Lachen. »Sieh es positiv: Er hat nicht mit seinen Giftstacheln auf dich geschossen.«
Fin wollte die Feder unter einem der roten Steine zermalmen, an denen er vorbeihastete. »Erzähl deine Witze der rauchgeschwängerten Tapete, Lev! Hast du den Kollegen aus der Jagdabteilung die Koordinaten gegeben?«
»Erstens: Ich rauche nicht mehr. Zweitens: Meine Witze sind das Salz in deiner Suppe. Und drittens werden Mantikore nicht mehr in Zoos gehalten. 1874 wurde der letzte erfolgreich zu einem Fischfresser umerzogen.«
Fin stieß ein Knurren aus, das wegen des Gestanks nach Essig und halbverdautem Fleisch in einem Würgen endete. »Das mag für das Deutsche Kaiserreich gelten, aber …«
Lev unterbrach ihn. »Das gilt weltweit.«
»Also wurde seit sechzehn Jahren kein einziger Mantikor mehr geboren?«
»Das Fressverhalten überträgt sich nachweislich auf die Kinder.«
»Drachendreck! Muss ich einen der Menschenschädel zu dir nach München schicken, mit denen das Biest seine Höhle dekoriert hat?«
Für einen Moment hörte Fin nur den eigenen abgehackten Atem und das Knirschen von Stein unter den Sohlen. Dann sagte Lev: »Ein weiterer Beweis dafür, dass die Karte echt ist.«
Etwas rieb zwischen Nacken und Hemdkragen. Fin fand einen Fingerknochen, den er angewidert wegwarf. »Ein weiterer Beweis dafür, dass ich zurückkehren sollte.«
Lev schnalzte mit der Zunge. »Es sind nur noch zwei Markierungen übrig.«
Ein Schrei kletterte Fins Kehle hinauf. Aber er durfte den Mantikor nicht erneut auf sich aufmerksam machen. Hastig warf er einen Blick über die Schulter zurück. Nichts als roter Fels, der in der Hitze flimmerte. Er war allein mit Paco. Der handgroße Feuerdrache flog neben ihm her und quäkte etwas, das Fin nicht interpretieren konnte.
»Als ich sagte, ich hätte gern Abwechslung von der Büroarbeit, habe ich nicht einen Flug nach Paraguay gemeint.«
»Wieso? War der Sattel des Pegasus unbequem?«
Fin unterdrückte einen weiteren Wutschrei. »Tapete, Lev!« Der Waldrand kam in Sicht. So schnell er konnte, rannte er in den Schutz des Dickichts. »Ich dachte an die jährliche Zählung der Lindwürmer im Schwarzwald.« Blätter streiften seine Arme. »Das Fangen von Kelpies im Wirmsee.« Fin sprang über einen Ameisenhaufen und hielt erst an, als er einen Fluss erreichte. »Von mir aus auch die Fütterung der Gargoyles in München. Aber nicht das Finden einer vergessenen Perchta!«
»Du hast nur eine Zehe verloren.«
Der Schrei brach aus Fin heraus. »Drei!«
Paco, der zum Trinken am Ufer gelandet war, spuckte vor Schreck eine kleine Flamme ins Wasser.
Fin konnte sich nicht zurückhalten. »Sie hat mir drei verdammte Zehen eingefroren, Lev!«
Lev bedachte ihn erneut mit Schweigen, was Fin dazu verleitete, den Rucksack in den roten Sand zu pfeffern.
»Im Sumpf hat mir der Hippokamp mit einem seiner zwei Hufe die Nase zertrümmert! Sie wird nie wieder gerade sein, genauso wenig wie meine Zehen nachwachsen werden! Was glaubst du eigentlich, was von mir übrig bleibt, wenn ich den letzten Markierungen auf der Karte nachgehe?«
»Du kannst jetzt nicht aufgeben«, tönte es eindringlich aus der Feder. »So eine Chance wiederholt sich nicht.«
»Das will ich schwer hoffen! Selbst mit Unterstützung vom Bund der Fabelwesen bliebe diese Expedition riskant.« Fin wusch sich das Gesicht im Fluss. »Haben sie den Antrag auf Spesenerstattung inzwischen genehmigt?«
»Sie haben ihn noch nicht geprüft. Soll ich dir Geld schicken?«
»Für was?«, fragte Fin zynisch. »Bezahlt der Bund die Überführung seiner toten Angestellten etwa nur, sofern die Forschungsreise abgesegnet wurde?«
»Natürlich tut er das in beiden Fällen.«
Fins Herz setzte einen Schlag aus. »Du hast das überprüft.«
»Nein! Ich weiß das, weil Igor in den Kaffeepausen mit seiner anstehenden Reise in den Himalaya nervt. Überhaupt spielt das keine Rolle!« Lev schluckte hörbar. »Du kommst zurück, Fin. Drei oder vier Zehen weniger, aber du wirst lebend zu mir zurückkommen.«
Zu mir.
Die Worte hämmerten durch Fins Kopf, blendeten die Rufe der Tukane und Papageien aus.
»Mit einem Wyvern«, fügte Lev hinzu.
Jäh kehrte die Wut zurück. »Die Perchta wohnt in einem zerfallenen Baumhaus, Lev. Sie friert Besucher mit ihrer Eismagie ein und vergräbt sie zwischen den Wurzeln unter ihrem Heim.«
»Was willst du damit andeuten?«
Er winkte Paco, der mit Flammen nach Fischen schoss, und ging weiter flussaufwärts. »Manche Dinge sollen nicht gefunden werden. Es hat einen Grund, warum jemand die Karte im Sekretär versteckt hat.«
»Der Grund heißt Egoismus.« Lev schien auf etwas zu kauen. Wahrscheinlich einem Bleistift. »Ich wette zehn Goldmark, dass einer aus dem Bund der Wissenschaftler an einem Heilmittel arbeitet. Stell dir den Skandal vor, wenn du ihm zuvorkommst.«
Fin hob eine Braue, bis ihm auffiel, dass nur der Feuerdrache das sehen konnte. »Darf ich dich daran erinnern, dass der Sekretär im Archiv unserer Organisation in München steht? Wieso hat dein Wissenschaftler aus Hamburg das Papier nicht einfach vernichtet? Wozu der Aufwand?«
»Weil man eine Karte von Alexander von Humboldt nicht einfach zerstört!«
»Du musst es ja wissen.«
Lev stöhnte frustriert. »Kannst du bitte dein Skeptizismus-Level senken?«
Fin bleckte die Zähne. »Entschuldige, aber neben deinem Rauswurf steht bei dieser Aktion auch noch mein Leben auf dem Spiel.«
Etwas knallte.
»Du wirst nicht sterben, hörst du?« Lev musste die Hand auf den Schreibtisch geschlagen haben. »Keiner hat gesehen, wie wir die Karte gestohlen haben! Niemand vermisst sie. Die Chefs werden den Antrag mit zwei Narren in Verbindung bringen, die sich langweilen und nach den Sternen greifen. Wahrscheinlich lesen sie den Wisch erst, wenn du wieder zurück bist. Und dann werden sie dir die Füße küssen. Du bringst ihnen einen Wyvern, Fin!«
Fin erspähte einen Kaiman, der auf einem Baumstamm im Fluss trieb. »Du redest immer so, als gäbe es keinerlei Zweifel daran, dass Humboldt tatsächlich Wyvern aufgespürt hat.«
Jetzt lachte Lev, die Laute schossen Fin direkt ins Blut.
»Einer von uns muss den Optimisten spielen«, sagte Lev.
Fin deutete Paco an, sich auf seine Schulter zu setzen. So leise wie möglich schlich er an dem Kaiman vorbei. »Warum lässt du dich nicht von den Moskitos fressen?«, flüsterte er. »Bei deinem Optimismus verheilt dein Knie auf dem Flug hierher.«
Abermals dieses Lachen. Und dann die Aussage, die Fins Blut gefrieren ließ.
»Bis zum Frühlingsfest werde ich ohne Krücken gehen können.«
Er suchte nach Worten. Nach etwas, das das Eis in ihm linderte. Doch alles, was er herausbrachte, war: »Wir reden morgen weiter. Paco jagt wieder Tapire.«
Der Feuerdrache riss empört die winzigen Augen auf, in denen Flammen tanzten. Lev protestierte. Und Fin zerstörte die Phönixfeder. Er zeigte Verständnis. Für viele Dinge. Allerdings nicht für Personen, mit denen er die Nacht des Frühlingsfestes verbrachte und die am nächsten Tag so taten, als sei nichts geschehen. Ja, aus einer Nacht musste nicht zwingend mehr werden. Aber zumindest reden konnte man darüber. Sie redeten doch sonst auch. Über Wichtiges. Unwichtiges. Nur nicht über das, was er Lev in dieser einen Nacht ins Ohr geflüstert hatte.
Paco hockte stumm auf seiner Schulter und glotzte ihn so lange beleidigt an, bis Fin ihm mit einem Seufzen die Jagd erlaubte.
»Wir rasten hier, bleib in der Nähe.«
Im Dickicht quäkte es, eine Zustimmung.
»Lass die Tapire in Ruhe, verstanden? Ich lösche keine Waldbrände mehr, nur weil du einem das Fell anzündest!«
Dieses Mal blieb das Quäken aus. Entweder ignorierte der Drache ihn, oder er jagte bereits einen Riesenschmetterling.
Fin zog die Karte aus dem Rucksack.
Wyvern und ihre (Un)Arten stand in schnörkeligen Buchstaben oberhalb des Maßstabs geschrieben. Mit dem Finger fuhr er Humboldts Reiseroute nach. Von Lima aus führte sie Richtung Osten, durch Bolivien hindurch, weiter gen Süden nach Paraguay, bevor es ihn gen Westen nach Chile gezogen hatte und dann wieder zurück nach Lima. Zwei Markierungen harrten noch Fins Überprüfung. Lev konnte die Notizen an den Rändern des Papiers bisher nicht entziffern, genauso wenig die Markierungen, die die Form von Runen trugen. Sie gehörten nicht zur Schrift der Inkas, dessen war sich Lev sicher.
Lev …
Fin biss die Zähne aufeinander. Fast ein Jahr lag es zurück. Er sollte nicht mehr daran denken, sondern sich damit befassen, woher er Zitronenparfüm bekam. Hätte er das alte nicht geopfert, würden sich seine Einzelteile längst im Bauch des Mantikors zersetzen. Der Geruch war das Einzige, das den Biestern solche Übelkeit verursachte, dass sie ihre Jagdinstinkte vergaßen.
Wieder betrachtete er die Karte. Wie hoch schätzte er die Wahrscheinlichkeit, auf eine zweite Mantikor-Höhle zu stoßen? Keine Rune glich der anderen. Mit etwas Glück würde er nur ein weiteres Blumenbeet antreffen. Mit viel Glück würde das Beet aus trompetenartigen Pflanzen bestehen, die nicht versuchten, seinen Verstand mit ihrem Duft zu vernebeln.
Halt.
Spielte er gerade wirklich mit dem Gedanken, weiterzureisen?
Vor seinem inneren Auge tauchte das Bild des Krankensaals auf. Die Patienten, die unter dem Wyvern-Fieber litten.
Glaubte man den Legenden, so hatten die Wyvern einst diesen Planeten beherrscht. Die Menschen, die gegen sie aufbegehrt und sie ausgerottet hatten, traf ein Fluch. Ab diesem Zeitpunkt, der Großen Wende, brach bis heute das Wyvern-Fieber immer wieder in allen Teilen der Welt aus.
Glaubte man der Medizin, so lag kein Fluch auf den Menschen, sondern Gift rann in ihrem Blut, das weitervererbt wurde. Manchmal ruhte es mehrere Generationen, nur um überraschend einem Ururenkel einen qualvollen Tod zu bescheren.
In all den Jahrhunderten konnte ein einziger Mensch vom Wyvern-Fieber geheilt werden. Marco Polo überfiel die Krankheit auf seiner Reise nach China. Hätten sein Vater Niccolò und sein Onkel Maffeo keinen eingefrorenen Wyvern im Gebirge von Tadschikistan gefunden, aus dessen Stachel am Schwanzende sie ein Gegenmittel herstellten, hätte Polo China wohl nie erreicht.
Fin fuhr mit der Zunge über seine Lippen. Ja, er würde weitergehen. Mit äußerster Vorsicht.
Er wühlte sich durch den Inhalt des Rucksacks. Neun Phönix-Federn zählte er. Allerdings besaß er nur noch einen Gedichtband, den er einem einsamen Urisk geben konnte. Das Wesen, halb Ziege halb Mensch, lebte in Teichen und stellte sein schrilles Wehklagen nur ein, wenn es unterhalten wurde.
Vollmond ist auch in fünf Tagen.
Für die Ifrits, die dann im silbernen Licht badeten, hatte er jedoch Paco. Damit sie Fin nicht mit gruseligen Wünschen belästigten, würde der Drache mit ihnen reden – von einem Feuerwesen zum anderen.
Fin verstreute das letzte getrocknete Basilikum um den Lagerplatz herum. Wenn er nicht im Dschungel auf das Kraut stieß, würde er mit der Narrenmaske schlafen müssen und hoffen, dass der Anblick die Kobolde fernhielt, die alles stahlen, sogar Fins schwarze Haare.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung. Paco brachte eine Schlange. Eine lebendige. In den Augen des Drachen, in denen man sein Element sehen konnte, tanzten helle Flammen und Stolz.
Elf Tage später erreichte Fin die vorletzte Markierung. Seine Stiefel schmatzten in der zähen Masse auf dem Waldboden. An den Stämmen klebte Gold. Honig tropfte von Farnen, Blättern, Büschen.
Durch den Kiel der Phönixfeder krähte Lev: »Ich habe die Schrift auf der Karte entziffert.«
Fin linste zu den Kronen hinauf. Riesige Waben hingen dort, manche mit Eiern befüllt, manche geöffnet, aus denen Honig floss. Dazwischen flogen Bienen, jede von ihnen so groß wie er und doppelt so breit. Sofort war er wieder sieben Jahre alt. Stand seinem ersten Goblin gegenüber. Schweiß rann ihm den Rücken hinab, sein Puls beschleunigte sich. Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Außer abhauen.
»Humboldt hat notiert: Der Gescheite nie vergisst, eine Schlange nimmer ihr Ende frisst.« Lev räusperte sich. »In ihrer Mitte muss nur suchen, wer Erlösung will vor dem Verfluchen.«
»Nett. Was weißt du über Riesenbienen?«
Lev fluchte. Papier raschelte. Fin vermutete, er blätterte durch den Band Insekten und ihre (Un)Arten. In diesem Moment traf ein Tropfen seine krumme Nase.
Mist!
Der Honig verklebte ihm die Nasenlöcher, er musste den Mund aufmachen, um zu atmen und …
Dieser Geschmack.
»Hier! Vorkommen: Amazonas und – unwichtig.« Lev ratterte eine Beschreibung herunter. »Ein Stich ist tödlich für Biene und Empfänger.«
Diese Süße!
»Fin?«
Auf Fins Zunge lag eine Antwort. Sie rollte zurück in seine Kehle, den Magen hinab. Genau wie der Honig, der besser schmeckte als alles, was er je probiert hatte.
»Hier steht auch, dass der Honig nur gekocht genießbar ist.«
Fin ließ Lev reden. Seine Welt schien Gold, das Summen der Bienen ein Lockruf, Teil ihres Volkes zu werden. Jede Faser in ihm zerrte vorwärts. Er griff nach einer Liane, wollte emporklettern, dorthin, wo er Flügel erhalten würde, wo es noch süßer riechen – die Welt roch nicht mehr süßlich.
Etwas kohlte.
Mit einem Aufschrei ließ Fin die Liane los. Seine Hose stand in Flammen, von Paco in Brand gesetzt! Der Schmerz trieb Fin Tränen in die Augen.
»Fin?«
Die Bienen bemerkten Pacos Feuer. Fin drückte den Drachen an sich und nahm die Beine in die Hand.
»Fin, was ist da los?«
Er stolperte durch ein Spinnennetz, ein Stiefel blieb im Honig stecken.
»Ich komme!« Lev riss eine Tür auf. »Ich nehme einen Pegasus!«
Fin rannte, bis seine Lungen brannten und er in eine Höhle taumelte, durch deren schmalen Eingang keine Biene passte.
»Bitte stirb nicht!« Kutschenlärm. »Ich hätte dir sagen sollen, dass ich Angst hatte!«
Dass ich Angst hatte.
Fünf Tage brütete Fin über der Aussage. Angst vor was? Den Urteilen anderer? Er fand, erneut, keine Antwort. Denn Lev hatte das Thema nicht wieder angeschnitten.
Er wäre gekommen.
Ein Teil von Fin wünschte sich, er hätte seinem Kollegen nicht gesagt, dass er in der Höhle Sicherheit gefunden hatte. Ein anderer Teil wisperte ihm zu, dass es nichts geändert hätte. Wäre Lev hier gewesen, hätten sie–wie so oft – über alles gesprochen. Nur nicht über das, was Lev Angst einjagte.
Vorsichtig näherte sich Fin der letzten Markierung.
Der Bixi war alt, fast vollständig versteinert. Das mannshohe Wesen mit dem Körper einer Schildkröte und dem Kopf eines Drachen bewegte sich nur noch in Zeitlupe.
Kein Wyvern.
Es hätte Fin nicht so treffen dürfen. Lev gehörte zu den Optimisten, nicht er.
»Ruf den Antrag zurück.« Seine Stimme klang seltsam tot. »Hier sind keine Wyvern.«
Bevor Lev antworten konnte, vernichtete Fin die Feder. Er betrachtete den Bixi. Den Felsen, den die Kreatur als letzte Ruhestätte auserkoren hatte. Das grüne Tal, auf das sie hinabblickte.
Er würde die Karte zerreißen. Paco sollte die Einzelteile verbrennen! Was hatte er sich dabei gedacht? Wäre Humboldt auf einen Wyvern gestoßen, hätte er ihn mitgenommen, der Welt ein Heilmittel geschenkt.
Fin zerrte die Karte aus dem Rucksack. Und hielt inne. Was hatte Lev gesagt?
Der Gescheite nie vergisst, eine Schlange nimmer ihr Ende frisst.
In ihrer Mitte muss nur suchen, wer Erlösung will vor dem Verfluchen.
Er konnte sich täuschen. Es konnte aber auch … Fieberhaft entfaltete er das Papier.
Die Markierungen bildeten einen unförmigen Kreis. Verband er sie miteinander, sah er …
Das Abbild einer Schlange. Die ihr Ende frisst!
Und in der Mitte, dem Mittelpunkt des unförmigen Kreises lag …
»Paco?«
Der Drache beobachtete ihn interessiert.
»Hast du Lust auf ein Bad?«
Fin stand am Fuße eines treppenähnlichen Wasserfalles. Paco saß auf einem Stein und streckte genüsslich die Schnauze in die Gischt, die auch Fins Gesicht benetzte.
Hier, in einem schillernden Regenbogen, flogen sie.
Wyvern.
Er konnte das Wort nicht aussprechen, so sehr erschien ihm der Anblick wie ein Traum.
Die Wyvern entsprachen nicht den Überlieferungen. Allerhöchstens doppelt so groß wie Paco, besaßen sie vier anstelle von zwei
Beinen. Außerdem zierten drei Stachel ihr Schwanzende, nicht einer.
Fin entschlüpfte ein Lachen, erschrocken hielt er die Hand vor den Mund, aus Angst, die Wesen zu verschrecken.
Hier flog es. Das Heilmittel.
Er musste nur einen Wyvern fangen. Einer genügte, um das Heilmittel zu analysieren und in Massenproduktion herzustellen.
Fin machte sich daran, ein Netz aus Lianen zu basteln, da teilte sich plötzlich einer der Wasserfälle.
Meine Kinder willst du schlachten?
Fin schrie auf. Wegen des Wesens, das vor ihm im Wasser stand. Und wegen der Worte, die es in seinen Kopf gesprochen hatte. Er hastete zu Paco, der sich platt auf den Stein drückte, und versteckte den Drachen hinter seinem Rücken.
Kannst du das verantworten? Ein Leben für ein Leben?
Fin verhaspelte sich. »W… wie bitte?« Das Wesen, das auf ihn herabblickte, war ebenfalls ein Wyvern. Einer, der die Größe eines mehrstöckigen Hauses besaß.
Der Wyvern reckte den Hals gen Regenbogen, woraufhin drei der kleineren Geschöpfe vor Fins Füßen landeten.
Das sind Elis, Amon und Nicha.
Fin starrte die Winzlinge an.
Gemessen an Menschenalter sind sie acht, neun und elf.
Im Einklang mit Fins Knien zitterte Paco in seinen Händen.
Erwähle einen. Aber wisse, dass wir sterben, schneidest du unsere Stacheln ab.
Fins Verstand flüsterte etwas von einer Falle. »Wirst …« Er würgte an den Worten. »Wirst du mich nicht fressen?«
Wenn du eines meiner Kinder tötest?
Der Wyvern schnaufte laut, es klang traurig.
Was hätte ich davon? Dass Menschen in mein Reich kommen, um dich zu rächen? Soll ich der Auslöser eines zweiten Krieges sein?
Das brachte Fin dazu, das Kinn vorzustrecken. »Hätten deine Vorfahren uns nicht unterdrückt, müsstest du keine Opfer bringen!«
Das Knurren des Wyverns vibrierte in Fins Knochen.
Hättet ihr uns einen Lebensraum gelassen, würdet ihr nicht unter unserem Gift leiden!
Der Wyvern schüttelte den massigen Kopf, so, als wollte er Gedanken loswerden.
Einer muss den ersten Schritt in Richtung Frieden wagen. Also?
Fin blickte wieder zu den drei Winzlingen am Boden. Er konnte das. Es war notwendig. Ein Leben für das von vielen. Er setzte Paco ins Gebüsch. So, dass der Drache ihn nicht sah. Dann zückte er sein Messer.
Die Wyvern betrachteten ihn. Die Klinge. In ihren Augen tanzte Stein. Und plötzlich sagte eine kindliche Stimme in Fins Kopf: Bringst du uns ein neues Spiel bei?
Das Messer entglitt ihm.
Sehen alle Menschen so komisch aus?
Fin wich zurück. Seine Atmung wurde immer unregelmäßiger. Er wollte fort. Er wollte sich übergeben. Stattdessen riss er sich zusammen und ging vor den kleinen Wyvern in die Hocke.
»Ich sehe komisch aus, weil ein Hippokamp meine Nase gebrochen hat. Aber selbst mit gerade Nase sehe ich nicht so gut aus wie Lev. Er … arbeitet mit mir im Bund der Fabelwesen. Möchtet ihr wissen, was wir da machen?«
Der Fluss kam in Sicht, die Sandbank in Form eines Herzens. Und damit der Einbaum, den er hier vor einer Ewigkeit, einem gefühlten Leben, zurückgelassen hatte. Fin zerrte ihn ins Wasser.
»Zeit, mir die Standpauke der Chefs anzuhören.« Immerhin war er wochenlang weggewesen. Ohne Genehmigung. Und er konnte nicht einmal eine Entschuldigung vorweisen.
Paco saß am Bug, spähte nach Fischen und quäkte abwesend eine Zustimmung. Fin schüttelte den Kopf, zog die Karte aus dem Rucksack und übergab sie den Fluten. Dann begann er zu rudern.
Gegen Abend zeichnete sich ein unförmiger Schatten auf dem Wasser ab.
Ein Wyvern!
Fin hatte keine Ahnung, was er davon halten sollte, als Amon im Einbaum landete.
Paps sagt, du hast den Test bestanden, sprach Amon in Fins Kopf hinein. Damit erhob sich der Wyvern wieder und verschwand. Zurück blieb ein orangefarbenes Etwas, das Paco beschnupperte.
In Fins Kehle steckte ein Kloß. Seine Nase schwoll zu.
Hin und her wälzte er das Bruchstück aus Bernstein, welches das Schwanzende eines jungen Wyverns einfasste.
Er zückte die letzte Phönixfeder.
»Lev? Ich weiß, die Arbeit ist unser Lieblingsthema. Rund um die Uhr. Was sagst du zu einem Abendessen? Bei dem wir mal über andere Dinge reden?«
Maria Seychaska
Terra Draconis
»Wir sind schon viel zu weit im Norden.«
Da sprach Kapitän Qiu leider eine Realität aus, die Zhou Yi-Long noch nicht wahrhaben wollte. Die Kälte reckte ihre Finger nach dem fuchsroten Teakholz und den fünfeckigen Segeln der langen Dschunke aus, die sich durch diemannshohen Wellen kämpfte.VorTagen zog die letzte Möglichkeit an ihnen vorbei, eins der schnellen Segelschiffe aus dem Verkehr der Kolonialrouten zu kapern. Denn Kapitän Qiu, der Laoda ihrer kleinen Mannschaft, priorisierte das Auffinden einer Insel, die wahrscheinlich gar nicht existierte. Eine Phantominsel, an deren Standort sie schon längst angekommen sein sollten.
Zhou konnte es drehen und wenden wie er wollte, die Karte, die er Tag für Tag, Stunde um Stunde, ja minütlich nach einem neuen Hinweis absuchte, schwieg. Sie gab ihm keine neuen Informationen. Er hatte sie studiert und jede Ortsbezeichnung rückwärts gelesen, die Buchstaben herumgeschoben, versucht sie als Anagramme, als Wegpunkte zu lesen, aber nichts davon brachte ihn dem Ziel näher.
»Wir sind noch nicht zu weit im Norden. Jeden Moment sollten wir Land sichten!« Das wollte Zhou zumindest glauben. Die Inschrift, die kreisrund um den unförmigen Kartenausschnitt verlief, besagte ganz eindeutig, dass die Insel mitten im Meer lag–vorausgesetztZhou interpretierte die geschwungenen Zeichen richtig. Wiederundwieder flogen seine Augen über die einzige in chinesischer Sprache verfasste Zeile in all den portugiesischen Wegbeschreibungen. Seit dem ersten Blick auf die Karte fiel sie Zhou immer wieder ins Auge:
Übersetzt hieß das so viel wie: Die Insel liegt in der Mitte des Meeres, einem Fische gleich, der im Ozean zwischen Untergrund und Wasserspiegel lebenslustig herumschwimmt.
Diese Zeile musste irgendeinen Hinweis, ein Geheimnis bergen. Sie musste das enthalten, was Zhou seit zahllosen Wochen übersah. Den Schlüssel zu dem Rätsel, weshalb die Dschunke just in diesem Augenblick das Herz der vermeintlichen Insel übersegeln sollte, besagtes Eiland im Nebel aber nicht auszumachen war. Zhous Finger zitterten ob der Kälte, die im Nebelatem lag. Sie kleideten sich zwar seit Tagen in Felle und dicke Lederhäute, doch seit die Nebelwolken sich dichter und dichter um die Dschunke drängten und ihre massive Außenverkleidung milchig weiß bemalten, hielt sich jeder, der nicht an Deck gebraucht wurde, im Bauch des Schiffes auf. Dort, wo sich die Wärme staute. Die Dschunke schluckte nach und nach die Besatzung und ihr Magen war der bestbeheizte Ort in diesen Gewässern.
Zhou zog den dicken Baumwollstoff seines Oberkleides enger um sich und stützte sich mit der dürren, zitternden Hand neben der Karte auf sein Pult. Die Zeichnungen inmitten des Schriftkreisrunds lokalisierten die Insel im Norden Hokkaidos, der japanischen Hauptinsel, deren abgebildete Küstenlinien die Orientierung auf dem kleinen Kartenausschnitt erleichterten.
»Wenn die Karte Recht behalten sollte.« Qiu klang nicht überzeugt. »Meine Augen mögen mich trügen und der Nebel mag seinen Teil zur Illusion beitragen, doch wir sind noch nicht am Ziel.«
Der Laoda verschränkte die Arme und musterte akribisch die undurchsichtigen Dampfberge, die sich in jeder Himmelsrichtung auftürmten. Wie nicht anders zu erwarten, behielt er Recht. Kein Land. Keine Insel. Kein Ziel. Zhou wischte seinen Atem, der als weiße Wolke aus Mund und Nase drang, aus dem Weg, um die Karte und ihre Umrisse ja nicht aus den Augen zu verlieren.
Er wollte die Schwaden, die um das große Stück Papier waberten, ebenfalls zur Seite wischen, doch klebrigen Zuckerfäden gleich blieben sie an Ort und Stelle hängen und zogen sich wieder zusammen. Sie fuhren mitten durch das Gebiet, auf dem die Karte Gamalands Umrisse zeichnete, doch die Dschunke machte nicht einmal Anstalten, auf eine Sandbank aufzulaufen, geschweige denn an den Klippen einer mit Nebelschleiern bekränzten Insel zu zerschellen.
»Was übersiehst du?« Qiu musterte den gedrungenen Mann neben sich prüfend, als könne er nur durch einen Blick auf Zhou, nicht einmal auf die Karte, das Geheimnis, die Lösung, die sie suchten, aufdecken.
»Die Insel liegt, der Karte nach zu urteilen, genau hier. Wir müssten uns direkt in der Mitte Gamalands befinden.« Aber weit und breit sah man nichts als geisterhaft grauweiß marmorierte Nebelfäden. Die Insel hatte ihre Wäsche ausgehängt und brachte in diesem weißen Weltatemwald die Dschunke Kapitän Qius vom Kurs ab. Oder ließ ihn und seine Mannschaft das Offensichtliche verkennen.
Sie, diese Insel, alles an ihr war ein Mythos. Niemand hatte die legendenumrankten Felsbrocken bislang finden können, die João da Gama Ende des 16. Jahrhunderts im Norden der japanischen Inseln entdeckte. Viele hatten danach gesucht, viele verschwanden und die, die zurückgekehrt waren, hatten berichtet, Gamaland sei nicht auffindbar. Zhou war der festen Überzeugung, dass es existierte. Die Karte vor ihm stellte den stichhaltigen Beweis dar. Und genau dort, wo er sie vermutete, befand sich womöglich das Grab eines der größten Piraten seiner Zeit. Vor drei Jahren verschwand er unter obskuren Umständen. Einer der berühmtesten Meereswölfe, die jemals im Pazifik die Säbel rasseln ließen. Unter seinem Kommando hätte die Dschunke Qius noch immer segeln müssen. Daher war der Kapitän nicht gewillt, den Tod seines Flottenkommandanten einfach so hinzunehmen.
Und Zhou war nicht gewillt, den Traum von dieser Entdeckung über die Planke zu schicken. Er würde ihn nicht all jenen Kritikerhaien vorwerfen, die von vornherein die Realisierbarkeit des ganzen Vorhabens belächelten. Entweder sie fanden Zheng, wurden seiner sterblichen Überreste oder zumindest der Geschichte seines Verschwindens habhaft, oder sie fanden diese Insel.
Ein Ruck ging durch den hölzernen Schiffsleib. Stark genug, um den wärmesuchenden Mageninhalt der Dschunke, die Mannschaft, die sich dem Leben unter Tage verschrieben hatte, wachzurütteln.
Unter Zhous und Qius Füßen wurden Stimmen laut.
Der Laoda musste einen Ausfallschritt machen, um das Gleichgewicht unter dem Wellenschlag, den die Dschunke meisterhaft ritt, nicht zu verlieren. Zhou hatte sich geistesgegenwärtig nach vorne gelehnt und seine Finger um die Außenflächen des Kartenpults verkrampft. So kalt und starr die Gelenke sein mochten, die roten Druckstellen, die die Bewegung hinterließ, attestierten, dass Leben in sie zurückkehrte. Zhou spürte die Nebel seinen Körper flüsternd umgarnen, konnte aber nichts weiter hören als das Meer. Das Rauschen beruhigte sich so schnell wieder, wie der Wellenschlag abebbte.
Erst als Zhou auch wirklich glaubte, dem Wasser und dem in die Aerosolbänke zurückgekehrten Frieden trauen zu können, hob er die Stimme: »Was war das? Eine Welle? Eine Gezeitenwelle? Fahren wir in einen Fjord ein?«
»Nein. Wir fahren weder in einen Fjord ein, noch war es eine Welle.« Qius Handflächen waren flach in Richtung Deckdielen gedreht, als wolle er das Schiff beruhigen, als wolle er dem Meer die Wut und der Dschunke die Aufregung allein durch seine Gestik nehmen. Zhou hätte sich auch gewundert, wäre seine erste Eingebung die Richtige gewesen. Oder hätte sein Wissen um das Leben auf hoher See das seines Kapitäns überstiegen.
»Wir haben etwas gerammt.« Qiu beäugte die Dielen der Dschunke argwöhnisch. Zhou wollte nicht meinen, dass er sich über ein etwaiges Loch im Schiffsbug freute. Doch wenn eben dieser Riss im tragenden Holz bedeutete, dass sie auf die ersten, spitzen Klippen vor Gamaland gestoßen waren, wäre selbst eine sinkende Dschunke ein Grund zum Optimismus. Die Hoffnung in ihm, über all die Leugner und Kritiker zu triumphieren, die seine Karte als Fälschung abtaten, übernahm die Oberhand. Zhou drückte sich vom nassfeuchten Holz des Kartenpults ab und hechtete in wenigen ausladenden Schritten zur Reling.
So weit, wie er sich darüber lehnte, wollte Qiu schon eingreifen und ihn zurück auf die Bodendielen ziehen. Doch die enttäuschte, ungläubige Miene, die Zhou aufsetzte, hielt den Kapitän davon ab: »Keine Klippen. Kein Land in Sicht.«
Er konnte die Enttäuschung nicht verbergen. Qiu hingegen machte diese Erkenntnis vielmehr unruhig, als sie ihn zum Resignieren verleitete–wenn sie nicht den Ausläufer einer Insel gerammt hatten, wenn es keine Welle gewesen war, die die Dschunke in die Luft gehoben hatte, welche Naturgewalt nahm sich dann seines Schiffs an?
»Was war das?« Ma, ein Junge mit kleinen, freundlichen Augen und Pausbacken, reckte seinen hochroten Kopf aus der Luke, deren abgegriffene Holzbeschaffenheit die glatten und gut geschrubbten Deckdielen kontrastierte. Bei der kleinsten Anstrengung bekam der pummelige Schiffsjunge ein Gesicht so scharlachrot, als habe er zum Mittag ein überwürztes Gericht der Sichuan-Küche verdrückt.
»Wir haben etwas gerammt. So wie du aussiehst willst du mir nicht mitteilen, dass wir mit Wasser volllaufen und drohen zu sinken?«, Qiu war offenbar auf das Schlimmste gefasst.





























