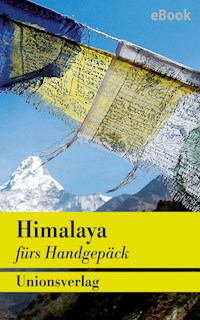
Himalaya E-Book
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Kunzang Choden begibt sich auf die Suche nach dem Yeti Ma Yuan ist erschüttert von der rauen Bergwelt Kanak Mani Dixit hält nicht viel vom Shangrila-Mythos Jin Zhiguo hat Mühe, den Pilgern über die Bergpässe zu folgen Shankar Lamichhane warnt vor dem täuschenden Licht der untergehenden Sonne Tsewang Yishey Pema führt und in die Höhle eines Eremiten Dor Bahadur Bista erzählt von der Mühsal, mehrere Frauen zu haben Gyalpo Tsering leidet mit den tibetischen Flüchtlingen in Indien Kumar Sanyal Prabodh sinniert über Sonderlinge, die im Himalaya ihr Glück suchen Tenzing Norgay ist nach der Eroberung des Mount Everest der glücklichste Mensch der Welt Sirish Rao glaubt nicht an den Sinn des Bergsteigens Deepak Thapa will mehr Achtung für die Sherpas H.P.S. Ahluwalia weiß, dass es Wichtigeres im Leben gibt als einen Gipfelsieg Dies und vieles mehr über den Himalaya …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Im Himalaya finden sich die vielfältigsten Kulturen und Religionen. Autorinnen und Autoren aus Nepal, Bhutan, Tibet, China und Indien, die hier zum Teil erstmals auf Deutsch vorgestellt werden, berichten von Spiritualität und Alltag, politischen Umwälzungen und religiösen Mythen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Alice Grünfelder studierte Sinologie und Germanistik in Berlin und Chengdu. Zahlreiche Reisen führten sie auch nach Tibet. Von 2004 bis 2010 betreute sie als Lektorin die Türkische Bibliothek im Unionsverlag. Seither ist sie als freie Lektorin, Übersetzerin und Literaturvermittlerin tätig.
Zur Webseite von Alice Grünfelder.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Alice Grünfelder (Hg.)
Himalaya
Menschen und Mythen
Erzählungen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Gabriele Jepsen
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30189-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 06:30h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HIMALAYA
Welchen Himalaya hätten Sie gern?Als Pilgerfrosch in MuktinathYaks, Yakhirten und der YetiAuf den Spuren des MigoiNicht einmal ein Leichnam zum EinäschernHimalaya-BalladeDie ewigen BergeDas Licht der untergehenden Sonne in den halb geschlossenen Augen des BuddhaDie Jagd auf das WildschafDie Höhle des EremitenSturm am Kali GandakiDas SchweigenDer Mond des JägersDer Fluch des toten RindsMondschein um den TrishulEin glücklicher MenschIst es das wert?Viel versprechende Zukunft für nepalesische Bergsteiger?Höher als der EverestNachwortWorterklärungenAutorinnen und AutorenMehr über dieses Buch
Über Alice Grünfelder
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Alice Grünfelder
Zum Thema Himalaya
Zum Thema Indien
Zum Thema Tibet
Zum Thema Asien
Zum Thema Berge
Zum Thema Bücher fürs Handgepäck
Welchen Himalaya hätten Sie gern?
Kanak Mani Dixit
Willkommen im Himalaya! Merkwürdige Dinge geschehen hier, denn dies ist das Land der Mystik, dem Himmel nah und doch so irdisch. Wer auf einem Hügel am Rand des Kathmandu-Tals steht, kann die Erdkrümmung als 450°Kilometer lange Schneekurve sehen, die sich vom Gipfel des Kangchendzönga im Osten bis zum Dhaulagiri im Westen windet. Wer aus dem Space-Shuttle zum Himalaya hinabsieht, entdeckt einen gekrümmten Tausendfüßler, der aus den Steppen Zentralasiens nach Süden rutscht.
Dies ist der gewaltigste Gebirgszug des Globus, bewohnt von 40 Millionen Menschen. Geografie, Klima und Geschichte haben hier so viele unterschiedliche Kulturen entstehen lassen wie in kaum einer anderen Region dieser Welt.
Doch der Himalaya hat ein Imageproblem. Es ist ein Problem, das sich andere Drittweltregionen wünschten: die Verklärung bis zur Unkenntlichkeit. Der Westen mythologisiert den Himalaya, um dort sein »Shangri-La« bewahren zu können, jenes Land, in dem nicht Materialismus und Konsumdenken vorherrschen, sondern Spiritualität das Handeln der Menschen lenkt.
Natürlich ist das ein Trugbild. Von den Balti im Karakorum bis zu den Naga im äußersten Osten treibt die Völker des Himalaya ein ähnliches Erwerbsstreben voran wie den Rest der Menschheit. Der einzige Unterschied: Sie sind spät dran. Die geografische und historische Isolation verhinderte lange Zeit ihren Anschluss an die moderne Warenwelt. Doch sobald das Angebot da ist, entsteht die Nachfrage.
Ein alltägliches Beispiel mag für zahllose stehen: Als 1994 erstmals Hubschrauber in der oberen Everest-Region landeten, was tat da, im Bergdorf Thame, das weibliche Oberhaupt einer Großfamilie? Die Frau benachrichtigte sogleich ihren Sohn in Kathmandu, dass er einen Sack Kunstdünger hinauffliegen lassen sollte.
Doch derlei Ereignisse werden ausgespart von jenen, die den Rohstoff liefern für den Mythos Shangri-La: von Schriftstellern, Bergsteigern, Reiseagenturen. Und von Filmemachern wie Bernardo Bertolucci. Dessen Film Little Buddha, gedreht 1993, illustriert den Hang zur Verzuckerung. Um Siddhartha Gautamas Wandel vom verwöhnten Prinzen zum asketischen Guru darzustellen, nimmt uns der Regisseur des Letzten Tangos in Paris mit zu den imposanten Klöstern Bhutans und den Reisterrassen im Kathmandu-Tal. Doch von der Region, in der Buddha tatsächlich gelebt und gepredigt hat, dem staubigen Tiefland im indischen Bihar, sehen wir fast nichts.
All dies hat plausible Gründe. Wer zu den Galapagosinseln reist, ist an Naturgeschichte interessiert. Ans Mittelmeer zieht die Touristen die Lust auf Strand und Sonne, nach Kenia fahren sie wegen der Safaris. Am Himalaya reizen sie vornehmlich zwei Dinge: die majestätischen Berge und die tibetisch-buddhistische Kultur. Und weil beides zusammenhängt – viele Bergvölker verehren die Gipfel als Götterthrone –, weil hier Mensch und Natur in vermeintlicher Eintracht leben und weil zudem der Westen diese Welt Ende der Sechzigerjahre »entdeckte«, zu einer Zeit, als sich bei den wohlhabenden Nationen die ersten Sättigungsgefühle einstellten und sie sich auf die Suche nach spirituellen Gegenentwürfen begaben –, weil also all dies so ist, lebt Shangri-La noch heute. Die Gralsburg des Glaubens, erfunden von dem Romanschriftsteller James Hilton vor rund sechzig Jahren, liegt hoch oben im wolkenumwölbten Himalaya.
Die Hartnäckigkeit des Mythos erstaunt insbesondere jene Völker, die in den mittleren Lagen des Himalaya leben, größtenteils Hindus. Mit Verwirrung und Enttäuschung verfolgen sie, wie die Touristen ohne weiteren Seitenblick zu den Hochtälern aufsteigen. Ausgerechnet diese abweisenden Regionen, von den Bewohnern der grünen Mittelgebirge lange Zeit verachtet als Heimat rückständiger Völker aus Tibet, stehen bei den reichen Ausländern im Mittelpunkt des Interesses. Wie seltsam. Bis heute veröffentlicht die Tageszeitung The Rising Nepal regelmäßig Leserbriefe, in denen Dorfbewohner von einem wundervollen See oder Wald berichten, der sich als Touristenattraktion vermarkten ließe – wenn nur die Regierung sich endlich entschließen könnte, dort ein Hotel oder Ähnliches zu bauen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, den braven Dorfbewohnern zu erläutern, was die Besucher aus dem Westen tatsächlich reizt.
Besucher reizt die Exotik der Gebirgswelt, und das ist weder verwerflich noch verwunderlich. Erstaunlich ist nur, mit welcher Bereitwilligkeit sie dabei allerlei spiritistischen Unsinn über unsere Heimat akzeptieren. Eines der meistverkauften Himalaya-Bücher weltweit ist Auf der Spur des Schneeleoparden von Peter Matthiessen. Doch das Buch tut nur so, als nehme es den Leser mit auf einen Treck durch Dolpo, tatsächlich zerrt es ihn auf eine Expedition durch das angstzerfressene Unterbewusstsein des Autors. Stones of Silence von dem Zoologen George Schaller, der Matthiessen durch Dolpo begleitete, hat sich weitaus schlechter verkauft: Schaller schreibt über Wildbestand und Artenschwund.
Haben Sie schon einmal von Mustang gehört? Von jener nepalesischen Grenzregion, die wie ein Daumen nach Tibet hineinragt und erst 1992 für Touristen geöffnet wurde? Das entlegene Hochtal besitzt alles, was ein Besucherherz erfreuen könnte: ein kleines, tibetisch sprechendes Volk namens Loba, einen Raja, der eine Art König ist, eine archaische, mauerbewehrte Stadt, viele uralte Klöster, von keinen Roten Garden aus Beijing verwüstet. Mustang ist tibetischer als Tibet selbst.
Die Faszination ist real – und reicht dennoch manchen nicht aus. Ein Team des japanischen Fernsehsenders NHK, das einen Dokumentarfilm über Mustang drehte, bezahlte nepalesische Polizisten dafür, drohend auf den Lehmdächern der Hauptstadt zu stehen, die Gewehre im Anschlag – so, als wagte sich das Team in ein schwer bewachtes Fort. Die Kontrolle der Passierscheine, normalerweise nur belanglose Routine, präsentierte der Film später mit einer Dramatik, als werde jeder Besucher ohne die richtigen Stempel sofort aufgehängt. Ein Filmteam des US-Senders Discovery wiederum ließ 1993 in seinem Dokumentarfilm einen buddhistischen Mönch das »heimatliche« Mustang erklären. Der Mönch stammte jedoch aus Indien und war vom Team in Kathmandu engagiert worden. Auf dem Festival der Bergfilme im kanadischen Banff errang der Streifen 1994 den ersten Preis.
Was unsereins mit grimmigem Lachen erfüllt, wenn wir solche Geschichten hören, ist das Wissen, dass der Himalaya und insbesondere Mustang solches Aufbauschen gar nicht nötig haben. Denn das »abgeschiedene Königreich«, als das Mustang dem staunenden Ausland immer wieder präsentiert wird, birgt ein Geheimnis, das noch kein Film enttarnt hat.
Jedes Jahr, wenn kurz nach Abzug der Touristen der Winter naht, brechen die meisten Männer Mustangs nach Süden auf. Sie tragen Kräuter und Ammonitsteine zu den Märkten der nepalesischen Stadt Pokhara und finanzieren mit einem Teil ihrer Erlöse eine Zugreise nach Jullundur, einer Industriestadt im indischen Punjab. Dort erwerben sie riesige Ballen von Pullovern aus Acryl. Anschließend durchreisen sie Indien Richtung Osten und verkaufen die Pullover an den Straßen. Sie sind klug, die Loba, sie wissen, wie begehrt »echte tibetische Wollwaren« sind. Sie wissen auch, wo sie während ihrer einträchtigen Überwinterung in wärmeren Zonen am günstigsten unterkommen: in Auffangstationen der indischen Regierung für tibetische Flüchtlinge.
Die Loba ziehen nur bis Indien. Ihre Nachbarn in Nepal, die Manangpa aus dem abgelegenen Manang-Tal, pendeln als Handelsreisende bis nach Bangkok und Hongkong – ehe sie im Frühjahr zurückkehren zu ihren Yaks auf den Hochweiden.
Die Loba und die Manangpa finden sich in beiden Welten zurecht. Die Anpassungsfähigkeit, mit der sie Jahrhunderte der Entwicklung regelmäßig vor- und zurückspringen, ist unglaublich. Gibt es irgendein Volk in Europa, das Ähnliches vermag?
Dies ist das Exotischste an Mustang – ohne dass es jene Faszination verringert, die Mustangs Klöster und Berge ausstrahlen. Beides gehört zusammen, beides ist real, jede Verklärung unnötig. Und das gilt für den gesamten Himalaya-Raum. Wer ihn unvoreingenommen durchwandert, wer davon ausgeht, dass der Menschen Wünsche und Sorgen hier grundsätzlich nicht anders sind als in den Provinzen Europas, der wird eine Wirklichkeit entdecken, die vielfältiger und aufregender ist als der matte Glanz von Shangri-La.
Umso erstaunlicher bleibt der unaufhörliche Nachschub an Mythen und Märchen, der aus dem Himalaya schwappt, gewiss mehr als aus irgendeiner anderen Reiseregion. Obwohl seit Jahrtausenden Pilger, gerüstet nur mit ihrem Glauben, ohne größeres Aufsehen wochenlang über Schneepässe wandern, fühlt sich heute jeder zweite Trecker, der einige Zeit in 5000 Meter Höhe marschiert ist, auf seltsame Weise gedrängt, über diese Extremerfahrung ein Buch zu schreiben oder zumindest einen dramatischen Bericht.
Nun, es ist wohl ungerecht oder zumindest illusorisch, von jedem Besucher zu erwarten, sich der Faszination von Klischees entziehen zu können. Touristen sind hier, um Urlaub zu machen. Und es ist eben weitaus fesselnder, Buddhas Augen auf dem gewaltigen Stupa von Bodnath zu betrachten als das, was diese Augen erblicken: die zementgrauen Häuserblocks von Kathmandu, die täglich weiter in das fruchtbare Tal wuchern.
Vier weit verbreitete Irrtümer möchte ich aber aufklären. Zunächst die Bedeutung des Begriffs »Sherpa«. Als die Briten vor siebzig Jahren begannen, zum Everest hinaufzusteigen, engagierten sie als Träger Männer vom Volk der Sherpa, einer aus Tibet in die nepalesische Khumbu-Region eingewanderten Volksgruppe. Heute wird »Sherpa« oft mit »Träger« gleichgesetzt. Tatsächlich kann ein Sherpa genauso gut Lehrer oder Mönch sein. In der Helambu-Region leben Sherpas, die eher verhungern würden, als die Lasten Fremder zu tragen. Anderen Volksgruppen in Nepal hingegen gefällt es durchaus, für »Sherpa« gehalten zu werden, weil ihnen dann höhere Löhne winken.
Die »Gurkha« wiederum gelten als Inbegriff eines furchtlosen, kriegerischen Volkes. Tatsächlich existiert kein Volk dieses Namens. Es gibt vielmehr ein Städtchen in Nepal namens Gorkha, von dem aus die Shah-Dynastie, eingewandert aus Rajasthan, vor zwei Jahrhunderten gewaltsam die umliegenden Fürstentümer zum heutigen Nepal einte.
Die »Gurkha«, berühmt geworden im Dienst der britischen Armee, entstammen meist den Volksgruppen der Gurung, Rai, Limbu und Magar. Und ihre Furchtlosigkeit ist so begrenzt wie bei allen Soldaten dieser Welt: Ein nepalesischer Historiker stieß kürzlich in Archiven aus der britisch-indischen Kolonialzeit auf Briefe von »Gurkha«, verfasst an den Fronten des Ersten Weltkriegs. Vom Terror der Schlacht schrieben die Männer, vom Schmerz der Wunden, von der Angst um die Angehörigen zu Hause. Keiner dieser Briefe ist jemals nach Nepal weitergeleitet worden.
Manche Klischees funktionieren andersherum, sie denunzieren. So wird das Balti-Volk im pakistanischen Karakorum in der Reiseliteratur häufig als unhöflich und geldgierig beschrieben. Ein kanadischer Soziologe, der nach den Ursachen für dieses Bild forschte, stieß auf einen profanen Umstand: Die Balti kennen sich aus in Tarifverhandlungen. Früher als andere Bergvölker hatten sie Geschäfte mit den britischen Kolonialherren gemacht, weshalb ein Balti-Träger bis heute weiß, wie lange er das Gepäck des weißen Sahib liegen zu lassen hat, bis er den Lohn erhält, von dem er meint, dass er ihm zustände. Kein Wunder, dass sein Ruf so schlecht ist.
Schließlich Bhutan: Das unabhängige Königreich gilt als Hort unverfälschten Buddhismus, als friedliches Land mit üppiger Natur und atemberaubenden Klosterburgen. So gut wie keine Reisebroschüre erwähnt, was Anfang der Neunzigerjahre im Süden des Landes geschehen ist: Über 100000 Lhotshampa, nepalstämmige Einwohner, wurden von der Regierung aus Bhutan vertrieben. Auch ein Shangri-La kann Leichen im Keller haben.
Es ist wohl an der Zeit, darauf hinzuweisen, dass auch im Himalaya viele Menschen von einem Shangri-La träumen. Hier heißt es nur anders: »Amri-Ka«, das gelobte Land USA, das jedem eine Chance gebe, unabhängig von Kaste oder Klasse. Von all den nepalesischen Schülern, die seit 1984 die jährlichen Sommercamps der YMCA in den USA besuchen, sind nur zwanzig Prozent zurückgekehrt. Als der Raja von Mustang 1995 zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten reiste, besuchte er Disneyland. Und daheim in den Bergdörfern wächst mit jedem Fernseher, der MTV empfangen kann, der Wunsch nach einem leichteren Leben, nach dem Glanz moderner Waren oder wenigstens nach einem Anschluss an das Straßennetz.
Es ist ungemein spannend, zu beobachten, was geschieht, wenn im Himalaya diese beiden Versionen von Shangri-La aufeinander treffen. Wenn ein Hausbesitzer sein altes, reich verziertes Holzhaus abreißen will zu Gunsten eines pflegeleichten Zementbaus – und ein Ausländer ihn zu überzeugen versucht, wie falsch das sei.
Ortsfremde erkennen häufig eher, wie bewahrenswert das Selbstverständliche ist. Die westliche Faszination am Himalaya hat uns deshalb unzählige Entwicklungsexperten und Privatpersonen beschert, die sich dem Erhalt traditioneller Kultur widmen. Kaum ein Tal ohne ein »Projekt«. Zu den bekanntesten Erfolgen zählt die einstige Königsstadt Bhaktapur bei Kathmandu. Die deutsche Regierung initiierte deren Restaurierung – nachdem die Bonner Experten zunächst große Schwierigkeiten hatten, die Bewohner davon zu überzeugen, wie sehr sich das Vorhaben touristisch und damit finanziell auszahlen würde.
Auch in Zukunft werden Reiseveranstalter den Himalaya vor allem als Stätte der Mystik und der Exotik verkaufen. Es ist wohl das Beste, wenn wir dies als Standortvorteil betrachten und dafür sorgen, dass der Gewinn gerecht verteilt wird.
Sie aber sollten skeptisch sein, wenn Sie wieder von einem »neu entdeckten Shangri-La« lesen. Denn so begann die Irreführung, als 1956 die ersten Pauschaltouristen nach Nepal reisten. In den frühen Achtzigerjahren war Ladakh an der Reihe, dann kamen Tibet und Bhutan. Zurzeit warten Sikkim, Arunachal Pradesh und die Randzonen von Tibet darauf, »entdeckt« zu werden.
Jede Neuentdeckung wurde begleitet von Meldungen, das bisherige Shangri-La sei nun zerstört. Auch das geschah mit Nepal, als es hieß, die Mittelgebirge würden entwaldet und die Sherpa ihre Kultur an den Tourismus verlieren. Ende der Siebzigerjahre prophezeite die Weltbank, dass Nepal »im Jahre 2000 keine Wälder mehr besitzt«.
Die Nachricht »Shangri-La erholt sich« kommt dagegen nie in die Schlagzeilen. Doch genau das geschieht in weiten Teilen des Himalaya. Es ist die Modernisierung selbst, es sind neue Straßen und Telefonleitungen, die vielen Menschen erlauben, nun rascher als bisher gefährliche Aspekte des Wandels zu erkennen. Bauern und Umweltschutzgruppen schließen sich zusammen, die Stimmen der Provinz dringen vernehmlicher in die Hauptstädte. So hat die nepalesische Regierung im letzten Jahrzehnt viele der verstaatlichten Wälder zur nachhaltigen Bewirtschaftung an Dorfgemeinschaften zurückgegeben. Inzwischen deuten Satellitenaufnahmen der NASA darauf hin, dass sich erodierte Hänge im zentralen Himalaya wieder begrünen.
Es gibt kein Shangri-La im Himalaya. Was es gibt, ist eine einmalige Vielfalt an Kulturen und prachtvollen Landschaften. Einige erleichtern unser Leben, andere erschweren es. Wer ohne nostalgisch verklärten Blick kommt, der wird beide Seiten entdecken.
Als Pilgerfrosch in Muktinath
Kanak Mani Dixit
Mit großen Sprüngen erreichte Bhaktaprasad schließlich das Dorf Kagbeni, das ein recht merkwürdiger Ort war. Bei seiner Ankunft bemerkte der Frosch, dass überall Kabel und elektrische Leitungen hingen. Aber als die Nacht hereinbrach, sah man nicht ein einziges elektrisches Licht in Kagbeni. Das Dorf lag genauso dunkel da wie jedes andere der tausenden von Dörfern in Nepal.
»Ich frage mich, woran das liegt«, dachte der Frosch. Und wie um genau diese Frage zu beantworten, ließ ihn das Schicksal in die Hände von Dzo Dzopa fallen, dem gesprächigsten Rindvieh südlich der Mongolei.
Dzo war aus der Verbindung zwischen einem Hochlandyak und einer Tieflandkuh entstanden. Sie lebte in einem Stall am Weg, und ganz offensichtlich bestand ihre Lebensaufgabe darin, Vorüberkommende zu sich zu locken und sich mit ihnen zu unterhalten. Sie hatte genau beobachtet, wie Bhaktaprasad das Dorf betrat.
»Du wunderst dich also«, fragte sie ihn, »weshalb wir in Kagbeni zwar elektrische Leitungen, aber kein Licht haben? Nur immer herein mit dir!«
Ein wenig unsicher, ob er das Richtige tat, betrat Bhaktaprasad den Stall.
»Setz dich hin, und ich erzähle dir alles«, sagte Dzo. Der Frosch nahm Platz, und ohne eine Sekunde zu verlieren, begann Dzo zu reden: »Es war einmal, da kamen ein paar Ingenieure – Menschen, du verstehst – von Kathmandu hierher und versprachen uns Elektrizität. Sie sagten, sie würden den starken Wind in diesem Tale nutzen, um Windräder anzutreiben und so Strom für ganz Kagbeni zu erzeugen. Unglücklicherweise unterschätzten die Ingenieure die Kraft der hiesigen Winde, und die Windräder wurden noch am selben Tage, an dem man sie in Betrieb genommen hatte, davongeblasen.«
»Und darum habt ihr hier überall Stromleitungen, aber keinen Saft drin!«, warf Bhaktaprasad ein. »Oh, wie dumm die Menschen doch sind!«
»Ja, ja, das wissen wir«, sagte Dzo und fügte hinzu: »Wir beide haben uns noch nicht vorgestellt.«
»Ich bin ein Frosch …«
»Das sehe ich«, schnitt Dzo ihm das Wort ab.
»Angehöriger der Art Rana tigrina …«
»Oh, einer von denen.«
»Wohnsitz in Kathmandu. Reiseziel unbekannt.«
»Gut. Und ich bin Dzo Dzopa. Mischling. Kreuzung zweier Linien. Hybride. Halb Yak, halb Tieflandkuh. In uns soll sich die Zähigkeit des Hochlandbewohners mit der Produktivität des Tieflandbewohners vereinen.«
»Erzähl mir was über Yaks!«, bat Bhaktaprasad, dem dieses Mischwesen zu gefallen begann. Es war so wohltuend selbstbewusst.
»Man nennt sie auch die ›Kamele des Himalaya‹. Aber wenn du mich fragst, dann sollte eher das Kamel ›Yak der Wüste‹ genannt werden.«
»Weiter, weiter«, trieb der Frosch Dzo an, ihre Erklärung fortzusetzen.
»Nun, Yaks haben ein dickes Fell und leben auf den höchsten Weiden der schneebedeckten Berge. Sie werden von den Yakhirten nur im Winter heruntergeholt, wenn es im Tiefland kühl ist. Und wie Maultiere sind Yaks Arbeitstiere. Sie sind sehr nützlich, ob tot oder lebendig. Denn aus ihrem Haar webt man Stoff, die Milch kann zum steinharten Chhurpi-Käse verarbeitet werden, der unter den Nahrungsmitteln den Rekord als die am längsten kaubare Substanz auf Erden hält. Und das Fleisch wird gegessen«, sagte Dzo Dzopa abschließend und verzog das Gesicht.
»Und was tust du, Dzo?«
»Ich? Ich tue so wenig wie möglich«, gluckste sie. »Meine Besitzerin in der Touristenherberge will Milch, aber ich gebe ihr so wenig, wie ich kann. Ich faulenze eben gerne. Dzo Dzopa hat landauf und landab sowohl Maultiere als auch Yaks zum Freund, aber bleibt selbst lieber zu Hause.« Dzo dachte eine Weile nach, dann fügte sie hinzu: »Ich biete Reisenden gute Unterhaltung und Beratung. Darum glaube ich, dass ich schon meinen Platz hier habe.«
An Tagen, an denen Dzo besonders träge war, weigerte sie sich sogar, auf die Weiden oberhalb von Kagbeni hinaufzutrotten. Sie lehnte sich stattdessen aus dem Stallfenster und bediente sich selbst an den Bündeln von Gras und Stroh, die die Dorfleute von den Feldern in den Ort trugen. Und während Dzo all das erzählte, kaute und kaute sie so unablässig, dass Bhaktaprasad entschied, es könne sich nicht bloß um das übliche Wiederkäuen wie bei allen Rindern handeln.
»Sag mal, Dzo, was hast du da im Mund?«
Und mit einem verschmitzten Blitzen in den Augen erwiderte Dzo: »Chhurpi-Käse!«
Auf ihrem Lauschposten am Pfad hielt Dzo ihre Antennen auf Tratsch und Reisenachrichten eingestellt: wann aufgrund schlechten Wetters ein Flug nach Jomsom gestrichen wurde; wo ein Erdrutsch eine Fußgängerbrücke weggerissen hatte; und was der König in Kathmandu auf seiner jährlichen Rede vor der Parlamentsversammlung gesagt hatte.
Bhaktaprasad befolgte Dzo Dzopas Rat und blieb einen weiteren Tag in Kagbeni.
»Von hier aus liegt ein steiler Anstieg vor dir«, hatte sie ihn gewarnt. »Frösche aus dem Tiefland sind anfällig für die so genannte Höhenkrankheit, deren Symptome auch zerebrale und pulmonale Ödeme umfassen.« Dzo räusperte sich und fügte ein bisschen verlegen hinzu: »Zumindest hat das die Direktorin der Himalaya-Bergrettungsgesellschaft gesagt, als sie letztes Jahr hier in Kagbeni einen Workshop abhielt.«
Bhaktaprasad hatte den Verdacht, dass die Sache mit der Höhenkrankheit vor allem Dzo Dzopas Trick war, ihn noch ein wenig länger in Kagbeni zu halten, damit sie weiter mit ihm reden konnte.
An diesem Abend beriet Dzo den Frosch bei seinen Reiseplänen: »Wir sind hier im Unteren Mustang. Das daumenförmige Gebiet auf der Karte, das aus der Mitte Nepals oben herausragt, ist das Obere Mustang. Es ist auch als das Land Lo bekannt, das nur wenige gesehen haben. Ich schlage vor, dass du zunächst den Tempel von Muktinath besuchst, dir dort deinen Segen holst und dann nach Norden weiterreist.«
Bhaktaprasad brauchte einen ganzen Tag, um den steil ansteigenden Weg nach Muktinath zu bewältigen. Als er Muktinath endlich erreichte, war es schon dunkel, und so hopste er zu einer verlassenen Unterkunft am Weg hinüber, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Tag würde er genug Zeit haben, den Ort zu erkunden.
Als der Morgen kam, sah Bhaktaprasad, dass Muktinath am Fuße eines gewaltigen Berges lag, der östlich davon aufragte. Das bedeutete, dass die Strahlen der Sonne die Siedlung erst gegen Mittag erreichen würden. Die Gegend jedoch, die im Schatten des Berges lag, wurde von dem Sonnenlicht erhellt, das die Hügelseite am anderen Ende des Tales reflektierte. Der Frosch sah sich um und stellte fest, dass Muktinath an einer Stelle lag, wo aus einer Quelle an der Bergseite Wasser entsprang. Die unmittelbare Umgebung war grün und einladend, mit schattigen Pappeln und dem Klang plätschernden Wassers. Der Tempel selbst hatte die Form einer Pagode mit zweifachem Dach. Aber ansonsten war die Landschaft karg und öde.
Doch als Bhaktaprasad den Tempel sah, fühlte er sich ein bisschen wie zu Hause, denn ganz ähnlich sahen auch die dicht an dicht stehenden Tempel in Kathmandu aus.
Muktinath war ein Pilgerort. Er war von solcher Heiligkeit, dass ihn von überall her große und kleine Geschöpfe aufsuchten, um zu beten und zu meditieren und um Loslösung von weltlichen Belangen zu erreichen. Auf der einen Seite des Tempels gab es 108 Wasserspeier, die an Brunnensteinen in Form eines Rinderkopfes angebracht waren. Eine sonderbare Gestaltung, die Bhaktaprasad 108-mal an Dzo erinnerte.
An dem Becken, in das sich das Wasser ergoss, traf Bhaktaprasad Tiere aus dem Osten, Westen, Norden und Süden, die alle auf Pilgerschaft hier waren. Da war ein älteres Paar, ein männlicher und ein weiblicher Gelbschwanz-Glanzfasan aus dem Jumla-Distrikt im Westen. Eine große Schakalfamilie war von Parasi, einem Distrikt des Terai, der an Chitwan grenzte, hierher gekommen. Eine Schildkröte, deren Sprache niemand verstand, gestikulierte, um den anderen klar zu machen, dass sie drei Jahre lang gekrochen war, um aus dem Süden Indiens hierher zu gelangen.
Das Fasanenpaar aus Jumla fasste Zuneigung zu dem jungen Bhaktaprasad und führte ihn durch den Tempel, der Gott Shiva geweiht war. An ihn grenzte ein Gebäude an, dessen Inneres fast ganz dunkel war. Bhaktaprasad sah eine Flamme, die über einer Felsenöffnung brannte. Sie war von klarem Blau und stammte von natürlichen Gasen, die hier aus den Tiefen der Erde entwichen. Das Geräusch fließenden Wassers ließ vermuten, dass es irgendwo unter ihren Füßen eine Quelle gab.
Der Mönch, der die Flamme bewachte, schaute auf Bhaktaprasad hinunter.
»Muktinath ist ein Ort von großer Bedeutung. Feuer und Wasser treffen hier aufeinander«, flüsterte er. Der Mönch erklärte ihm, dass Muktinath alle Betenden willkommen hieß, die tibetischen Buddhisten aus dem Norden, die Hindus aus dem Süden, ebenso wie diejenigen, die die Natur als Gottheit verehrten, und sogar Besucher, die überhaupt nicht religiös waren.
»Dieser Ort hat eine besondere Macht. Energie aus den Tiefen der Erde steigt hier auf, um uns zu begegnen und uns daran zu erinnern, respektvoll mit unserer Erde umzugehen.«
In der Dunkelheit des Tempelheiligsten, die tanzende blaue Flamme vor Augen, fühlte Bhaktaprasad eine Woge des Verstehens über sich kommen: dass man nämlich die Erde und alles, was zu ihr gehörte, respektieren musste. Erst durch das eigensinnige Vorhaben, sein Land erkunden zu wollen, war er bis nach Muktinath gelangt, und in diesem Raum, im Schein der Flamme, begriff er, dass er das Richtige getan hatte.
Nachdem das Fasanenpaar seine Gebete vor der Flamme gesprochen hatte, begab sich Bhaktaprasad mit ihm wieder nach draußen ins helle Licht. Der Frosch beschloss, seinen Weg fortzusetzen, und lehnte die Einladung des alten Paares, mit ihm nach Jumla zu kommen, höflich ab.
In der Nähe des Tempels entdeckte Bhaktaprasad ein Schild, auf dem »Tourist Information« stand, und betrat das Gebäude. Eine Dame hinter dem Schalter blickte zu ihm herab und fragte, ob sie helfen könne. Der Frosch fragte nach möglichen Routen, um seine Reise fortzusetzen.
»Nun«, antwortete sie, »Sie könnten entweder zurück nach Kagbeni gehen oder in den Norden nach Lo Manthang, der Hauptstadt des Oberen Mustang. Oder Sie nehmen die östliche Route und übersteigen den hohen Thorung-La-Pass.« Dieser Pass, sagte sie, verbinde den Mustang-Distrikt auf dieser Seite mit dem Manang-Distrikt auf der anderen. Dorthin gäbe es einen steilen Weg, doch keine Siedlungen weit und breit. Sie habe bisher noch von keinem Frosch gehört, der den Thorung-La überquert habe. »Wenn man im Hochgebirge zu schnell aufsteigt, erhält der Körper nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen. Darum werden Frösche krank, genau wie andere Tieflandbewohner auch, und können sogar sterben«, sagte die Dame hinter dem Informationsschalter.
Bhaktaprasad hatte nicht die Absicht, so jung zu sterben. Tatsächlich hatte er eigentlich überhaupt nicht die Absicht zu sterben. Also beschloss er, Dzo Dzopas Vorschlag zu befolgen und Lo Manthang zu besuchen.
Yaks, Yakhirten und der Yeti
Kunzang Choden
Meine Eltern besaßen wie schon ihre Vorfahren zwei Yakherden. Die weibliche Herde lieferte uns sahnige Milch, Käse, Jogurt und Takepa, den trockenen Hartkäse; die andere Herde bestand nur aus männlichen Tieren, die hauptsächlich zur Arbeit herangezogen wurden. Diese zähen Kreaturen transportierten Salz von Tibet nach Bhutan und brachten auf dem Rückweg Reis aus Kurtoi mit, wo wir einige Felder besaßen. Nach dem Einmarsch der Chinesen in Tibet wurden die alten Handelswege jedoch geschlossen; jetzt trugen die Yaks nur mehr zwei- oder dreimal im Jahr den Reis über den 4100 Meter hohen Rodong-La-Pass von den subtropischen Regionen Kurtois ins klimatisch gemäßigte Bumthang. In den übrigen Monaten des Jahres blieben die Tiere auf den hohen Bergweiden, sodass wir sie kaum je zu Gesicht bekamen. Über beinahe drei Generationen hatten ein gewisser Mimi Kaydola und seine beiden Söhne, Shanty und Khandola, die männliche Yakherde unserer Familie versorgt. Als ich alt genug war, um mich an Dinge erinnern zu können, war nur noch Mimi Khandola am Leben, der unsere Herde nach wie vor hütete. Ich erinnere mich gut an ihn. Er war bereits ein alter Mann mit ergrauten Haaren und grauen Bartsträhnen im Gesicht, die sich unordentlich und widerspenstig über seine Wangen und sein Kinn kringelten. Die Kinder im Dorf waren von ihm fasziniert, denn für sie war Mimi Khandola gleichbedeutend mit den Yaks, und die Yaks lebten in einer Region, die er »die Welt des Migoi« nannte. Wenn er uns besuchte, ließen wir sofort alles stehen und liegen, beobachteten die langsam voranschreitende Prozession der großen Tiere und sangen dazu »Yakyey, Yakyey!« oder »Yaks, Yaks!« wie ein einsilbiges Mantra. Mimi Khandola schlenderte neben seinen Tieren einher, rief ein jedes beim Namen und schnalzte laut mit der Zunge, um ihnen die Richtung zu weisen.
Zum Leben brauchte Khandola nicht viel. Früher bekamen die Hirten statt eines Lohns eine monatliche Ration, die Phok genannt wurde, und dazu Kleidung. Mimi Khandola erhielt seinen Phok allerdings nur selten zur rechten Zeit; für gewöhnlich holte er ihn ein paar Monate früher oder später ab – meine Mutter richtete sich dabei immer ganz nach ihm. Wenn die Yaks zu uns herunterkamen, erhielt jedes Tier seine Salzration. Dazu wurde ein Horn mit etwa dreihundert Gramm Salz gefüllt, dann hielt einer den Kopf des Yaks fest, und ein zweiter stopfte ihm den Inhalt des Horns ins Maul. Man sagte uns, die Tiere würden das Salz brauchen. Sie schüttelten dann den zotteligen Kopf, aus ihren Mundwinkeln tropfte ein Gemisch aus Speichel und Salz, und silbrige Fäden hingen ihnen vom Kinn herab, doch sie spuckten das Salz nie aus. Manchmal mussten sie niesen, wobei sie dann sehr zur Freude der Kinder kräftig salzigen Speichel versprühten.
Nachdem die Yaks ihre Salzration erhalten hatten, suchten sie sich einen schattigen Platz im Hof unseres Guts, wo sie sich ermattet und keuchend hinlegten, denn sie konnten die Hitze in den Tälern nur schlecht ertragen. Und während Mimi Khandolas Vorräte hergerichtet wurden, drängten wir Kinder uns um den alten Mann und baten ihn, uns Geschichten von seinem Leben in der Wildnis zu erzählen. Besonders interessierten wir uns für alles, was mit dem Yeti zu tun hatte, über den Khandola sprach wie über einen Gefährten. Wenn wir ihn fragten, ob es den Migoi, so nennen wir den Yeti, wirklich gebe, setzte er ein so sanftes wie rätselhaftes Lächeln auf und fragte nur: »Den Migoi?« Wie um sich zu vergewissern, wiederholte er immer erst einen Teil einer Frage, die man ihm stellte. »Natürlich! Das ist mein Kamerad, ich lebe doch in der Welt des Migoi.«
»Aber hast du nicht Angst vor ihm?«
»Angst? Warum sollte ich Angst vor ihm haben? Ich tue ihm nichts, also tut er mir auch nichts.« Wir glaubten zwar in unserer kindlichen Unschuld, dass Mimi Khandola uns die Wahrheit sagte, doch die Erwachsenen lachten immer nur ängstlich und sagten: »Ah, Mimi Khandola, lügst du uns an, oder sprichst du wirklich die Wahrheit?«
Mimi Khandola sprach vom Migoi stets wie von einem ganz normalen Yak oder einer Bergweide. Vor dem Tiger etwa hatte er sehr viel mehr Angst und auch Ehrfurcht. Bei seinem letzten Besuch im Dorf erzählte er uns von einem Geschehen, das ihn offensichtlich sehr beeindruckt hatte. Ein Migoi war anscheinend eines gewaltsamen Todes gestorben. Das hatte Khandola sehr mitgenommen; er machte einen verwirrten Eindruck auf uns, und merkwürdigerweise starb er bald danach selbst. Wie sich herausstellte, war der Tod des Migoi mehr als nur eine Art Vorbote seines eigenen Todes gewesen. So wie er gelebt hatte, starb er auch – allein in der Wildnis, inmitten der großartigen Schönheit der Berge, und nur mit den Yaks als stummen Zeugen seines Todes.
Ein paar Männer des Dorfes erklärten sich bereit, Mimi Khandolas Leichnam von den Sommerweiden herunterzuholen und zum Einäscherungsplatz in der Nähe des Dorfes zu bringen. Nach dem Phowa-Ritual für die Verwandlung seines Bewusstseins zur Zeit des Todes führte der Dorfastrologe das Ro-stid-thama durch, die Berechnungen und Weissagungen für den Leichnam. Dabei stellte sich heraus, dass die Bergdämonen Mimi Khandolas Lebenskraft im Verlauf eines ungewöhnlich schrecklichen Erlebnisses aus ihm herausgezogen hatten. Alle waren sich sicher, dass es sich dabei nur um den Überfall der Wildhunde auf den Migoi gehandelt haben konnte. Bei den Totenritualen für einen Menschen wird dieser nicht durch seinen Namen repräsentiert, sondern durch sein Geburtsjahr, also zum Beispiel durch den Zwölfjahreszyklus, in dem jedem Jahr ein Tier zugeschrieben wird. Mimi Khandola war im Jahr des Affen geboren worden. Der Astrologe erklärte, dass das, was Mimi Khandola als den Tod des Migoi – der einem großen Affen ähneln soll – erlebte, sehr wahrscheinlich eine Vision seines eigenen Todes gewesen war. Er hatte also seinen Tod mehrere Tage vor dem eigentlichen Sterben vorausgesehen.
Es war mitten im Sommer, erzählte uns Mimi Khandola, und er hatte seine Yaks auf eine der höchsten und entlegensten Weiden geführt. Die Tiere litten unter der drückenden Hitze; auf Weiden in kühlerer Höhe hingegen fühlten sie sich immer wohl. Der Umzug auf das höher gelegene Weideland war langsam, aber reibungslos vonstatten gegangen; die Tiere hatten sich recht gut an den Weg gehalten, und so waren sie bereits am frühen Nachmittag an ihrem Ziel angekommen. Mimi Khandola lud seine Habe ab, die zwei Yaks getragen hatten, und legte alles unter einen Felsvorsprung, unter dem er die nächsten Tage lagern wollte. Die Tiere verteilten sich bald auf den Weiden, und Mimi Khandola setzte sich in den Schatten des Felsens und kochte Tee. Nachdem er einige Tassen getrunken hatte, in die er etwas Kaphe gestreut hatte, das sättigende, geröstete Gerstenmehl, lehnte er sich an einen Yaksattel und schlief ein Weilchen.
Als er aufwachte, ging gerade die Sonne unter; ein kühler Wind war aufgekommen. Da es bald dunkel sein würde – in den Bergen bricht die Nacht sehr rasch herein –, sammelte er herumliegendes Holz und trug es zu seinem Schlafplatz. In der Nähe stand ein Bambuswald; er schnitt ein ganzes Bündel Bambusstangen und zog sie zu seinem Lagerplatz – Bambus ist in der Wildnis immer gut zu gebrauchen. Doch während er Bambus schnitt und hin- und herlief, fiel ihm auf, dass sich viele der Yaks zusammengedrängt hatten und nervös und unruhig zu sein schienen. Ängstlich reckten sie die Köpfe hoch und blickten in die Ferne. Bis er das Feuer angezündet und einen Haufen Steine für seine Schleuder gesammelt hatte, waren einige der Tiere bereits in Panik geraten; die anderen drängten sich so eng es ging zusammen, als spürten sie eine unbekannte Gefahr.
Mimi Khandola saß am Feuer, beobachtete die Tiere und versuchte, sich auf das Spinnen der Wolle zu konzentrieren, was ihn gewöhnlich beruhigte. Er rollte den Griff seiner Spindel am Oberschenkel entlang, ließ sie dann sich drehen und dabei die Wolle laufen, die er wie einen Armreif am linken Handgelenk trug. Aber plötzlich stoben die Yaks in alle Richtungen auseinander. Mimi Khandola stand auf, um nachzusehen, was passiert war. Kleine, rötlich gelbe Tiere hetzten hinter den fliehenden Yaks her – Wildhunde, diese widerlichen, gefürchteten Räuber! Sie versetzten ihn sofort in einen Zustand höchster Wachsamkeit, und eine plötzliche Panik erfasste ihn. Wild durcheinander und mit angstvoll erhobenen Schwänzen rannten die Yaks vor den Hunden davon. Mimi Khandola zählte mindestens zwölf der wilden Jäger, die wie ein erfahrenes Team zusammenarbeiteten und sich ein Opfer aussuchten.
Schon bald hatten sie den alten Dawala (das heißt Mond; dieser tiefschwarze Yak hatte auf der Stirn einen weißen Kreis) eingekesselt. Die Wildhunde waren schlau genug, immer die schwächsten oder ältesten Tiere auszuwählen. In einem Kreis knurrender, zähnefletschender Angreifer kämpfte der alte Yak um sein Leben. Doch die Überzahl und die unglaubliche Wendigkeit seiner Feinde brachten ihn vollkommen durcheinander. Die Wildhunde taktierten und arbeiteten bestens zusammen. Während einige ihr Opfer von vorne ablenkten, schlugen die anderen von hinten immer wieder zu – die bevorzugte Angriffstaktik der Meute. Ein paar der Hunde kratzten sogar Erde auf und schleuderten sie dem Yak ins Gesicht, als wollten sie ihn blenden. Dann sprangen mindestens zwei Wildhunde Dawala an und gruben ihre Zähne tief in seinen Nacken. Hilflos brüllte der Yak im Todeskampf, doch nun rissen ihm die anderen Tiere bereits die Eingeweide heraus; er fiel keuchend in sich zusammen wie ein Ballon, aus dem die Luft entwichen ist, und ging mit einem dumpfen Aufschlag zu Boden. In dem lauten Durcheinander von fliehenden Yaks, knurrenden Hunden und dem keuchenden Opfer ging das scharfe Zischen von Mimi Khandolas Schleuder unbemerkt unter. Nun machten sich die Räuber voller Heißhunger über ihre Beute her; knurrend und kläffend rissen sie in wilder Hast den Körper des Yaks in Stücke. Mimi Khandola zielte wieder und wieder und schleuderte durch die Nacht einen Stein nach dem anderen auf die Räuber. Ab und zu war ein lautes Knacken des Bambus im Feuer zu hören und über allem Mimi Khandolas Stimme, der aus voller Kehle schrie. Schließlich, nachdem sie den größten Teil ihrer Beute verschlungen hatten, zerstreuten sich die Wildhunde zögerlich. Von dem riesigen Yak aber war kaum etwas übrig geblieben.
Mimi Khandola blieb die ganze Nacht wach, und seine Yaks standen dicht gedrängt zusammen. Immer wieder nahm er die Schleuder zur Hand und sandte ein scharfes Zischen durch die Nacht, und ab und zu legte er ein Stück Bambus nach, der laut krachend in den Flammen zerbarst.
In den nächsten Tagen hütete Mimi Khandola die Tiere besonders umsichtig. Er hoffte, dass diese räudigen elenden Kreaturen endgültig verschwunden waren. Aber trotzdem beschloss er, die Yaks bald wieder auf eine andere Weide zu bringen.
Der Platz unter dem überhängenden Felsen war kaum groß genug für Mimi Khandola, um sich hinzulegen. Er schlief eingeengt zwischen dem Felsen und den Yaksätteln, die er parallel zur Felswand aufgereiht hatte, und normalerweise schlief er sehr gut. Er hatte soeben nach den Tieren gesehen, seine übliche Mahlzeit verzehrt und wollte gerade unter seine Decken aus Yakhaar schlüpfen, als er das einsame Heulen eines Wildhundes vernahm. Es wurde von einem zweiten, ebenso traurig klingenden Heulen erwidert, das aber aus noch weiterer Ferne zu kommen schien. »Ach, diese ekligen Wildhunde«, brummte Mimi Khandola vor sich hin und stand auf, um noch ein paar Steine für seine Schleuder zu sammeln. Es war bereits dunkel, sodass er die Steine kaum sehen konnte; er tastete mehr nach ihnen. Und er spürte, dass auch die Yaks auf der Hut waren. Die meisten von ihnen lagen zwar am Boden, doch sie starrten ängstlich in die Dunkelheit, und einige waren aufgestanden und bereit zur Flucht. Mimi Khandola ging zu ihnen, schnalzte mit der Zunge und streichelte sie beruhigend. Danach herrschte lange Zeit absolute Stille. Und plötzlich brach der Vollmond durch die Wolken und tauchte alles in silbernes Licht.
»Heute ist Vollmond. Kein Wunder also, dass die Hunde den Mond anheulen«, dachte Mimi Khandola erleichtert und setzte sich wieder unter seine Decken. Doch schlafen konnte er nicht mehr. Während er die mondbeschienene Landschaft betrachtete, hörte er einen herzzerreißenden Laut, der niemals von einem Wildhund herrühren konnte. Er lauschte angespannt und hatte das Gefühl, dass sich der Laut näherte. Dann waren erneut die Hunde zu hören. Sie jaulten und kläfften wie zuvor, als sie den alten Yak angegriffen hatten. Vielleicht hatte Mimi Khandola nicht richtig gezählt; vielleicht fehlte eines der Tiere und fiel nun den wilden Räubern zum Opfer. Ohnmächtig saß er da und horchte auf die wilden Laute, und dabei schwirrten ihm Zahlen im Kopf herum. Vielleicht hatte er nur drei-mal-fünfzehn-und-drei gezählt anstatt drei-mal-fünfzehn-und-vier? (Die meisten Bhutaner zählen in Zwanziger-Einheiten, doch Mimi Khandola kannte nur die Zahlen bis fünfzehn.) Es war ein Stöhnen und Knurren zu hören, das nicht von den Wildhunden stammen konnte, aber mit Sicherheit auch nicht von einem Yak. Was mochten die Jäger diese Nacht erbeutet haben?





























