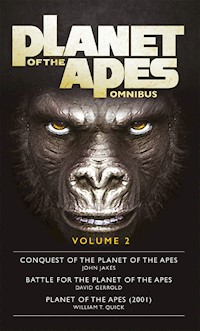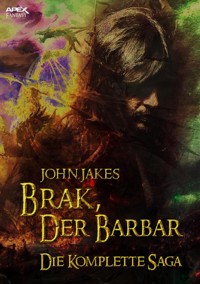6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte zweier Familien
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Bürgerkrieg ist vorüber. Stolz erhebt sich der siegreiche Norden über den gedemütigten Süden. Die Sklaverei ist besiegt, doch der Klu-Klux-Klan schürt neue Ängste. Vor dieser gespenstischen Kulisse begegnen sich auch die beiden Familien der Hazards und Mains wieder.
Werden sie Sieg und Niederlage vergessen und ihre Freundschaft fortführen oder zerstören Hass und verletzter Stolz ihre gemeinsame Geschichte?
Der dritte Teil der Familiensaga - ein monumentales Epos über Liebe, Hass und Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1281
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber den AutorTitelImpressumZitatWidmungPersonenverzeichnisProlog: Die große Parade 1865Erstes Buch: In aussichtsloser Lage123456789101112Zweites Buch: Eine Winterbilanz1314151617181920212223Drittes Buch: Banditi242526272829303132333435363738Viertes Buch: Das Jahr der Heuschrecke394041424344454647Fünftes Buch: Washita4849505152535455Sechstes Buch: Der Weg in die ewigen Jagdgründe56575859606162636465Siebtes Buch: Über den Jordan6667686970717273Epilog: Der Exerzierplatz 1883NachwortÜber den Autor
John Jakes wurde 1932 in Chicago geboren und lebt heute in Connecticut und South Carolina. Nach dem Studium der amerikanischen Literatur und langjähriger Tätigkeit in Public-Relations-Agenturen, begann er eine Karriere als Schriftsteller. Weltberühmtheit erlangte er mit seiner großen Trilogie über den Amerikanischen Bürgerkrieg, die unter dem Titel »Fackeln im Sturm« verfilmt wurde.
John Jakes
HIMMEL UNDHÖLLE
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonWerner Waldhoff
beHEARTBEAT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1987 by John Jakes
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Heaven and Hell«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1988/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Motiven © shutterstock/KennStilger47, © shutterstock/Brzostowska
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-2851-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Der Verlust des Himmels
ist der größte Schmerz
in der Hölle.
CALDERÓN DE LA BARCA
Für all meine Freunde bei Harcourt Brace Jovanovich
Personenverzeichnis
Mit Ausnahme der historischen Gestalten sind alle Figuren in diesem Roman frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Menschen aus Vergangenheit oder Gegenwart ist zufällig.
Die Hazards
GeorgeStahlindustrieller in Lehigh Station, Pennsylvania
ConstanceGeorges Frau
Stanleyein farbloser Beamter in Washington mit wachsender Neigung zum Alkohol
IsabelStanleys ehrgeizige Frau
BillyBerufsoffizier, sucht nach dem Bürgerkrieg sein Glück als Bauunternehmer in Kalifornien
Brett, geb. MainBillys Frau
Virgiliamilitante Verfechterin der Gleichberechtigung für Schwarze
Die Mains
CooperErbe der Main-Plantage in South Carolina, Beamter in Charleston
JudithCoopers Frau
Marie-LouiseJudiths und Coopers halbwüchsige Tochter
CharlesCoopers Cousin, hat als Berufsoffizier auf der Seite der Sezession gekämpft, wurde deshalb aus der US-Armee ausgeschlossen
MadelineWitwe von Coopers im Krieg gefallenem Bruder Orry, Verwalterin der Main-Plantage
Ashtondas verstoßene schwarze Schaf der Familie, schreckt vor nichts zurück, um sich zu rächen
Weitere wichtige Personen
Elkanah BentIntimfeind der Familien Main und Hazard, hat nach einer schweren Kopfverletzung den Verstand verloren
Willa Parkereine junge Schauspielerin, die alles daransetzt, um Charles Main sein Kriegstrauma bewältigen zu helfen
Desmond LaMotteein Tanzlehrer alter Schule, Verwandter von Madeline Mains erstem Mann, will eine alte Schmach seiner Familie rächen
Scipio Brownein schwarzer Lehrer und Kinderheimleiter, alter Bekannter Virgilia Hazards
Theo Germanein junger US-Offizier im Dienst in South Carolina, findet große Sympathie bei Marie-Louise Main
Prolog
Die große Parade1865
… Friede, Friede rufend,wenn es keinen Frieden gibt.
JEREMIAS 6,14; 8,11
Die ganze Nacht hindurch regnete es in Washington. Kurz vor Tagesanbruch des 23. Mai – ein Dienstag – erwachte George Hazard in seiner Suite im Willard-Hotel. Er legte eine Hand auf die warme Schulter seiner Frau und lauschte.
Kein Regen mehr.
Die Stille war ein gutes Omen für diesen Feiertag. Heute Morgen begann eine neue Ära, eine Ära des Friedens, mit einer geretteten Union.
Warum hatte er dann dieses Gefühl drohenden Unheils?
George glitt aus dem Bett. Das Flanellnachthemd umflatterte seine behaarten Waden, als er sich aus dem Zimmer stahl. George war jetzt einundvierzig, ein untersetzter Mann mit kräftigen Schultern, dessen unterdurchschnittliche Größe ihm bei seinen Klassenkameraden in West Point den Spitznamen »Stumpf« eingetragen hatte. Grau durchsetzte sein dunkles Haar und den sauber gestutzten Bart, den er wie so viele andere noch trug, um zu zeigen, dass er in der Armee gedient hatte.
Er schlurfte ins Wohnzimmer, das mit Zeitungen und Zeitschriften übersät war; gestern Abend war er zu müde gewesen, um sie noch aufzuheben. Er begann sie einzusammeln und zu stapeln, wobei er sich bemühte, so leise wie möglich zu sein. Im zweiten und dritten Schlafzimmer schliefen seine Kinder. William Hazard III. war im Januar sechzehn geworden. Ende des Jahres würde Patricia dieses Alter erreichen. Das vierte Schlafzimmer gehörte Georges jüngerem Bruder Billy und dessen Frau Brett. Billy würde heute in der Parade mitmarschieren, hatte aber die Erlaubnis erhalten, die Nacht außerhalb des Pionierlagers von Fort Berry zu verbringen.
Die Zeitungen und Zeitschriften schienen Georges düstere Vorahnung verspotten zu wollen. Die New York Times, die Tribüne, der Washington Star, die letzten Ausgaben von Army und Navy Journal hörten sich alle gleichermaßen triumphierend an. Während er auf dem Nebentisch einen sauberen Stapel auftürmte, stachen ihm die Sätze ins Auge:
Obwohl unser gigantischer Krieg erst seit einigen Tagen beendet ist, haben wir bereits mit der Auflösung der großartigen Unionsarmee begonnen …
Sie hat die Rebellion zerschmettert, die Union gerettet und für sich und uns ein Land gewonnen …
Das Kriegsministerium hat angeordnet, sechshunderttausend Blankoentlassungen auf Pergamentpapier zu drucken …
Unsere selbstbewusste Republik entlässt ihre Armeen, schickt ihre treuen Soldaten heim, schließt ihre Rekrutierungszelte, hebt ihre Materialkontrakte auf und bereitet sich darauf vor, den düsteren Pfad des Krieges zu verlassen, um die breite, helle Straße des Friedens zu beschreiten …
Die Feierlichkeiten dafür fanden heute und morgen statt: eine große Parade von Grants Potomac-Armee und Uncle Billy Shermans raubeiniger Armee des Westens. Grants Männer würden heute marschieren; Shermans Truppen morgen. Shermans Westerner taten Grants Männer aus dem Osten spöttisch als »Papierkragen« ab. Vielleicht würden die Westerner ihre Parade mit Kühen und Ziegenböcken, Mulis und Kampfhähnen abhalten, die sie in ihr Camp an den Ufern des Potomac mitgebracht hatten.
Nicht alle Männer, die in den Krieg gezogen waren, würden mitmarschieren. Einige ruhten, getrennt von ihren Lieben, für immer in der Erde, so wie Georges bester Freund Orry. George und Orry hatten sich 1842 als Rekruten in West Point kennengelernt. Gemeinsam hatten sie als Soldaten in Mexiko gekämpft und sich ihre Freundschaft über die Kapitulation von Fort Sumter hinaus bewahrt, in deren Folge der Krieg sie auf verschiedene Seiten stellte. In dessen letzten Tagen fand Orry den Tod bei Petersburg. Nicht in der Schlacht – er fiel der dummen, sinnlosen, rachsüchtigen Kugel eines verwundeten Unionssoldaten zum Opfer, dem er hatte helfen wollen.
Einige der jungen Männer, die der Krieg alt gemacht hatte, zogen immer noch über die Straßen des Südens, auf dem Heimweg zu Not und Elend und Armut in einem Land, das vom Hunger und von den Feuern der Eroberungsbataillone beherrscht wurde. Andere saßen noch in nordwärts fahrenden Zügen, an Körper und Geist verstümmelt von den Kloaken, die als Rebellengefängnisse herhalten mussten. Manch einer der konföderierten Soldaten war nach Mexiko verschwunden oder weiter nach Westen gegangen, um seine unsichtbaren Wunden zu vergessen. Orrys junger Cousin Charles hatte den Weg nach Westen gewählt.
Für viele andere hatte der Krieg in Schmach und Schande geendet. Das galt in erster Linie für Jeff Davis, der sich nach Irwinville, Georgia, geflüchtet hatte. Viele Zeitungen des Nordens behaupteten, er habe der Gefangennahme zu entgehen versucht, indem er sich unter einem Damenkleid versteckte. Wie immer auch die Wahrheit lauten mochte, für gewisse Elemente im Norden war Gefängnis für Davis bei Weitem nicht ausreichend. Sie schrien nach dem Strick.
George zündete sich eine seiner teuren kubanischen Zigarren an und ging hinüber zu den Fenstern mit Blick auf die Pennsylvania Avenue. Von der Suite aus hatte man einen herrlichen Blick auf die Route, die die heutige Parade nehmen würde, doch er hatte Sonderkarten für die Tribüne direkt hinter dem Präsidenten. Vorsichtig schob er ein Fenster hoch.
Der Himmel war wolkenlos. Er lehnte sich vor, um den Zigarrenrauch hinauszulassen; überall an den drei- und vierstöckigen Gebäuden der Avenue hingen patriotische Flaggen. Lebhaftere Dekorationen hatten endlich die Trauertücher verdrängt, die man allerorten nach Lincolns Ermordung hatte sehen können.
Ein scharlachrotes Lichtband über dem Becken des Potomac markierte den Horizont. Unten auf der schlammigen Avenue begannen sich Vehikel, Reiter und Fußgänger in Bewegung zu setzen. George sah zu, wie eine schwarze Familie – Eltern und fünf Kinder – in Richtung des Präsidentenparks eilte. Für sie gab es mehr als nur das Kriegsende zu feiern. Der dreizehnte Nachtrag zur Verfassung garantierte ihnen, dass die Sklaverei für immer abgeschafft war; die Staaten mussten ihn nur noch ratifizieren, um ihn zum Gesetz zu erheben.
Ein heller werdender Himmel, ein Farbenspiel von Rot, Weiß und Blau und kein Regen mehr – warum wich unter solch günstigen Voraussetzungen seine dunkle Vorahnung nicht?
Es lag an den Familien, entschied er, den Mains und den Hazards. Sie hatten den Krieg überlebt, aber sie hatten schwer gelitten. Virgilia, seine Schwester, gehörte nicht mehr zur Familie; ihr Extremismus hatte sie in ein selbst gewähltes inneres Exil getrieben. Das war besonders traurig, da Virgilia direkt hier in Washington lebte, wenn auch George ihren genauen Aufenthaltsort nicht kannte.
Dann gab es da noch seinen älteren Bruder Stanley; ein inkompetenter Mann, der durch Kriegsprofite skrupellos einen gewaltigen Geldberg angehäuft hatte. Trotz seines Erfolges – oder vielleicht gerade deswegen – war Stanley ein Säufer.
Bei den Mains sah es nicht besser aus. Orrys Schwester Ashton war irgendwo im Westen verschwunden, nachdem sie an einer erfolglosen Verschwörung zum Sturz der Davis-Regierung zugunsten einer extremeren Regierung beteiligt gewesen war. Orrys Bruder Cooper, der in England für das Marineministerium der Konföderierten tätig gewesen war, hatte seinen einzigen Sohn Judah verloren, als ihr Schiff auf der Rückfahrt vor Fort Fisher von einem Blockadeschiff der Union versenkt worden war.
Und dann war da noch Madeline, die Witwe seines besten Freundes Orry, die sich der schweren Aufgabe gegenübersah, ihr Leben und die abgebrannte Plantage am Ashley River in der Nähe von Charleston neu aufzubauen. George hatte ihr einen Kreditbrief über vierzigtausend Dollar gegeben, auf die Bank, die mehrheitlich ihm gehörte. Er hatte gehofft, dass sie um weitere Beträge bitten würde; der größte Teil der ursprünglichen Summe war für die Zinsen zweier Darlehen und für Bundessteuern benötigt worden; außerdem hatte sie verhindern müssen, dass der Besitz von Agenten des Schatzamts, die bereits den Süden überzogen, konfisziert und weiterverkauft wurde. Trotzdem hatte sich Madeline nicht bei ihm gemeldet, und das beunruhigte ihn.
Selbst zu dieser frühen Stunde herrschte sehr reger Fuhrverkehr auf der Avenue. Es war ein denkwürdiger Tag, und wenn er dem Himmel und der sanften Brise trauen konnte, dann würde es auch ein wunderschöner Tag werden. Warum war er dann nicht in der Lage, dieses Gefühl nahenden Unheils zu bannen, nachdem er nun seine Befürchtungen, was die beiden Familien anbelangte, beim Namen genannt hatte?
Die Hazards nahmen ein schnelles Frühstück zu sich. Vor allem Brett wirkte besonders glücklich und aufgeregt, dachte George mit einem gewissen Neid. In wenigen Wochen wollte Billy sein Entlassungsgesuch einreichen. Dann würden die beiden an Bord eines Schiffes nach San Francisco gehen. Sie hatten zwar Kalifornien nie gesehen, fühlten sich aber durch Schilderungen des Klimas, der Landschaft und die unbegrenzten Möglichkeiten angezogen. Billy wollte dort eine eigene Baufirma gründen. So wie sein Freund Charles Main, mit dem zusammen er West Point absolviert hatte – inspiriert von George und Orry, wollte er so weit wie möglich von den narbenbedeckten Schlachtfeldern weg, wo Amerikaner gegen Amerikaner gekämpft hatten.
Das Paar hatte es eilig mit dieser Reise. Brett ging mit ihrem ersten Kind schwanger. Billy hatte es George vertraulich mitgeteilt; der Anstand gebot, dass über eine Schwangerschaft nicht gesprochen wurde, nicht einmal unter Familienmitgliedern. Wenn die Zeit einer Frau gekommen war und ihr Bauch sich deutlich rundete, dann taten die Leute so, als würden sie nichts bemerken. Beim zweiten Kind erzählten die Eltern dem Erstgeborenen oft genug, dass der Doktor das Baby in einer Flasche gebracht habe. George und Constance hielten die meisten der Schicklichkeitsnormen ein, auch wenn sie viele für albern hielten, doch auf die Geschichte mit der Flasche hatten sie sich nie eingelassen.
Gegen acht Uhr fünfzehn erreichte die Familie ihren Tribünenabschnitt. Sie nahmen zwischen Reportern, Kongressabgeordneten, Richtern des Obersten Gerichtshofs und hohen Armee- und Marineoffizieren Platz. Zu ihrer Linken zog sich die Avenue um das Schatzamt in der Fifteenth Street; hinter der Biegung lag der lange Anstieg der Straße zum Kapitol.
Zu ihrer Rechten drängten sich, soweit der Blick reichte, Menschen hinter Barrikaden, hingen aus Fenstern und saßen auf Dächern und durchhängenden Baumästen. Direkt gegenüber stand der überdachte Pavillon für die Gäste von Präsident Johnson, zu denen die Generäle Grant und Sheridan und Stanley Hazards Arbeitgeber, Kriegsminister Stanton, gehören würden. An der vorderen Dachlinie des Pavillons hingen zwischen Wimpeln und Immergrün Banner mit den Namen der Unionssiege:
ATLANTA und ANTIETAM, GETTYSBURG und SPOTSYLVANIA und viele andere.
Viertel vor neun war immer noch nichts vom Präsidenten zu sehen. Ein Meer von Klatsch umspülte zurzeit den derben, ungehobelten Mann. Die Leute meinten, dass es ihm an Takt fehle; außerdem war er ein schwerer Trinker. Und er war recht ordinär – nun, das zumindest stimmte. Andrew Johnson, ein Schneider und späterer Senator, hatte als Sohn eines Kneipenkellners selbst für seine Bildung sorgen müssen, jedoch besaß er nicht Lincolns Fähigkeit, die schlichte Herkunft zu seinem persönlichen Vorteil auszunutzen. George kannte Johnson. Er hielt ihn für einen schroffen, starrsinnigen Mann, der der Verfassung in beinahe religiöser Weise ergeben war. Das allein brachte ihn schon in Widerspruch zu den Radikalen Republikanern, die die Verfassung gerne nach ihrem Wunsch interpretiert hätten, um so ihre Vision der Gesellschaft durchzusetzen.
George war in vielen Punkten mit den Radikalen einer Meinung, wozu auch die Bürgerrechte und das Wahlrecht für geeignete Männer beider Rassen gehörten. Doch immer häufiger fand er die Motive und die Taktiken der Radikalen abstoßend. Viele von ihnen machten kein Geheimnis aus ihrer Absicht, den Schwarzen allein dafür das Stimmrecht zu gewähren, dass die Republikaner zur Mehrheitspartei wurden, und so die traditionell demokratische Herrschaft über das Land zu brechen. Die Radikalen trugen den Besiegten gegenüber Feindseligkeit zur Schau, was sich allerdings auch auf alle anderen Gruppierungen erstreckte, die sie für ideologisch unrein hielten.
Präsident Johnson und die Radikalen standen sich in einem zunehmend heftiger werdenden Kampf um den Wiederaufbau der Union gegenüber. Der Streit war nicht neu. Lincoln hatte 1862 seinen Louisianaplan vorgelegt, den er später noch erweiterte, um die Wiederaufnahme eines jeden abtrünnigen Staates zu ermöglichen, falls ein »nennenswerter Kern« von Wählern – lediglich zehn Prozent der 1860 zugelassenen – ein Loyalitätsgelübde ablegte und eine Pro-Union-Regierung einsetzte.
Im Juli 1864 hatten die Radikalen Republikaner mit einer Gesetzesvorlage zurückgeschlagen, die von Senator Ben Wade aus Ohio und dem Abgeordneten Henry Davis aus Maryland eingebracht worden war. Darin wurde ein wesentlich schärferer Wiederaufbauplan umrissen, einschließlich der Maßnahme, dass über die geschlagene Konföderation das Militärrecht verhängt werden sollte. Das Gesetz schob dem Kongress die Kontrolle über den Wiederaufbau zu. Anfang 1865 hatte Tennessee eine Regierung entsprechend dem Lincolnplan gebildet, angeführt von einem Nationalrepublikaner namens Brownlow. Die Radikalen im Kongress verweigerten den gewählten Repräsentanten dieser Regierung die Anerkennung.
Andrew Johnson beschuldigte Jefferson Davis, die Ermordung Lincolns im Ford’s Theatre »inspiriert und herbeigeführt« zu haben. Er erhob die obligaten scharfen Anklagen gegen den Süden, beharrte aber auch darauf, Lincolns gemäßigtes Programm durchzuführen. Erst vor Kurzem hatte George gehört, dass Johnson beabsichtigte, das Programm im Sommer und Herbst mittels Präsidentenerlass durchzusetzen. Da der Kongress Sitzungspause hatte und erst wieder spät im Jahr zusammentreten würde und da Johnson ganz gewiss keine Sondersitzung einberufen würde, konnte er den Radikalen einen Strich durch die Rechnung machen.
Die politische Windrichtung wies also auf Gegenschläge der Radikalen hin. Eine von Georges Missionen in Washington bestand darin, einem mächtigen Politiker aus Pennsylvania seine Ansichten darzulegen. Er spendete der Partei jährlich so viel, dass er sich dazu berechtigt fühlte. Vielleicht konnte er sogar etwas Gutes bewirken.
»Papa, da ist Tante Isabel«, sagte Patricia hinter ihm.
George entdeckte Stanleys Frau, die aus der Präsidentenloge winkte. Er zog eine Grimasse und winkte zurück. »Sie wollte sichergehen, dass wir sie auch gesehen haben.«
Brett lächelte. Constance tätschelte seine Hand. »Komm, George, sei nicht gehässig. Du würdest mit Stanley nicht den Platz tauschen wollen.«
George zuckte die Schultern und ließ seine Blicke weiterhin über die Menge schweifen, auf der Suche nach dem Kongressabgeordneten aus seinem Staat, mit dem er sprechen wollte. Während er damit beschäftigt war, griff Constance in ihre Tasche nach einem Bonbon. Ihr rotes Haar kringelte sich glänzend unter dem modischen Strohhut hervor. Sie besaß noch immer diese helle irische Lieblichkeit, doch seit ihrer Hochzeit – gegen Ende des Mexikanischen Krieges – hatte sie dreißig Pfund zugenommen. George störte es nicht; er betrachtete das Gewicht als ein Zeichen von Zufriedenheit.
Pünktlich um neun donnerte beim Kapitol eine Kanone los. Kurz darauf hörten die Hazards in der Ferne eine Blaskapelle When Johnny Comes Marching Home spielen. Dann vernahmen sie, wie unsichtbare Tausende den Paradeeinheiten hinter der Biegung zujubelten. Bald schon marschierten die ersten Soldaten um die Ecke beim Schatzamt, und alle sprangen auf, klatschten und schrien Hurra.
Der wie ein Gelehrter wirkende General George Meade führte die Parade an; unter stehenden Ovationen ritt er auf den Präsidentenpavillon zu. Auf den Bäumen sitzende kleine Jungs beugten sich weit vor, um zu klatschen, und wären beinahe abgestürzt. Meade salutierte vor den Würdenträgern mit seinem Säbel – bis jetzt waren weder Grant noch Johnson erschienen –, dann übergab er sein Pferd einem Corporal und setzte sich zu ihnen.
Frauen jubelten. Männer weinten ganz offen, ein Mädchenchor sang und streute Blumen auf die Straße. Die Sonne ließ die Alabasterkuppel des Kapitols in weißem Feuer aufglühen, als General Wesley Merritt die Dritte Division heranführte. Der reguläre Befehlshaber, Little Phil Sheridan, war bereits unterwegs zum Golf von Mexiko, um dort seinen Dienst anzutreten. Als die Dritte erschien, sprang selbst William auf, der ansonsten die übliche Verachtung der Heranwachsenden für fast alles und jedes zeigte, und pfiff und klatschte.
Zugweise, jeweils sechzehn Reiter nebeneinander, so zog mit blitzenden Säbeln Sheridans Kavallerie vorüber. Die Kavalleristen mit ihren frisch gestutzten Bärten sahen sauber und ordentlich aus und zeigten kaum Anzeichen von Kriegsmüdigkeit. Viele von ihnen hatten Gänseblümchen oder Veilchen in die Mündungen ihrer geschulterten Karabiner gesteckt.
Jeder Dienstgrad senkte den Säbel vor dem Präsidenten, der endlich mit entschuldigendem Gesichtsausdruck zusammen mit General Grant den Pavillon betreten hatte. George hörte, wie eine Frau einige Reihen hinter ihm laut fragte, ob Johnson bereits betrunken sei.
Staubwolken stiegen auf. Der Geruch von Pferdeäpfeln wurde stärker. Dann hörte George von der Fifteenth Street her aufbrausenden Jubel: »Custer! Custer! Custer!«
Und da kam er, auf seinem zierlich die Hufe setzenden Braunen, Don Juan: der »Boy General« – schulterlange Locken, blond mit rötlichem Unterton, scharlachfarbenes Halstuch, goldene Sporen, den breitkrempigen Hut als Dank für den Jubel gezogen. Nur wenige Unionsoffiziere hatten Öffentlichkeit und Presse so für sich eingenommen. George Armstrong Custer war der Jüngste in West Point gewesen, Brigadier mit dreiundzwanzig, Generalmajor mit vierundzwanzig. Zwölf Pferde waren unter ihm zusammengeschossen worden. Er war furchtlos oder tollkühn, je nach Betrachtungsweise. Es hieß, er wolle Präsident werden, nachdem sich Ulysses Grant um das Amt beworben hatte. Falls er das wirklich wollte – und falls ihm das berühmte »Custer-Glück« treu blieb und die Öffentlichkeit ihn nicht vergaß –, dann würde er es wahrscheinlich auch erreichen.
Der Boy General führte seine Kavalleristen mit den roten Halstüchern an, während seine Regimentskapelle Garry Owen spielte. Die Schulmädchen drängten heran, bereit, wieder zu singen. Sie warfen Blumen. Nahe der Präsidententribüne streckte Custer seine behandschuhte Hand aus, um eine Blume zu fangen. Die plötzliche Bewegung erschreckte den Braunen. Er ging durch.
George erhaschte einen Blick auf Custers wütendes Gesicht, als der Braune auf die Seventeenth Street zuraste. Als Custer Don Juan wieder unter Kontrolle hatte, fand er es unmöglich, gegen den Strom von Männern und Pferden anzureiten, um Johnson seinen Salut zu entrichten. Wutentbrannt ritt er weiter. Nichts da mit Custers Glück heute Morgen, dachte George, während er sich eine Zigarre anzündete. Die Straße des Erfolgs war nicht glatt und eben. Gott sei Dank zielte sein Ehrgeiz nicht auf ein hohes Amt ab.
Wenn er sich recht an das Programm erinnerte, dann würde es noch eine Weile dauern, bis die Pioniere erschienen. Er entschuldigte sich und machte sich erneut auf die Suche nach dem Politiker, den er in der Menschenmenge zu entdecken hoffte.
Er fand ihn unter den Bäumen hinter der Sondertribüne. Der Kongressabgeordnete Thaddeus Stevens, Republikaner von Lancaster und vielleicht der herausragendste Mann unter den Radikalen, war über siebzig, doch noch immer umgab ihn eine Aura urwüchsiger Kraft. Weder sein Klumpfuß noch seine deutlich erkennbare, hässliche, dunkelbraune Perücke konnten sie zerstören. Seine strengen Gesichtszüge beeindruckten noch mehr, da er weder einen Backen- noch einen Schnurrbart trug.
Stevens beendete sein Gespräch. Seine beiden Bewunderer tippten an ihre Hüte und entfernten sich. George trat mit ausgestreckter Hand vor. »Hallo, Thad.«
»George. Großartig, dich zu sehen. Ich hörte, du habest die Uniform ausgezogen.«
»Und bin wieder in Lehigh Station, um die Hazard-Werke zu leiten. Hast du einen Moment Zeit? Ich würde mich gern mal von Republikaner zu Republikaner mit dir unterhalten.«
»Sicher doch«, sagte Stevens. Ein Vorhang fiel über seine dunkelblauen Augen. George hatte das früher schon erlebt, wenn Politiker in Deckung gingen.
»Ich wollte dir nur sagen, dass ich dafür bin, Mr. Johnsons Programm eine Chance zu geben.«
Stevens schürzte die Lippen. »Ich verstehe deine Besorgnis. Ich weiß, dass du unten in Carolina Freunde hast.«
Mein Gott, der Mann hatte eine Art, einen mit seiner Offenheit aus dem Gleichgewicht zu bringen. George wünschte, er wäre zehn Zentimeter größer, um nicht aufschauen zu müssen. »Ja, das stimmt. Die Familie meines besten Freundes, der den Krieg nicht überlebt hat. Ich muss zur Verteidigung der Familie sagen, dass ich sie nicht für Aristokraten halte. Oder für Kriminelle.«
»Sie sind beides, wenn sie Schwarze als Sklaven gehalten haben.«
»Thad, bitte, lass mich ausreden.«
»Natürlich.« Stevens Tonfall war nicht mehr freundlich.
»Vor einigen Jahren war ich der Meinung, dass übereifrige Politiker auf beiden Seiten diesen Krieg unnötigerweise provoziert hätten. Jahr um Jahr dachte ich über diese Frage nach und kam zu dem Schluss, dass ich mich getäuscht hatte. So schrecklich es auch war, der Krieg musste ausgekämpft werden. Eine allmähliche friedliche Emanzipation hätte niemals stattgefunden. Die Leute mit den traditionellen Interessen hätten die Sklaverei am Leben erhalten.«
»Vollkommen richtig. Mit ihrer Kooperation und Ermutigung importierten und verkauften die Sklavenhändler Schwarze aus Kuba und von den Westindischen Inseln noch lange, nachdem der Kongress den Handel 1807 verboten hatte.«
»Mich interessiert die Gegenwart im Augenblick mehr. Der Krieg ist vorbei, und es darf niemals einen weiteren Krieg geben. Die Kosten an Leben und Besitz sind einfach zu hoch. Der Krieg macht jeden Versuch materiellen Fortschritts zunichte.«
»Ah, das ist es«, sagte Stevens mit einem frostigen Lächeln. »Das neue Glaubensbekenntnis des Geschäftsmannes. Ich bin mir dieser Woge ökonomischen Pazifismus im Norden wohl bewusst. Ich möchte nichts damit zu tun haben.«
George fuhr zornig auf. »Und warum nicht? Sollst du nicht deine republikanische Wählerschaft repräsentieren?«
»Repräsentieren, ja. Gehorchen, nein. Mein Gewissen ist meine einzige Leitlinie.« Er legte George eine Hand auf die Schulter und blickte auf ihn herab; allein wie er den Kopf neigte, wirkte irgendwie herablassend. »Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, George. Ich weiß, dass du dem Staat und den nationalen Organisationen große Spenden zukommen lässt. Deine Laufbahn im Krieg ist untadelig, dessen bin ich mir wohl bewusst. Unglücklicherweise ändert das nichts an meinen Ansichten, was den südlichen Sklavenstaat anbelangt. Alle, die dieser Klasse angehören oder sie unterstützen, sind Verräter an unserer Nation. Sie residieren momentan nicht in souveränen Staaten, sondern in eroberten Provinzen. Sie verdienen härteste Bestrafung.«
In seinen Augen sah George das Licht des wahren Glaubens, des heiligen Krieges aufblitzen. Zyniker witterten hinter diesem Fanatismus schäbige Motive. Sie verknüpften Stevens’ Kreuzzug für die Rechte der Neger mit seiner Haushälterin in Lancaster und Washington, Mrs. Lydia Smith, einer hübschen Witwe und Mulattin. Sie verbanden die Brandschatzung seiner Eisenwerke in Chambersburg durch Jubal Earlys Soldaten mit seinem Hass auf alle Dinge des Südens. George war von diesen Erklärungen nicht überzeugt; er hielt Stevens für einen ehrlichen, wenn auch extremen Idealisten. Es hatte ihn nie überrascht, dass Stevens und seine Schwester Virgilia gute Freunde waren.
Trotzdem repräsentierte der Kongressabgeordnete keineswegs das gesamte Spektrum der republikanischen Meinung. George sagte scharf: »Ich dachte, die Exekutive führe das Kommando beim Wiederaufbau des Südens.«
»Nein, Sir. Das ist das Vorrecht des Kongresses. Mr. Johnson war ein Narr, als er seine Absicht verkündete, Regierungsbefehle zu erlassen. Das hat große Feindseligkeit bei meinen Kollegen ausgelöst, und du kannst versichert sein, dass wir diesen Unfug korrigieren werden, wenn wir uns wieder versammeln. Der Kongress wird es nicht dulden, dass seine Rechte vereinnahmt werden.« Stevens hämmerte die Spitze seines Stocks gegen den Boden. »Ich werde es nicht dulden.«
»Aber Johnson tut lediglich das, was Abraham Lincoln …«
»Lincoln ist tot«, sagte Stevens, bevor er den Satz beenden konnte. Rot anlaufend sagte George: »Also gut. Welches Programm würdest du befürworten?«
»Eine vollkommene Rekonstruktion der südstaatlichen Institutionen und Gebräuche durch Okkupation, Konfiskation und durch das reinigende Feuer des Gesetzes. Solch ein Programm mag kraftlose Gemüter erschrecken und schwache Nerven erschüttern, aber es ist notwendig und gerechtfertigt.« Georges Gesicht rötete sich noch stärker. »Genauer gesagt, ich wünsche harte Strafen für Verräter in hohen Ämtern. Ich bin nicht zufrieden damit, dass Jeff Davis in Fortress Monroe eingesperrt ist. Ich wünsche seine Exekution. Ich wünsche, dass jedem Mann, der die Armee oder die Marine verlassen hat, um sich in den Dienst der Rebellion zu stellen, die Amnestie verweigert wird.« Mit gemischten Gefühlen dachte George an Charles. »Und ich bestehe auf den vollständigen Bürgerrechten für alle Neger. Ich fordere das Wahlrecht für jeden infrage kommenden schwarzen Mann.«
»Dafür würden sie dich sogar in Pennsylvania mit Steinen bewerfen. Weiße glauben einfach nicht, dass Schwarze gleichwertige Menschen sind. Das mag falsch sein – was ich auch glaube –, aber es ist nun mal Realität. Dein Plan wird nicht funktionieren.«
»Gerechtigkeit wird nicht funktionieren, George? Gleichheit wird nicht funktionieren? Das kümmert mich nicht. Das sind meine Überzeugungen. Für sie werde ich kämpfen. In Fragen moralischer Prinzipien kann es keine Kompromisse geben.«
»Verdammt noch mal, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Und eine ganze Menge Nordstaatler denken genauso über …«
Aber der Kongressabgeordnete hatte sich bereits neuen Bewunderern zugewandt.
Das Bataillon des Pionierkorps der Potomacarmee marschierte die Pennsylvania Avenue hinunter auf den Präsidentenpavillon zu, acht Kompanien in schicken neuen Uniformen, die die verdreckten Fetzen, die sie während der letzten Tage des Virginia-Feldzuges getragen hatten, ersetzten. An den Gürteln der Hälfte der Männer schwangen kurze Spaten, Symbole ihrer gefährlichen Einsätze – Brückenbau, Straßeninstandsetzung –, häufig genug unter feindlichem Feuer, das zu erwidern sie viel zu beschäftigt gewesen waren.
Billy Hazard, mit sauber gestutztem Bart, marschierte voller Stolz und Energie zwischen ihnen unter der heißen Sonne dahin; seine gut heilende Brustwunde schmerzte fast nicht mehr. Er blickte hinüber zu der Tribüne, wo seine Familie sitzen sollte. Er entdeckte das liebliche, strahlende Gesicht seiner Frau, als sie ihm zuwinkte. Dann bemerkte er seinen Bruder und wäre beinahe aus dem Gleichschritt gekommen, George starrte mit grimmigem Gesicht abwesend vor sich hin.
Unter den lautstarken Klängen der Militärkapelle marschierten die Pioniere in einem Blumenregen, der über ihnen niederging, an der Sondertribüne vorbei. Auch Constance merkte, dass etwas nicht stimmte. Als Billy vorbei war, erkundigte sie sich danach.
»Oh, ich habe endlich Thad Stevens gefunden, das ist alles.«
»Das ist nicht alles, das sehe ich dir doch an. Erzähl’s mir.«
George schaute seine Frau an; wieder drückte ihn die Ahnung nahenden Unheils wie ein schweres Gewicht nieder. Die Vorahnung stand nicht in direktem Zusammenhang mit Stevens, doch war er ein Teil des ganzen Mosaiks.
Ein ähnliches Gefühl hatte George im April 1861 überkommen, als er zugesehen hatte, wie ein Haus in Lehigh Station bis auf die Grundmauern niederbrannte. Er hatte in die Flammen gestarrt und in einer Art Vision die ganze Nation brennen sehen und sich vor der Zukunft gefürchtet. Diese Furcht war nicht unbegründet gewesen. Er hatte Orry verloren, die Mains hatten Mont Royal verloren, der Krieg hatte Hunderttausende von Leben gekostet und beinahe das Band zwischen den Familien zerrissen. Seine jetzige Vorahnung unterschied sich kaum von der damaligen.
Achselzuckend versuchte er die Sache vor Constance herunterzuspielen. »Ich brachte meine Ansichten zum Ausdruck, und er wischte sie ziemlich bösartig beiseite. Er will den Süden bluten lassen und die Kontrolle des Kongresses über den Wiederaufbau.« George versuchte einen Gefühlsausbruch zu vermeiden, schaffte es aber nicht. »Constance, Stevens ist bereit, Mr. Johnson den Krieg zu erklären, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Und ich dachte, die Zeit für die Wiedervereinigung der Union sei gekommen. Unsere Familie hat weiß Gott genug gelitten und geblutet. Genau wie Orrys Familie.«
Constance seufzte, auf der Suche nach einer Möglichkeit, seinen Kummer zu lindern. Mit einem gezwungenen Lächeln auf ihrem rundlichen Gesicht sagte sie: »Liebster, schließlich geht es hier trotz allem nur um Politik.«
»Nein. Es ist viel mehr als das. Ich war der Meinung, wir feierten, weil der Krieg vorbei ist. Stevens hat mich eines Besseren belehrt. Der Krieg fängt erst an.«
Und George war sich nicht sicher, ob die Familien, von vier Jahren Krieg bereits angeschlagen und verwundet, noch einen weiteren überleben konnten.
Erstes Buch
In aussichtsloser Lage
Wir alle sind der Meinung, dass abgefallene Staaten nicht mehr in ihrer eigentlichen Beziehung zur Union stehen und dass es das ausschließliche Ziel der Regierung sein muss, sowohl in ziviler als auch in militärischer Hinsicht diese Beziehung wiederherzustellen. Ich glaube, dies ist nicht nur möglich, sondern lässt sich sogar leichter erreichen, wenn wir gar nicht in Betracht ziehen, dass diese Staaten zu irgendeinem Zeitpunkt nicht zur Union gehört haben. Sind sie wieder sicher zu Hause gelandet, so spielt es keine Rolle mehr, ob sie je weg gewesen waren.
Letzte öffentliche Rede von
ABRAHAM LINCOLN
von einem Balkon des Weißen Hauses,
11. April 1865
Zertretet die Verräter. Tretet die Verräter in den Staub.
Kongressabgeordneter THADDEUS STEVENS
nach Lincolns Ermordung,
1865
1
Überall um ihn herum schossen Flammensäulen in den Himmel. Der Kampf hatte zuerst das trockene Unterholz, dann die Bäume in Brand gesetzt. Der Rauch trieb ihm die Tränen in die Augen, sodass er die feindlichen Schützen kaum sehen konnte.
Charles Main beugte sich tief über den Nacken von Sport, seinem Grauen, schwenkte seinen Strohhut und brüllte: »Hah! Hah!« Vor ihm galoppierten mit flatternden Mähnen zwanzig herrliche Kavalleriepferde, zuerst in die eine, dann in die andere Richtung, auf der Flucht vor der Hitze und dem roten Flammenwirbel.
»Wir müssen verhindern, dass sie wenden«, schrie Charles hinüber zu Ab Woolner, den er in dem dichten Rauch nicht sehen konnte. Gewehrschüsse bellten. Eine verschwommene Gestalt links von ihm kippte aus dem Sattel.
Konnten Sie es schaffen? Sie mussten es schaffen. Die Armee benötigte dringend diese gestohlenen Gäule.
Hinter einem umgestürzten Baumstamm sprang ein bulliger Sergeant im Blau der Union hoch. Er brachte sein Gewehr in Anschlag und jagte der Stute, die die Herde anführte, eine Kugel in den Kopf. Sie stieß eine Art Bellen aus und brach zusammen. Ein Brauner hinter ihr stolperte und ging ebenfalls zu Boden. Im Weitergaloppieren hörte Charles das Splittern von Knochen. Ein Grinsen legte sich über das rußige Gesicht des Sergeants. Er schoss dem Braunen ein Loch in den Kopf.
Die Hitze versengte Charles’ Gesicht. Der Rauch blendete ihn. Ab und die anderen Männer des grau gekleideten Stoßtrupps hatte er vollständig aus den Augen verloren. Nur die Notwendigkeit, die Tiere zu General Hampton zu bringen, trieb ihn weiter durch das Inferno, in dem sich Feuer und Sonnenlicht vermischten.
Seine Lungen schmerzten, schrien nach Luft. Er glaubte vor sich eine Lücke zu sehen, die das Ende des brennenden Waldes markierte. Er setzte die Sporen ein; Sport reagierte sofort. »Ab, geradeaus. Siehst du’s?« Keine Antwort, nur noch mehr Schüsse, noch mehr Schreie, noch mehr Geräusche von Pferden und Männern, die in die brennenden Blätter stürzten, die wie ein Teppich den Boden bedeckten. Charles drückte sich den Hut fest auf den Kopf, riss seinen 44er Armeecolt hoch und zog mit dem Daumen den Hammer zurück. Vor ihm versperrten drei Unionssoldaten mit erhobenen Bajonetten den Fluchtweg. Vor den heranstürmenden Pferden wichen sie zur Seite. Ein Soldat rammte einem Schecken sein Bajonett in den Bauch. Eine Blutfontäne überschüttete ihn. Mit einem schrillen, herzzerreißenden Wiehern ging der Schecke zu Boden.
Diese unglaubliche Brutalität Tieren gegenüber raubte Charles fast den Verstand. Er feuerte zweimal, aber Sport galoppierte über derart unebenes Gelände, dass er auf keinen Treffer hoffen durfte. Inmitten der rasenden Herde suchten sich die drei Unionssoldaten ihre Ziele. Eine Kugel traf Sport direkt zwischen den Augen; Blut spritzte über Charles’ Gesicht. Er schrie wie ein Wahnsinniger auf, als die Vorderbeine des Grauen einknickten und er nach vorn stürzte.
Er landete hart und stemmte sich benommen auf Hände und Knie. Ein weiterer grinsender Unionssoldat stieß mit seinem Bajonett zu. Charles hatte den Eindruck von orangefarbenem Licht, so grell, dass man gar nicht hinschauen konnte, und einer derart intensiven Hitze, dass er zu spüren glaubte, wie sie seine Haut versengte. Der Unionssoldat rammte Charles das Bajonett in den Bauch und zog es nach oben, riss ihn vom Nabel bis zum Brustbein auf.
Ein zweiter Soldat drückte Charles einen Gewehrlauf gegen den Kopf. Charles hörte die Explosion, spürte die Wucht des Aufpralls – dann wurde der Wald dunkel.
»Mr. Charles …«
»Geradeaus, ab! Der einzige Weg, der rausführt!«
»Mr. Charles, Sir, wachen Sie auf!«
Er schlug die Augen auf, sah die Silhouette einer Frau vor dunkelrotem Licht. Er rang nach Luft, schlug um sich. Rotes Licht. Der Wald brannte.
Nein. Das Licht stammte von den roten Schalen der Gasglühkörper im Salon. Es gab kein Feuer, keine Hitze. Immer noch benommen sagte er: »Augusta?«
»O nein, Sir«, sagte sie traurig. »Ich bin’s, Maureen. Sie haben so geschrien, dass ich dachte, Sie hätten irgendeinen Anfall.«
Charles richtete sich auf und schob sich das dunkle Haar aus der schweißbedeckten Stirn. Seine Haare waren schon eine ganze Weile nicht mehr geschnitten worden. Sie ringelten sich über den Kragen seines verwaschenen blauen Hemdes. Obwohl er erst neunundzwanzig war, hatte sein gutes Aussehen unter Entbehrungen und Verzweiflung gelitten.
Auf der anderen Seite des Salons der Suite im »Grand Prairie Hotel«, Chicago, sah er seinen Revolvergurt auf einem Sitzkissen liegen, in dem sein Colt steckte. Den Colt zierte eine Gravur mit einer Szene, in der Indianer gegen Armeedragoner kämpften. Über der Lehne des gleichen Stuhls hing sein Umhängemantel, zusammengesetzt aus Flicken von zimtfarbenen Südstaatenhosen, Pelzmänteln, Unionsüberziehern und gelben und scharlachroten Bettdecken. Stück für Stück hatte er ihn sich während des Krieges genäht, um sich warm zu halten.
»Ein schlechter Traum«, sagte er. »Habe ich Gus geweckt?«
»Nein, Sir. Ihr Sohn schläft tief und fest. Tut mir leid wegen Ihres Albtraums.«
»Ich hätte es gleich merken müssen. Ab Woolner kam darin vor. Und mein Pferd Sport. Sie sind beide tot.« Er rieb sich die Augen. »Bin schon wieder in Ordnung, Maureen. Danke.«
Zweifelnd sagte sie: »Jawohl, Sir«, und schlich auf Zehenspitzen hinaus.
In Ordnung, dachte er. Wie konnte er jemals wieder in Ordnung sein? Er hatte alles im Krieg verloren, denn er hatte Augusta Barclay verloren. Sie war bei der Geburt seines Sohnes gestorben, von dessen Existenz er erst nach ihrem Tod erfahren hatte.
Der Traum hielt ihn immer noch in seinem Bann. Er konnte den brennenden Wald sehen und riechen, so wie damals die Wildnis gebrannt hatte. Er konnte spüren, wie die Hitze sein Blut zum Kochen brachte. Es war ein typischer Traum. Er war ein ausgebrannter Mann, der im Wachzustand von zwei bohrenden Fragen gequält wurde: Wo konnte er für sich selbst Frieden finden? Wo war sein Platz in einem Land, das sich nicht mehr im Kriegszustand befand? Seine einzige Antwort auf beide Fragen lautete: nirgendwo.
Wieder strich er sich die Haare zurück und schwankte zu der Anrichte, um sich einen kräftigen Drink einzuschenken. Der Sonnenuntergang tauchte die Dächer der Randolph Street, die vom Eckfenster aus zu sehen waren, in ein rötliches Licht. Er leerte gerade, immer noch bemüht, seinen Albtraum abzuschütteln, seinen Drink, als Augustas Onkel, Brigadier Jack Duncan, durch das Foyer auf ihn zukam.
Seine ersten Worte waren: »Charlie, ich habe schlechte Nachrichten.«
Brevetbrigadier Duncan war ein untersetzter Mann mit grauen Kraushaaren und geröteten Wangen. In voller Montur machte er einen großartigen Eindruck: Frack, Degengürtel, Bandelier, Schärpe mit darüber gefalteten Handschuhen, Chapeau mit schwarzseidener Kokarde. Sein tatsächlicher Rang auf seinem neuen Posten bei der Militärdivision von Mississippi mit Hauptquartier in Chicago war Captain. Die meisten Offizierspatente aus Kriegszeiten waren heruntergestuft worden, aber wie alle anderen auch hatte Duncan ein Recht darauf, mit seinem höheren Rang angesprochen zu werden. Er trug den einen Silberstern eines Brigadiers auf seinen Epauletten, klagte aber über die große Verwirrung, die in Bezug auf Ränge, Titel, Insignien und Uniformen in der Nachkriegsarmee herrschte.
Charles wartete darauf, dass er weitersprach, und zündete sich inzwischen einen Zigarrenstummel an. Duncan legte seinen Hut beiseite und schenkte sich einen Drink ein. »Ich war den ganzen Nachmittag über bei der Division, Charlie. John Pope wird von Bill Sherman als Kommandant abgelöst.«
»Ist das die schlechte Nachricht?«
Duncan schüttelte den Kopf. »Wir haben immer noch eine Million Männer unter Waffen, aber nächstes Jahr um diese Zeit werden wir mit Glück gerade noch fünfundzwanzigtausend haben. Als Teil dieser Reduktion werden das Erste bis Sechste Freiwillige Infanterieregiment ausgemustert.«
»Die ganzen bekehrten Yankees?« Dabei handelte es sich um konföderierte Gefangene, die sich der Unionsarmee angeschlossen hatten, um dem Gefängnis zu entgehen.
»Bis zum letzten Mann. Sie haben übrigens ihre Aufgabe recht ordentlich erfüllt. Sie haben die Sioux davon abgehalten, die Siedler in Minnesota niederzumetzeln, sie haben vom Feind zerstörte Telegrafenleitungen wiederaufgebaut, Forts bemannt und den Postdienst aufrechterhalten und bewacht. Aber das ist nun alles vorbei.«
Charles ging hinüber zum Fenster. »Verdammt noch mal, Jack, ich habe den ganzen weiten Weg hierher gemacht, um mich einem dieser Regimenter anzuschließen.«
»Ich weiß. Aber die Türen sind nun verschlossen.«
Charles drehte sich um, und sein Gesicht war so verzweifelt und elend, dass Duncan tief bewegt war. Dieser Mann aus South Carolina, der sich des Kindes seiner Nichte angenommen hatte, war ein guter Mann. Aber wie so viele andere auch hatte ihn das Ende des Krieges, der ihn vier Jahre lang völlig ausgefüllt hatte, schmerzlich aus der Bahn geworfen.
»Na gut«, sagte Charles. »Dann werde ich vermutlich Böden wischen müssen. Oder Löcher buddeln.«
»Es gäbe noch einen Weg, wenn dir das einen Versuch wert ist.« Charles wartete. »Die reguläre Kavallerie.«
»Teufel auch, das ist unmöglich. Die Amnestie schließt West-Point-Absolventen aus, die die Seiten gewechselt haben.«
»Das lässt sich umgehen.« Bevor Charles eine Frage stellen konnte, fuhr er fort: »Es gibt einen Überschuss an Offizieren, aber es fehlt an qualifizierten Mannschaftsdienstgraden. Du bist ein guter Reiter und ein erstklassiger Soldat – solltest du ja wohl auch mit deiner West-Point-Ausbildung. Sie ziehen dich mit Sicherheit all den irischen Emigranten und einarmigen Wunderkindern und entsprungenen Sträflingen vor.«
Charles kaute nachdenklich auf seiner Zigarre herum. »Was ist mit meinem Jungen?«
»Nun, es bleibt bei dem Arrangement, auf das wir uns bereits geeinigt hatten. Maureen und ich behalten Gus, bis du mit der Ausbildung fertig bist und auf irgendeinen Posten versetzt wirst. Mit etwas Glück – wenn du beispielsweise in Fort Leavenworth oder Fort Riley landest – kannst du die Frau eines Unteroffiziers als Kindermädchen anheuern. Wenn nicht, dann kann er beliebig lange bei uns bleiben. Ich liebe den Jungen. Ich würde jeden Mann erschießen, der ihn schief anschaut.«
»Ich auch.« Charles sinnierte weiter. »Mir bleibt kaum eine Wahl, was? Bei den Regulären anmustern oder nach Hause gehen, von Cousine Madelines Barmherzigkeit leben und mein restliches Leben lang Kriegsgeschichten erzählen.« Er kaute grimmig auf seiner Zigarre herum. Er warf Duncan einen rätselhaften Blick zu und erkundigte sich: »Bist du sicher, dass sie mich bei den Regulären nehmen?«
»Charlie, Hunderte von ehemaligen Reb… äh, Konföderierten treten in die Armee ein. Du musst nur das tun, was sie auch tun.«
»Und was ist das?«
»Wenn du anmusterst, lüg auf Teufel komm raus.«
»Der nächste«, sagte der Rekrutierungssergeant.
Charles ging zu dem fleckigen Tisch, unter dem ein stinkender Spucknapf stand. Nebenan schrie ein Mann auf, als der Barbier ihm einen Zahn ausriss.
Der Unteroffizier roch nach Gin, sah aus, als hätte er das Pensionsalter bereits um zwanzig Jahre überschritten, und erledigte alles im Zeitlupentempo. Charles hatte schon eine Stunde gewartet, während der Sergeant zwei glutäugige junge Männer abfertigte, von denen keiner englisch sprach. Der eine beantwortete sämtliche Fragen, indem er sich gegen die Brust schlug und ausrief: »Budapest, Budapest!« Der andere klopfte sich gegen die Brust und rief: »United States Merica.« Möge Gott der Armee gnädig sein.
Der Sergeant drückte an seiner geäderten Nase herum. »Bevor wir anfangen, tu mir einen Gefallen. Pack diese scheußliche Ansammlung von Lumpen, oder was immer es auch sein mag, und befördere sie nach draußen. Schaut grässlich aus und riecht wie Schafscheiße.«
Vor Wut kochend faltete Charles seinen Umhängemantel zusammen und legte ihn ordentlich draußen vor der Tür auf den Boden. Zurück am Tisch sah er zu, wie der Sergeant seine Feder in die Tinte tauchte.
»Du weißt ja, die Verpflichtung geht auf fünf Jahre.«
Charles nickte.
»Infanterie oder Kavallerie?«
»Kavallerie.«
Das eine Wort verriet ihn. Feindselig sagte der Sergeant: »Südstaatler?«
»South Carolina.«
Der Sergeant griff nach einem Papierstapel. »Name?«
Darüber hatte Charles lange nachgedacht. Er brauchte einen Namen, der dem seinen ähnelte, damit er ganz natürlich reagierte, wenn er angesprochen wurde. »Charles May.«
»May, May.« Der Sergeant blätterte die Papiere durch und legte sie schließlich beiseite. Auf Charles’ fragenden Blick antwortete er: »Liste mit West-Point-Absolventen. Hat das Divisionshauptquartier ausgebrütet.« Er musterte Charles’ schäbige Klamotten. »Musst dir keine Sorgen machen, dass man dich irrtümlich für einen dieser Jungs hält, schätze ich. Also, irgendwelche militärischen Erfahrungen?«
»Berittene Legion Wade Hampton. Später …«
»Wade Hampton genügt.« Der Sergeant schrieb es auf. »Höchster Dienstgrad?«
Er fühlte sich nicht wohl dabei, aber er befolgte Duncans Rat. »Corporal.«
»Kannst du das beweisen?«
»Ich kann gar nichts beweisen. Meine Papiere sind in Richmond verbrannt.«
Der Sergeant schnaufte. »Das ist verdammt bequem für euch Rebellen. Na ja, wir können nicht wählerisch sein. Seit Chivington letztes Jahr mit Schwarzer Kessels Cheyenne abgerechnet hat, spielen die verfluchten Prärieindianer verrückt.«
Die »Abrechnung«, wie es der Sergeant formuliert hatte, entsprach nicht gerade den Fakten, die Charles kannte. In der Nähe von Denver war eine Gruppe von Auswanderern von Indianern niedergemetzelt worden. Ein ehemaliger Prediger, Colonel J. M. Chivington, hatte in Colorado eine Freiwilligentruppe zusammengestellt, die einen Gegenschlag gegen ein Cheyenne-Dorf am Sand Creek führten, obwohl nicht der geringste Beweis existierte, dass der Häuptling des Dorfes, Schwarzer Kessel, oder seine Leute für den Überfall verantwortlich waren. Von den dreihundert Leuten, die Chivingtons Männer am Sand Creek töteten, waren zweihundertfünfundzwanzig Frauen und Kinder. Dieser Überfall hatte viele Menschen im Land empört, aber der Sergeant gehörte offenbar nicht zu ihnen.
Der Zahnarztpatient kreischte erneut auf. »Nein«, sinnierte der Sergeant, während seine Feder über das Papier kratzte, »wir können kein bisschen wählerisch sein. Wir müssen so ziemlich alles nehmen, was sich sehen lässt.« Ein Blick zu Charles. »Verräter eingeschlossen.«
Charles kämpfte seinen Zorn nieder. Wenn er weitermachte – und er musste weitermachen; er war Soldat, etwas anderes hatte er nicht gelernt –, dann würde er wahrscheinlich das Thema Verräter in allen Variationen zu hören bekommen. Er gewöhnte sich besser gleich daran, sich das klaglos anzuhören.
»Kannst du lesen oder schreiben?«
»Beides.«
Der Rekrutierungssergeant brachte tatsächlich ein Lächeln zustande. »Das ist gut, obwohl es, verdammt noch mal, keine Rolle spielt. Die wesentlichen Merkmale hast du. Mindestens einen Arm, ein Bein, und du atmest noch. Unterschreib hier.«
Die Glocke der Lokomotive läutete. Maureen zögerte. »Sir – Brigadier alle Fahrgäste einsteigen.«
Inmitten der über den Bahnsteig ziehenden Rauchschwaden umarmte Charles seinen zu einem Bündel verpackten Sohn. Der kleine Gus, mittlerweile sechs Monate alt, krümmte sich in einer Kolik. Maureen säugte das Baby immer noch, und zum ersten Mal reagierte es schlecht darauf.
»Ich will nicht, dass er mich vergisst, Jack.«
»Deswegen habe ich ja die Daguerreotypie von dir machen lassen. Wenn er ein bisschen älter ist, zeige ich ihm das Bild und sage Papa dazu.«
Sanft legte Charles seinen Sohn zurück in die Arme der Haushälterin, die, wie er vermutete, auch die Ehefrau ohne Trauschein war. »Passt gut auf den Kleinen auf.«
»Die Annahme, wir könnten das nicht tun, grenzt fast schon an Beleidigung«, sagte Maureen, das Kind wiegend.
Duncan umklammerte Charles’ Hand. »Geh mit Gott – und denk daran, halte deine Zunge und dein Temperament im Zaum. Vor dir liegen ein paar harte Monate.«
»Ich schaff’s schon, Jack. Ich kann für jedermann den Soldaten spielen, sogar für die Yankees.«
Die Pfeife schrillte. Vom letzten Waggon aus gab der Schaffner das Signal und brüllte nach vorn zum Lokomotivführer: »Abfahrt! Abfahrt!« Charles sprang auf die Stufen des Zweite-Klasse-Waggons und wankte, als der Zug losschnaufte. Er war froh um den aufsteigenden Dampf, der verhinderte, dass sie seine Augen sehen konnten, als der Zug den Bahnhof verließ.
Charles hing in seinem Sitz. Wegen seines düsteren Aussehens hatte sich niemand neben ihn gesetzt; den abgetragenen Strohhut hatte er tief in die Stirn gezogen, sein Umhängemantel lag neben ihm. Auf seinen Knien ruhte ungelesen eine Ausgabe der National Police Gazette.
Dunkle Regenstreifen krochen diagonal über das Fenster. Sturm und Nacht verbargen alles, was dahinter lag. Er kaute an einem vertrockneten Brötchen, das er einem Händler im Gang abgekauft hatte, und spürte die alte hilflose Leere in sich aufsteigen.
Er blätterte die Seiten der New York Times durch, die ein Fahrgast zurückgelassen hatte, der an der letzten Station ausgestiegen war. Die Annoncen erregten seine Aufmerksamkeit: Fantastische Angebote für Brillen, Korsetts, den Luxus auf Küstendampfschiffen. Eine Annonce offerierte ein Tonikum gegen das Leid. Er schob die Zeitung beiseite. Ein Jammer, dass es nicht so einfach war.
Unbewusst begann er eine kleine Melodie vor sich hin zu pfeifen, die ihm vor ein paar Wochen in den Sinn gekommen war und nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Das Gepfeife machte eine kräftige Frau auf der anderen Seite des Ganges munter. Der Kopf ihrer plumpen Tochter ruhte in ihrem Schoß. Die Frau überwand ihre Hemmungen und sprach Charles an.
»Sir, das ist eine wunderbare Melodie. Ist es vielleicht zufällig eine von Miss Jenny Linds Nummern?«
Charles schob seinen Hut zurück. »Nein. Ist mir selber nur so in den Sinn gekommen.«
»Oh, ich dachte, es müsse von ihr stammen. Wir sammeln die Noten all ihrer berühmten Nummern. Ursula kann sie ganz herrlich spielen.«
»Das bezweifle ich nicht.« Trotz seiner guten Absichten klang es kurz und schroff.
»Sir, falls Sie mir die Bemerkung erlauben«, sie deutete auf die Gazette auf seinen Knien, »was Sie da lesen, ist keine christliche Literatur. Bitte, nehmen Sie das hier. Sie werden es erbaulicher finden.«
Sie reichte ihm ein kleines Pamphlet, das er noch von den Camps in Kriegszeiten kannte. Eine der kleinen religiösen Ermahnungen der amerikanischen Traktatgesellschaft.
»Danke«, sagte er und begann zu lesen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, hiernach steht dir der Himmel offen, und die Engel Gottes werden herniedersteigen …
Verbittert blickte Charles wieder zum Fenster hinaus. Er sah keine Engel, keinen Himmel, nichts als die grenzenlose Finsternis der Prärie von Illinois und den Regen – wahrscheinlich Vorboten einer Zukunft, so düster wie die Vergangenheit. Duncan hatte zweifellos recht, dass harte Zeiten vor ihm lagen. Er sank noch tiefer in sich zusammen und sah zu, wie die Finsternis draußen vorüberflog.
Leise begann er die kleine Melodie zu summen, die wunderschöne Pastellbilder von Mont Royal heraufbeschwor – sauberer, herrlicher, größer, als es je gewesen war, bevor es niederbrannte. Die kleine Melodie erzählte ihm von dieser verlorenen Heimat, von seiner verlorenen Liebe und von allem, was er in den vier blutigen Purpurtraumjahren der Konföderation verloren hatte. Sie sang ihm von Gefühlen und einem Glück, von dem er mit Sicherheit wusste, dass er es nie wieder erleben würde.
ANZEIGE
AN ALLE, DIE LEIDEN
Es erscheint fast unglaublich, dass die Menschen weiterhin leiden, wenn solch ein Heilmittel wie
PLANTATION BITTERS
für sie erreichbar ist. Personen, die an Kopfschmerzen, Depressionen, Sodbrennen, Schmerzen in der Seite, am Rücken oder im Bauch, an Krämpfen, schlechtem Atem oder anderen Symptomen des schrecklichen Monsters Verdauungsstörung leiden, sind freundlich eingeladen, dieses Heilmittel zu testen.
MADELINES JOURNAL
Juni 1865. Liebster Orry, ich beginne mit diesen Aufzeichnungen, weil ich mit Dir reden muss. Zu sagen, dass ich ohne Dich haltlos treibe, dass ich mit Schmerzen lebe, beschreibt auch nicht annähernd meinen Zustand. Ich werde mich bemühen, Selbstmitleid von diesen Seiten fernzuhalten, aber ich weiß, es wird mir nicht immer gelingen.
Ein winziger Teil von mir freut sich darüber, dass Du nicht hier bist und so den Niedergang unserer geliebten Heimat nicht mit ansehen musst. Das ganze Ausmaß dieses Ruins wird erst allmählich sichtbar. South Carolina schickte ungefähr 70 000 Männer in diesen unseligen Krieg, mehr als ein Viertel davon wurden getötet, die höchste Verlustquote aller Staaten, wie es heißt.
Bis zu 200 000 befreite Neger schwärmen nun überall herum. Das ist die halbe Bevölkerung des Staates oder mehr. Auf der Flussstraße traf ich letzte Woche Maum Ruth, die früher dem verstorbenen Francis LaMotte gehörte. Sie hielt einen alten Mehlsack so sorgsam fest, dass ich mich erkundigte, was er enthielt. »Hab’ die Freiheit hier drin, und werd’ sie nicht mehr loslassen.« Voll Trauer und Zorn ging ich davon. Wie falsch war es doch von uns, dass wir unseren Schwarzen keine Bildung zukommen ließen. Sie sind hilflos dieser neuen Welt ausgeliefert, in die ein merkwürdiger Friede sie geschleudert hat.
»Unsere« Schwarzen – ich denke gerade über diese zufällige Wortwahl nach. Es klingt herablassend, und ich bin vergesslich. Ich gehöre zu ihnen – in Carolina gilt man als Schwarzer, wenn man zu einem Achtel Negerblut in den Adern hat.
Was Deine Schwester Ashton so hasserfüllt in Richmond über mich erzählt hat, ist nun im ganzen Bezirk bekannt. In den letzten Wochen wurde das allerdings mit keinem Wort erwähnt, wofür ich Dir zu danken habe. Du erfreust Dich höchster Achtung, und man trauert aufrichtig um Dich …
Wir haben vier Reisfelder bepflanzt. Wir sollten eine ordentliche kleine Ernte zum Verkaufen haben, falls es einen Käufer gibt. Andy, Jane und ich arbeiten jeden Tag auf den Feldern.
Ein Pastor der Afrikanischen Methodistenkirche traute Andy und Jane letzten Monat. Sie haben einen neuen Nachnamen angenommen. Andy wollte Lincoln, aber Jane weigerte sich, den Namen haben sich schon zu viele ehemalige Sklaven ausgesucht. Stattdessen heißen sie jetzt Sherman, eine Wahl, mit der sie sich bei der weißen Bevölkerung nicht unbedingt beliebt machen werden! Aber sie sind freie Menschen. Es ist ihr gutes Recht, sich den Namen zuzulegen, der ihnen gefällt.
Das Pinienhaus, als Ersatz für das von Cuffey und Jones und ihrem Abschaum niedergebrannte Herrenhaus gebaut, hat einen neuen weißen Anstrich bekommen. Jane kommt jeden Abend zu mir hoch, während Andy unermüdlich an den Kalkmörtelwänden ihrer neuen Hütte arbeitet; wir unterhalten uns oder flicken die Lumpen, die als Ersatz für anständige Kleidung dienen – und manchmal tauchen wir sogar in unsere »Bibliothek«. Sie besteht aus einem »Godey’s-Lady’s Buch« von 1863 und den letzten zehn Seiten eines Southern Literary Messenger.
Jane spricht oft von der Gründung einer Schule, sie wollte sogar das neue »Büro für befreite Sklaven« bitten, uns bei der Suche nach einem Lehrer behilflich zu sein. Ich habe diese Aufgabe übernommen – ich fühle mich dazu verpflichtet, trotz des Unwillens, den das sicherlich hervorrufen wird. In der Bitternis der Niederlage sind nur sehr wenige Weiße bereit, jenen zu helfen, die durch Lincolns Feder und Shermans Schwert befreit wurden.
Bevor wir jedoch an eine Schule denken können, müssen wir erst mal ans Überleben denken. Der Reis reicht für unseren Lebensunterhalt nicht aus. Ich weiß, dass der gute George Hazard uns unbegrenzten Kredit einräumen würde, aber ich halte es für Schwäche, ihn darum zu bitten. In dieser Hinsicht bin ich ganz bestimmt eine Südstaatlerin voll von halsstarrigem Stolz.
Vielleicht können wir Holz von den Pinien- und Zypressenhainen verkaufen, die es auf Mont Royal im Überfluss gibt. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Sägemühle betreibt, aber ich kann es lernen. Wir würden Geräte benötigen, was eine weitere Hypothek bedeutete. Die Banken in Charleston öffnen vielleicht bald schon wieder ihre Pforten – sowohl Geo. Williams als auch Leverett Dawkins, unser alter nationalrepublikanischer Freund, haben während des Krieges in britischen Sterling spekuliert und die Gewinne in einer ausländischen Bank deponiert. Damit nun wollen sie das kommerzielle Blut wieder durch die Adern des flachen Landes pumpen. Wenn Leveretts Bank aufmacht, werde ich mich an ihn wenden.
Ich muss außerdem noch Arbeiter einstellen und frage mich, ob ich das kann. Die Sorge ist weitverbreitet, dass die Neger es vorziehen, ihre Freiheit zu genießen, anstatt für ihre alten Besitzer, wie gütig sie auch immer gewesen sein mochten, zu arbeiten. Ein quälendes Problem für den ganzen Süden.
Aber, mein liebster Orry, ich muss Dir noch von meinem unwahrscheinlichen Traum erzählen – den zu verwirklichen ich mir vor allem anderen versprochen habe. Er wurde vor wenigen Tagen geboren, aus meiner Liebe zu Dir heraus und meiner Sehnsucht und meinem immerwährenden Stolz, Deine Frau zu sein …
In dieser Nacht verließ Madeline, unfähig zu schlafen, nach Mitternacht das weiß gekalkte Haus, das mittlerweile einen kleinen Flügel mit zwei Schlafzimmern besaß. Auch jetzt, wo sie auf die Vierzig zuging, war Orry Mains Witwe immer noch so vollbusig und schmalhüftig wie zu der Zeit, als er sie auf der Flussstraße gerettet hatte, obwohl Alter und Mühsal ihr Gesicht zu zeichnen begannen.
Fast eine Stunde lang hatte sie geweint, hatte sich dessen geschämt, war aber machtlos dagegen gewesen. Nun eilte sie die weite Rasenfläche hinunter, über ihr ein Mond, der blendend weiß über den Bäumen am Ufer des Ashley River hing. An der Stelle, wo sich einst der Pier vorgeschoben hatte, schreckte sie einen weißen Reiher auf. Der Vogel stieg auf und strich an dem großen, vollen Mond vorbei.
Sie wandte sich um und blickte über den Rasen zurück zu dem Haus unter den mit Moos bewachsenen Eichen. Eine Vision stieg in ihr auf, eine Vision des herrlichen Hauses, in dem sie und Orry als Mann und Frau gelebt hatten. Sie sah die eleganten Säulen, die erleuchteten Fenster. Sie sah Kutschen vorfahren, lachende Herren und Damen aussteigen.
Ganz plötzlich war der Gedanke da. Er ließ ihr Herz so schnell schlagen, dass es fast schon schmerzte. Wo jetzt die armselige, weiß gekalkte Hütte stand, würde sie ein neues Mont Royal aufbauen. Ein wunderbares, großartiges Haus, das für immer als Erinnerung an ihren Mann und dessen Güte dienen sollte, eine Erinnerung an alles, was an der Mainfamilie und ihrer gemeinsamen Vergangenheit gut war.
In einem Sturzbach von Gedanken schoss es ihr durch den Kopf, dass das Haus nicht eine genaue Nachahmung des verbrannten Herrenhauses werden dürfte. Diese Art von Schönheit hatte – im Verborgenen – zu viel Böses repräsentiert. Obwohl die Mains gut zu ihren Sklaven gewesen waren, hatten sie sie doch zweifellos als Besitz gehalten und so ein System unterstützt, in dem Fesseln und Peitschen und Tod und Kastration für jene, die genügend Mut zur Flucht besaßen, an der Tagesordnung waren. Gegen Kriegsende hatte sich Orry von dem System so gut wie losgesagt; Cooper hatte es in jüngeren Jahren ganz offen verdammt. Auch deshalb musste das neue Mont Royal wahrhaftig neu sein, denn eine neue Zeit war angebrochen. Ein neues Zeitalter.
Tränen stiegen ihr in die Augen. Madeline streckte ihre verschränkten Hände dem Mond entgegen. »Irgendwie werde ich es schaffen. Dir zu Ehren.«
Sie sah es deutlich vor sich, das neue Haus, wie Phönix aus der Asche auferstanden. Wie eine bäuerliche Priesterin hob sie Kopf und Hände irgendwelchen Gottheiten entgegen, die sie aus dem Sternengewölbe des nächtlichen Himmels über Carolina beobachten mochten. Sie sprach zu ihrem Mann dort zwischen den fernen Sternen:
»Ich schwöre beim Himmel, Orry. Ich werde es bauen – für dich!«
Überraschender Besuch heute. General Wade Hampton, auf dem Heimweg von Charleston. Es heißt, aufgrund seines Ranges und seiner Unbarmherzigkeit als Soldat werde es Jahre dauern, bis die Amnestie so umfassend sei, dass sie auch ihn einschließe.
Seine Kraft und seine heitere Gemütsart erstaunen mich. Er hat so viel verloren – sein Bruder Frank und sein Sohn Preston sind in der Schlacht gefallen, 3000 Sklaven dahin und sowohl Millwood als auch Sand Hills vom Feind niedergebrannt. Er haust in einer Aufseherhütte in Sand Hills und kann der Anschuldigung nicht entgehen, dass er und nicht Sherman Columbia niedergebrannt habe, indem er Baumwollballen in Brand steckte, damit sie nicht den Yankee-Plünderern in die Hände fielen.
Doch er zeigt sich von all dem nicht deprimiert, sondern bringt stattdessen seine Besorgnis um andere zum Ausdruck …
Wade Hampton saß vor dem Pinienhaus auf einem Baumklotz, der als Stuhl diente. Lees ältester Kavalleriekommandant, mittlerweile siebenundvierzig, bewegte sich mit einer gewissen Steifheit. Fünfmal war er auf dem Schlachtfeld verwundet worden. Nach seiner Heimkehr hatte er sich den gewaltigen Vollbart abrasiert und nur noch ein Büschel unter dem Mund stehen lassen, obwohl er nach wie vor den riesigen Schnurrbart und Backenbart trug. Unter einem alten Wollmantel steckte ein Revolver mit Elfenbeingriff in einem Pistolenhalfter.
»Kaffee mit Schuss, General«, sagte Madeline, als sie mit zwei dampfenden Blechtassen wieder in das gesprenkelte Sonnenlicht trat, »Zucker und etwas Kornwhisky – obwohl ich fürchte, der Kaffee ist nichts weiter als ein Gebräu aus gerösteten Eicheln.«
»Ich werde ihn trotzdem genießen.« Lächelnd nahm Hampton seine Tasse. Madeline setzte sich auf eine Kiste, neben einen Strauch gelben Jasmin, den sie so liebte.
»Ich bin gekommen, um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen«, sagte er zu ihr. »Mont Royal gehört nun Ihnen.«
»In gewissem Sinne ja. Ich besitze es nicht.«
Wade Hampton zog eine Augenbraue fragend in die Höhe, und sie erklärte ihm, dass Tillet Main die Plantage seinen Söhnen Orry und Cooper gemeinsam hinterlassen hatte, trotz seiner langjährigen Meinungsverschiedenheit mit Cooper, was die Sklaverei anbelangte. Am Ende hatten Blutsbande und Tradition in Tillet die Oberhand gewonnen über Zorn und Ideologie. Wie den meisten Männern seines Alters und seiner Zeit waren Tillet seine Söhne wichtig, weil er seinen Besitz schätzte und die geschäftlichen und finanziellen Fähigkeiten von Frauen gering achtete. Als er sein Testament schrieb, machte er sich lediglich die Mühe, jeder seiner beiden Töchter, Ashton und Brett, eine gewisse Geldsumme zukommen zu lassen, in der Annahme, dass sie von ihren Ehemännern versorgt würden. Das Testament besagte weiter, dass im Falle des Todes eines Sohnes dessen Besitzanteil direkt an den Bruder fiel.
»Deshalb ist jetzt Cooper der Alleineigentümer, aber er hat mir großzügig erlaubt, hierzubleiben, schon allein Orrys wegen. Ich leite die Plantage und habe Anspruch auf den Gewinn, solange er der Besitzer ist und ich die Hypothekarzinsen zahle. Ich bin natürlich auch für alle laufenden Ausgaben zuständig, aber das versteht sich wohl von selbst.«
»Und Sie sind durch dieses Arrangement abgesichert? Ich meine, ist es legal und bindend?«
»Absolut. Einige Wochen nach Orrys Tod legte Cooper diese Vereinbarung schriftlich fest. Das Dokument macht die Sache unwiderruflich.«
»Nun, da ich weiß, wie sehr die Leute aus Carolina Familienbande und Familienbesitz achten, nehme ich an, dass Mont Royal den Mains stets erhalten bleiben wird.«
»Ja, davon bin ich überzeugt.« Das war ihr einziger, sicherer Halt. »Unglücklicherweise haben wir momentan weder irgendwelche Einnahmen, noch besteht Aussicht darauf. Auf Ihre Frage nach unserem Wohlergehen kann ich nur sagen, wir kommen schon irgendwie über die Runden.«
»Vermutlich darf keiner von uns zurzeit mehr erwarten. Gegen Ende des Monats wird meine Tochter Sally Colonel Johnny Haskell heiraten. Das ist wenigstens ein Lichtblick.« Er nippte an seiner Tasse. »Köstlich. Was haben Sie von Charles gehört?«
»Vor zwei Monaten bekam ich einen Brief. Er schrieb, er hoffe, wieder bei der Armee unterzukommen, draußen im Westen.«
»Soviel ich weiß, tun das sehr viele Konföderierte. Ich hoffe, sie behandeln ihn anständig. Er war einer meiner besten Scouts. Iron Scouts, so nannten wir sie. Er wurde dem Namen gerecht, obwohl ich gestehen muss, dass ich gegen Ende zu gelegentlich ein merkwürdiges Benehmen bei ihm feststellte.«