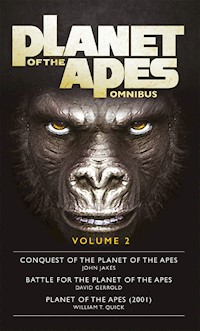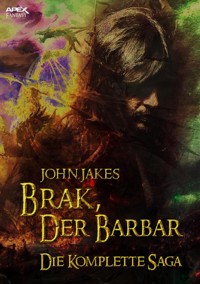6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte zweier Familien
- Sprache: Deutsch
Das Unfassbare ist geschehen. Aus dem jahrzehntelang schwelenden Konflikt um die Frage der Sklavenhaltung ist ein offener Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten entbrannt, der auch vor den Familien der Mains und Hazards nicht haltmacht. Sie werden hineingerissen in einen Strudel von Gewalt und Hass, und ihre Freundschaft wird mehr als einmal auf eine harte Probe gestellt ...
Der zweite Teil der Familiensaga - ein monumentales Epos über Liebe, Hass und Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1349
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber den AutorTitelImpressumZitatWidmungPersonenverzeichnisProlog: AprilascheErstes Buch: Eine Vision von Scott1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Zweites Buch: Der Weg nach unten33343536373839404142434445464748Drittes Buch: Ein Ort, schlimmer als die Hölle495051525354555657585960616263Viertes Buch: »Lasst uns sterben, um die Menschheit zu befreien«64656667686970717273747576777879808182838485868788Fünftes Buch: Die Metzgersrechnung8990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117Sechstes Buch: Das Urteil des Herrn118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146NachwortÜber den Autor
John Jakes wurde 1932 in Chicago geboren und lebt heute in Connecticut und South Carolina. Nach dem Studium der amerikanischen Literatur und langjähriger Tätigkeit in Public-Relations-Agenturen, begann er eine Karriere als Schriftsteller. Weltberühmtheit erlangte er mit seiner großen Trilogie über den Amerikanischen Bürgerkrieg, die unter dem Titel »Fackeln im Sturm« verfilmt wurde.
John Jakes
LIEBE UNDKRIEG
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonWerner Waldhoff
beHEARTBEAT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1984 by John Jakes
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Love and War«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 1986/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Motiven © iStock/RASimon,© shutterstock/natu
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-2649-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Es gibt zwei Dinge, die größer sind als alle anderen:Das eine ist die Liebe, das andere der Krieg.
KIPLING
Für Julian Muller.
Kein Schriftsteller hatte je einen besseren Freund.
Mit Ausnahme der historischen Persönlichkeiten sind alle Figuren in diesem Roman frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu realen Personen aus Vergangenheit oder Gegenwart ist rein zufällig.
Personenverzeichnis
Die Hazards (Norden)
GeorgeStahlindustrieller in Pennsylvania, West-Point-Absolvent
ConstanceGeorges Frau, stammt aus dem Süden
Stanleyein farbloser Beamter in Washington
IsabelStanleys ehrgeizige Frau
William, genannt BillyBerufsoffizier, West-Point-Absolvent
Brett, geb. MainBillys Frau, stammt aus dem Süden
Virgiliamilitante Abolitionistin, das schwarze Schaf der Familie
Die Mains (Süden)
OrryPlantagenbesitzer in South Carolina, Klassenkamerad von George Hazard in West Point und dessen engster Freund
CooperIngenieur, entschiedener Gegner der Sklaverei, setzt sich trotzdem für die Sache des Südens ein
JudithCoopers Frau
Ashtoneine schöne Frau, die vor nichts zurückschreckt, um ihren gesellschaftlichen Ehrgeiz zu befriedigen
James HuntoonAshtons Ehemann, ein glückloser Anwalt
Brettverheiratet mit Billy Hazard in Pennsylvania
Charlesein verwaister Cousin, der mit den Maingeschwistern aufwuchs, Berufsoffizier, Klassenkamerad von Billy Hazard in West Point und dessen engster Freund
Clarissa Gault Maindas greise Familienoberhaupt
Weitere wichtige Personen
Elkanah Bentuntalentierter Berufsoffizier, West-Point-Absolvent, Intimfeind von George Hazard und Orry Main
Justin La MotteNachbar der Mains, ein brutaler Sklavenhalter
Madeline La MotteJustins Frau, floh vor dessen Gewalttätigkeit zu Orry Main, mit dem sie eine langjährige Liebe verbindet
Prolog:
Aprilasche
Am letzten Tag im April, eine Stunde vor Mitternacht, brannte das Haus. Das ungestüme Läuten der fernen Feuerglocken weckte George Hazard. Er stolperte den dunklen Flur entlang, die Treppen hoch zum Turm des Wohnhauses und trat auf den schmalen Balkon hinaus. Ein kräftiger, warmer Wind fachte die Flammen an und verstärkte ihr Licht. Selbst von seinem Standort aus, hoch oben über der Stadt Lehigh Station, erkannte er das brennende Haus – das einzige ordentliche Haus, das in der schäbigen Gegend nahe beim Kanal noch übrig geblieben war.
Er rannte hinunter in sein schwach erleuchtetes Schlafzimmer und schnappte sich seine Kleider, ohne mehr als einen flüchtigen Blick darauf zu werfen. Er versuchte sich leise anzuziehen, konnte aber nicht vermeiden, dass Constance, seine Frau, aufwachte. Sie war beim Lesen der Heiligen Schrift eingeschlafen – nicht ihre eigene Douay-Version, sondern eine der Familienbibeln der Hazards, in die sie ihren Rosenkranz gelegt hatte, ehe sie das Buch geschlossen und George einen Gutenachtkuss gegeben hatte. Seit dem Fall von Fort Sumter und dem Kriegsausbruch hatte Constance mehr Zeit als üblich über der Bibel verbracht.
»George, wohin rennst du?«
»Es brennt in der Stadt. Hörst du nicht den Feueralarm?«
Immer noch schläfrig rieb sie sich die Augen. »Aber du springst doch nicht immer gleich an die Pumpen, wenn die Glocken läuten.«
»Das Haus gehört Fenton, einem meiner besten Vormänner. In seinem Haushalt hat es kürzlich Ärger gegeben. Vielleicht ist das Feuer kein Zufall.« Er beugte sich über sie und küsste ihre warme Wange. »Schlaf weiter. In einer Stunde bin ich wieder im Bett.«
Er drehte das Gaslicht aus und begab sich schnell nach unten zum Stall. Er sattelte sich selbst ein Pferd; das ging bei Weitem schneller, als wenn er einen Stallknecht geweckt hätte. Die Besorgnis spornte ihn zur Eile an. Seine spontane Anteilnahme verwirrte ihn geradezu, denn seit Orry Mains Besuch vor genau zwei Wochen hatte sich George in einem merkwürdig dumpfen Zustand befunden. Er fühlte sich fern vom Leben um sich herum und vor allem fern vom Leben einer Nation, deren eine Hälfte sich losgelöst und die andere Hälfte angegriffen hatte. Die Union war abgetrennt; Truppen wurden zusammengestellt. Und George hatte sich in die Isolation zurückgezogen, als hätte das keinerlei Auswirkungen auf sein Dasein oder seine Gefühle.
Kaum im Sattel, galoppierte er weg vom Herrschaftshaus, das er auf den Namen Belvedere getauft hatte, die gewundene Hügelstraße hinunter auf das Feuer zu. Die starken Windstöße bliesen wie die fauchenden Öfen des Hazard-Eisenwerks; das Haus des Vormanns musste sich in ein Inferno verwandelt haben. War die freiwillige Werksfeuerwehr schon am Schauplatz? Er betete darum.
Auf der holprigen Straße musste er sein Pferd fest unter Kontrolle halten. Sein Weg führte ihn an den zahlreichen Gebäuden des Eisenwerks vorbei, wo selbst zu dieser Stunde noch Licht brannte und Rauch und Lärm aufstiegen. Hazard war rund um die Uhr in Betrieb und produzierte Schienen und Bleche für die gerade anrollenden Kriegsanstrengungen der Union. Jetzt jedoch waren Geschäfte das Letzte, was der an den Terrassen der besseren Heime vorbeihetzende Mann im Sinn hatte. Durch die ebenen Straßen des Handelsviertels galoppierte er der grellen Hitze des Feuers entgegen.
Seit einiger Zeit schon wusste George von den Problemen in Fentons Haus. Für gewöhnlich hörte er immer, wenn ein Arbeiter Schwierigkeiten hatte. Er wollte es so. Gelegentlich war Disziplin nötig, aber er bevorzugte den Einsatz von Diskussion, Verständnis und Rat, erwünscht oder nicht erwünscht.
Im vergangenen Jahr hatte Fenton seinen herumstreunenden Cousin aufgenommen, einen kraftstrotzenden Burschen, zwanzig Jahre jünger als er. Da ihm das Geld ausgegangen war, brauchte der junge Mann einen Job. Der Vorarbeiter verschaffte ihm einen bei Hazard, und der Neuankömmling führte sich einige Monate recht ordentlich. Obwohl verheiratet, hatte Fenton keine Kinder. Seine gut aussehende, aber nicht mit besonderer Intelligenz gesegnete Frau stand altersmäßig dem Cousin näher als ihm. Bald schon bemerkte George, dass der Vorarbeiter an Gewicht verlor. Er schien seine Arbeit mit ungewohnter Gleichgültigkeit zu verrichten. Schließlich wurde George Bericht erstattet von einem teuren Fehler, der zulasten des Vorarbeiters ging. Und eine Woche später wiederholte sich das.
Letzte Woche hatte ihn George, sowohl um neuerliches Versagen zu verhindern als auch um dem Mann zu helfen, zu einem Gespräch geholt. Normalerweise locker und entspannt, sogar im Gespräch mit dem Besitzer, hatte Fenton nun einen kalten, angespannten, gequälten Ausdruck in den Augen und ließ sich nur ein Zugeständnis entlocken: Er hatte mit häuslichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Mehrfach betonte er die beiden Worte – häusliche Schwierigkeiten. George drückte sein Mitgefühl aus, stellte aber klar, dass die Fehler aufhören müssten. Fenton versprach, dafür zu sorgen, indem er die »Schwierigkeiten« behob und den Cousin aus seinem Haus warf. Mit einem unbehaglichen Gefühl beließ es George dabei, da er die Natur der »häuslichen Schwierigkeiten« ahnte.
Vor sich sah er nun Silhouetten, die vor den Rammen hin und her sprangen; Wasserstrahlen spritzten wirkungslos über das bereits eingestürzte Haus. Das rote Licht spiegelte sich im Metall der veralteten Pumpe und färbte die vier Pferde, die Pumpe und Schlauchwagen vor Ort gezogen hatten; wie schreckliche Bestien aus der Hölle scharrten sie mit den Hufen und schnaubten.
Als er aus dem Sattel sprang, hörte er einen Mann in der dunklen Straße links vom brennenden Haus brüllen. George drängte sich schnell durch die Zuschauer. »Bleib zurück, verdammt noch mal!«, schrie der Freiwilligenchef durch seinen Schalltrichter, als George aus der Menge auftauchte. Der Chef ließ seinen Arm sinken und entschuldigte sich sogleich: »Oh, Mr. Hazard, Sir. Hab Sie nicht erkannt.«
Was bedeuten sollte, dass er den reichsten Mann der Stadt, vielleicht des ganzen Tales, nicht erkannt hatte, bis er beinahe vor ihm stand; jedermann kannte den stämmigen George Hazard, der in diesem Jahr sechsunddreißig geworden war. Georges windzerzaustes Haar wies die ersten von der Sonne gebleichten Stellen auf, die es im Frühling und Sommer aufzuhellen pflegten; aber auch einige graue Strähnen zeichneten sich schon ab. Die Augen, eisfarben, wie es in der Hazardfamilie üblich war, spiegelten das Feuer von außen wider und Georges Besorgnis von innen. »Was ist hier passiert?«
Den Worten folgte eine gestammelte Zusammenfassung vom Chef, während die Freiwilligen, die sich vor Jahren den Namen »Die Unentwegten« gegeben und ihr Motto, Officium Pro Periculo, auf jedes Ausrüstungsstück geprägt hatten, weiterhin an den Pumpen arbeiteten. Für das zerstörte Haus war das Wasser die pure Verschwendung. Man konnte nichts weiter tun, als die nahe gelegenen Schuppen und Hütten vor dem Funkenregen zu schützen. Deshalb hatte der Chef Zeit, sich mit dem wichtigsten Mann der Stadt zu unterhalten.
Er sagte, es sehe so aus, als hätte Fenton am Abend zuvor seine Frau mit seinem Cousin im Bett überrascht. Der Vorarbeiter hatte ein großes Küchenmesser genommen und seine Frau und ihren Liebhaber niedergestochen, bevor er das Haus in Brand steckte. Während dieser Zeit hatte der tödlich verwundete Cousin es geschafft, das Messer gegen seinen Angreifer zu richten und ihm vier Stiche zuzufügen. Tränen füllten Georges Augen, und mit harten Fingerknöcheln rieb er drüber. Fenton war einer seiner umgänglichsten Männer gewesen; belesen, fleißig, intelligent, freundlich zu allen, die er beaufsichtigte. »Der da brüllt, das ist er«, sagte der Chef. »Aber er glaubt selber nicht, dass er noch lange zu leben hat. Die anderen beiden waren tot, als wir ankamen. Wir haben sie rausgezogen und zugedeckt. Sie liegen dort drüben, wenn Sie einen Blick darauf werfen wollen.«
Wie unter Zwang ging George auf die beiden Leichen zu, die unter einer Plane mitten auf der Straße lagen; ein unangenehmer Geruch strömte von ihnen aus. Das Schreien hielt an. Der Wind fachte das Feuer an, verlieh ihm eine fauchende Stimme und wirbelte Funken und glühenden Schutt durch die Luft. Die Freiwilligen pumpten weiter mit aller Kraft; die genieteten Lederschläuche liefen quer durch den leeren Kanal zum Wasser des Flusses.
George stoppte einen Schritt vor der Plane und hob sie an. Unlängst hatte er sich über die Kosten einer modernen Latta-Dampfpumpe für die Stadt informiert, deshalb wusste er einigermaßen Bescheid über Brände und ihre Auswirkungen. Das aber reichte nicht aus, um ihn auf den Anblick des toten Liebespaares vorzubereiten.
Die Frau war schlimmer verkohlt als der Mann, ihre geschwärzte Haut war aufgebrochen und hatte sich an vielen Stellen zusammengerollt. Die versengte Kleidung des Cousins enthüllte Hunderte von Brandblasen, aus denen wie Tränen eine leuchtend gelbe Flüssigkeit sickerte, in der sich das Licht spiegelte. Die Gesichter, Hälse und heraushängenden Zungen der beiden Opfer waren in letzter qualvoller Agonie auf der Suche nach frischer Luft angeschwollen, als nur noch sengender Rauch in ihre Lungen drang. Während sich bei der Frau schwer sagen ließ, ob die Flammen sie getötet hatten oder ob sie erstickt war, bestand beim Cousin kaum Zweifel; seine Augen quollen vor, groß wie Äpfel.
George ließ die Plane fallen und schaffte es, sich nicht zu übergeben, als es ihm heiß in der Kehle hochstieg. Der Anblick hatte bei ihm nicht nur den Gedanken an Feuer heraufbeschworen. Tod. Leiden. Verlust. Und in letzter, alles überwältigender Konsequenz: Krieg. Erschauernd ging er zurück zum Feuerwehrchef; tief in ihm kamen unerwartete Gefühle in Bewegung.
»Kann ich helfen, Tom?«
»Mächtig nett von Ihnen, Sir, aber es ist zu spät, noch irgendwas zu tun. Wir können bloß nebenan alles nass halten.« Ein Feuerwehrmann kam auf sie zugerannt, um zu sagen, dass Fenton gestorben sei. Wieder schauderte George; warum hörte er immer noch dieses Schreien? Er schüttelte den Kopf. Der Chef fuhr fort: »Es war schon zu spät, als wir kamen.«
George nickte voller Trauer und ging zurück zu seinem Pferd.
Was mit George geschah, als er, das Pferd im Schritt gehen lassend, den Schauplatz verließ, war nur als Reaktion auf den Schrecken zu erklären: Der Zustand dumpfer Betäubung, in den er in letzter Zeit abgetrieben war, löste sich endlich auf.
Er hatte gewusst, dass in diesem Land ein Bürgerkrieg tobte. Aber wissen hieß nicht verstehen. Er hatte alles gewusst und nichts verstanden, obwohl er einstmals in Mexiko gekämpft hatte. Aber der Mexiko-Feldzug lag weit zurück. Als er langsam den Hügel hochritt, während der Wind Asche über ihn hinwegtrieb, holte ihn endlich die Realität ein. Die Nation befand sich im Krieg. Sein jüngerer Bruder Billy, ein Offizier des Pionier-Korps, war im Krieg. Sein bester Freund und Klassenkamerad in West Point, Kamerad in Mexiko, war im Krieg. Er erinnerte sich nicht mehr an den Schriftsteller, aber er erinnerte sich an die Zeilen: Niemand ist eine Insel –
Er ließ seine Gedanken über die letzten zwei Wochen zurückschweifen, versuchte, in der nationalen Stimmung eine Erklärung für seine eigene zu finden. Nach drei Jahrzehnten der Spannung war für viele, vielleicht für die meisten Bürger des Nordens, die Bombardierung von Fort Sumter ein willkommenes, wenn nicht freudiges Ereignis gewesen. George hatte diese Gefühle nicht teilen können; die Waffen bedeuteten, dass Männer guten Willens es nicht geschafft hatten, ein schmerzvolles menschliches Problem zu lösen, das am ersten Tag entstanden war, an dem weiße Händler Neger und Negerinnen an der Küste des wilden Amerikas verkauft hatten.
Ein Problem, das schon seit so langer Zeit unlösbar erschien – und zum Schluss nicht einmal mehr analysiert werden konnte, so dicht umgab der rhetorische Stacheldraht die gegnerischen Stellungen. Andere, die stets nur an sich dachten und für sich sorgten, nahmen die ganze Angelegenheit weniger tragisch; sie fanden es nicht bedrohlich, für sie war es lediglich ein Ärgernis, das zu umgehen war – so wie man schlafenden Bettlern in der Gosse auswich.
Aber in den Jahren, in denen der Kriegskessel zum Kochen gebracht worden war, hatte Amerika nicht nur aus zwei Klassen bestanden, den Fanatischen und den Gleichgültigen. Es gab auch Männer und Frauen mit anständigen Absichten. George zählte sich dazu. Hätten sie den Kessel umstoßen, die glühenden Kohlen löschen und ein Konzil der Vernünftigen einberufen sollen? Oder klafften so tiefe Abgründe, dass die Heißsporne auf beiden Seiten das niemals zugelassen hätten? Wie auch immer die Antwort lauten mochte, die Männer guten Willens hatten sich nicht durchsetzen können, hatten den anderen das Kommando überlassen, und die gespaltene Nation befand sich im Krieg.
Trauer. Orry Main hatte sie geteilt, als er Lehigh Station besuchte. Das war gerade zwei Wochen her. Auf seiner mutigen Reise von South Carolina nach Pennsylvania hatte er sich zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt; sein Aufenthalt selbst war extrem gefährlich geworden, als eines Nachts Georges Schwester Virgilia, eine heftige Gegnerin der Sklaverei und besessene Hasserin von allem und jedem, was aus dem Süden kam, einem aufgebrachten Pöbel Orrys Anwesenheit verraten hatte. Nur mit gezogener Waffe hatte George seinen guten, aufrichtigen Freund aus der Stadt bringen können.
Danach war – was gekommen? Nicht Apathie, nicht ganz. Er hatte sich mit den täglichen Problemen befasst: Vertragsangebote, Unbehagen über Fentons häusliche Schwierigkeiten; hundert Dinge, große und kleine. Bis heute Nacht hatte er sich vor der Bedeutung des Krieges gleichsam hinter einer Mauer versteckt. Feuer und Messer hatten diese Mauer zerstört und ihm wieder eine grundsätzliche Lektion ins Gedächtnis gerufen. Zum Teufel mit den Narren, die ganz fröhlich »nur« einen Neunzigtagekonflikt voraussagten. Für Tod und Ruin reichten kurze Augenblicke aus.
Sein Herz hämmerte. Ihm war schlecht. Jenseits der niedergerissenen Mauer erkannte er die Drohung, der er sich in den vergangenen beiden Wochen zu entziehen gesucht hatte. Die Bedrohung betraf das Leben jener, die ihm am meisten auf dieser Welt bedeuteten, das langsam und sorgfältig geschmiedete Band zwischen seiner Familie und der Familie der Mains in South Carolina. Das Feuer hatte ihm gezeigt, wie zerbrechlich dieses Band war. Zerbrechlich wie Fenton und die anderen beiden und das Haus, das sie mit all ihren Leidenschaften, Unzulänglichkeiten und Träumen beherbergt hatte. Von all dem war nur Asche übrig geblieben, die der Wind um ihn herumwirbelte.
Wie er so nach Mitternacht am 1. Mai diesen Hügel in Pennsylvania hochritt, da konnte er der Glut einer kleinen, bald vergessenen häuslichen Tragödie den Rücken zuwenden – ein Klischee in ihrer Häufigkeit und Gewöhnlichkeit; und so gottverdammt erschreckend und herzzerbrechend, wenn man es vor Augen hatte. Physisch konnte er sich abwenden, aber nicht psychisch. Seine Vision griff über die vergangenen zwei Wochen hinaus und umfasste zwei Dekaden.
Die Hazards, Eisenhüttenbesitzer aus Pennsylvania, und die Mains, Reispflanzer aus South Carolina, hatten ihre ersten Bande geknüpft, als sich je ein Sohn aus jedem Haus an einem Sommernachmittag des Jahres 1842 auf einem Pier im New Yorker Hafen begegneten. An diesem Tag schlossen George Hazard und Orry Main Bekanntschaft, auf einem Schiff, das den Hudson River Richtung Norden hochfuhr. Als sie an Land gingen, wurden aus ihnen Kadetten in West Point. Dort erlebten und überlebten sie so vieles, was ihr spontanes Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkte. Da war einmal die Kopfarbeit – leicht für George, der keine große Sehnsucht nach einer militärischen Karriere hatte; schwer für Orry, der nichts anderes anstrebte. Sie schafften es, die Schindereien eines hinterlistigen – einige behaupteten: verrückten – Studenten in höherem Semester namens Elkanah Bent zu ertragen, sie erreichten sogar nach einer Serie besonders abscheulicher Taten, die er begangen hatte, seinen Rausschmiss. Doch Washingtoner Einfluss hatte Bent wieder auf die Militärakademie zurückgebracht, und bei seiner Graduierung hatte er George und Orry versprochen, dass er nichts vergessen und ihnen ihre sämtlichen Sünden zurückzahlen werde.
Die Mains und die Hazards lernten einander kennen, während die lange Zündschnur des Partikularismus zum Pulver der Sezession niederbrannte. Besuche waren abgestattet worden, Bündnisse hatten sich geformt – auch Hass hatte es gegeben. Selbst George und Orry hatten ernsthaft miteinander gestritten. George weilte gerade zu Besuch auf der Mainplantage, Mount Royal, als ein Sklave flüchtete, der gefasst und auf Befehl von Orrys Vater grausam bestraft wurde. Der anschließende Streit stellte die größte Belastungsprobe ihrer Freundschaft dar, und beinahe wäre sie durch die Entzweiung, die wie ein langsam wirkendes Gift in den Blutkreislauf des Landes sickerte, zerstört worden.
Der Mexikanische Krieg, bei dem die beiden Freunde im gleichen Infanterieregiment als Lieutenants dienten, trennte sie schließlich auf unerwartete Art und Weise. Captain »Butcher« Bent schickte George und Orry an der Churubusco Road in den Kampf, wo ein Bombensplitter Orrys linken Arm wegriss und seine Träume von einer militärischen Laufbahn zerstörte. Kurz darauf rief George die Nachricht vom Tode von Hazard senior heim, weil seine Mutter, mit gesundem Instinkt ausgestattet, Georges älterem Bruder Stanley nicht zutraute, das gewaltige Familiengeschäft vernünftig zu lenken. Bald nachdem er das Kommando bei Hazard übernommen hatte, entriss George seinem ehrgeizigen, verantwortungslosen Bruder die Führung über die Eisenwerke.
Die Amputation seines linken Arms versetzte Orry zeitweilig in brütende, einsiedlerische Stimmung. Aber nachdem er erst einmal gelernt hatte, mit einer Hand Arbeiten auszuführen und die Plantage zu leiten, stand er dem Leben wieder optimistisch gegenüber, und seine Freundschaft mit George erneuerte sich von selbst. Orry war Trauzeuge, als George Constance Flynn heiratete, das römisch-katholische Mädchen, das er auf dem Weg nach Mexiko in Texas kennengelernt hatte. Dann beschloss Georges jüngerer Bruder Billy, die Akademie zu besuchen, während Orry, verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit, seinen verwaisten Cousin Charles vor dem Leben eines Taugenichts zu bewahren, diesen überredete, sich bei der Akademie zu bewerben. Bald schon entsprach die Freundschaft von Charles Main und Billy Hazard, die sich zuvor schon gekannt hatten, derjenigen der beiden älteren West-Point-Absolventen.
In der letzten Friedensdekade blieben viele Nord- und Südstaatler persönliche Freunde, trotz der immer heftiger werdenden Rhetorik, den immer schärferen Drohungen der politischen Führer auf beiden Seiten. Auch diese beiden Familien hielten es so. Mains kamen nach Norden, Hazards reisten gen Süden – allerdings in keinem Fall ohne Schwierigkeiten.
Georges Schwester Virgilia, deren leidenschaftliche Sklavenbefreiungsideen längst die Grenze zum Extremismus überschritten hatten, hätte beinahe das Band der Freundschaft gelöst, als sie während eines Hazard-Besuches auf der Plantage einem Mainsklaven zur Flucht verhalf.
Orrys wunderschöne, aber charakterlose Schwester Ashton hatte eine Zeit lang an Billy Gefallen gefunden, aber bald schon erkannte dieser die Güte und Aufrichtigkeit von Ashtons jüngerer Schwester Brett. In vielerlei Hinsicht ebenso halsstarrig und verrückt wie Virgilia, hatte die zurückgewiesene Ashton auf ihren Moment der Rache gewartet; sie zettelte eine Verschwörung an, um Billy in einem an den Haaren herbeigezogenen Duell ermorden zu lassen, keine zwei Stunden nach seiner Hochzeit mit Brett in Mont Royal. Cousin Charles hatte das Komplott in seiner direkten Kavallerieoffiziersart angepackt – das heißt, ziemlich gewalttätig –, und Orry hatte Ashton und ihren Mann, den extremistischen Südstaatler James Huntoon, für immer vom Land der Mains verbannt.
Virgilias schwarzer Geliebter, der Sklave, bei dessen Flucht sie geholfen hatte, war als Mitglied von John Browns mörderischer Bande bei Harpers Ferry erschossen worden. Virgilia, die das miterlebt hatte, war voller Panik nach Hause geflohen und befand sich deshalb in jener Nacht, in der Orry seinen gefährlichen Besuch abstattete, auf Belvedere. Dieser Besuch und die Umstände, die dazu geführt hatten, gingen einem nachdenklichen George durch den Kopf, als er das letzte steile Straßenstück nach Belvedere hochritt.
Orrys bilderstürmender älterer Bruder Cooper war für gewöhnlich anderer Meinung gewesen als die meisten Südstaatler, wenn es um ihre ganz spezielle Institution ging. Als Gegenbeispiel einer auf Landarbeit basierenden Ökonomie, die den Besitz von Menschen erforderlich machte, hatte er den Norden angeführt – keineswegs perfekt, aber ein Schritt in das neue, weltweit angebrochene Zeitalter der Industrialisierung. Im Norden strebten freie Arbeiter unter dem Dröhnen der Maschinen einer blühenden Zukunft entgegen, ohne die Last überalterter Methoden und Ideologien, die so schwer waren wie Handschellen und ebenso hinderlich. Was die traditionelle Ausrede von Coopers Staat und Region anbelangte, dass die Sklaven mehr Sicherheit besaßen und deshalb glücklicher waren als die Fabrikarbeiter in den Nordstaaten, die mit unsichtbaren Ketten an riesige, hämmernde Maschinen geschmiedet waren, so lachte er nur darüber. Ein Fabrikarbeiter konnte tatsächlich bei dem Lohn verhungern, den die Unternehmer ihm zahlten. Aber er konnte weder gekauft noch verkauft werden wie gewöhnliches Hab und Gut. Er konnte jederzeit gehen, und niemand würde ihn verfolgen; kein Arbeiter würde wieder eingefangen, ausgepeitscht und am Schwungrad seiner großen Maschine aufgehängt werden.
Cooper versuchte in Charleston eine Schiffsbauindustrie zu etablieren und hatte sogar mit der Konstruktion eines gewaltigen Eisenschiffs begonnen, entworfen nach den Plänen, die der geniale britische Konstrukteur Brunei ausgearbeitet hatte. George hatte Geld in das waghalsige Unternehmen gesteckt, mehr um ihrer Freundschaft willen und weil er Coopers Glauben teilte, als um eines schnellen Profits willen, für den die Aussichten gering waren.
In den letzten Tagen von Fort Sumter, als der Krieg zur Gewissheit wurde, hatte Orry Hypotheken auf den Familienbesitz aufgenommen und so viel Bargeld wie nur möglich zusammengekratzt. Die Summe belief sich auf sechshundertfünfzigtausend Dollar, einen Bruchteil der ursprünglich von George investierten Million und neunhunderttausend Dollar. Trotz seines deutlichen Südstaatenakzents hatte Orry es auf sich genommen, das Geld in einer kleinen, unscheinbaren Tasche per Zug nach Lehigh Station zu bringen. Das Risiko war gewaltig, aber er kam trotzdem. Aus Freundschaft und weil es um eine Ehrensache ging.
In der Nacht, in der sich die beiden Freunde trafen, hatte Virgilia heimlich den Mob zusammengetrommelt – mit ziemlicher Sicherheit, um den Besucher lynchen zu lassen. Aber der Versuch war fehlgeschlagen, Orry konnte sich mit dem Spätzug in Sicherheit bringen und befand sich nun – wo? South Carolina? War er sicher nach Hause gelangt, so besaß er wenigstens eine Chance, glücklich zu werden. Madeline La Motte, die Frau, die Orrys Liebe besaß, wie sie ihn trotz ihrer Gefangenschaft in einer unheilvollen Ehe liebte, war nach Mont Royal geeilt, um vor einer Verschwörung gegen Billy zu warnen. Einmal dort, blieb Madeline gegen den Willen ihres Mannes, der sie seit Jahren systematisch gequält hatte.
Der Fall von Fort Sumter erzwang neue Entscheidungen. Charles hatte sich, nach seinem Ausscheiden aus der Armee der Vereinigten Staaten, der Kavallerie von South Carolina angeschlossen. Sein bester Freund, Billy, blieb bei den Pionieren der Union. Und Billys in den Südstaaten geborene Frau Brett lebte in Lehigh Station. Die persönliche Welt der Mains und der Hazards befand sich in einem höchst unsicheren Gleichgewicht, während sich massive, bedrohliche, unvorhersehbare Gefahren zusammenbrauten.
Das war es, was George während der vergangenen vierzehn Tage verdrängt hatte. Das Leben war eine zerbrechliche Angelegenheit, Freundschaft ebenso. Vor ihrer Trennung hatten er und Orry sich geschworen, dass der Krieg niemals das Band zwischen ihnen zerschneiden könnte. Als er sich an die Schrecken dieser Nacht, an die Schmerzensschreie und Glutkaskaden erinnerte, fragte sich George, ob sie sich nicht naiv verhielten. Ein fast wildes Gefühl durchpulste ihn, dass er etwas unternehmen musste, um sich selbst seine Hingabe an die Verteidigung ihrer Freundschaft zu bestätigen.
Er brachte sein Pferd in den Stall und begab sich direkt in die Bibliothek von Belvedere, ein geräumiges Zimmer mit dem Geruch von Leder und Papier.
Als er auf seinen Schreibtisch zuging, sah er aus den Augenwinkeln ein Erinnerungsstück, das auf einem ansonsten stets leeren Tisch aufbewahrt wurde. Es war ein konischer Gegenstand, aus grobem Material, ungefähr fünfzehn Zentimeter hoch. Die dunkelbraune Farbe deutete auf schweres Eisenerz hin.
Ihm wurde klar, weshalb seine Aufmerksamkeit erregt worden war. Irgendjemand – möglicherweise das Hausmädchen – hatte den Gegenstand aus seiner gewohnten Position gerückt. Er nahm den Meteoriten in die Hand und hielt ihn fest, während er den Ort vor sich sah, wo er ihn vor langer Zeit gefunden hatte – in den Hügeln um West Point während seiner Kadettenzeit.
Was in seiner Hand lag, war der Splitter eines Meteoriten, der aus unvorstellbaren Fernen durch die bestirnte Finsternis gekommen war. Sternen-Eisen, so nannten es die alten Männer seines Fachs, seine Vorfahren. Als die Pharaonen ihr Reich am Nil regiert hatten, war es bereits bekannt gewesen.
Eisen. Der mächtigste Stoff des Universums. Das Rohmaterial für den Aufbau und die Zerstörung von Zivilisationen. Daraus wurden die gewaltigen Todeswaffen geschmiedet, die George aus einer ganzen Reihe von Gründen zu produzieren beabsichtigte: Patriotismus, Hass auf die Sklaverei, Profit, ein väterliches Verantwortungsgefühl für jene, die bei ihm arbeiteten.
Was hier in seinen Händen lag, war, in gewissem Sinne, Krieg. Schnell legte er das Stück auf den Tisch zurück, genau an die Stelle, wo es hingehörte.
Er zündete das Gaslicht über seinem Schreibtisch an und öffnete die untere Schublade, in die er die kleine, einfache Tasche getan hatte – zur Erinnerung. Eine Weile betrachtete er die Tasche. Dann, aus einem tiefen Gefühl heraus, tauchte er die Feder ein und schrieb mit großer Geschwindigkeit:
Mein lieber Orry,
als Du diese Tasche zurückgabst, hast Du eine Tat von höchstem Mut und Anstand vollbracht. Es ist eine Tat, die ich eines Tages hoffentlich wiedergutmachen kann. Falls ich es nicht tue – nicht tun kann –, so nimm diese Worte hier, damit Du meine Absichten kennst.
Vor allem sollst Du wissen, dass ich unbedingt das Band der Zuneigung zwischen unseren beiden Familien bewahren möchte, das seit so vielen Jahren gewachsen und immer stärker geworden ist. Das ist mein aufrichtigster Wunsch, und danach habe ich gestrebt, trotz Virgilia, trotz Ashton – trotz der Lektionen über die Natur des Krieges, die ich einst in Mexiko gelernt, aber bis heute Nacht vergessen hatte.
Ich weiß, dass Du an den Wert dieses Bandes ebenso glaubst wie ich. Aber es ist so zerbrechlich wie ein Weizenhalm vor der Eisensense. Sollte es uns nicht gelingen, das zu bewahren, was so sehr Bewahrung verdient – oder falls ein Hazard oder Main fällt, was, möge Gott Erbarmen mit uns haben, durchaus der Fall sein kann, wenn dieser Konflikt länger andauert, so wirst Du wissen, dass ich unsere Freundschaft über alles andere stellte und sie nie aufgegeben habe. So, wie ich weiß, dass Du es auch tun wirst. Ich bete darum, dass wir uns sehen, wenn alles vorbei ist, doch falls nicht, so rufe ich Dir – aus meinem tiefsten Herzen – ein liebevolles Auf Wiedersehen zu.
Dein Freund –
Er wollte gerade den ersten Buchstaben seines Vornamens daruntersetzen, doch dann schrieb er stattdessen mit einem feinen, traurigen Lächeln seinen Spitznamen von West Point: Stumpf.
Langsam faltete er die Blätter; langsam legte er sie in die Tasche und schnallte sie zu; langsam schloss er die Schublade und erhob sich, begleitet von einigen irritierenden Geräuschen seiner Gelenke. Wegen der warmen Nacht standen die Fenster überall in Belvedere offen. Er roch den schwächer werdenden Brandgeruch, den der Wind herbeitrug. Ihn fror, und er fühlte sich alt, als er das Gaslicht ausdrehte und müde die Treppe hochstieg.
Erstes Buch
Eine Vision von Scott
Die Flagge, die jetzt noch hier in der Brise flattert, wird vor dem 1. Mai über dem Dom des alten Kapitols von Washington wehen.
LEROY P. WALKER,
Kriegsminister der Konföderierten, bei einer Rede in Montgomery, Alabama, April 1861
1
Die Morgensonne überflutete die Weide. Plötzlich tauchten hinter einem Hügel drei schwarze Pferde auf. Zwei weitere Pferde, mit herrlich glänzendem Fell und wehenden Mähnen und Schweifen, folgten ihnen hinunter in das windgepeitschte Gras. Dicht dahinter erschienen zwei berittene Sergeants in reichlich mit Tressen versehenen Husarenjacken. Die Sergeants, breites Grinsen auf den Gesichtern, ritten im Galopp, brüllend und ihre Mützen in Richtung der schwarzen Pferde schwenkend.
Der Anblick lenkte sofort Captain Charles Mains Truppe ab. Die jungen Freiwilligen aus South Carolina ritten auf ihren Braunen eine Straße entlang, die sich durch Wälder und Farmland des Prince William County schlängelte. Die Dreitageübung hatte sie ein ganzes Stück nordwärts zwischen Richmond und Ashland geführt, aber Charles glaubte, dass ein langer Ritt nötig war, um die Männer einzugewöhnen. Alle waren sie geborene Reiter und Jäger; andere Leute hätte Colonel Hampton für die Kavallerietruppe, die er in Columbia zusammengestellt hatte, gar nicht genommen. Aber ihre Reaktion auf die Poinsett Tactics, so der inoffizielle Name für das Handbuch, das seit 1841 die Bibel des Kavalleristen war, reichte von unterdrückter Gleichgültigkeit bis zu lauter Verachtung.
»Verschone mich vor Gentlemen-Soldaten«, murmelte Charles, als einige seiner Männer ihre Pferde dem Zaun zuwandten, der Straße und Wiese trennte. Die schwarzen Pferde schwenkten um und galoppierten neben dem Zaun her. Die schwitzenden Sergeants waren ihnen hart auf den Fersen; sie donnerten an der langen Reihe der Kavalleristen in ihren schmucken, mit glänzenden Goldknöpfen verzierten Jacken vorbei.
»Wer seid ihr, Jungs?«, rief Charles’ Senior-Lieutenant, ein untersetzter, fröhlicher junger Mann mit rotem Kraushaar.
Die Junibrise trug, von Hufschlägen überdeckt, die Antwort zurück. »Black Horse. Fauquier County.«
»Zeigen wir ihnen, wie man reitet, Charlie«, schrie First-Lieutenant Ambrose Pell seinem Vorgesetzten zu.
Um ein Chaos zu vermeiden, bellte Charles einen Befehl: »In Zweierreihen – Trab – vorwärts!«
Das Manöver wurde so schlampig ausgeführt, dass es fast schon an Befehlsverweigerung grenzte. Die Truppe schaffte es, sich in der richtigen Gangart zu Zweierreihen zu formieren, und reagierte dann mit viel Geschrei auf Charles’ Befehl zum Galopp. Aber es war schon zu spät, um die Sergeants noch einholen zu können, die die fünf schwarzen Pferde nach links trieben, über eine Wiese hinweg, und dann in einem Wäldchen verschwanden.
Neid bohrte seinen Stachel in Charles. Wenn die Unteroffiziere tatsächlich zur Black-Horse-Kavallerie gehörten, von der er schon so viel gehört hatte, dann hatten sie sich ein paar edle Tiere eingefangen. Mit seinem eigenen Pferd Dasher, in Columbia gekauft, war er unzufrieden. Die Stute stammte aus guter Carolina-Zucht, scheute aber häufig. Bis jetzt hatte »die Stürmerin« ihrem Namen noch keine Ehre gemacht.
Die Straße bog nach Nordosten ab, weg von der eingezäunten Weide. Charles reduzierte die Gangart auf Trab und ignorierte eine weitere frivole Frage von Ambrose, den er, beruflich gesehen, unglückseligerweise mochte. Er fragte sich, wie um alles in der Welt er aus dieser Ansammlung von Aristokraten, die einen beim Vornamen nannten, West Point verachteten und einen niederzuschlagen versuchten, wenn man ihnen einen unliebsamen Befehl gab, eine Kampfeinheit formen sollte. Seit ihrer Ankunft im Biwak unten in Hanover County hatte Charles zweimal seine Fäuste zu Hilfe nehmen müssen, um Disziplin herzustellen.
In der Hampton-Truppe hatte er so eine Art zusammengewürfelte Einheit bekommen, mit Männern, die aus allen Teilen South Carolinas stammten. Fast alle anderen unter Hamptons Kommando stehenden Einheiten, egal ob zu Fuß oder zu Pferd, waren in einem County, manche sogar in einer einzigen Stadt, zusammengestellt worden. Der Mann, der eine Kompanie formte, gewann für gewöhnlich auch die Wahl, mit der die Freiwilligen sich ihren Captain suchten. In Charles’ Truppe gab es weder derartige Bekanntschaften noch Freundschaften; in seinem Dienstverzeichnis standen Jungs aus den Bergen, vom Fuße des Gebirges, ja sogar aus seinem eigenen Flachland. Dieses bunte Gemisch forderte einen Führer, der nicht nur aus guter Familie stammte, sondern auch über ausreichende Erfahrung in militärischen Dingen verfügte. Ambrose Pell, Charles’ Gegenkandidat bei der Wahl, besaß das Erstere, aber nicht das Letztere. Und Wade Hampton hatte noch vor der Abstimmung klargemacht, wer für ihn infrage kam. Trotzdem hatte Charles nur mit einer Mehrheit von zwei Stimmen gewonnen. Allmählich wünschte er, er hätte Ambrose gewählt.
Jetzt jedoch, wo die laue Sommerbrise sein Gesicht streichelte und Dasher auf jeden Schenkeldruck reagierte, hatte er das Gefühl, dass er zu großen Wert auf Disziplin legte. Bis jetzt war der Krieg ein einziger Jux. Ein Yankee-General, Butler, war bereits in einem heftigen Gefecht bei Bethel Church vermöbelt worden. Die Yankee-Hauptstadt, die der Politiker aus dem Westen präsidierte, den viele South Caroliner nur den »Gorilla« nannten, sollte sich in ein schreckensstarres Dörfchen verwandelt haben. Das Hauptproblem der vier Truppen der Hampton-Kavallerie schien sich auf epidemische Bauchschmerzen zu beschränken, erzeugt durch zu viele Feste in Richmond. Sämtliche Freiwilligen hatten sich für zwölf Monate verpflichtet, aber keiner von ihnen glaubte daran, dass dieser Hickhack zwischen den beiden Regierungen neunzig Tage dauern würde. Während er den Duft des sonnenwarmen Grases und des Pferdeleibes einsog, fiel auch Charles, fünfundzwanzig Jahre alt, groß und tief gebräunt und auf eine etwas raue Art gut aussehend, der Gedanke schwer, dass sie sich im Krieg befanden. Noch größere Schwierigkeiten bereitete ihm die Erinnerung an das mulmige Gefühl in den Eingeweiden, wenn man ernst gemeinte Kugeln pfeifen hört, obwohl ihm schon einige um die Ohren geflogen waren, bevor er zu Beginn des Jahres bei der Zweiten U.S.-Kavallerie in Texas ausgetreten und heimgekehrt war, um sich den Konföderierten anzuschließen.
»Oh, Jung-Lochinvar kam aus dem Westen –« Charles lächelte; Ambrose sang das Gedicht mit monotoner Stimme. Andere fielen schnell ein: »– überall entlang der weiten Grenze war sein Streitross am besten.«
Sympathie für diese jungen Heißsporne dämpfte Charles’ professionelle Vorbehalte. Er hätte das Singen unterbinden müssen, aber er tat es nicht, sondern genoss schweigend seine persönliche Isolation. Er war lediglich ein paar Jahre älter als die meisten von ihnen, kam sich aber wie ihr Vater vor.
»So treu in der Liebe und so furchtlos im Krieg – nie gab es einen Ritter, der Jung-Lochinvar glich!«
Wie sie ihren Scott liebten, diese Südstaatenjungs. Die Frauen waren da nicht anders. Alle beteten sie Scotts ritterliche Visionen an und lasen unermüdlich jeden Roman und jedes Gedicht, das er geschrieben hatte. Vielleicht lag in dieser seltsamen Bewunderung des alten Sir Walter einer der Schlüssel zu diesem eindeutig seltsamen Krieg verborgen, der noch gar nicht richtig begonnen hatte. Cousin Cooper, der Ketzer der Mainfamilie, sagte oft, der Süden blicke zu viel zurück, anstatt sich auf die Gegenwart zu konzentrieren – oder auf den Norden, wo Fabriken wie die Eisenwerke der Hazard-Familie die geografische und politische Landschaft dominierten. Voller Anbetung zurückzublicken zu der Ära von Scotts federgeschmückten Rittern war eine Angewohnheit, die Cooper häufig und voller Leidenschaft kritisierte.
Ganz plötzlich, voraus, zwei Schüsse. Ein Ruf von hinten. Sich im Sattel umdrehend, sah Charles, dass der Kavallerist, der aufgeschrien hatte, noch aufrecht saß – nur überrascht, nicht getroffen. Lautlos seine Unaufmerksamkeit verfluchend, wandte er sich wieder nach vorn und konzentrierte seinen Blick auf ein dichtes Nussbaumwäldchen rechts von der Straße. Blaue Rauchschlieren zwischen den Bäumen verrieten die Stelle, wo die Schüsse abgefeuert worden waren. Ambrose und einige andere grinsten. »Knöpfen wir uns die Bande vor«, brüllte ein Kavallerist begeistert.
Du Idiot, dachte Charles, während sich seine Magengegend zusammenkrampfte. Er erspähte Pferde in dem Wäldchen und hörte das Knallen weiterer Gewehre, übertönt vom Brüllen seiner eigenen Stimme, die den Befehl zum Angriff gab.
2
Der Angriff von der Straße auf die Bäume zu war ungeordnet, aber wirkungsvoll. Eine Yankee-Patrouille von einem halben Dutzend Reiter galoppierte davon, als Charles’ Männer das Wäldchen stürmten.
Charles war der Erste, sein doppelläufiges Schrotgewehr in der Armbeuge. Die Akademie und Texas hatten ihm beigebracht, dass erfolgreiche Offiziere führen; sie feuern nicht ihre Leute an. Der reiche und kräftig gebaute Pflanzer, der die Truppe zusammengestellt hatte, war das beste Beispiel dafür. Hampton war einer jener seltenen Männer, die kein West Point nötig hatten, um zu wissen, wie man Soldaten führt.
Zwischen den Walnussbäumen dröhnten Schrotgewehre, beantwortet von Gewehrfeuer; der Rauch wurde dichter, und Charles’ Truppe riss auseinander. Jeder suchte sich seinen eigenen Weg, verhöhnte den jetzt kaum noch sichtbaren flüchtenden Feind.
»Wohin rennt ihr Yankee-Jungs so schnell?«
»Na los, dreht euch um und kämpft gegen uns!«
»Die sind unsere Zeit gar nicht wert, Jungs!«, schrie Ambrose Pell. »Ich wünschte, unsere Nigger wären hier. Die könnten sie jagen.« Ein einzelner Schuss aus einem dunklen Teil des Wäldchens unterstrich seine letzten Worte. Instinktiv duckte sich Charles auf Dashers Hals hinunter. Die Stute schien nervös, unsicher, obwohl sie wie alle anderen Truppenpferde auch im Camp von Columbia an Gewehr- und Artilleriefeuer gewöhnt worden war.
Eine Kugel zischte vorbei. Sergeant Peterkin Reynolds brüllte. Sofort feuerte Charles beide Läufe in Richtung der Bäume ab. Augenblicklich ertönte ein Schmerzensschrei.
Er riss Dashers Kopf hart zurück, drehte sich um. »Reynolds?« Bleich, aber grinsend hielt der Sergeant seinen grauen Kadettenärmel hoch, mit einem Riss unten am Aufschlag und lediglich einem kleinen Blutfleck.
Freunde von Reynolds nahmen die Verwundung weniger leicht. »Verfluchte Schneider und Schuster zu Pferd«, schrie ein Mann, als er an Charles vorbeigaloppierte, der ihn vergeblich zurückbefahl.
Durch eine Baumlücke sah Charles einen Nachzügler der Unions-Patrouille, einen plumpen blonden Burschen ohne jede Kontrolle über sein Pferd, einen jener schweren Klepper, wie sie für die eilig zusammengewürfelte Nordstaaten-Kavallerie typisch waren. Der Mann gab seinem Pferd die Sporen und fluchte. Ein Deutscher.
Der Deutsche war ein derart schlechter Reiter, dass der Kavallerist, der an Charles vorbeigedonnert war, keine Mühe hatte, ihn einzuholen und seitlich aus dem Sattel zu zerren. Er schlug schwer zu Boden und kreischte, bis er seinen Stiefel aus dem linken Steigbügel befreit hatte.
Der junge Mann aus South Carolina hatte seinen langen, sechs Pfund schweren Säbel mit der zweischneidigen, geraden Klinge gezogen, der nach den Anweisungen des Colonels in Columbia geschmiedet worden war und über die den Vorschriften entsprechende Länge hinausging. Hampton hatte seine Truppe aus eigener Tasche ausgerüstet.
Ambrose ritt an Charles’ Seite. Er deutete nach vorn. »Schau dir das an, Charlie, ja? Verschreckt wie ’n Waschbär.«
Ambrose übertrieb nicht. Der Yank kniete zitternd auf dem Boden, als der Kavallerist aus dem Sattel stieg, seinen Säbel mit beiden Händen packte und weit ausholte. Charles schrie: »Cramm! Nein!«
Kavallerist Cramm wirbelte herum und funkelte ihn an. Charles schob dem Lieutenant seine Schrotflinte in die Hand und sprang mit einem Satz vom Pferd. Er rannte auf den Kavalleristen zu und packte den noch immer erhobenen Arm.
»Ich sagte Nein.«
Trotzig wehrte sich der Kavallerist gegen Charles’ Griff. »Lass mich los, du verdammtes Schoßhündchen, du verfluchter West-Point-Hundesohn, du verdammter –«
Charles ließ los, donnerte dann seine rechte Faust in Cramms Gesicht. Aus der Nase blutend, knallte der junge Mann rücklings gegen einen Baumstumpf. Charles entwand ihm den Kavalleristensäbel und drehte sich um, schaute die finster blickenden Männer zu Pferd an. »Wir sind Soldaten, keine Metzger, und ihr tut besser daran, das nicht zu vergessen. Der nächste Mann, der sich meinem Befehl widersetzt oder mich verflucht oder mich mit dem Vornamen anredet, marschiert vors Kriegsgericht. Nachdem ich persönlich mit ihm fertig bin.«
Er ließ seine Blicke über einige feindselige Gesichter gleiten, warf dann den Säbel zu Boden und ließ sich seine Schrotflinte zurückgeben. »Lassen Sie antreten, Lieutenant Pell.«
Ambrose wich seinem Blick aus, kam aber dem Befehl nach. Charles hörte Gemurre. Die freudige Stimmung des Morgens war verschwunden; es war ohnehin dumm von ihm gewesen, daran zu glauben.
Entmutigt fragte er sich, wie seine Männer im echten Kampf überleben sollten, wenn sie ein Scharmützel weniger ernst nahmen als eine Fuchsjagd. Wie konnten sie siegen, wenn sie sich weigerten, als Einheit kämpfen zu lernen – was in allererster Linie hieß, Gehorsam zu lernen?
Sein langjähriger Freund aus West-Point-Tagen, Billy Hazard von den Bundes-Pionieren, wusste, wie wichtig es war, den Krieg ernst zu nehmen. Cousin Orry Main und dessen engster Freund, Billys älterer Bruder George, wussten es ebenfalls. Alle Männer von der Akademie wussten es. Vielleicht erklärte das die Kluft, die zwischen den Berufsoffizieren der alten, regulären Armee und den Amateur-Heißspornen klaffte. Selbst Wade Hampton machte sich manchmal über die Männer von West Point lustig.
»Nicht schlimmer als Bienengesumm, nicht wahr?«, hörte Charles einen Kavalleristen sagen, während Ambrose die Truppe auf der Straße wieder zu Zweierreihen formte.
Charles enthielt sich jeglichen Kommentars und ritt zu dem sich windenden, dreckverschmierten Gefangenen. »Du wirst einen weiten Weg mit uns zurückmarschieren müssen. Aber dir wird nichts geschehen. Verstehst du?«
»Ja, versteh.« Der Deutsche sprach ein mühsames Englisch.
Die Kavalleristen hielten alle Yankees für Pöbel oder Arbeiter; unwürdige Gegner. Als Charles den armseligen, dickbäuchigen Gefangenen musterte, konnte er diesen Standpunkt verstehen. Der Jammer dabei war lediglich der, dass es im Norden hunderttausendmal mehr armseliges Volk gab als im Süden. Das machten sich die Jungs aus Carolina nie klar.
Sein Freund Billy kam ihm in den Sinn. Wo war er? Würde Charles ihn jemals wiedersehen? Würden sich die Hazards und Mains je wieder nahestehen? Trotz der Ehe von Cousine Brett mit Billy?
Zu viele Fragen. Zu viele Probleme. Auf einmal war die Sonne für diese Sommerzeit viel zu kalt. Eine halbe Meile vom Schauplatz des Scharmützels entfernt hörte Charles seine Stute Dasher husten. Ihre Nüstern waren übermäßig feucht, als er ihren Kopf herumzog.
Beginnender Ausfluss? Ja. Der Husten hielt an. Gott, nicht die Druse, dachte er. Das war eine Winterkrankheit.
Aber sie war ein junges Pferd, sehr empfindlich. Ihm wurde klar, dass er ein weiteres Problem hatte, mit möglicherweise katastrophalen Folgen.
3
Jeden Schulterstreifen des jungen Mannes zierte eine einzelne Silbertresse. Sein Revers zeigte das Schloss mit den Türmen innerhalb eines Lorbeerkranzes, das Ganze goldgeschmückt auf einem kleinen schwarzen Samtoval. Sehr elegant, diese Uniform aus dunkelblauem Waffenrock und Röhrenhosen.
Der junge Mann wischte sich den Mund mit einer Serviette ab. Er hatte ein köstliches Mahl aus Beefsteak, Röstzwiebeln und Austern verspeist, dem er eine Mandelsüßspeise folgen ließ – morgens um zehn nach zehn. Frühstück konnte man hier bis elf Uhr bestellen. Washington war eine bizarre Stadt. Aber auch eine erschreckende Stadt. Jenseits des Potomac auf Arlington Heights entwarf Brigadegeneral McDowell Kriegspläne in dem Herrschaftshaus, das die Lees verlassen hatten. Während er auf neue Befehle wartete, hatte der junge Mann vorgestern ein Pferd gemietet und war hinübergeritten. Es hatte ihn nicht gerade aufgemuntert, als Armee-Hauptquartier einen überfüllten, lärmenden Ort mit deutlichen Anzeichen von allgemeiner Verwirrung vorzufinden. Hier schien man sich ziemlich bewusst zu sein, dass die Konföderierten-Posten nicht allzu viele Meilen entfernt standen.
Bundestruppen hatten den Potomac überquert und Ende Mai die Virginiaseite besetzt. Regimenter aus New England drängten sich nun in die Stadt. Ihre Anwesenheit schwächte das Entsetzen ab, das in der ersten Woche nach Fort Sumters Fall über Washington gelegen hatte; zu jener Zeit waren Telegrafen- und Eisenbahnverbindungen nach Norden für eine Weile unterbrochen gewesen. Jeden Moment hatte man mit einem Angriff gerechnet. Das Kapitol war eiligst befestigt worden. Einige der Ersatztruppen wurden vorübergehend dort untergebracht. Die Anspannung hatte sich etwas gelegt, aber der junge Mann spürte auch hier noch die gleiche Verwirrung, die er in McDowells Hauptquartier entdeckt hatte. Zu viele neue und alarmierende Dinge ereigneten sich zu schnell.
Gestern Abend hatte er im Büro des alten Generals Totten, des Befehlshabers der Pioniere, seine Befehle entgegengenommen. First Lieutenant William Hazard wurde dem Department von Washington zugeteilt und hatte sich bei einem Captain Melanchton Elijah Farmer zum einstweiligen Dienst zu melden, bis seine reguläre Einheit, die Kompanie A – und aus mehr bestand das Pionier-Korps der Armee der Vereinigten Staaten nicht –, von einem anderen Auftrag zurückkehrte. Billy hatte den Aufbruch der A-Kompanie verpasst, da er sich zu der Zeit zu Hause in Lehigh Station, Pennsylvania, erholte, wohin er seine junge Braut Brett gebracht hatte. Er hatte sie auf der Main-Plantage in South Carolina geheiratet und wäre anschließend um ein Haar von einem ihrer früheren Verehrer ermordet worden.
Charles Main hatte ihm das Leben gerettet. Billys linker Arm schmerzte noch gelegentlich von der Derringer-Kugel, die ihn genauso gut hätte umbringen können. Der Schmerz diente einem guten Zweck. Er erinnerte ihn daran, dass er auf ewig in Charles Mains Schuld stehen würde.
Das Frühstück hatte seinen Hunger gestillt, ihn aber nicht von seinen Vorahnungen erlöst. Billy war ein guter Ingenieur. Er war ausgezeichnet in Mathematik und liebte die Berechenbarkeit von Gleichungen und ähnlichen Dingen als Standardverfahren für Konstruktionen. Jetzt sah er sich einer Zukunft gegenüber, die weder geordnet noch berechenbar war.
Mehr noch, er fühlte sich isoliert. Er war von seinen Berufskollegen getrennt; von seiner Frau, die er von ganzem Herzen liebte; und, aus eigenem Entschluss, von einem seiner älteren Brüder. Stanley Hazard lebte mit seiner unangenehmen Frau und ihren beiden Zwillingssöhnen in dieser Stadt. Stanley war von seinem politischen Mentor, Simon Cameron, mit ins Kriegsministerium genommen worden.
Billy liebte seinen älteren Bruder George, aber für Stanley hegte er namenlose, zwiespältige Gefühle, die sich aus fehlendem Respekt, Schuldgefühlen und fehlender Zuneigung zusammensetzten. Er kannte keinen Menschen in Washington, aber das brachte ihn nicht dazu, Stanley zu besuchen. Tatsächlich hatte er deswegen im National Hotel sein Frühstück eingenommen, weil ein Großteil der Gäste hier immer noch für den Süden war; Stanley würde daher mit ziemlicher Sicherheit hier nicht anzutreffen sein.
Er hatte die Rechnung bezahlt und gab dem Kellner ein Trinkgeld. »Danke, Sir – ich danke Ihnen. Das ist viel mehr, als ich von diesen billigen Westerntypen bekomme, die hier in der Stadt auftauchen, um sich von ihrem Nigger liebenden Präsidenten einen Job vermitteln zu lassen. Zum Glück haben wir hier nicht so viele von dem Westernpack. Sie trinken kaum, vögeln werden sie vermutlich auch nicht, und alle schleppen sie ihr Gepäck selber. Einige meiner Freunde in anderen Hotels verdienen nicht mal –«
Billy ließ ihn mit seinem Gejammer stehen; der Akzent des Mannes deutete darauf hin, dass er aus dem Süden oder aus einem der Grenzstaaten stammte. Es schien massenhaft solche Leute in der Hauptstadt zu geben. Yankees, aber nur dem Namen nach. Fiel die Stadt, was durchaus der Fall sein mochte, dann würden sie in den Straßen die Stars-and-Bars-Fahne zur Begrüßung von Jeff Davis schwenken. Draußen stellte er fest, dass es mittlerweile aus schlammig grauem Himmel zu nieseln begonnen hatte. Er stülpte seinen schwarzen Filzhut auf; eine Seite der tressenbesetzten Krempe war hochgebogen und wurde von einem glänzenden Messingadler gehalten.
Billy, ein Jahr älter als sein Freund Charles, war ein sehr kräftig gebauter junger Mann mit dunklen Haaren und den farblosen, eisigen Augen, wie sie in der Hazard-Familie üblich waren. Das derbe Kinn verlieh ihm einen Ausdruck von Zuverlässigkeit und Stärke. Kürzlich hatte er der neuen Schnurrbart-Mode nachgegeben; seiner, aus dem er jetzt gerade ein Frühstücksbrösel klaubte, war dicht und noch dunkler als sein Haar.
Da Billy vermutete, dass es sich bei Captain Farmer um einen politischen Günstling handelte, hatte er es mit seiner Meldung nicht eilig. Er beschloss, sich noch einige Stunden zu gönnen, um die Stadt zu erforschen – die Viertel, die weitab vom respektablen, modernen Teil lagen.
Bald schon bereute er seinen Entschluss. Der Krieg hatte die Stadtbevölkerung auf das Dreifache der ursprünglichen Vierzigtausend anschwellen lassen. Man konnte nicht über die Straße gehen, ohne Kutschen ausweichen zu müssen, betrunken schwankenden Soldaten, Fuhrleuten, die auf ihre Maultiere eindroschen und sie verfluchten, eleganten Gentlemen, die einem die Adresse eines Quacksalbers zuflüsterten, der die Französische Krankheit in vierundzwanzig Stunden kurierte – sogar Schweine und schnatternde Gänse waren unterwegs.
Schlimmer noch, die Stadt stank. Die schlimmsten Düfte stammten von den Abwässern, die voll schleimiger Klumpen im Stadtkanal trieben. Billy stoppte auf einer der Fußgängerbrücken, die zum Südwestteil führten, bekannt als »die Insel«. Er schaute hinunter, wo ein toter Hund zwischen Salatblättern und Exkrementen dahintrieb.
Er schluckte Reste seines Frühstücks hinunter und ging schnell davon, in Richtung Osten auf das Kapitol zu, dessen Dom immer noch fehlte. Überall schwärmten Soldaten und Politiker herum. Arbeiter flitzten um große Stapel von Holz, Eisenplatten und Marmorblöcken. Billy bog um einen solchen Block und kollidierte mit einer alten, übergewichtigen Hure in federgeschmücktem, schmutzigem Samt. Sie ließ ihm die Wahl zwischen sich und ihrer graugesichtigen Tochter, nicht älter als vierzehn, die sich an ihre Seite drückte.
Billy bemühte sich um Höflichkeit. »Ma’am, ich habe eine Frau in Pennsylvania.«
Die Hure hatte für seine Höflichkeit nicht viel übrig. »Leck mich am Arsch«, sagte sie, als er weiterging. Er lachte, aber nicht aus vollem Herzen. Ein paar Minuten später strebte er nach Norden in das überfüllte Gebiet, wo er ein Zimmer in einer Pension genommen hatte. Unterwegs kaufte er sich noch ein Schreibheft.
Später, in der zunehmenden Dämmerung, spitzte er eine Feder an. In Hemdsärmeln beugte er sich über die erste leere Seite seines Heftes, das von einer Lampe erhellt wurde. Er trug das Datum ein und schrieb:
Meine geliebte Frau – ich beginne dieses Tagebuch und werde es weiterführen, damit Du weißt, was ich, außer Dich ständig zu vermissen, heute getan habe und an den kommenden Tagen tun werde. Heute habe ich die Hauptstadt erkundet – kein angenehmes oder herzerwärmendes Erlebnis, aus Gründen, die der Anstand mir verbietet, dieser Seite anzuvertrauen -–
Bei dem Gedanken an Brett – an ihr Gesicht, ihre Hände, ihren Duft in der Intimität ihres Bettes – spürte er ein körperliches Bedürfnis nach ihr. Für einen Moment schloss er die Augen. Als er sich wieder unter Kontrolle hatte, kritzelte er weiter.
Die Stadt ist bereits schwer befestigt, was ich als Anzeichen eines langen Krieges deuten würde, wäre es nicht allgemeine Überzeugung, dass er nur kurz sein wird. Ein kurzer Krieg ist aus vielerlei Gründen wünschenswert – nicht zuletzt aus dem offensichtlichsten Grund, dass wir als Mann und Frau zusammenleben können, wo immer auch mein Dienst mich in Friedenszeiten hinführen wird. Aber abgesehen von persönlichen Dingen lässt uns ein kurzer Krieg mehr Hoffnung, die Dinge wieder in die alte Ordnung zu bringen. Heute begegnete ich auf einem öffentlichen Weg einem Neger – entweder ein Freigelassener oder Konterbande, wie General Butler Südstaaten-Flüchtlinge bezeichnet. Der schwarze Mann gab den Gehsteig nicht frei, um mich passieren zu lassen. Die Erinnerung an diesen Vorfall hat mich den ganzen Tag beunruhigt. Ich bin ebenso sehr wie jeder andere Bürger darauf bedacht, die Schande der Sklaverei zu beenden, aber die Freiheit des schwarzen Mannes darf nicht zum Freibrief werden, und ich glaube, ich stehe mit dieser Ansicht nicht allein. Für die Armee, das weiß ich, trifft es mit absoluter Sicherheit zu. Es heißt sogar, selbst unser Präsident spreche immer noch von der Notwendigkeit, die befreiten Schwarzen wieder in Liberia anzusiedeln. Deshalb meine Furcht vor einem sich länger hinziehenden Krieg, der sehr wohl das Chaos zu vieler schneller Veränderungen in der sozialen Ordnung mit sich bringen könnte.
Er hielt inne, die Feder auf gleicher Höhe wie die stetige Flamme. Wie feucht, wie schwer die Luft auf ihm lastete; jeder tiefe Atemzug kostete Anstrengung.
Die Worte erzeugten unerwartete Schuldgefühle. Jetzt schon verdammte er beinahe die ideologische Konfusion des Krieges. Vielleicht würden sich klarere Antworten abzeichnen, wenn er und Brett erst wieder vereint waren und sie dieses Tagebuch las.
Verzeih die merkwürdige Philosophiererei. Die Atmosphäre hier erzeugt eigenartige Zweifel und Reaktionen, und ich habe niemanden, mit dem ich das teilen könnte, mit Ausnahme desjenigen Menschen, mit dem ich alles teile – mit Dir, meine geliebte Frau. Gute Nacht, und möge Gott Dich segnen – – –
Mit einem langen Federstrich beendete er den Absatz und schlug das Heft zu. Kurz darauf zog er sich aus und löschte die Lampe. Der Schlaf wollte nicht kommen. Das Bett war hart, und vor lauter Sehnsucht nach Brett wälzte er sich ruhelos herum, während draußen in den Straßen Rowdys Scheiben zerbrachen und Pistolenschüsse abfeuerten.
»Lije Farmer? Gleich dort, Kamerad.«
Der Corporal deutete auf ein Sibley-Zelt, weiß und kegelförmig, eines von vielen. Er gab Billy einen aufmunternden Klaps und schlenderte pfeifend davon. Bei den Freiwilligen war eine solche Disziplinlosigkeit derart weit verbreitet, dass Billy gar nicht darauf achtete. Vor dem Eingang zum Zelt räusperte er sich. Er faltete seine Handschuhe über der Schärpe und trat ein, den Marschbefehl in der linken Hand.
»Lieutenant Hazard meldet sich zur Stelle, Captain – Farmer –« Die Verblüffung zog das letzte Wort in die Länge. Der Mann mochte fünfzig oder mehr sein. Schlohweißes Haar; patriarchalischer Ausdruck. Er stand im Unterhemd da, die Hosenträger über den Hüften, und hielt eine Bibel in der rechten Hand. Auf einem gebrechlichen Tisch entdeckte Billy einige technische Texte von Mahan. Er war zu verwirrt, um irgendetwas anderes wahrzunehmen.
»Ein herzliches Willkommen, Lieutenant. Ich habe Ihrer Ankunft mit großer Freude, nein, Erregung entgegengesehen. Sie überraschen mich gerade dabei, wie ich dem Allmächtigen im Morgengebet Dank sagen möchte. Wollen Sie sich mir nicht anschließen, Sir?«
Er kniete nieder. Bestürzung verdrängte sein Erstaunen, als Billy erkannte, dass es sich bei Captain Farmers Frage um einen Befehl handelte.
4
Während Billy sich in Alexandria zum Dienst meldete, fand eine der routinemäßigen Regierungsversammlungen im Gebäude des Kriegsministeriums an der Westseite des President’s Park statt. Simon Cameron, der frühere politische Boss von Pennsylvania, führte von seinem unglaublich überhäuften Schreibtisch aus den Vorsitz, obwohl der Minister selbst die Versammlung nicht einberufen hatte; das hatte der ältliche, selbstgefällige Luftballon veranlasst, der vorgab, die Armee zu kommandieren. Von einem Stuhl in einer Ecke aus, in die Cameron zwei Assistenten als Beobachter befohlen hatte, beobachtete Stanley Hazard General Winfield Scott mit einer Verachtung, die zu verbergen ihm Mühe bereitete.
Stanley, der auf die vierzig zuging, war ein blasser Mensch. Zwar mit Bauch, aber beinahe zierlich im Vergleich zu dem General, der schon vor langer Zeit den Spitznamen »Alter Schaumschläger« bekommen hatte. Fünfundsiebzig Jahre alt, mit einem Rumpf, der einem aufgequollenen Klumpen Brotteig glich, so ließ Winfield Scott den oberen Teil des größten Stuhles, der im Gebäude aufzutreiben gewesen war, unter seiner Körpermasse verschwinden. Tressen überzogen seine Uniform.
Außerdem nahmen an der Versammlung noch der gut aussehende, pompöse Finanzminister, Mr. Salmon Chase, teil und ein Mann in einem schlicht geschnittenen grauen Anzug, der in der Stanley gegenüberliegenden Ecke saß. Seit Beginn der Versammlung hatte der Mann kaum ein Wort gesprochen. Mit höflicher, aufmerksamer Miene lauschte er Scotts Geschwafel. Als Stanley den Präsidenten das erste Mal auf einem Empfang getroffen hatte, entschied er, dass es nur ein passendes Wort für ihn gab: abstoßend. Es war mehr eine Sache des persönlichen Stils als der äußeren Erscheinung, obwohl Letztere sicherlich schon schlimm genug war. Stanley hatte eine Liste weiterer, gleicherweise treffender Beschreibungen zusammengestellt. Dazu gehörten albern, tölpelhaft und tierisch.
Unter Druck hätte Stanley zugegeben, dass er für die Teilnehmer an dieser Versammlung, allenfalls mit Ausnahme seines Vorgesetzten, nichts übrig hatte. Natürlich verlangte sein Job, dass er Cameron bewunderte, der ihn als Belohnung für viele freigebige Beiträge zu dessen politischen Kampagnen nach Washington gebracht hatte.
Obwohl loyal eingestellt, hatte Stanley schnell die gröbsten Schwächen des Ministers erkannt. Beweis dafür sah er vor sich in den Aktentürmen und den Stapeln von Zeitungen aus Richmond und Charleston – wichtige Quellen für Kriegsinformationen –, die von jedem verfügbaren Plätzchen des Schreibtischs aus in die Höhe ragten. Vom Teppich ragten ähnliche Säulen empor. Chaos hieß der Gott, der Simon Camerons Kriegsministerium regierte.
Hinter dem großen Schreibtisch saß der Meister von alldem, den Mund zusammengepresst, das graue Haar lang, die grauen Augen ein Rätsel. In Pennsylvania hatte man ihm den Spitznamen »Boss« gegeben, aber niemand benützte ihn mehr, zumindest nicht in seiner Gegenwart. Seine Finger waren ständig mit den wichtigsten Büroutensilien beschäftigt, einem schmutzigen Papierfetzen und einem Bleistiftstummel.
»– zu wenig Waffen, Herr Minister«, schnaufte Scott. »Mehr höre ich nicht von unseren Ausbildungslagern. Uns fehlt das Material, um Tausende von Männern auszubilden und auszurüsten, die so tapfer dem Aufruf unseres Präsidenten gefolgt sind.«
Chase beugte sich vor. »Und der Ruf, voranzustürmen, Richmond zu stürmen, wird mit jeder Stunde drängender. Sie verstehen sicherlich den Grund dafür.«
Cameron sagte trocken, aber mit diskreter Zurechtweisung: »Der Kongress der Konföderierten tagt bald dort.« Er konsultierte einen weiteren winzigen Papierfetzen, den er in seiner Jacke entdeckt hatte. »Um genau zu sein – am 20. Juli. Der gleiche Monat, in dem die meisten unserer Neunzigtageverpflichtungen auslaufen.«
»Also muss McDowell was unternehmen«, blaffte Chase. »Auch er ist unzulänglich ausgerüstet.«
Heimlich notierte Stanley eine kurze Botschaft. Wahres Problem sind die Leute. Er erhob sich und reichte die Notiz über den Schreibtisch. Cameron packte sie, las sie, knüllte sie zusammen und deutete ein sparsames Nicken in Stanleys Richtung an. Er verstand McDowells Hauptsorge, bei der es nicht um die Ausrüstung ging, sondern um die Notwendigkeit, sich auf Freiwillige verlassen zu müssen, deren Verhalten er nicht voraussagen und deren Mut er nicht trauen konnte.
Cameron zog es jedoch vor, diesen Punkt unerwähnt zu lassen. Er erwiderte dem kommandierenden General mit schlammiger Nachgiebigkeit: »General, ich vertrete weiterhin die Meinung, dass unser Hauptproblem nicht in zu wenig Waffen, sondern in zu vielen Männern besteht. Wir haben bereits dreihunderttausend unter Waffen. Das sind weitaus mehr, als wir für die gegenwärtige Krise benötigen.«
»Nun, ich hoffe, Sie haben recht damit«, sagte der Präsident aus seiner Ecke. Niemand beachtete ihn. Wie gewöhnlich war Lincolns Stimme hoch und schrill, ein Quell zahlreicher Witze hinter seinem Rücken.
Chase entschied sich gegen eine klare Antwort und für Rhetorik. »Wir müssen mehr tun als nur hoffen, Herr Präsident, und unsere Einkäufe in Europa massiver vorantreiben. Wir haben zu wenig Artillerie im Norden, jetzt, wo wir unter dem Verlust von Harpers Fer zu leiden –«
»Europäische Einkäufe werden geprüft«, sagte Cameron. »Aber meiner Meinung nach ist so was unnötig extravagant.«
Scott stampfte auf den Boden. »Verdammt, Cameron, Sie reden von Extravaganz angesichts der Rebellion von Verrätern?«
»Vergessen Sie nicht den Zwanzigsten nächsten Monats«, ergänzte Chase.
»Mr. Greeley und gewisse andere Leute lassen kaum zu, dass ich es vergesse.«
Aber die gereizten Worte gingen unter, als Chase weiterdröhnte: »Wir müssen Davis und sein Pack zerquetschen, bevor sie von Frankreich und England anerkannt werden. Wir müssen sie vollkommen zerquetschen. Ich stimme mit dem Kongressabgeordneten Stevens aus Ihrem Staat überein. Wenn die Rebellen nicht aufgeben und zurückkehren –«
»Das werden sie nicht.« Scott sprach von oben herab. »Ich kenne die Virginier. Ich kenne die Südstaatler.«
Chase fuhr ungerührt fort: »– dann sollen wir Thad Stevens Rat wortgetreu befolgen. Verwandeln wir den Süden in ein Schlammloch.«
Nach diesen Worten räusperte sich der Präsident.