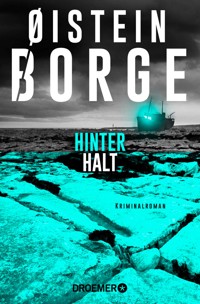
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Bogart Bull
- Sprache: Deutsch
Fall zwei für den Osloer Europol-Kommissar Bogart Bull - ein skandinavischer Kriminalroman auf höchstem Niveau: komplex, vielschichtig, tiefgründig Eigentlich befindet sich der Osloer Europol-Kommissar Bogart Bull rein privat in Nordirland. Doch dann verschwindet in Belfast ein norwegisches Ehepaar, deren Tochter gute Kontakte in die Politik hat, und schon wird Bull auf den Fall angesetzt. Schnell stellt sich heraus, dass die Norweger ermordet wurden. Offenbar waren sie auf eine Leiche gestoßen und jemandem in die Quere gekommen. Doch was hatten die beiden älteren Herrschaften in unwegsamem Gelände mitten im Wald zu suchen? Und warum steckt in der leeren Augenhöhle des anderen Toten eine Lilie – das alte Symbol des irischen Freiheitskampfes? Für Leser/innen von Jo Nesbø, Jussi Adler-Olsen und Eric Berg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Øistein Borge
Hinterhalt
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen von Andreas Brunstermann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Fall zwei für den Osloer Europol-Kommissar Bogart Bull – ein skandinavischer Kriminalroman auf höchstem Niveau: komplex, vielschichtig, tiefgründig
Eigentlich befindet sich der Osloer Europol-Kommissar Bogart Bull rein privat in Nordirland. Doch dann verschwindet in Belfast ein norwegisches Ehepaar, deren Tochter gute Kontakte in die Politik hat, und schon wird Bull auf den Fall angesetzt. Schnell stellt sich heraus, dass die Norweger ermordet wurden. Offenbar waren sie auf eine Leiche gestoßen und jemandem in die Quere gekommen. Doch was hatten die beiden älteren Herrschaften in unwegsamem Gelände mitten im Wald zu suchen? Und warum steckt in der leeren Augenhöhle des anderen Toten eine Lilie – das alte Symbol des irischen Freiheitskampfes?
Für Leser/innen von Jo Nesbø, Jussi Adler-Olsen und Eric Berg
Inhaltsübersicht
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Epilog
Nachwort
Geheimnisse gibt es in jeder Familie. Sie können in Wände eingemauert sein, im Gewissen eines einzelnen Menschen ruhen oder in seinen Genen verborgen liegen. Es sind kleine Abschnitte einer größeren Geschichte, ausgelöscht von jemandem, dem daran gelegen war, dass nicht alles erzählt wurde. So existieren Geheimnisse in Gedanken und im Bewusstsein weiter, bis sie schließlich mit demjenigen sterben, der sie in sich trägt. Dann lösen sie sich in Asche auf oder zerfallen zu Erde, werden zu winzigen Fragmenten, wie zufällig über die Felder zerstreut und somit unlesbar für alle, die nach uns kommen.
1
Nordirland
Freitagvormittag, 13. Mai 2016
Was zum Teufel machen wir hier?
Obwohl sie Lust hatte, die Frage laut auszusprechen, beließ sie es beim bloßen Gedanken. Gab es etwa eine noch absurdere Art von Ferientour, als in einem nordirischen Dorf herumzukurven auf der Suche nach einem Grab? Einem leeren Grab? Sie warf einen Blick auf ihren Ehemann, der am Steuer des kleinen Leihwagens saß. Mit einer Hand am Lenkrad, während er mit der anderen am Navigationsgerät herumfummelte. Die Koordinaten hatten sie von einem Journalisten der Irish Times bekommen, vor der Abreise aus Oslo.
Als er mit der Idee von Belfast als Reiseziel zu ihr gekommen war, hatte sie vorsichtig protestiert. Ihn daran erinnert, dass es Städte wie Wien, Brügge und Lissabon gab, die sie noch nicht besucht hatten. Doch wie schon so oft zuvor hatte sie schließlich nachgegeben. Er war Hobbyhistoriker mit einem besonderen Interesse für neuere europäische Konflikte, weshalb Belfast für ihn so verlockend war, wie es Florenz für einen Renaissance-Fan gewesen wäre. Zwei Jahre zuvor war sie ihm nach Sarajevo gefolgt und im darauffolgenden Jahr mit Istanbul belohnt worden. Jetzt waren sie hier, im Herzen eines hundert Jahre alten Unabhängigkeitskrieges, einer Fehde, bei der momentan zwar keine Flammen loderten, deren schwärende Glut aber jederzeit wieder angefacht werden konnte.
Wie viel Egoismus musste man eigentlich ertragen können?
Wie viel Aufopferung war vonnöten, um eine Ehe am Leben zu erhalten?
Fast vierzig Jahre war es jetzt her – im Sommer 1978. Sie hatte einen Teilzeitjob im Nachtclub Safari, dem damaligen Vergnügungstempel für junge Menschen im Osloer Westen. Eines schönen Tages stand er einfach da. Ein schiefes Lächeln unter einem sonnenbleichen Haarschopf und ein auf den Zapfhahn gerichteter Zeigefinger. Es war einer dieser rätselhaften Augenblicke, die zu erleben nur sehr wenigen vergönnt ist, ein Augenblick, in dem du einen anderen Menschen anblickst und es einfach weißt. Bevor auch nur ein einziges Wort geäußert wurde, war alles auf seltsame Art entschieden. Welchen Satz hatte noch einmal ihr religiöser Schwiegervater ein knappes Jahr später auf der Hochzeitsfeier aus der Bibel zitiert? Und der Herr sagte: Dies ist meine Botschaft an euch – liebet einander! Etwas in der Art. Hätte Gott sich herabgelassen, sie zu fragen, hätte sie wohl geantwortet, dass er die Privatsphäre der Menschen deutlicher respektieren solle.
Marion O’Neill.
So hieß sie, die Katholikin, die nicht mehr in dem anonymen Grab lag. Der Hobbyhistoriker hatte ihre tragische Geschichte während des Flugs über die Nordsee erzählt. O’Neill war Witwe und musste fünf Kinder versorgen, als sie in einer Spätsommernacht im Jahr 1976 spurlos verschwand. Zweiundzwanzig Jahre später, nachdem das Belfast-Abkommen unterschrieben und den paramilitärischen Kräften auf beiden Seiten Amnestie gewährt worden war, hatten zwei ehemalige IRA-Mitglieder die Stelle verraten, an der sie verscharrt worden war. Sie selbst hatten Marion O’Neill seinerzeit in einen Lieferwagen gezerrt, nach Bryansford gebracht, ihr in den Nacken geschossen und sie in ein tiefes Grab inmitten eines verlassenen Waldstücks geworfen. Es war die Art von Strafe, zu der die Provisional IRA Menschen verurteilte, die den Feind mit Informationen über die Truppe versorgte oder sie auf andere Art und Weise verriet. In der Regel ließen sie die Leiche eines Überläufers am Ort der Hinrichtung liegen, zur Abschreckung und als Warnung an alle anderen. In O’Neills Fall war die Tote vergraben worden, angeblich aus Rücksichtnahme auf die fünf Kinder.
Weshalb willst du dahin?, hatte sie ihn gefragt. Das Grab ist doch leer.
Ich würde gern den Ort sehen, an dem es passiert ist, hatte er erwidert.
Er wollte gern den Ort sehen. Einige ihrer Freundinnen beklagten sich darüber, dass ihre Männer zu viel Zeit auf dem Golfplatz verbrachten. Sie ahnten ja nicht mal, wie glücklich sie damit sein konnten.
Neben dem Seitenfenster sauste eine massive Mauer aus Felssteinen vorbei, und instinktiv suchte ihr Fuß nach dem Bremspedal, das nicht da war. Das Pfund konnten die konservativen Engländer gern behalten – aber den Rechtsverkehr und das Lenkrad auf der richtigen Seite einzuführen, das sollte doch wohl möglich sein?
Abermals warf sie einen Blick auf ihren Mann. Er war fast siebzig und seit Kurzem pensioniert, hatte jedoch den Gesichtsausdruck eines Kindes auf dem Weg nach Disneyland. Lautlos seufzte sie in sich hinein. Immerhin hatte er gefragt und sie nicht zu etwas gezwungen. Sie hätte ein Veto einlegen können. Dann hätten sie jetzt im Café Central in Wien sitzen können, mit Sachertorte auf dem Tisch sowie Karten für die abendliche Opernvorstellung in der Tasche.
»Du bist so still«, sagte er. »Woran denkst du?«
Woran dachte sie eigentlich? Sie streckte eine Hand aus und streichelte seinen Arm.
»Dass das hier wohl Liebe sein muss.«
Einige Minuten später erreichten sie Castlewellan. Eine Hauptstraße mit einer Handvoll Seitenstraßen, friedlich und makellos hübsch. Der Bus vor ihnen schlich träge vorwärts und gab ihr Gelegenheit, die Umgebung zu inspizieren. Pub, Postamt und Lebensmittelladen. Schwarz gestrichene, schmiedeeiserne Tore und Butzenfenster mit Geranien, Stiefmütterchen und Petunien in Kästen davor. Eine Postkartenidylle ohne eine Spur von jenem irrwitzigen Hass, der Nordirland einst in Brand gesteckt hatte.
Hatte der Ort wohl so ausgesehen, als Marion O’Neill auf ihrer letzten Reise hier durchgekommen war?, fragte sie sich. Konnte dieses Dorf ausschließlich katholisch oder protestantisch sein, wie eine Art Vorzeigegetto? Einen Augenblick lang erwog sie, ihren Mann danach zu fragen, ließ es aber sein. Die gerade herrschende Stille war einem fünfzehnminütigen Vortrag ohne Punkt und Komma bei Weitem vorzuziehen. Sein Atemvorrat hatte mitunter eine erstaunliche Kapazität.
Sie näherten sich dem Rand des Ortes, wo eine Tankstelle, ein kleines Busdepot und ein heruntergekommener Sportplatz ohne Tribünen das Idyll ablösten. Ein nach rechts weisendes Schild verriet, dass die B180 weiter nach Bryansford und Tollymore Forest Park führte.
»Wir folgen dieser Straße ein Stückchen und biegen dann später wieder ab«, sagte er und betätigte den Blinker. »Wir müssten in ungefähr fünfzehn Minuten da sein.«
Am Straßenrand tauchte ein mannshohes, selbst gemaltes Schild auf:
PREPARE
TO MEET
THY GOD
Amos 4V12
Sie riss die Augen auf.
»Hast du das gesehen?«
»Presbyterianer«, sagte er lächelnd. »Deren Blick auf das Christentum ist sogar noch fundamentalistischer als der meines Vaters.«
Die letzten Reste der Besiedelung lösen sich hinter ihnen auf. Auf beiden Seiten der Straße wachsen majestätische Buchen, deren obere Äste einander berühren. Die tief stehende Sonne sendet Lichtstrahlen durch das Laubwerk und lässt die Blätter aufblitzen. Wie das funkelnde Spiel eines geschliffenen Diamanten, denkt sie. Wie sieht ein Grab nach vierzig Jahren wohl aus? Was würde er dort zu sehen bekommen? Eine Mulde im Boden? Nichts? Einen überwucherten Flecken im Wald, wo eine Frau ermordet worden war, die damals etwa so alt war wie ihre gemeinsame Tochter heute? Sie konnte Menschen verstehen, die historische Schlachtfelder aufsuchten. Waterloo, Gettysburg oder die Strände in der Normandie.
Aber das hier?
Sie biegen auf eine unbefestigte Straße ab, die dann schmaler wird und sich sanft durch das Terrain schlängelt. Nach zwei Minuten kommen sie zu einer Gabelung. Zur Rechten setzt sich die Straße fort. Er bremst und überprüft das Navigationsgerät. Biegt nach links ab, auf einen Karrenweg, wo das Gras zwischen den Reifenspuren am Unterboden des Wagens entlangschabt. Dichter Mischwald auf beiden Seiten. Am Wegesrand wächst massenhaft Fingerhut, so hübsch in seiner purpurroten Pracht, aber giftig wie Zyankali.
»Das können jetzt nur noch ein paar Hundert Meter sein.«
Sie weiß nicht, ob er mit ihr spricht oder mit sich selbst. Beide nicken, erleichtert darüber, dass der kleine morbide Ausflug bald hinter ihnen liegt. Danach wollen sie zurück nach Belfast. Zum Lunch. Vielleicht ein oder zwei Glas Riesling? Am besten zwei.
Hinter der nächsten Kurve hat sich vor Kurzem jemand eines umgestürzten Baumes angenommen. Er fährt langsamer. Der mittlere Teil des Stamms, vom Umfang eines erwachsenen Mannes, ist herausgesägt worden, damit vorbeikommende Fahrzeuge das Hindernis passieren können. Dort, wo die Säge angesetzt wurde, leuchtet das Holz hell. Auf dem Boden liegen frische Sägespäne in der Farbe reifer Weizenkörner.
»Da hat uns jemand einen Dienst erwiesen«, sagt er. »Wäre wirklich blöd gewesen, hier umkehren zu müssen.«
Nach zwei weiteren Kurven endet der Weg. An einem Wendeplatz. Oder einem Parkplatz. Am Fuß einer prächtigen Hängebirke steht ein weißer Kastenwagen mit blauer Aufschrift:
Mitchell & O’Connor
Plumbing and heating
Spaziergänger?, denkt sie. Oder vielleicht jemand mit demselben wahnwitzigen Vorhaben wie wir? Klempner auf Wandertour an einem Freitagmorgen? Sie fragt ihren Mann. Der zuckt mit den Schultern.
»Die Arbeitslosigkeit in diesem Land ist immer noch hoch. Vermutlich ist es besser, durch den Wald zu wandern, als sinnlos vor dem Fernseher zu hocken.«
Er öffnet die Tür und klettert hinaus, immer noch mit diesem verflixten Navi in der Hand. Sie sieht zu dem Kastenwagen hinüber. Der sieht neu aus. Jedenfalls ist er frisch gewaschen.
»Kommst du?«, fragt er.
Sie zögert, öffnet dann aber die Tür. In diesem Moment hört sie es. Eine Amsel. Ein ungleichmäßiges, aber wunderschönes Zwitschern, verlockend, als wolle der Vogel einen Artgenossen anlocken. Das Geräusch dämpft ihre schwelende Unruhe. Erinnert sie an den Garten zu Hause in Nordberg. Drei Jahre hintereinander hat sie die Vögel im großen Kirschbaum unten beim Schuppen beobachtet, ein Männchen und ein Weibchen, meist am späten Nachmittag oder früh am Abend.
Ihr Mann steht bereits am Waldrand und wartet ungeduldig wie ein eifriger Hund, der darauf hofft, dass sein Besitzer endlich kommt und mit ihm loszieht.
»Wir müssen da lang«, sagt er und winkt sie zu sich. »Hier gibt es einen Pfad.«
Der Pfad ist schmal, aber deutlich erkennbar. An den Rändern wachsen frische grüne Farnkrautbüschel, und an einigen Stellen müssen sich die beiden an Büschen vorbeidrücken und unter Zweigen hinwegducken, die auf den Pfad ragen. Die Amsel ist verstummt. Er geht schnell, und sie muss sich anstrengen, um mit ihm Schritt zu halten.
»Haben wir’s so eilig?«, fragt sie, ihm folgend.
Er antwortet nicht, verringert aber sein Tempo. Sie scheucht ein aufdringliches Insekt weg, das um ihren Kopf herumschwirrt. Mist!
Sie kommen zu einer Lichtung, einer kreisförmigen Öffnung im Wald. Etwa tausend Quadratmeter, vielleicht noch etwas mehr. Auf der rechten Seite der Lichtung, fast unmittelbar am Waldrand, ragt ein Felsbrocken in der Größe eines Autos aus dem Gras hervor. Abrupt bleibt er vor ihr stehen.
»Das ist er«, sagt er andächtig.
»Das ist was?«
»Der O’Neill-Stein. Laut McKenna von der Irish Times haben sie sie direkt daneben begraben.«
Eine Weile betrachten sie den Felsen aus der Entfernung. Ein Schauder durchfährt sie, wie ein kalter Lufthauch aus einer Nacht vor vierzig Jahren. Entspann dich, Monica. Sie liegt dort nicht mehr. Das ist bloß ein Stein.
Überraschenderweise ist sie es, die zuerst auf die Lichtung hinaustritt. Vielleicht von dem Wunsch getrieben, es hinter sich zu bringen, vielleicht auch aufrichtig empört über das Schicksal, das einer jungen Mutter von fünf Kindern widerfahren ist; als handele es sich um ein unbewusstes Bedürfnis nach Genugtuung, stellvertretend für alle Frauen, die Opfer männlicher Gewalt geworden sind. Sie bewegt sich schneller, hört die Schritte ihres Mannes und seinen Atem hinter sich. Dann ist sie am Ziel und geht halb um den großen Stein herum.
Im ersten Augenblick glaubt sie, einer Sinnestäuschung zu unterliegen, einem Fantasiegebilde, hervorgerufen durch die Nervosität und die unbestimmbare Färbung der Situation.
Vor ihr im Gras liegt Marion O’Neill. Dann ist sie verschwunden und ersetzt durch eine männliche Gestalt. Im Laufe der nächsten Sekunden, wie viele es sind, weiß sie nicht, zerbröselt ihre Hoffnung auf eine Illusion. Er liegt da wirklich, Monica. Tot und direkt vor deinen Füßen.
Ein älterer Mann in einem Anzug. Er hat nur ein Auge, blutrot und inmitten der grauweißen Stirn. Wo die Augen sein sollten, ist etwas Weißes. Dünnes Papier. Oder sind das … die Kronblätter einer Blume?
Ein merkwürdiges Rauschen in ihren Ohren. Sie nimmt die aufgeregten Schläge ihres eigenen Pulses wahr und merkt, wie sich ihr Magen vor lauter Abscheu zusammenzieht. Kaum schafft sie es, sich vorzubeugen, bevor auch schon Erbrochenes aus ihrem Mund hervorsprudelt. Sie sinkt auf die Knie, stützt sich auf den Ellbogen ab und neigt die Stirn hinab zum feuchten Boden.
Plötzlich hört sie wieder das Zwitschern. Die Amsel. Gleichzeitig entdeckt sie sie, in der Lücke zwischen ihren Schenkeln, mit den Köpfen nach unten, als ließe jemand diesen Albtraum verkehrt herum in einem alten Filmprojektor laufen. Zwei Gestalten kommen von hinten auf sie zu. Sie zwinkert eine Träne weg, richtet sich mit zitternden Armen auf und wendet den Kopf.
Sie tragen dunkle Uniformen, schwarze Barette und hohe Schaftstiefel. Noch nie zuvor hat sie eine Maschinenpistole gesehen, ist sich aber absolut sicher, dass diese Leute genau solche in den Händen halten. Breitbeinig und mit halb zusammengekniffenen Augen bleiben die beiden Gestalten ein paar Meter entfernt stehen.
Völlig verwirrt richtet sie den Blick auf ihren Mann, der immer noch an derselben Stelle steht und den Toten betrachtet. Mit einer Hand kramt er nach etwas in seiner Manteltasche.
»Wir … wir müssen Hilfe herbeirufen«, sagt er mit heiserer Stimme.
Er hat die anderen nicht bemerkt.
»John …«
Er zieht das Handy aus der Tasche. Es gleitet ihm aus den feuchten, zitternden Fingern und landet auf dem Boden neben ihr. Er flucht leise und beugt sich hinunter.
»John!!«
Er hält mitten in der Bewegung inne und blickt sie fragend an.
»Sieh …« Sie stößt das knappe Wort mühsam hervor und deutet mit dem Kopf auf die Lichtung hinter ihnen. Plötzlich ergreift einer der Soldaten das Wort:
»The bitch stays down! You too, mister – down on your knees.«
John Sand, pensionierter Richter am Obersten Gerichtshof, bleibt halb hinuntergebeugt und mit offenem Mund stehen, wie zur Salzsäule erstarrt.
»Get down on your fuckin’ knees!«
Mit einem letzten Rest von Geistesgegenwart krallt sie sich oben am Ärmel seines Mantels fest und zieht ihn neben sich zu Boden.
»Don’t move – not a fuckin’ finger!«
Der zweite Soldat wendet den Kopf und ruft in Richtung Waldrand:
»Tobin!«
Sie hören Schritte hinter sich. Am Rande des Gesichtsfelds taucht eine Gestalt auf. Keine Uniform, aber von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Strickmütze, kurze Kampfjacke, Hose und weiche Sportschuhe. Die schwarz gekleidete Gestalt kommt näher und bleibt ein paar Meter vor ihnen stehen.
Die beiden, die auf dem feuchten Boden knien, können nicht glauben, was sie da sehen.
2
Oslo
Montag, 9. Mai 2016
Nur mit Boxershorts bekleidet lag Bogart Bull auf dem Rücken. Eine unbekannte und überaus hübsche Frau beugte sich über ihn. Sie hatte das rabenschwarze Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, die vollen Lippen formten ein warmes Lächeln. Sofern Bull sich nicht täuschte, hatte er eine ähnliche Situation – bei der eine wildfremde Frau involviert war – zuletzt als Abiturient erlebt. Der Unterschied bestand nur darin, dass diese Schönheit vollständig bekleidet war, mit einer weißen Uniform. Und sie hielt eine Spritze in der Hand.
»Ein kleiner Pikser und dann schlafen wir gleich ein«, sagte sie.
Bull sah die Spritze auf sich zukommen. Der Größe nach zu urteilen reichte sie vermutlich aus, um ein Nashorn zu betäuben.
»Ich dachte, man benutzt solche Masken«, wandte er ein.
»Früher ja. Aber eine Injektion ist sowohl sicherer als auch effizienter.«
Die Nadel drang ein. Er spürte den Stich bis in die Zehenspitzen.
»Jetzt zählen wir von hundert rückwärts«, hörte er irgendwo über sich eine Stimme sagen.
Zu allem Überfluss auch noch ein IQ-Test. Bereitwillig machte er sich an die Aufgabe, kam bei achtzig leicht ins Stocken und segelte bei fünfundsiebzig in die Dunkelheit.
Als er nach einer guten Stunde wieder aufwachte, saß der Chirurg neben ihm. Er war zwar nicht so hübsch wie die Anästhesieschwester, doch sein gebräuntes Gesicht strahlte Ruhe und Zuversicht aus.
»Wie fühlen Sie sich?«, wollte Doktor Jacobsen wissen.
Wie er sich fühlte? Fantastisch! Bull hatte sich nicht mehr so selig gefühlt, seit er in den frühen Neunzigern einen streng verbotenen Stoff zu sich genommen hatte. Er brabbelte dies hervor, als sei es die größte Selbstverständlichkeit, unbekannten Menschen von seinen Jugendsünden zu berichten.
»Manchmal kommt es vor, dass Patienten um einen Nachschlag bitten. Buchstäblich im reinsten Glücksrausch«, erwiderte Jacobsen mit einem Nicken. »Jetzt werden Sie gleich in den Ruheraum gerollt, da bekommen Sie eine Kleinigkeit zu essen und etwas zu trinken. Sie müssen vier bis fünf Stunden ausruhen, bevor Sie wieder nach Hause fahren dürfen. Wohlgemerkt mit einem Taxi. Oder Sie lassen sich abholen. Jedenfalls setzen Sie sich heute nicht mehr ans Steuer. Die nächsten Tage gehen Sie es ruhig an. Bis aufs Gassigehen mit dem Hund bitte keine körperlichen Anstrengungen.«
»Ich habe gar keinen Hund«, gab Bull grinsend zurück und versuchte, den Schleier vor seinen Augen zu durchdringen. »Aber ich könnte die Nachbarn fragen, ob sie mir ihren ausborgen. So ein … wie heißen die noch mal … Pekingese?«
»Ein kleiner Spaziergang ohne Hund tut’s sicher auch«, erwiderte Jacobsen lächelnd. »Etwas Bewegung, um den Kreislauf wieder in Gang zu bringen.«
Der Arzt warf einen Blick auf den Krankenbericht in seiner Hand.
»Sie arbeiten als Ermittler bei der Kripo, nicht wahr?«
»Stimmt. Ich tauge zu nichts anderem«, seufzte Bull.
»Es wäre vorteilhaft, wenn Sie in den nächsten zwei Monaten keine längeren Reisen unternehmen, auch über den Zeitraum der Krankschreibung hinaus. Na, Sie haben ja meine Handynummer, Bull. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, melden Sie sich bitte.«
Doktor Jacobsen stand auf, wünschte ihm Glück und verschwand mit einem Händedruck aus Bulls Leben.
Da saß er also wieder. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren krankgeschrieben. Beim letzten Mal wegen anderer Probleme. Unmäßiger und übertriebener Alkoholkonsum, hatte es in den Papieren geheißen. Jetzt war es der Rücken. Vorsichtig lehnte Bull sich auf dem Sofa zurück. Vielleicht war es ja Einbildung, aber fühlte es sich nicht schon viel besser an? War es tatsächlich so einfach, einen Bandscheibenvorfall zu behandeln? Eine Stunde mit schulmedizinischer Magie und der Wirbelsäulendämon war ausgetrieben. Natürlich zu einem Preis, der Doktor Jacobsen in nur einer Stunde mehr verdienen ließ, als Bull am Ende eines Monats einstreichen konnte. Milchmädchenrechnung, Bogart. Wenn der Rücken wieder besser wurde, war jede einzelne Krone perfekt investiert. Außerdem musste die Klinik ja auch ihre Unkosten decken. Eine Stunde Unkosten, dachte er kurz und schob das Rechenstück beiseite.
Vorsichtig erhob er sich vom Sofa, griff nach der Kaffeetasse auf dem Wohnzimmertisch und tapste hinüber in die offene Küche. Die war nagelneu, genau wie der Rest der Wohnung. Etwa ein Jahr lebte er jetzt hier. Er erinnerte sich an den Tag, an dem er die Tür des Reihenhauses im Prost Hallings vei zum letzten Mal geschlossen hatte. An das schmerzhafte Gefühl, Frida und Anine hinter den gelben Mauern zurückzulassen, obwohl sie doch nur ein paar Hundert Meter entfernt auf dem Friedhof Østre Gravlund begraben lagen.
8. Oktober 2013. Der Tag, an dem ein kranker Mann ihm das Einzige genommen hatte, das er nicht verlieren durfte, und ihn in einer Leere zurückgelassen hatte, die so an ihm zehrte, dass er fast untergegangen wäre. Jetzt, zweieinhalb Jahre danach, passierte es manchmal immer noch, dass er von Rache träumte. Davon, Richard Torp eigenhändig umzubringen, ihm das Leben aus dem Leib zu reißen, während der oben am Holmenkollen in seinem Rollstuhl saß und in seinem Irrsinn vor sich hin brütete. Wenn diese Gedanken in Bull wüteten, hörte er stets Fridas Stimme:
Was ist denn das für eine mittelalterliche Haltung, Bogart? Du musst dich zusammenreißen. Und wozu sollte so etwas gut sein? Du vermisst uns, das weiß ich. Aber geh weiter in deinem Leben, Liebling. Diese Möglichkeit hast du, und das ist mehr, als Richard Torp vergönnt ist.
Geh weiter. Natürlich hatte sie recht. Ein Schritt nach dem anderen. Ganz langsam und in Richtung von etwas, das einem normalen Leben glich. Und es war leichter geworden. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Noch immer fiel er manchmal in ein schwarzes Loch. Schlaflose Nächte mit Tränen, Schuldkomplexen und dem lähmenden Gefühl von Sinnlosigkeit. Doch die Abstände dazwischen wurden immer größer.
Weitergehen.
Wenn es auch sonst nichts gab, so hatte er doch immer noch seinen Job. Norwegens Mann bei Europol. Einer in einer Gruppe von reisenden Ermittlern, die den lokalen Polizeibehörden bei der Aufklärung von Morden an ausländischen Staatsbürgern helfen sollten. Dieses Projekt – das den pompösen Namen Flying Tigers trug – bestand jetzt etwa seit zwei Jahren, doch vorläufig war der Fall Krogh in Südfrankreich der Höhepunkt seiner ausländischen Ermittlertätigkeit gewesen (sofern man von einem Höhepunkt reden konnte, wenn drei Norweger auf bestialische Art und Weise ermordet wurden). Nach dieser Geschichte war Bull in Dänemark, Litauen und Belgien gewesen, doch hatte ihm keiner der Fälle besonders viel abverlangt. Zwischen den Tigertouren arbeitete er als Ermittler, allerdings nicht in leitender Position, sodass eine kurzfristige Abberufung auf den Kontinent jederzeit gewährleistet war.
Jetzt stand Nordirland auf dem Programm. Dieses Mal allerdings wollte er als Privatmann und in Begleitung seines Vaters dorthin. Der Kunstmaler Thomas Bull war mit der Idee vorgeprescht, als Vater und Sohn sich ein paar Monate zuvor zum Weihnachtslunch im Theatercafé getroffen hatten.
»Deine Mutter wäre jetzt siebzig«, hatte der Vater gesagt, als er gerade das Bacon-Fett über den Lutefisk verteilte. »Am 22. Mai, um genau zu sein. Ich dachte, es wäre doch angebracht, wenn wir da rüberfliegen und … ja, das Ereignis auf irgendeine Art würdigen.«
Wäre angebracht?, dachte Bull. Als handele es sich um einen Höflichkeitsbesuch, den abzustatten man sich gezwungen sah. Doch er unterließ einen Kommentar über die Wortwahl seines Vaters. Wegen der Weihnachtsstimmung und allem. Er bat darum, den Vorschlag überdenken zu dürfen, woraufhin sein Vater etwas darüber murmelte, dass Spontaneität anscheinend kreativen Menschen vorbehalten war. Zwei Tage später rief Bull seinen streitlustigen Vater an und bestätigte seine Teilnahme an der Expedition.
»Es gibt immer noch Hoffnung für dich, mein Junge«, hatte der Vater konstatiert.
3
Donnerstag, 19. Mai 2016
Die silbrige Aufzugtür schloss sich hinter Bogart Bull. Weich und lautlos wurde er in die oberste Etage des mondänen Wohnungskomplexes hinaufgetragen. Im Laufe nur weniger Jahre hatte sich dieser Teil des Osloer Hafengeländes, das zu betreten die besseren Kreise der Osloer Bürgerschaft zuvor nur im Notfall gewagt hätten, in ein exklusives Wohngebiet verwandelt, wo dieselben Kreise bereitwilligst etwa 100000 Kronen pro Quadratmeter zahlten, um darin leben zu dürfen.
Vor nunmehr fast eintausend Jahren hatte Harald der Harte einst Oslo gegründet. Sechshundert Jahre später hatte der dänisch-norwegische König Christian IV. das Zentrum der Stadt weiter nach Westen verlegt, und die ehemalige Feuerstätte des Wikingerkönigs war zu einer Art Hinterhof der Hauptstadt verkommen. Die 1990er-Jahre hatten eine Wiedergeburt der Gegend eingeleitet. Die schnell fortschreitende Entwicklung der Stadt hatte der Umgebung einen neuen Status verliehen, hier befanden sich inzwischen eines der schönsten Opernhäuser Europas, eine Skyline mit hypermodernen Bürobauten sowie Wohnungen in der obersten Preisklasse.
Bull konnte nicht umhin, seinen Vater in dieser Umgebung als Anachronismus zu betrachten. Nicht aufgrund der Quadratmeterpreise. Thomas Bulls Durchbruch als Künstler war erst spät erfolgt, doch als der erst einmal eine Tatsache war, rissen sich wohlhabende Menschen und Sammler förmlich um die großen, mit T. Bull signierten Leinwände. Sein Sohn war hingegen durchaus bereit, ein kleines Vermögen darauf zu wetten, dass die übrigen Hausbewohner den in einem separaten Verschlag auf jeder Etage befindlichen Müllschlucker nur selten mit nicht mehr als einer Mülltüte bekleidet aufsuchten oder nachts um drei Puccini-Arien von der Terrasse auf die Stadt hinunterschmetterten.
Sein Vater war eben ein waschechter Exzentriker.
Bull drückte auf den Klingelknopf neben der massiven Eingangstür, wartete ein paar höflich angemessene Sekunden ab und wiederholte dann die Prozedur. Nach einem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und Thomas offenbarte sich – in Pyjama und Pantoffeln. Seiner Gewohnheit folgend, übersprang der alte Bock die üblichen Formalitäten.
»Jetzt schon?«, sagte er und blickte seinen Abkömmling brüsk an. »Bist du nicht ziemlich früh?«
Bull schaute auf seine Armbanduhr.
»Genau auf die Minute.«
»Du musst dich etwas gedulden«, erwiderte der Vater und winkte ihn herein. »Ich hab noch nicht alles gepackt.«
»Willst du im Nachtgewand reisen?«
Der Maler bedachte ihn mit einem grimmigen Blick, drehte sich dann um und stapfte in Richtung Bad. Bull durchquerte den geräumigen Eingangsbereich und trat ins Wohnzimmer. Alles war peinlich sauber und aufgeräumt, was ihn vermuten ließ, dass die Putzhilfe des Vaters erst neulich hier gewirkt hatte. Aus den säulenförmigen Lautsprechern rechts und links neben dem Sofa ertönte Sibelius’ Streichquartett in a-Moll. Wie immer blieb Bull stehen und genoss die Aussicht aus den Panoramafenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten. Unten rechts lag das Opernhaus, ein Stück daneben thronte die Festung Akershus, und etwas links davon glitzerte der Oslofjord wie Katzengold in der Vormittagssonne. So sollte es sein, wenn man alt wird, dachte er. Eine Arbeit, die einen voll und ganz ausfüllt, genügend Geld, klassische Musik aus der Anlage und eine Putzhilfe, die die Fenster zur Welt von jedem Staubkorn befreit.
Er drehte sich um. Wie automatisch suchte sein Blick das Foto, das über dem schwarz lackierten Klavier hing. Der dreijährige Bogart auf dem Schoß seiner Mutter, in einer Sekunde verewigt, die etwa ein Jahr vor ihrem Tod lag. Ein Sturz vom Pferd während eines Besuchs auf dem Hof der Eltern außerhalb von Belfast. Eine verschreckte junge Stute, die sich im unwegsamen Gelände aufbäumte, und eine Reiterin ohne Helm. Bogart Bulls erste Erfahrung mit der Zerbrechlichkeit des Lebens.
Hinter ihm wurde eine Tür geöffnet. Bull drehte sich um und blickte direkt in die Augen von Fai, der philippinischen Putzhilfe seines Vaters. An und für sich nichts Aufsehenerregendes, abgesehen davon, dass sie einen Morgenmantel trug. Ein freundliches »Hallo« und ein verschämtes Lächeln, bevor die reizende Gestalt in den Vorraum enteilte. Wie zur Antwort darauf kam sein leicht mürrisch wirkender Vater aus der anderen Richtung, mittlerweile angezogen und in Besitz eines Reisepasses, der zur Hälfte aus der Brusttasche seiner Anzugjacke ragte.
»Wollen wir los?«, fragte er.
Bull versuchte, das aufkeimende Lächeln zu unterdrücken.
»Stimmt was nicht?«, fragte Thomas herausfordernd.
»Aber nein … alles gut. Ich hab mich nur gerade gefragt, ob Morgenmäntel inzwischen zur Standardausrüstung von Putzhilfen gehören.«
»Dass man unten anfängt, heißt nicht, dass einem der Aufstieg gänzlich verwehrt bleibt«, gab Thomas Bull zurück.
4
Belfast, Nordirland
Freitag, 16. Juli 1976
Den meisten Menschen, die Samuel »Sammy« Bennett zum ersten Mal begegneten, fielen zwei Dinge auf: seine Augen, so sanft, wie sie nur bei jemandem sein konnten, der sich seiner eigenen Stärke vollends bewusst ist. Und seine Hände, mit den langen, schlanken Fingern und den Adern, die sich unter der Haut abzeichneten. Die Hände eines Künstlers.
Und Sammy war wirklich ein Künstler. Niemand konnte so raffiniert wie er eine Sprengladung konstruieren; eine der vielen Eigenschaften, die ihm einen Platz im innersten Kreis der Ulster Volunteer Force gesichert hatten. Er hatte der UVF nun fast ebenso lange gedient wie Gusty Spence, der Anführer der Organisation, und angesichts der Tatsache, dass Gusty eine lebenslange Freiheitsstrafe im Crumlin-Gefängnis absaß, war Sammys Mandat im Kampf gegen die Provos – die Provisional IRA – nahezu unbegrenzt.
An diesem Julimorgen wurde zwischen Sammys empfindlichen Fingern ein Meisterwerk geboren. Sein Arbeitszimmer befand sich im Keller eines Hauses in der Fingal Street, ein kleiner Raum, dessen Wände jeweils den etwa gleichen Flächeninhalt aufwiesen wie der Boden, auf dem Sammy stand. An der einen Wand befand sich sein improvisierter Arbeitstisch, eine überstrichene Spanplatte auf zwei Böcken. Über dem Tisch hing eine längliche Lampe, die einzige Lichtquelle im Raum. Das Kellerfenster in der Wand gegenüber war mit schwarzem Filz verklebt.
Nur vier Menschen wussten, was sich in diesem anonymen Keller abspielte, und alle waren bereit, für die UVF und die Union ihr Leben zu lassen.
Sammy streckte den Arm aus und fischte aus der Tasche am Ende des Tisches einen durchsichtigen Plastikbeutel. Behutsam hob er ihn in Augenhöhe hoch. Im Schein der Lampe schwebten winzige, gewichtslose Staubpartikel. Der unförmige Inhalt des Beutels erinnerte ein wenig an einen Klumpen Brotteig, kaum größer als Sammys Faust.
Semtex.
Ein Plastiksprengstoff, den ursprünglich die Tschechoslowaken in den 1950er-Jahren entwickelt hatten, der nun jedoch in Libyen und an einigen Orten in Westeuropa erhältlich war. Sammy betrachtete die hellrote Masse. Er kannte sich sowohl mit der Wirkung von Semtex als auch mit der von C-4 bestens aus. Sogar wenn nur eine relativ kleine Ladung wie diese hier explodierte, wurde eine Druckwelle mit einer Geschwindigkeit von fünf- bis sechstausend Metern pro Sekunde ausgelöst. Alles, was sich in einem Radius von acht bis zehn Metern befand, würde in winzige Fetzen gesprengt. Außerhalb dessen würde die Druckwelle Menschen und Gegenstände wie wild durcheinanderwirbeln und zu nicht vorhersehbaren Verletzungen sowie Todesfällen führen. Der extrem starke Hitzeeffekt – die Feuerkugel – würde das Übrige dazu beitragen.
Genauso sah Sammy es. Dazu beitragen.
Knapp eine Woche war vergangen, seit drei seiner engsten Freunde, zwei davon Mitglieder der UVF, einem Attentat auf McShane’s Bar in der Sandy Row zum Opfer gefallen waren. Laut Aussage von Augenzeugen hatte ein Lastwagen von der Lafferty Brewery ein paar Minuten vor elf Uhr draußen auf der Straße vor McShane’s angehalten. Der Fahrer und ein weiterer Mann hatten eine Sackkarre von der Ladefläche gehoben und fünf Kästen Bier darauf geladen. Oder genauer gesagt: Die Zeugen nahmen an, dass es sich um Bier handelte. Unter dem obersten Kasten hatten zwei Maschinenpistolen gelegen, und im Laufe der nächsten dreißig Sekunden war McShane’s in ein Schlachthaus verwandelt worden. Nachdem die letzte Schusssalve verstummt war, lagen acht Tote und drei Schwerverletzte auf dem blank gescheuerten Steinboden. Der 68-jährige Martin McShane, Pub-Besitzer und eingeschworener Royalist, befand sich unter den Opfern.
Eigentlich hätte Sammy sich im Pub befinden sollen, als es knallte, aber er hatte verschlafen. Von seinen Freunden war nur noch Francis »Frankie« Stevens am Leben, als Sammy gleichzeitig mit dem ersten Notarztwagen am Ort des Geschehens eintraf. Frankie lag direkt neben dem durchlöcherten Tresen auf dem Rücken und machte eine kraftlose Bewegung mit einem Arm, als er Sammy in der Türöffnung entdeckte. Auf unsicheren Beinen durchquerte Sammy das Lokal und fiel neben seinem Freund auf die Knie.
»Du bist verdammt spät …«, flüsterte Frankie durch den blutigen Schaum vor seinem Mund.
Sammy brachte kein Wort hervor. Sein ganzer Körper zitterte unkontrolliert, während er mit ansehen musste, wie sein bester Freund um jeden Atemzug kämpfte.
»Aber vielleicht nicht so schlimm«, kam es kaum hörbar von Frankie. »Jetzt wissen wir wenigstens … dass einer die Schuld einfordern wird.«
Sammy fand seine Sprache wieder. »Verdammt, Frankie – halt durch!«, flehte er. »Der Notarzt ist da. Gleich helfen sie dir.«
Der Schatten eines Lächelns streifte Frankies Lippen. Ein letzter Atemzug – und dann kam es, so leise, dass Sammy fast nicht verstanden hätte, was der andere sagte, wenn die Worte nicht so herzzerreißend bekannt geklungen hätten:
»For God and Ulster, Samuel …«
Dann starb Francis Stevens.
Am Morgen nachdem Frankie und die anderen in die Erde hinabgelassen worden waren, hatte Sammy Bennett einen Strauß gelber Saat-Wucherblumen auf die Küchenfensterbank seiner kleinen Wohnung in der Glenwood Street gestellt. Knapp fünf Stunden später klopfte Sean Ervine an seine Tür.
Ervine, ein magerer und düster wirkender Mann Ende dreißig, war Detective Sergeant in der Royal Ulster Constabulary. Auf dem Papier war die RUC das für ganz Nordirland zuständige Polizeikorps, doch es war kein Geheimnis, dass die meisten Offiziere mit den Loyalisten und mit England sympathisierten.
Ervine warf einen Blick auf die Browning in Sammys Hand.
»Zittrig, Sammy?«
»Ich habe gerade drei Freunde begraben«, erwiderte Sammy knapp und legte die Pistole zurück in die Kommode. »Kaffee?«
»Lieber ein Bier, wenn du eins dahast. Magenprobleme«, fügte Ervine erklärend hinzu und klopfte auf seinen Bauch.
Sammy ging in die Küche und kam mit zwei Flaschen Murphy’s zurück. Dann setzten sie sich an den kleinen Esstisch im Wohnzimmer und stießen an.
»Frankie Stevens«, sagte Ervine feierlich. »Möge er in Frieden ruhen.«
Sie tranken. Ervine zog ein Päckchen No. 9 aus der Brusttasche, klopfte zwei Zigaretten halb heraus und hielt Sammy das Päckchen hin. Der schüttelte den Kopf. Männliche Nichtraucher waren in Belfast eher ungewöhnlich, aber Sammy war kein gewöhnlicher Mann. Ervine gab sich Feuer und nahm einen tiefen Zug.
»Was kann ich für dich tun, Sammy?«
»Du meinst wohl: ›Was kann ich für Ulster tun?‹«
Ervine nahm einen weiteren Zug von seiner 9-er. Eine grimmige Bemerkung lag ihm auf der Zunge, aber er schluckte sie hinunter.
»Sind das nicht zwei Seiten derselben Medaille?«
Sammy schob sein Murphy’s zur Seite und beugte sich über den Tisch.
»Sie haben elf Männer auf dem Gewissen, Sean. Elf Männer! Paddy Henderson ist einen Tag später im Krankenhaus gestorben, und Joe Williams wird für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Wenn wir darauf nicht antworten, können wir die Flagge auch gleich einholen und zusammenpacken.«
Ervine nickte ernst. Er wusste, dass Bennett recht hatte. Hinter den Kämpfern der UVF standen Zehntausende von Loyalisten, Männer und Frauen, deren Herzen für Ulster brannten. Das Attentat auf McShane’s hatte auch sie getroffen – wenn auch indirekt. Eine ausbleibende Reaktion darauf würde als Zeichen von Schwäche gewertet werden, und die UVF brauchte das Vertrauen und die Unterstützung der Menschen – ebenso wie die Menschen Vertrauen in die UVF haben mussten. Ervine wusste genau, worauf Sammy Bennett abzielte.
Ein Vögelchen aus den Reihen der Provisional IRA.
»Ich brauche Informationen«, bestätige Sammy leise. »Aber dieses Mal einhundert Prozent verlässlich.«
Informant war ein bekannter Begriff in der RUC, und Sean Ervine gehörte zu einer kleinen Gruppe von Beamten, die sich darauf spezialisiert hatten, solche Informanten zu rekrutieren. Grob betrachtet gab es zwei Herangehensweisen. Geld war die einfachste. Viele Unterstützer der Provisional IRA waren arbeitslos, und die lumpigen Almosen, die sie vom Staat erhielten, reichten gerade für das Allernötigste aus – Lebensmittel, ein Dach über dem Kopf und Kohle. Nur wenige allerdings schnappten nach diesem Köder, da es im Falle einer Entdeckung zu unmissverständlichen Konsequenzen kam: Ein brutaler Tod für den Überläufer und ewige Schande für seine oder ihre Familie.
Die andere Taktik war zynisch und absolut herzlos: Man suchte sich ein verletzliches Individuum aus den Reihen des Feindes aus, vorzugsweise eine Person mit engen Beziehungen zum Ehepartner oder zu den Eltern. Danach wurde eine Waffe oder eine geringe Menge Sprengstoff im Keller oder im Auto eines der Familienmitglieder versteckt. Dieses Material wurde dann während einer routinemäßigen Razzia der RUC »entdeckt«, und das nichts ahnende Opfer wurde verhaftet und sah sich plötzlich mit einer langen Gefängnisstrafe konfrontiert. Dem Mitglied der Provos stand eine einfache Wahl zur Verfügung: Ein paar oberflächliche Informationen über dieses oder jenes Gerücht im Austausch gegen eine Einstellung des Verfahrens gegen Freunde oder Familie. Hatte sich der- oder diejenige erst einmal im Netz verfangen, konnten Ervine und seine Kollegen weiter Druck ausüben und noch mehr Informationen verlangen, ohne dass der unfreiwillige Verräter die Möglichkeit hatte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er oder sie galt in den Akten bereits als Spitzel, ein tout, und nur das Schweigen der RUC konnte verhindern, dass eine Kugel der Provos im Nacken der betreffenden Person landete.
Ervine goss den letzten Rest aus der Bierflasche in sich hinein und rülpste diskret.
»Schwebt dir irgendwas Besonderes vor?«, fragte er.
»Republikaner«, erwiderte Sammy. »So viele wie möglich und an einem Ort versammelt.«
Ervine ließ die Zigarettenkippe in die Flasche fallen und stand auf.
»Ich werde sehen, was ich tun kann, Sammy. Du hörst bald wieder von mir. Und danke fürs Bier.«
Er ging. Sammy Bennett blieb sitzen und betrachtete den Zigarettenqualm, der unter der Zimmerdecke schwebte. Dann trank er sein Bier aus. Wie ein Torffeuer loderte der Hass in ihm, ein Rachedurst, der sich nicht mit einem oder zwei Murphy’s löschen ließ. Die Morde im McShane’s waren der persönliche Aspekt der Sache. Aber der politische war wichtiger. Die Republikaner und die Provos würden ihren Kreuzzug sowieso fortsetzen, auch ohne eine Reaktion der Gegenseite, bis zu dem Tag, an dem Nordirland der englischen Krone entrissen würde. Es würden weitere Attentate folgen. Weitere Autobomben würden detonieren. Und weitere Scharfschützen würden ihre Posten auf den Dächern in der Antrim Road einnehmen. Immer mehr protestantische Familien würden ihre Väter, Söhne, Mütter und Töchter begraben müssen.
Es war eine Spirale der Gewalt, die nur gestoppt werden konnte, wenn eine Seite die andere in die Knie zwang. So einfach war das. Sieg oder Niederlage. Rein theoretisch gab es natürlich eine dritte Möglichkeit: ein am Verhandlungstisch eingegangener Kompromiss. Doch allein der Gedanke daran verursachte Sammy Übelkeit. Sie waren Engländer und würden es bis in alle Ewigkeit bleiben, jedenfalls so lange, bis Samuel Patrick Bennett noch Leben in sich spürte.
Zwei Tage später rief Ervine an. Als Sammy den Hörer ans Ohr hielt, verriet ihm ein Klicken in der Leitung, dass der Anruf aus einer Telefonzelle kam.
Nicht alles, was im RUC-Hauptquartier in der Station in New Hamiltontown vor sich ging, hatte offiziellen Charakter.
»Du hast Glück«, sagte Ervine.
»Erzähl.«
»Barry Quinn – Quartiermeister in der Belfast-Brigade – wird bald dreißig. Und zu diesem Anlass gibt es eine große Feier. Nächste Woche Montag.«
»Wo?«
»Hendley’s in der Beechfield Street.«
Sammy fluchte lautlos in sich hinein. Die Beechfield Street lag im Zentrum von Short Strand, einer katholischen Enklave im Herzen der Stadt. Er wusste genau, dass es bei so einem Anlass eine lückenlose Überwachung geben würde.
»Vergiss es«, sagte er. »Wir kommen da nicht mal in die Nähe.«
»Wer sagt, dass man in die Nähe kommen muss? Einer meiner Informanten steht auf der Gästeliste.«
»Und er ist zu hundert Prozent verlässlich?«
»Es ist eine ›sie‹, um genau zu sein. Und ja – sie ist … bombensicher.«
Sammy hörte Ervine über sein eigenes Wortspiel kichern. Im Laufe einer Sekunde zeichnete sich ein Plan in seinem Kopf ab. Konnte es wirklich so einfach sein? Doch – es könnte funktionieren.
»Bist du noch dran?«, fragte Ervine.
»Ich bin hier«, gab Sammy zurück. »Wie heißt die Dame?«
»Keine Namen, Sammy. Das weißt du doch besser als ich.«
»Alter?«
»Ende zwanzig. Was stellst du dir vor?«
Sammy starrte aus dem Küchenfenster. Ein heftiger Wind ließ große Regentropfen gegen die Scheibe prasseln.
»Ich stelle mir vor, dass sie Quinn und den anderen Gästen einen Gruß von uns überbringt«, sagte er. »Zusammen mit einer Geburtstagstorte.«
5
Freitag, 23. Juli 1976
Marion O’Neill betrachtete den falschen Mond, der vor ihrem Fenster hing. Elektrische Straßenbeleuchtung gab es mittlerweile fast in der ganzen Stadt, in ihrem Viertel jedoch wurde die nächtliche Dunkelheit immer noch von alten, runden Gaslaternen durchbrochen. Sie war achtundzwanzig Jahre alt, wusste aber, dass die meisten Menschen sie für zehn Jahre älter hielten. Was hatte am meisten an ihr gezehrt? Fünf Geburten in sieben Jahren? Oder der Vater ihrer Kinder, der im letzten Herbst in lustiger Runde unzählige Gläser Bushmills in sich hineingegossen hatte, kurz danach über die Kaikante unten beim River Lagan gefallen war, um daraufhin im eiskalten Wasser zu ertrinken?
Marion zog es vor zu glauben, dass er gestolpert war, doch sicher war sie nicht. Joey war aktiver Republikaner gewesen, abgesehen von ein paar anderen Dingen, auf die sie weniger stolz war.
Die Tür zum Schlafzimmer war angelehnt, und sie konnte das leise Schnarchen ihres ältesten Sohnes hören. Er litt an Asthma, was vom rußigen Qualm Hunderter Kohleöfen in Ardoyne und The Bone nicht eben gelindert wurde. Die fünf Kinder lagen nebeneinander auf dem Doppelbett, Kopf an Fuß, wie Ölsardinen in einer Büchse. Sie selbst schlief auf dem Diwan im Wohnzimmer. Wenn sie schlafen konnte.
Schon als Joey noch lebte, hatten sie jeden Penny zweimal umdrehen müssen. Ohne sein Einkommen konnte Marion jetzt nicht einmal davon träumen, eine Rechnung pünktlich zu bezahlen. Sechs Mägen mussten gefüllt werden. Der Hausbesitzer verlangte Miete. Die Kinder konnten nicht nackt herumlaufen. Und Medizin gab es auch nicht umsonst. Sie hatte ein wenig Unterstützung von Verwandten bekommen, aber die Armut war eine Familienkrankheit.
Wusste er es, dieser Polizist, der vor ein paar Monaten bei ihnen angeklopft hatte? Ihr erster Gedanke war, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen, doch andererseits wollte er ja gar nicht viel für die grünen Scheine, die er auf den Tisch legte. Sie sollte die Augen offen halten. Aufpassen und hören, was in der Nachbarschaft vor sich ging. Dann und wann einen Kaffee mit ihm trinken, während sie sich darüber unterhalten konnten, was gerade so passierte. Einen Kaffee. Wie gefährlich könnte so etwas sein? Sie kannte ein paar Mädchen, die aus lauter Not ihren Körper verkauft hatten.
Was sie nicht wusste, war, dass Sean Ervine während ihrer ersten Unterhaltung ein kleines Diktafon in seinem Zigarettenpäckchen versteckt hatte. Bei der nächsten Begegnung hatte er ihr das aufgenommene Gespräch vorgespielt. Von diesem Augenblick an hatte er Marion O’Neill besessen, und die Kaufsumme kam in nur kleinen Raten.
Nach und nach hatte Ervine den Schraubstock noch etwas fester angezogen, aber erst vor zwei Tagen hatte er ihr einen konkreten Auftrag erteilt. Eine Torte sollte zur Geburtstagsfeier von Barry Quinn gebracht werden. Sie hatte sich strikt geweigert. Hatte ihn angeschrien und mit allen hässlichen Ausdrücken bedacht, die ihr in den Sinn gekommen waren. Und was hatte Ervine getan? Er hatte gelächelt und gefragt, was fünf Kinder zwischen drei und zehn Jahren wohl tun sollten, wenn die Mutter nicht zurückkäme. Sie hatte die Tränen zurückhalten können, bis er die Haustür hinter sich geschlossen hatte.
Am nächsten Tag sollte sie den Tortenbäcker im Botanischen Garten treffen.
Irgendwo hinter ihr raschelte es. Eine graubraune Ratte huschte über den Linoleumboden und verschwand unter der großen Kommode. Marion fragte sich, wieso diese Viecher in einem Haus, wo es kaum genug Nahrung für Menschen gab, derart fett werden konnten.
6
Samstag, 24. Juli 1976
Er saß am vereinbarten Ort, auf einer Bank an der Rückseite des Konservatoriums. Tweedjacke, Schiebermütze und eine Ausgabe des Familienmagazins Ireland’s Own auf dem Schoß.
Familienmagazin … pfui Teufel.
Sie riss sich zusammen und konzentrierte sich. Ging weder zu schnell noch zu langsam. In dieser Stadt wurde alles Außergewöhnliche sofort bemerkt, und Augen gab es überall. Sie verließ den kiesbedeckten Weg und nahm neben dem Mann auf der Bank Platz. Ohne den Blick von seinem Magazin zu heben, sagte er:
»Murphy’s.«
»No. 9«, antwortete sie.
Sammy Bennett schob seine Schiebermütze in den Nacken und sah sie an. Ihr erster Gedanke war, dass er nicht wie ein Mörder wirkte.
»Hast du Angst?«, fragte er.
»Was ist in der Torte? Gift? Sprengstoff?«
»Zieh nicht so’n mürrisches Gesicht, Kleine. Du und ich, wir sitzen hier und unterhalten uns über das schöne Wetter.«
Sie versuchte es mit einem winzigen Lächeln.
»Du brauchst bloß zu wissen, dass der Transport völlig ungefährlich ist. Wir machen das Ganze ja nicht, um eine Mutter von fünf Kindern aus dem Weg zu räumen.«
Er zog seine Schiebermütze wieder tiefer in die Stirn.
»Siehst du den Typen, der zwei Bänke neben uns sitzt? Den mit der Thermoskanne?«
Sie nickte.





























