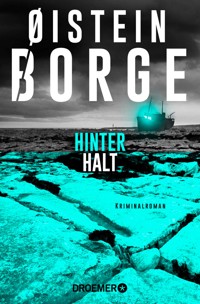Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Bogart Bull
- Sprache: Deutsch
Die Krimi-Entdeckung aus Skandinavien - der neue Nesbø Bogart Bull, Kommissar bei der Osloer Kriminalpolizei, durchlebt eine schwere Zeit, nachdem seine Frau und sein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Seine Chefin versetzt ihn zu Europol, wo ein mysteriöser Fall auf ihn wartet: Der schwerreiche norwegische Unternehmer und Kunstsammler Axel Krogh ist in seiner Villa in Südfrankreich ermordet aufgefunden worden - doch alle Verdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Bulls einziger Anhaltspunkt ist ein Gemälde von Edvard Munch, das einen Dämon zeigt. Nichts anderes hat der Mörder aus der Villa entwendet. Bulls Ermittlungen führen ihn schnell in die Vergangenheit: zu einem grausamen, ungesühnten Verbrechen in den vierziger Jahren … "Mit das Beste, was ich seit langer Zeit in der norwegischen Kriminalliteratur gelesen habe." Bookbloggeir/ Geir Tangen
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Øistein Borge
Kreuzschnitt
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen von Andreas Brunstermann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bogart Bull, Kommissar bei der Osloer Kriminalpolizei, durchlebt eine schwere Zeit, nachdem seine Frau und sein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Seine Chefin versetzt ihn zu Europol, wo ein mysteriöser Fall auf ihn wartet: Der schwerreiche norwegische Unternehmer und Kunstsammler Axel Krogh ist in seiner Villa in Südfrankreich ermordet aufgefunden worden – doch alle Verdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Bulls einziger Anhaltspunkt ist ein Gemälde von Edvard Munch, das einen Dämon zeigt. Nichts anderes hat der Mörder aus der Villa entwendet. Bulls Ermittlungen führen ihn schnell in die Vergangenheit: zu einem grausamen, ungesühnten Verbrechen in den vierziger Jahren …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Herbst
Prolog
Frieden.
Wie an einem tropischen Strand – mit spielenden Kindern und sorglosen Eltern. In den Minuten, bevor die Flutwelle hereinbricht.
Oder wie in einem Volkswagen Polo, der an einem Oktobertag im Jahr 2013 eine Garage im Osloer Osten verlässt. Am Steuer sitzt eine Mutter. Auf dem Sitz neben ihr das Kind, ein zartes 12-jähriges Mädchen mit einer roten Schleife im blonden Haar.
Als der gelbe Wagen in den Teisenvei einbiegt, taucht ein flaschengrüner Volvo V 40 hinter ihm auf und folgt ihm hinunter zum Tvetenvei und weiter hinüber nach Helsfyr. Die Straßen sind fast leer um diese Tageszeit. Die beiden Fahrzeuge durchqueren ungehindert den Oslo-Tunnel Richtung Bærum. Sie folgen der E18 bis Sandvika, wo sie die Autobahn verlassen und auf die nach Hønefoss führende E16 wechseln. Das Mädchen mit der Schleife hat zum Geburtstag ein Smartphone mit Kopfhörern bekommen und singt inbrünstig einen Song mit, der, vermutet die Mutter, von der schwedischen Sängerin Laleh stammt. Sie fahren über den Hügel bei Sollihøgda und dann am Sundvollen Tagungshotel vorbei, wo genau in diesem Augenblick zwei führende weibliche Parteimitglieder die politische Agenda für die neue Regierung des Landes präsentieren. Das Mädchen denkt nicht so viel an die Zukunft Norwegens, dafür umso mehr an die neugeborene Cousine in Fagernes. Sie kann es kaum erwarten, das Baby zu sehen.
Auf dem Überholstreifen in Höhe der Gastwirtschaft Vik Veikro rast ein grüner Volvo mit hohem Tempo an Mutter und Tochter vorbei.
Der junge Fahrer treibt den Motor des Volvo im dritten Gang bis ans Äußerste, wechselt dann in den vierten und erreicht den höchsten Punkt der Hügelkuppe. Bei Rud überholt er zwei weitere Autos und kommt schließlich zu der fast drei Kilometer langen und schnurgeraden Strecke, die eine landwirtschaftlich genutzte Ebene namens Steinssletta durchschneidet. Am Ende der Strecke bremst der Fahrer ab und hält an einer Bushaltestelle an. Er lässt ein in Richtung Oslo fahrendes Motorrad passieren, und nachdem er in den Seitenspiegel geblickt hat, wendet er den Wagen. Wieder liegt die Ebene vor ihm. Er beachtet weder den wolkenlosen Himmel noch die bleiche Herbstsonne, welche die umliegenden Äcker erhellt. Er hat nur Augen für den winzigen gelben Fleck am anderen Ende der Ebene. Ein paar Mal holt er tief Luft, dann drückt er das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Die Tachonadel bewegt sich über die 100 hinaus. Sein Herz hämmert wild unter dem Kapuzenpullover. Er spürt den Zweifel, den er schon erwartet hatte, weshalb er vier 20-Milligramm-Ritalin-Kapseln geschluckt hat, bevor er aus Oslo weggefahren ist, und jetzt ist er der Sendbote der Gerechtigkeit.
Als der Abstand zwischen ihm und dem gelben Wagen nur noch knapp hundert Meter beträgt, lenkt er den Volvo auf die entgegenkommende Spur.
Es dauert weniger als zwei Sekunden, um alles zu verändern.
1
Sainte-Maxime, Côte d’Azur
Mittwochabend, 23. April 2014
Axel Krogh war so gekleidet, wie es seiner gesellschaftlichen Stellung entsprach. Ein schwarzer seidener Morgenrock von Hermès über einem schneeweißen Hemd und einer dazu passenden Hose aus chinesischem Leinen. Der Alte stand vor den nach Süden weisenden Panoramafenstern und betrachtete sein Spiegelbild im Fensterglas. Der Widerschein seines blassen Gesichts hing wie ein Gespenst über den Lichtern der Stadt auf der anderen Seite der Bucht. Wie immer weckte der Anblick von Saint-Tropez widerstreitende Gefühle in Krogh.
Für ihn und andere Gutsituierte war es viele Jahre ein Ferienparadies gewesen, mittlerweile aber zu einer vulgären Bühne für Hedonisten verkommen.
Er hatte von Kindern reicher Eltern gehört, die Champagner für 3000 Euro pro Flasche kauften, um ihn dann wie Sprudelwasser auf sich und ihre Freunde zu spritzen, als hätten sie eine Etappe der Tour de France gewonnen. Die Brut russischer Oligarchen oder norwegischer Finanzmakler, Emporkömmlinge, stolzierte durch Straßen, in denen man früher neben kultivierten Persönlichkeiten wie Aristoteles Onassis, Brigitte Bardot oder dem Schah von Persien flanieren konnte.
Krogh hatte schon Mitte der neunziger Jahre vom demographischen Verfall Saint-Tropez’ die Nase voll gehabt. Nachdem er ausreichende Mengen französischer Francs in die richtigen Taschen gesteckt hatte, war es ihm gelungen, sich eines der begehrtesten Baugrundstücke in den Hügeln westlich von Sainte-Maxime zu sichern, wo er sich eine fast tausend Quadratmeter große, modernistische Villa aus Glas und Schiefer bauen ließ. Vom Meer aus gesehen wirkte es, als schwebte das Haus völlig frei und gewichtslos über dem Boden. Nach Anbruch der Dunkelheit war es ein leuchtendes Raumschiff aus einer anderen Galaxie. Die Villa war sowohl eine Landmarke als auch ein provenzalisches Denkmal für den norwegischen Architekten Sverre Fehn geworden, einen Künstler, der sich nur selten dazu überreden ließ, Privathäuser zu entwerfen. Maison Krogh war weitaus mehr als ein Gebäude. Es war eine Vision. Die Erfüllung eines Traums. Eine Manifestation der Trennung Kroghs von Saint-Tropez.
Axel Krogh war ein durch und durch nüchterner Mann. Trotz seines beachtlichen Vermögens war die Villa an der Riviera das Einzige, das in seinen privaten Ausgaben als Extravaganz hätte gelten können. Zwar hatte er zweistellige Millionensummen für Kunst ausgegeben, betrachtete diese aber als Investition, genauso wie einen Wohnblock oder ein attraktives Grundstück. Im Schatten anderer, zu größeren Risiken bereiten Immobilieninvestoren hatte Krogh kleine Brötchen gebacken und erst Anfang der achtziger Jahre die einfache Formel gefunden, die sein Imperium begründete: kleine Einkaufszentren, in Südnorwegen gelegen, wo es eine zufriedenstellende Bevölkerungsdichte gibt, die Entfernungen zur nächsten großen oder mittelgroßen Stadt jedoch mehr als siebzig Kilometer betrugen. Viele der Zentren wurden in aufgegebenen Industriegebäuden untergebracht, wodurch die Investitionskosten auf ein Minimum beschränkt blieben. Jedes dieser Gebäude hatte Platz für zwanzig bis dreißig Geschäfte, und alle führten Dinge des täglichen Bedarfs, was bedeutete, dass die Menschen sie in regelmäßigen Abständen aufsuchten. Dieses Konzept hatte besser funktioniert, als Krogh je zu träumen gewagt hatte. Die Anzahl seiner Einkaufszentren hatte die vierzig bereits überschritten. Einzeln betrachtet warfen sie zwar keine astronomischen Summen ab, aber zusammengenommen waren sie eine Goldgrube.
In Geschäftskreisen galt Krogh als konservativ und altmodisch. Während er bei seinem Leisten geblieben war, hatten viele seiner Gleichgesinnten auf neue Branchen gesetzt: Offshore, Medien, Telekommunikation, Aquakultur und alternative Energien. Einige von ihnen waren reicher geworden als er, weitaus mehr allerdings hatten zusehen müssen, wie ihr Vermögen sich auflöste, und grämten sich über ihren eigenen Übermut.
Die Krogh-Gruppe hingegen stand genauso fest und unerschütterlich da wie die Immobilien, die sie verwaltete.
Erst als er auf die neunzig zuging, hatte Krogh das Tagesgeschäft der Gesellschaft jüngeren Kräften überlassen. Er verbrachte nun große Teile des Jahres in Sainte-Maxime, wobei ihm die moderne Technologie erlaubte, die geschäftlichen Aktivitäten im Blick zu behalten. An jedem letzten Freitag im Monat nahm die Geschäftsführung der Krogh-Gruppe an dem massiven Tisch im französischen Esszimmer des Magnaten Platz. Niemals ließ Axel Krogh auch nur den geringsten Zweifel daran, wer das letzte Wort hatte.
Einen praktischen Nachteil allerdings hatte das Maison Krogh: Familie, Freunde und Geschäftspartner gaben einander die Klinke in die Hand. Ektoparasiten. Seine Tochter Ella und ihr Ehemann waren vor drei Tagen angekommen, und erst vor wenigen Stunden hatte Kroghs Teilhaber Erik Jacobsen nebst Gattin den anderen Gästeflügel in Beschlag genommen. Im Augenblick befanden sich die vier Gäste in einem der besseren Restaurants der Stadt, eine gesellschaftliche Verpflichtung, der Krogh sich entzogen hatte. Einerseits, weil er seinen Schwiegersohn nicht ausstehen konnte, und andererseits, weil alle vier den Blick erwartungsvoll auf den Inhaber der Krogh-Gruppe gerichtet hätten, sobald die Rechnung auf dem Tisch gelandet wäre.
Parasiten.
Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Der scharfe Laut durchschnitt die Stille im Haus, und Krogh wandte sich erstaunt um, als habe er vergessen, dass der Apparat hinter ihm überhaupt existierte. Es musste sich um ein Ortsgespräch handeln. Ella und Erik riefen stets auf seinem Handy an. Er ließ das Teufelswerk klingeln. Nach einer halben Minute war es still.
Krogh starrte das Telefon an, als betrachte er eine Kakerlake in der makellosen Umgebung seines Schreibtischs.
Dreißig Sekunden später begann es erneut zu klingeln. Krogh riss den drahtlosen Apparat aus der Halterung und blaffte ins Telefon:
»Oui?«
Die wohlklingende Stimme am anderen Ende der Leitung stellte sich als Pierre Vigny vor, Schichtleiter der Wachgesellschaft La Sécurité nationale.
Krogh durchforstete sein Gedächtnis.
»Adam Smith«, sagte er schließlich. Der Name des legendären Ökonomen fungierte für Eingeweihte als Codewort im Maison Krogh.
»Marktliberalismus«, erwiderte Vigny.
Grünes Licht.
»Es tut mir leid, Sie so spät noch zu stören, Monsieur Krogh«, fuhr Vigny fort. »Aber auf meinem Bildschirm sehe ich, dass einer der Sensoren an Ihrer Haustür außer Betrieb ist. Wir haben einen Wachmann in der Nähe und würden ihn gern vorbeischicken, um den Fehler zu beheben.«
Krogh seufzte.
»Kann das nicht bis morgen warten? Ich wollte gerade ins Bett.«
»Ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Belästigung, Monsieur Krogh, aber die Versicherungsgesellschaft wird sich wie ein Bluthund auf uns stürzen, falls in so einer Situation etwas passieren sollte. Unser Vertreter kann in fünf Minuten bei Ihnen sein und braucht vermutlich noch weniger Zeit, um das Problem zu beheben.«
Krogh seufzte erneut, weniger diskret als beim ersten Mal.
»Sie haben fünf Minuten. Die Uhr läuft ab jetzt.«
»Herzlichen Dank, Monsieur. Und noch einen schönen Abend.«
Axel Krogh murmelte eine Erwiderung und beendete das Gespräch.
Es verstrichen knapp vier Minuten, bis an der Haustür geläutet wurde.
Auf dem kleinen Monitor an der Innenseite der Tür konnte er den Wachmann ausmachen, der die grün-weiße Uniform der Wachgesellschaft trug und eine eingeschaltete Taschenlampe in der Hand hielt. Das Bild auf dem Monitor flackerte ein paarmal kräftig auf. Vermutlich weil der Idiot die Kamera im Schein der Taschenlampe untersuchte.
Krogh fluchte leise auf Französisch und öffnete. Der Lichtkegel richtete sich auf ihn, er hörte ein leises Bon soir und hatte für einen Moment den absurden Eindruck, der Wachmann reiche ihm die Taschenlampe. Dann registrierte er gerade noch, dass das schwere Ende der Taschenlampe in Brusthöhe auf seinen Morgenrock traf, bevor der Schmerz blitzartig durch seinen Körper jagte und ihn von Kopf bis Fuß lähmte.
Es wurde dunkel.
2
Erik Jacobsen musterte Ella Krogh Sars, die ihm am Tisch im L’Endroit gegenübersaß. Zum weiß Gott wievielten Mal staunte er darüber, wie eine so perfekte Erscheinung innerlich derart hohl sein konnte. Es lag durchaus nicht an ihrem Intellekt, doch hinter dem hübschen Gesicht, dem formvollendeten, ausgesucht elegant gekleideten Körper herrschte Permafrost. Diese Frau besaß die Empathie eines Salzwasserkrokodils und ebenso dessen Appetit – allerdings auf Männer. Oder präziser ausgedrückt: auf Männer in einer gewissen Position. Deren finanzielle Möglichkeiten bedeuteten ihr wenig. Als einzige Tochter Axel Kroghs war Geld für Ella nur von untergeordneter Bedeutung. Es war der Promifaktor, der sie die perlweißen Zähne blecken und ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Sie hatte ihr Bett mit einem spanischen Tennisprofi, mit einem schwedischen Filmregisseur, mit einem norwegischen Talkshow-Host sowie mit unbekannt vielen weiteren Spielgefährten geteilt.
Kurzfristig waren sie jeweils gegeneinander ausgetauscht worden.
Einer von ihnen war Erik Jacobsen. Und um der Wahrheit gerecht zu werden: Er hatte sich mehr als einmal von ihr verschlingen lassen. Es hatte auf einem Firmenfest begonnen, der Urmutter aller außerehelichen Affären. In seiner Eigenschaft als neuer Konzernchef der Krogh-Gruppe hatte man Jacobsen die Tochter des Inhabers als Tischdame zugewiesen, und wie die meisten Männer hatte er sich blenden lassen. Nach mehreren zum Kaffee gereichten Cognacs hatte sie ihn auf die dichtbevölkerte Tanzfläche gezogen, wo der Druck ihres Unterleibs ausgereicht hatte, um seinen in akute Alarmbereitschaft zu versetzen. Drei Stunden später waren sie auf dem Wohnzimmerfußboden in Ellas Wohnung wie wilde Tiere übereinander hergefallen.
Ella wurde für Jacobsen gefährlich und zerstörerisch wie Heroin. Als sie dem Talkshow-Host einige Wochen nach diesem schicksalsträchtigen Fest den Laufpass gab, hatte sie ihren Spieleinsatz erhöht: um Erik Jacobsens Frau und zwei heranwachsende Kinder. Zu diesem Zeitpunkt war Erik nicht nur sprichwörtlich in ihr innerstes Wesen vorgedrungen, ohne allerdings an dem Gefallen zu finden, was er da vorfand. Schließlich stellte Ella ihm ein Ultimatum: Scheidung oder eine verschlossene Tür.
Jacobsen wählte Letzteres. Zur Strafe zeigte sie ihm fortan die kalte Schulter.
Ella verschwendete keine Zeit. Ihr nächstes Opfer zerrte sie zu allem Überfluss vor den Traualtar. Mikkel Sars war vier Jahre jünger als seine Gattin, sein Vermögen gleich null, doch mehrere Rollen in norwegischen Filmen und TV-Serien hatten ihn qualifiziert. Dass der Mann kaum in der Lage war, den britischen Premierminister namentlich zu benennen, schien Ellas Enthusiasmus nicht zu dämpfen. Ganz anders sah das Axel Krogh. Der Alte erwähnte den Bräutigam nicht einmal im Nebensatz, als er auf der Hochzeitsfeier seiner Tochter eine Rede hielt. Und Jacobsen wusste genau, dass Krogh einen Ehevertrag hatte aufsetzen lassen, der sich bis in eine Tiefe von tausend Metern als wasserdicht erweisen würde.
Erik Jacobsen fühlte sich in Ellas Gegenwart immer ein wenig unwohl. Nicht, weil seine physische Begierde immer noch loderte, sondern weil ihr als Alleinerbin nach dem Tod des Alten siebzig Prozent der Krogh-Gruppe zufallen würden. Zwar war Axel Krogh ungewöhnlich agil für sein Alter, aber der Tag, an dem Jacobsen es mit Ella als Mehrheitseignerin zu tun bekäme, lag nicht allzu weit in der Ferne.
Es war eine altbekannte Situation: Axel Krogh war ein durchtriebener Stratege und Geschäftsmann, aber auch ein einsamer alter Mann, der seine Tochter vergötterte. Jacobsen konnte nur darauf hoffen, dass Kroghs letzter Wille einen überschäumenden Reichtum für Ella zur Folge haben, ihr jedoch entscheidenden Einfluss auf die Leitung der Gesellschaft versagen würde.
»Was meinst du, Erik?«
Ella blickte ihn fragend an. Für einen winzigen, erschreckenden Augenblick war er nicht sicher, ob er vielleicht laut gedacht hatte.
»Wie bitte?«
»Wollen wir unsere Liebsten noch ins Nachtleben von Sainte-Maxime locken oder lieber den Abend mit einem Glas auf der heimischen Terrasse abrunden? Was ist mit dir, Cath? Lust auf eine kleine Samba?«
Diese Frage richtete sich an Cathrine Jacobsen. Wie üblich hatte Eriks Frau sich während des Essens sehr zurückgehalten.
»Danke, aber ich glaube, ich möchte den Abend nicht allzu sehr in die Länge ziehen«, sagte sie. »Reisen strengt mich immer etwas an.«
»Es sei dir verziehen«, erwiderte Jacobsen.
Ella lächelte ihn an. Ein Lächeln, das Jacobsen nur als ein Gott, was hast du da bloß für eine langweilige Tusse geheiratet interpretieren konnte. Dann lenkte sie ihren Blick auf Mikkel Sars, der sich dezent darum bemühte, ein Gähnen zu unterdrücken.
»Anscheinend zwecklos, einen jüngeren Mann zu heiraten. Möchtest du auch nach Hause und in deinem Bettchen schlafen, Mikkelschatz?«
»Bett klingt gut«, erwiderte Sars grinsend. »Schlafen muss ich aber nicht unbedingt.«
Die passende Antwort für einen untalentierten Schauspieler, dachte Jacobsen.
»Wenn alle satt und zufrieden sind, sollten wir vielleicht die Rechnung kommen lassen?«, sagte er laut.
Die Dunkelheit ließ nach. Seine Sinne kehrten langsam zurück. Leuchtende Blitze vor den Augen, in die Sand oder Staub geraten war. Der Geruch von Leinöl. Musik.
Musik?
Axel Krogh lauschte. Nach einer Weile erkannte er die Melodie und die sie begleitenden Worte der französischen Nationalhymne.
Auf, auf Kinder des Vaterlands!
Der Tag des Ruhmes, der ist da.
Gegen uns wurde der Tyrannei
Blutiges Banner erhoben.
Die Musik schien lauter zu werden. Krogh konnte allerdings nicht sagen, ob es an der Geräuschquelle lag oder an seinem wieder einsetzenden Hörvermögen.
Zu den Waffen, Bürger!
Formt Eure Schlachtreihen,
Marschieren wir, marschieren wir!
Bis unreines Blut
Unserer Äcker Furchen tränkt!
Jetzt wurde auch sein Blick schärfer, und er begriff, dass er bäuchlings auf dem Wohnzimmerfußboden lag. Seine Arme waren auf schmerzhafte Weise nach hinten auf den Rücken verdreht und an den Gelenken zusammengebunden. Er schaffte es nicht, zu …
Sein Gedanke wurde jäh unterbrochen, als zwei Füße in seinem Blickfeld erschienen. Weiche, schwarze Ledersportschuhe mit einem goldenen Logo an der Seite. Die Füße verschwanden wieder. Dann spürte er einen warmen Luftzug am Ohr, gefolgt von einer weichen, beinahe flüsternden Stimme.
»Bon retour, mon vieux.«
Er versuchte, den Kopf zu drehen, erhaschte aber nur einen kurzen Blick auf einen Arm und eine behandschuhte Hand.
»Was willst du?«
Krogh versuchte, seine Stimme ruhig klingen zu lassen. Irgendetwas sagte ihm, dass dies für die weiteren Schritte des anderen entscheidende Bedeutung haben könnte.
»Gefällt Ihnen die Musik, Monsieur?«
»Hast du es auf mein Geld abgesehen? Da drüben auf dem Schreibtisch liegt meine Geldbörse mit etwas Bargeld und drei Kreditkarten.«
Der andere lachte leise.
»Was für eine traurige Welt, in der wir leben. Nicht wahr, Monsieur? Alle scheinen nur von einer einzigen Sache besessen zu sein: Geld. Hat man keins, gehen die Leute davon aus, man sei minderbegabt. Hat das ganze Geld Sie glücklich gemacht, Monsieur? Und bitte lügen Sie mich nicht an.«
»Nein«, erwiderte Krogh, ohne zu zögern. Nicht zum ersten Mal hatte er über diese Frage nachgedacht.
»Hab ich’s mir doch gedacht. Doch andererseits – ich vermute, Unglück lässt sich in einem Haus wie diesem besser ertragen als in irgendeiner Bruchbude in Marseille.«
»Bist du immer so philosophisch, wenn du andere Menschen ausraubst?«, fragte Krogh bissig.
Es dauerte fünf unheilverkündende Sekunden, bis die Antwort kam. Die Stimme klang jetzt einen Hauch brüchiger.
»Sie sollten nicht zu viel auf meine Bildung vertrauen, Monsieur. Sie könnten enttäuscht werden. Und außerdem – wer redet hier von Raub? Ich werde allenfalls ein kleines Souvenir mitnehmen, bevor ich mich zurückziehe.«
»Bedienen Sie sich«, sagte Krogh. Ganz unbewusst war er zur Höflichkeitsform übergegangen.
Wieder das leise Lachen. Er klingt jung, dachte Krogh. Wie spät war es? Vielleicht kurz vor elf? Ella und die anderen würden wohl nicht vor Mitternacht wieder da sein.
»Seien Sie unbesorgt, Monsieur. Ich weiß genau, was ich haben will.«
Im Hintergrund erstarben die letzten Töne der Marseillaise. Nur Kroghs keuchender Atem durchbrach noch die Stille.
»Das war es schon, Monsieur. Ich fürchte, dass das Ende der stolzen Melodie Frankreichs auch das Ende unserer kleinen Unterhaltung bedeutet. Wie haben Sie sich ausgedrückt? ›Bedienen Sie sich?‹ Eine interessante Formulierung für einen geizigen Mann wie Sie, Monsieur. Ungeachtet dessen eine Aufforderung, der ich zu folgen gedenke.«
Krogh schaffte es nicht mehr, den Mund zu öffnen, bevor ihn das Klebeband zum Schweigen brachte. Erst in dieser Sekunde meldete sich die Angst, die eiskalte Erkenntnis, dass er das Opfer eines weitaus gefährlicheren Eindringlings als eines einfachen Einbrechers geworden war. Er spürte, dass der Mann irgendetwas mit seinem Rücken tat; ein plötzlicher Luftzug über der feuchten Haut. Zwei Stofffetzen segelten am Rande seines begrenzten Blickfelds zu Boden. Leinen und Seide. Weiß und schwarz. Gut und Böse. Eine Hand packte seinen Haarschopf, sein Kinn wurde jäh hochgerissen. Die Nackenwirbel knackten. Dann sah er von rechts die andere Hand kommen. Das Licht einer Halogen-Lampe an der Decke wurde von der glänzenden Klinge zurückgeworfen. Die Todesangst überkam Axel Krogh wie ein Axtschlag. Er spürte, wie sich seine Blase leerte.
Nicht auf diese Weise, bitte nicht. Lieber Gott, sei mir gnädig! Nicht auf diese Weise.
Sie einigten sich auf einen kleinen Spaziergang. Die Hügel, die zum Maison Krogh hinaufführten, waren nicht zu unterschätzen. Gleichwohl war die milde Abendluft den Ausdünstungen eines Wunderbaums an der Frontscheibe eines Taxis vorzuziehen. Arm in Arm bildete das Ehepaar Sars die Vorhut. Jacobsen konnte nicht umhin, die Hand des Schauspielers zu bemerken, die zärtlich über Ellas Rücken strich.
Verärgert stellte er fest, dass der Anblick ihn erregte. In den ersten Jahren mit Cathrine hatte er das Glück des ehelichen Bettes mit diversen Seitensprüngen kombiniert, ohne allzu viel über die Moral seines Doppelspiels nachzudenken. Doch umgekehrt proportional zum Lockruf der verbotenen Früchte war seine Lust auf Cathrine nach und nach verschwunden. Er hatte diverse Erklärungen für dieses Phänomen angeführt, Alter und Arbeitsstress die Schuld gegeben, und Cathrine hatte Verständnis geäußert. Sie hatte ihn getröstet und gesagt, dass so etwas ganz normal sei und natürlichen Schwankungen unterliege, besonders nach einigen Ehejahren. Jetzt waren sie seit über zwanzig Jahren verheiratet. Erik war fünfundzwanzig gewesen, als sie ihm das Jawort gegeben hatte, kurz nachdem beide mit dem Studium fertig geworden waren.
Der Gedanke, seine Ehe zu beenden, kam ihm völlig absurd vor. Cathrine war seine beste Freundin und eine erstklassige Verwalterin des Lebens, das sie sich sowohl durch gemeinsam erbrachte Anstrengungen als auch durch gemeinsam erlebte Freuden aufgebaut hatten – zwei wohlerzogene Kinder, ein schönes Zuhause, ein Ferienhaus am Meer und eines in den Bergen, ein Freundeskreis mit erfolgreichen Vertretern aus Wirtschaft und Geistesleben … In seiner Seele herrschte kein Funken Zweifel – er und Cathrine würden zusammen alt werden, genauso wie es ihrer beider Eltern erlebt hatten.
Sie erreichten die Hügelspitze und spazierten gemütlich die letzten Meter zum Tor hinauf. Der Name der Residenz war in das schwarz lackierte schmiedeeiserne Gitter eingelassen. Ella gab einen sechsstelligen Code in das Zahlenfeld ein. Gerade als das Tor zur Seite glitt, flüsterte Mikkel Sars ihr etwas ins Ohr. Seine Bemerkung wurde mit einem lauten, fröhlichen Lachen quittiert, dem Ella einen saftigen Kuss auf seine Lippen folgen ließ. Krönung der abendlichen Sondervorstellung, dachte Jacobsen. Eine verkrampfte Demonstration von Verliebtheit und Lust, von Ella inszeniert und auf ihn gemünzt, der die männliche Hauptrolle abgelehnt hatte.
Sie überquerten den Vorplatz. In blassem Lichtschein lag der überdachte Haupteingang des Maison Krogh vor ihnen. Minimalistischer Stil und großzügige Ausmaße. Als sie sich der mit Schiefer bedeckten Treppe vor der Haustür näherten, drehte Ella sich um und breitete die Arme aus. Vielleicht war es diese melodramatische Geste, die sie und ihre Begleiter von der dunklen Gestalt ablenkte, die etwas weiter entfernt aus einer Seitentür des Ostflügels glitt. Sekunden später verschwand sie in den Schatten der dichten Vegetation des Gartens.
»Liebe Freunde«, verkündete Ella mit gespielter Feierlichkeit, »ihr seid vielleicht alle müde, aber kein magischer Abend wie dieser darf ohne ein Glas Champagner zu Ende gehen. Erik und Mikkel – ihr geht und macht Feuer im Kamin auf der Terrasse, während Cath und ich mal schauen, ob Papa ein paar edle Tropfen auf Eis liegen hat.«
Jacobsen wollte schon protestieren, besann sich aber. Die verdammte Vorstandssitzung fand erst in zwei Tagen statt. Heute Abend waren sie Gäste. Wenn sie unbedingt den Abend mit einer halben Stunde auf der Terrasse abrunden wollte, dann bitte sehr. Mit Mikkel Sars auf den Fersen umrundete er das Haus und näherte sich der Terrasse mit Aussicht auf die mondbeschienene Bucht von Saint-Tropez.
Noch bevor sie die Terrasse erreichten, hörten sie es. Später hätte Erik Jacobsen schwören können, dass Ellas Schrei bis hinüber nach Saint-Tropez zu vernehmen gewesen sein musste.
3
Kripo Hauptquartier, Oslo
Montagmorgen, 21. April 2014
Der Kaffee war wie immer ungenießbar. Aber die Tasse war hübsch. Weiß, mit abgeschrägtem Henkel und einem handgemalten roten Herz, worauf sie mit großen Buchstaben geschrieben hatte:
BESTER PAPA
DER WELT!
Die Formulierung war nicht besonders originell, aber das spielte keine Rolle, wichtig war nur, dass Anine diese Worte für ihn geschrieben hatte.
Er saß dort, wo er an jenem Tag gesessen hatte. Auf demselben Stuhl, vor demselben Schreibtisch, in demselben kleinen Büro, mit derselben Tasse vor sich. Und soweit er sich erinnerte, hatte er auch dieselben Sachen getragen.
Kripo-Ermittler Bogart Bull gab nichts auf Mode.
Sechs Monate und sechzehn Tage waren vergangen. Sie hatten an seine Tür geklopft, dann war Kripo-Chefin Eva Heiberg mit einem von Bulls Kollegen hereingekommen. Schon in diesem Moment hatte er begriffen, dass etwas nicht stimmte. Heiberg kam niemals zu ihm, er ging zu ihr. Mit einem für sie ungewöhnlichen Gesichtsausdruck hatte sie ihn angeblickt und sich geräuspert, dann war seine Welt eingestürzt.
Nur wenig konnte er sich an die Tage erinnern, die der Beisetzung vorausgegangen waren. Ein junger Mann vom Bestattungsunternehmen, mit professioneller Anteilnahme und Vorschlägen für die Einzelheiten der Zeremonie. Ein Pastor, der behutsam zu klären versuchte, was über die beiden gesagt werden sollte. Ein paar Blumenboten an der Tür im Prost Hallingsvei. Und der Keller im Rechtsmedizinischen Institut, das inzwischen die irreführende Bezeichnung »Volksgesundheitsinstitut« trug.
Einige Male war er dort im Zusammenhang mit seiner Arbeit gewesen. Hatte neben dem Pathologen gestanden und die bleichen kalten Körper betrachtet, die vom scharfen weißen Neonlicht erbarmungslos zur Schau gestellt wurden. Ihm unbekannte Menschen, die irgendjemand erschossen, erstochen, erwürgt oder erschlagen hatte.
An jenem Tag war der Keller eine andere Welt. Dieselben hellgrünen Wände, derselbe lackierte Betonfußboden, aber plötzlich war er ein Angehöriger. Bis zu jenem Augenblick hatte ihm eine innere Stimme zugeflüstert, dass es ein Missverständnis sein könnte. Es gab andere gelbe Polos. Es könnte eine andere Frida Bull mit kleiner Tochter geben. Vielleicht hatte die Verkehrspolizei das Autokennzeichen nicht genau überprüft. Die lodernde Flamme der vergeblichen Hoffnung.
Der Keller. Zwei sterile Stahltische, die Konturen zweier Körper unter weißem Tuch, der eine etwas kleiner als der andere. Der Pathologe hatte ihn mitleidsvoll angesehen, bevor er das eine Tuch behutsam beiseitezog und das Gesicht des größeren Körpers freilegte.
In den wenigen Sekunden, die das Gehirn benötigte, um die Wahrheit zu erkennen, hatte Bull regungslos dagestanden. Dann war er mit einem so durchdringenden Schluchzen zusammengebrochen, dass er glaubte, gleich dort auf dem Betonfußboden sterben zu müssen.
In den Wochen nach dem Begräbnis hatte er dort Trost gesucht, wo ihn ein Mann ohne Familie und mit wenigen Freunden finden konnte. In der Flasche. Früher war Alkohol für ihn eine Form der sozialen Entspannung gewesen. Ein Bier nach der Arbeit, ein Glas Wein mit Frida, nachdem Anine eingeschlafen war, ein oder zwei Drinks mit Kollegen am Abend, wenn sie beruflich in der Stadt unterwegs waren.
Doch nach der Beerdigung hatte er die betäubende Wirkung des Alkohols ganz bewusst gewählt. In den ersten Wochen hatte er ihm nach Feierabend und an den Wochenenden Gesellschaft geleistet. Nachts träumte Bogart Bull von einem gelben Wagen – oder dem, was einst ein gelber Wagen gewesen war, ein qualmendes Inferno aus zerschmettertem Stahl, zerbrochenem Glas, ausgelaufenem Öl und …
Nach einer Weile hatte er immer mehr getrunken, auch nachts, um die Alpträume auf Distanz zu halten. Im Büro fand er ständig neue Ausreden, um nicht an Besprechungen teilnehmen zu müssen. Er wusste genau, dass der Geruch und die glänzenden Augen ihn früher oder später verraten würden. Seine Arbeitsergebnisse waren nur noch blasse Schatten früherer Leistungen. Schließlich wurde er in Eva Heibergs Büro zitiert. Der Glanz des Parketts blendete ihn. Das auf schonende Weise überbrachte Urteil war deutlich: Sein Schreibtisch würde während der Beurlaubung auf ihn warten, vorausgesetzt, er stimmte einer Entziehungskur zu. Die Kosten sollten zu Lasten der Behörde gehen.
Bull hatte erwidert, sie solle zur Hölle fahren.
Eine weniger nachsichtige Chefin hätte ihm sofort gekündigt. Doch Heiberg schluckte die Beleidigung herunter, schickte Bull nach Hause und überlegte ein paar Minuten, bevor sie zum Telefonhörer griff.
Zwei Tage später stand Bulls Vater, der Kunstmaler Thomas Bull, vor der Tür seines Sohnes. Ein höchst überraschter und stark betrunkener Bogart ließ ihn ein. Sie hockten im Wohnzimmer und starrten einander an. Keiner sagte ein Wort. Thomas Bull sah die leeren Wodkaflaschen auf der Fensterbank hinter dem Sofa. Er sah das frisch Erbrochene auf dem Fußboden vor der Terrassentür. Er sah das Fotoalbum auf dem Tisch. Und er sah den grenzenlosen Schmerz im aufgedunsenen Gesicht seines Sohnes. Dann ergriff er das Wort.
»Sie waren so stolz auf dich, Bogart, besonders Anine. Frida und sie sind jetzt nicht mehr da, aber sie leben in denen weiter, die sie geliebt haben. In uns. Sieh mich an, mein Junge! Sieh mich an und sag mir, dass du ihr Andenken beschmutzen willst, indem du dich selbst zugrunde richtest. In deinem eigenen Dreck, ohne Würde, ohne Arbeit, ohne Zukunft. Sag es mir, aber vergiss nicht, dass Anine und Frida dich auch hören werden.«
Bogart hob den Blick und sah seinen Vater fragend an, als hätte er ihn erst in diesem Moment wahrgenommen. Der Alte beugte sich vor und legte die Hand seines Sohnes in seine Hände. Die leise, intensive Stimme schien aus Bogarts eigenem Inneren zu kommen:
»Genau das hat er sich gewünscht, Bogart. Willst du dieses Schwein etwa gewinnen lassen?«
Er wurde in einer Klinik in Vestfold untergebracht. Während ehemalige Alkoholiker mit Therapeutenurkunde über Sucht und Abhängigkeit schwadronierten, bekam er langsam wieder einen klaren Kopf. Alkoholismus sei von einem Genfehler verursacht, es handele sich um eine Art Hirnschaden, wurde von fachlicher Seite behauptet. Bull explodierte und beleidigte den Therapeuten auf schärfste, gnadenlos in seiner Kritik an dem Mann und dessen eigenen Genen.
Die Ärzte ignorierten die Episode, vermutlich weil sie Bulls Vorgeschichte kannten. Sorgfältig vermied er die Gemeinschaftsräume an den Abenden, wies alle Kontaktversuche von Mitpatienten ab und begab sich auf lange Wanderungen durch die Wälder der Klinik. Abends las er, ein Foto seiner Tochter diente als Lesezeichen. Nach fünf langen Wochen durchschritt Bull die Pforten der Klinik in die andere Richtung. Noch immer galt er als Alkoholiker, allerdings mit dem zweifelhaften Vermerk »trocken«.
Die Alpträume mit dem gelben Wagen ließen langsam nach, wichen anderen Träumen, in denen meist Frida auftauchte. Einige waren sexuell gefärbt, und immer, wenn er aus ihnen erwachte, versuchte er im Halbschlaf wieder in Fridas Umarmung zu gleiten. Vergeblich. In einem anderen, häufig wiederkehrenden Traum streiften sie Hand in Hand durch eine surrealistische Stadtlandschaft – mit überfüllten Straßen und einer Architektur, die von einem Gaudí auf LSD zu stammen schien. Die Menschenmenge um sie herum nahm zu, das Gedränge verdichtete sich, bis er schließlich gezwungen war, Fridas Hand loszulassen, und seine Frau in der Menge verschwinden sah wie eine Schiffbrüchige auf offener See. Er hasste diese Träume fast ebenso sehr wie die Alpträume, weil sie nur eine grausame Deutung zuließen: Er hatte es nicht geschafft, sie zu beschützen.
Nach zwei Monaten war er zurück in seinem Job. Mit ein paar rühmlichen Ausnahmen teilten sich die Kollegen in zwei Gruppen: die übertrieben Freundlichen und Verständnisvollen und diejenigen, die ihm aus sicherer Distanz mitleidige Blicke zuwarfen. Er hätte mit dieser Entfremdung leben können. Viel schlimmer hingegen war, dass die wichtigen Fälle auf anderen Schreibtischen landeten; als hätte der Alkohol Bulls Sinne für immer stumpf gemacht. Er sprach Heiberg darauf an. Sie hörte ihm zu, hielt aber daran fest, dass er noch Zeit brauche – wie ein Sportler nach einem Comeback, lautete die zweifelhafte Metapher.
Bull war gänzlich anderer Meinung. Wenn es etwas gab, das er nicht brauchte, so war das Zeit. Er brauchte Herausforderungen. Aufgaben, die so interessant und kräftezehrend waren, dass keine Zeit mehr blieb, um an das Schreckliche zu denken.
In einer kurzen Phase des Beleidigtseins erwog er, seinen Job aufzugeben. Sich vielleicht als Privatdetektiv niederzulassen. Doch nach kurzer Selbstprüfung ließ er den Gedanken fallen. Privatdetektiv war ein einsamer Beruf, und Bull war einsam genug. Genau deswegen saß er jetzt immer noch an seinem Schreibtisch, sechs Monate und sechzehn Tage später, verwitwet und kinderlos. Aber Vater war er weiterhin. Man hört niemals auf, Vater zu sein.
Es klopfte an seiner Bürotür, und Miriam, eine der Sachbearbeiterinnen, schaute herein.
»Heiberg will mit dir sprechen«, sagte sie.
Ehemals Polizeipräsidentin in einem mittelgroßen Distrikt des Landes, war Eva Heiberg zu ihrem eigenen Erstaunen zur Kripo-Chefin in Oslo ernannt worden. Selbst jetzt noch, vierzehn Monate und viele lobende Worte später, überlegte sie manchmal, ob die Behörde andere Voraussetzungen als fachliche Qualifikation zugrunde gelegt hatte. Ihr Geschlecht zum Beispiel. In solchen Momenten half es, eine naturbegabte Pragmatikerin zu sein. Es war ihr egal.
Heiberg konnte Bull durchaus etwas abgewinnen. Der Mann hatte eine derart scharfe Zunge, dass manche nach einem Gespräch mit ihm wie blutüberströmt erschienen, doch nur selten oder nie sagte er etwas Unbedachtes. Außerdem war er integer. Er hatte sie als neue Chefin akzeptiert, ohne die geringste Missbilligung über ihre Ernennung und gleichzeitig auch ohne irgendein Anzeichen, sich bei ihr einschmeicheln zu wollen. Er war schlichtweg ein konzentrierter und tüchtiger Ermittler, der seine Arbeit erledigte, ohne nach Pfosten Ausschau zu halten, die er anpinkeln konnte, wenn er die Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert hatte.
Heiberg konnte nicht umhin, festzustellen, dass die Tragödie vor anderthalb Jahren ihre Sympathien für ihn verstärkt hatte.
Fünf Jahre zuvor, als Bull dem Abschnitt für Gewaltverbrechen bei der Osloer Polizei angehört hatte, war er als Leiter einer Ermittlung tätig gewesen, die zur Festnahme von Richard Torp führte, einem 19-jährigen Jüngling aus besten Verhältnissen, der drei brutale Vergewaltigungen auf dem Gewissen hatte. Alle Opfer waren jünger als Torp, und eines der Mädchen hatte die Misshandlungen nur mit knapper Not überlebt. Nicht nur sein jugendliches Alter war die Ursache dafür, dass Torp sich in der Kategorie »wiederholt gewalttätige Sexualverbrecher« besonders hervorhob. Der junge Mann kam aus einer profilierten Familie aus dem Osloer Westen, die seit drei Generationen steinreich war, und dementsprechend bauschte sich der Prozess zu einem Skandal titanischen Ausmaßes auf, in dem ein pikantes Detail nach dem anderen ans Licht kam. Ein emotional vernachlässigter Bursche aus reichem Elternhaus, mit einem alleinerziehenden Vater, der seinen Sohn in gleichem Maß mit Statussymbolen wie knallharten körperlichen Züchtigungen bedacht hatte. Die Verteidigerin bemühte sich erfolgreich, die spezifischen sozialen Umstände, unter denen ihr Mandant herangewachsen war, und den daraus resultierenden Missbrauch von stimulierenden sowie sedierenden Rauschmitteln ins Feld zu führen. Richards Vater, der Reeder und Finanzmagnat Hermann Torp, wurde so nachhaltig von seinem hohen Ross gestoßen, dass nur noch ein paar silbergraue Haarsträhnen aus dem Dreck hervorlugten, als alles vorbei war.
Das Gerichtsurteil von sechs Jahren Haft läutete den Beginn von Richard Torps Alptraum ein. Im Gefängnis Ullersmo war das junge, hübsche Papasöhnchen mit seinen drei Vergewaltigungen auf dem Kerbholz eine Delikatesse. Im Laufe eines Tages avancierte Richard zur Knasthure Nummer eins, und als er nach dreieinhalb Jahren entlassen wurde, waren die psychischen Schäden nicht mehr zu heilen. Vor den Gefängnismauern gab es nichts und niemanden, der auf ihn wartete. Nachdem der Vater sorgfältig alle erbrechtlichen Ansprüche seines Sohnes beschnitten hatte, war er mit seinem Vermögen zu einem unbekannten Ort im Ausland aufgebrochen. Richards Mutter hatte schon Mitte der neunziger Jahre den Kampf gegen den Krebs verloren, lange bevor der Junge das schulpflichtige Alter erreicht hatte. Seine ehemaligen Kumpane wandten dem freigelassenen Freund den Rücken zu.
Richard Torp hatte nicht nur eine Strafe abgebüßt, er war für immer verurteilt.
Die Feuerwehrleute, die ihn in Steinssletta aus dem Wrack seines Leihwagens schnitten, hatten erschrocken feststellen müssen, dass der kaum noch intakte Körper immer noch einen Puls fühlen ließ. Die behelmten Hilfskräfte flüsterten einander zu, dass ein Volvo eben ein Volvo sei, sie selbst es aber vorgezogen hätten, zu sterben. Sechs Monate später war es ein Beatmungsgerät, das Richard Torp am Leben erhielt.
Am Tag nach dem Unglück war im Kripogebäude in der Brynsallee ein Einschreiben für Bull angekommen. Der Text war schmerzhaft kurz und präzise, wie eine Strophe in einem makabren Gedicht:
Du hast mein Leben zerstört.
Jetzt habe ich deins zerstört.
R. T.
So sieht grenzenlose Trauer aus, dachte Eva Heiberg und musterte die Gestalt im Sessel vor sich. Ein etwas mehr als mittelgroßer Mann Anfang vierzig. Blaugraue Augen, die in dem glattrasierten Gesicht merkwürdig alt wirkten. Das dunkle Haar war kurz geschnitten und zeigte graue Strähnen an den Schläfen. Die Nase war kräftig und gebogen wie bei einem Indianer, mit einer nicht zu übersehenden Narbe auf dem linken Nasenflügel. Bull saß zurückgelehnt im Sessel, abwartend, und hielt die Hände locker im Schoß gefaltet. Für einen kurzen Moment ließ Heiberg den Blick auf dem Ehering ruhen, den er immer noch an der rechten Hand trug.
»Sie schauen gut aus, Bogart«, sagte sie aufrichtig.
Er lächelte schwach, sagte aber nichts.
»Wie fühlen Sie sich?«
»Wie ein ausgemusterter Fußballspieler, der sich noch gut an die Zeiten erinnert, als er unbestritten einen Platz in der Mannschaft hatte.«
Heiberg wich seinem Blick nicht aus.
»Fußball gehört nicht zu meinen Interessengebieten, aber ich glaube, mal gehört zu haben, dass Spieler manchmal an andere Mannschaften ausgeliehen werden?«
»Die in der Regel in einer untergeordneten Liga spielen«, sagte Bull.
»Nicht in diesem Fall.«
Er richtete sich kaum merklich auf. Heiberg nahm ein Schreiben vom Tisch und hielt es sich vors Gesicht.
»Das hier kam vor ein paar Tagen von Europol in den Niederlanden. Nicht zu verwechseln mit Liverpool in England. Sie kennen die Organisation. Die Mitgliedsländer hatten eine Vorstandssitzung und haben sich die Köpfe heiß gedacht. Kurz gesagt geht es dabei um Folgendes: Offene Grenzen, freier Zuzug von Arbeitskräften sowie mehr Freizeit und geringere Reisekosten lassen die Menschen häufiger als früher umherziehen. Das wiederum führt dazu, dass eine immer größer werdende Zahl von Mordopfern in einem anderen Land beheimatet ist als dem, in dem der Mord begangen wurde. Beispielsweise werden jedes Jahr zwei bis drei norwegische Staatsbürger außerhalb des Landes getötet, aber innerhalb der EU-Grenzen. Länder wie Spanien, Deutschland oder Frankreich weisen vermutlich noch höhere Zahlen auf. In vielen dieser Fälle benötigt die nationale Kriminalpolizei Unterstützung durch Vertreter der Polizeibehörden im Heimatland des Mordopfers, und das auch in Form von physischer Anwesenheit während der Ermittlungen. Bis jetzt wurde diese Hilfe nach Bedarf und vorhandenen Kapazitäten auf improvisierte Art geleistet. Die hohen Herren im Vorstand von Europol möchten diese Verfahrensweise systematisieren. Dieser Plan mündet nun in eine Direktive, die besagt, dass jedes Mitgliedsland einen oder mehrere Ermittler zu diesem Zweck abkommandieren soll. Norwegen ist formal betrachtet nicht verpflichtet, an dieser Maßnahme teilzunehmen, aber der Justizminister hat uns zum Mitmachen angewiesen. Die Anzahl der Ermittler soll proportional zur aktuellen Einwohnerzahl jedes Landes bestimmt werden. In diesem Fall: ein erfahrener und dynamischer Polizeibeamter.«
Heiberg beendete ihren Monolog und betrachtete Bulls Gesichtsausdruck. Der war nicht allzu leicht zu deuten.
»Wenn ich Sie nicht missverstehe, betrachten Sie mich also als dynamisch?«
Heiberg beherrschte sich mühsam.
»Schon lange bevor ich meinen Fuß in dieses Gebäude gesetzt habe, hatte ich großen Respekt für Sie als Fachmann«, sagte sie langsam. »Jeder, dem es so ergangen ist wie Ihnen, wird für längere oder kürzere Zeit davon geprägt sein. Jetzt kommt es darauf an, ob Sie für anspruchsvolle Aufgaben bereit sind. Abgesehen von Ihren fachlichen Qualifikationen ist es außerdem von Vorteil, dass Sie gut Englisch sprechen. Wie ein Eingeborener, so hat sich jedenfalls Eriksen ausgedrückt.«
Heiberg machte eine Pause und trank einen Schluck ihres lauwarmen Kaffees. Dann sah sie ihn wieder an.
»Woran liegt das übrigens?«
»Woran liegt was?«
»Dass Sie Englisch wie ein Eingeborener sprechen.«
»Meine Mutter war Irin. Sie starb, als ich noch ganz klein war. Aber ich habe die meisten Sommerferien bei meinen Großeltern in der Nähe von Belfast verbracht.«
Heiberg nickte. Etwas an seinem Ausdruck gab ihr das Gefühl, dass er sich mit Freude an diese Besuche erinnerte.
»Und was soll ich Ihrer Meinung nach in den Zeiten tun, in denen da draußen mal gerade kein Bedarf nach mir besteht?«, sagte Bull. »Ist ja schon etwas morbid, am Schreibtisch zu sitzen und darauf zu hoffen, dass ein Landsmann irgendwo auf dem Kontinent ins Gras beißt.«
»Sie werden hier in der Abteilung operativ tätig sein, allerdings nicht als Ermittlungsleiter. Sinn und Zweck soll ja sein, dass Sie kurzfristig losgeschickt werden können, ohne dass wir im Rahmen eines laufenden Falls Änderungen an der Personalbesetzung vornehmen müssen. Oslo bleibt also Ihre Basis, aber Sie müssen natürlich mit einer gewissen Reisetätigkeit rechnen.«
»Gewiss. Da passt es ja gut, dass ich keine … Familie habe.«
Heibergs Kaffeetasse stoppte auf halbem Weg zum Mund. Dann setzte sie sie langsam ab und beugte sich über den Schreibtisch.
»Hören Sie zu, Kriminalermittler Bull. Ich habe versucht, Ihnen in einer schwierigen Zeit den Rücken zu stärken. Das ist nicht immer leicht gewesen. Hier gibt es so einige, die meinen, Sie seien fertig; dass Sie zu einer Behörde mit weniger anspruchsvollem Mandat als dem unseren versetzt werden sollten oder dass man Ihnen alternativ ein hübsches Abschiedspaket schnürt. Das mindeste, was Sie als Ausgleich für meine Bemühungen tun könnten, ist, sich wie ein normaler Mensch zu benehmen. Mit anderen Worten: Hören Sie auf, in Zweifel zu ziehen, dass ich Sie tatsächlich für den richtigen Mann für so einen Job halte.«
»Und wenn ich ablehne?«
»Das betrachte ich als eine rein hypothetische Möglichkeit. Sie können ein paar Tage darüber nachdenken. Den Haag erwartet ein hohes Tempo bei der Implementierung dieses Projekts. Sollten Sie ablehnen, muss ich jemand anderen fragen.«
Heiberg warf einen Blick auf ihren Terminkalender.
»Sie haben vier Tage. Wir sehen uns am Freitag um neun wieder, hier in meinem Büro.«
4
Østre Gravlund Friedhof/Kripo-Hauptquartier Oslo
Freitagmorgen, 25. April 2014
In Norwegen gibt es Friedhöfe, die idyllischer gelegen sind als der Østre Gravlund, der halbwegs zwischen der E6 und dem verkehrsreichen Tvetenvei eingeklemmt ist. Zwar schützen die Bäume ein wenig vor Lärm und Wind, doch im Winter wird der Schnee von den Abgasen grau gefärbt, und die Besucher bewegen sich eilig zwischen rauhreifüberzogenen Grabsteinen und warmen Autos, die auf dem Parkplatz warten.
Bull kam immer zu Fuß. Und immer früh am Morgen, bevor er zur Arbeit ging. Das Reihenhaus im Prost Hallingsvei, der Friedhof und das Gebäude der Kripo bildeten auf der Karte ein Dreieck, dessen Ecken nur wenige Minuten Fußweg miteinander verband. Bulls heilige Dreieinigkeit – Haus, Grab, Büro.
Sechs Monate und zwanzig Tage. Bald kam der Mai. Der erste Frühling ohne sie. Der erste Frühling in einem zerstörten Leben, ein Leben, das sich vielleicht – aber nur vielleicht – irgendwann reparieren ließ. Zumindest so, dass es lebbar wurde. Wie immer, wenn Bull vor dem schwarzen, glatt polierten Grabstein stand, stellte er sich seinen eigenen Namen unter den beiden anderen in den Granit gemeißelt vor. Eines Tages würde es so sein. Der Gedanke war beruhigend, ja fast erheiternd.
Um diese Tageszeit waren nur selten andere Menschen auf dem Friedhof anzutreffen, ein Umstand, der es Bull erlaubte, laut zu seinen Liebsten zu sprechen. Er erzählte ihnen, dass er sich entschieden habe, den Job anzunehmen. Dass er sie deswegen nicht wie sonst jeden Tag besuchen könne, aber so oft vorbeischauen werde, wie es ihm möglich sei. Dass er Heiberg verdächtige, ihm die Aufgabe in erster Line angeboten zu haben, um sich des Problems Bull zu entledigen. Er erzählte ihnen, wie schrecklich er sie vermisse, aber dennoch hoffe, dass die neue Arbeit so sinnvoll sei, dass es sich wieder lohne, auf Erden allein herumzuwandeln.
Dann schaute er zum Himmel hinauf, schloss die Augen und lauschte. Er war sich nicht sicher, glaubte aber zu hören, dass sie seine Entscheidung begrüßten.
»Das freut mich zu hören, Bogart.«
Heiberg sah aufrichtig froh aus. Oder vielleicht ist sie erleichtert, dachte Bull. Erleichtert darüber, seine mögliche Weigerung nicht mit dem Bescheid kontern zu müssen, dass er in der Behörde Geschichte war. Doch streng genommen war das bedeutungslos. Die Entscheidung war gefallen, er hatte den Job übernommen. Jetzt lautete die Frage, wie lange es wohl dauern würde, bis das Schicksal ihn in die Ferne rief.
Es dauerte etwa fünf Sekunden.
»Wenn es nicht taktlos wäre, könnte ich vielleicht ›des einen Tod, des anderen Brot‹ sagen«, begann Heiberg. »Jedenfalls ist es Fakt, dass uns Ihr erster Fall schon vor diesem Treffen erreicht hat. Frankreich, genauer gesagt Sainte-Maxime, ein Küstenort auf der Strecke zwischen Nizza und Toulon. Waren Sie schon mal in der Gegend?«
Bull schüttelte den Kopf. Anfang der neunziger Jahre hatte er während einer Interrail-Tour große Teile Frankreichs verschlafen, ansonsten gab es da nichts. Frida und Annie hatten die griechischen Inseln vorgezogen.
»Übrigens ein ziemlich pikanter Fall, aus mehreren Gründen«, fuhr Heiberg ungeachtet Bulls mangelnder Frankophilie fort. »Sagt Ihnen der Name Axel Krogh etwas?«
»Nicht direkt.«
»Krogh war einer dieser Schattenmänner des norwegischen Wirtschaftslebens. Er rangierte ziemlich weit oben auf der Liste der Reichsten im Land, gab in den Medien allerdings ein unauffälliges Profil ab. Mittwochabend wurde er in seinem Haus in Sainte-Maxime ermordet aufgefunden. Wie gesagt ist die Sache aus mehreren Gründen etwas pikant. Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten, und anscheinend wurde die Leiche auch geschändet, ohne dass Details aus dem Bericht hervorgehen. Wir reden hier mit anderen Worten also nicht von irgendeiner Straßenschlägerei mit Todesfolge. Kroghs Tochter hat ihn gefunden. Sie war da unten mit ihrem Ehemann und einem anderen Paar zu Besuch, Cathrine und Erik Jacobsen. Letzterer ist anscheinend so eine Art Stellvertreter im Kroghschen Imperium.«
Heiberg betrachtete Bull, während sie weiterredete. Sein Blick schien sich im Takt mit ihren Worten zu klären. Sein Nacken streckte sich. Eine winzige Drehung des Kopfes, als hörte er auf einem Ohr besser als auf dem anderen. Bin ich hier etwa Zeugin einer Auferstehung?, dachte sie. In der Klinik in Vestfold war er dem Alkoholnebel entstiegen. Hier und jetzt, in ihrem Büro, wurde womöglich der letzte Schleier weggezogen.
»Heiberg?«
»Was?«, erwiderte sie verwirrt und begriff, dass er ihr eine Frage gestellt hatte.
»Stehen in dem Bericht irgendwelche Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin?«
»Wie beispielsweise?«
»Inwieweit die erwähnten Schändungen vor oder nach Eintreffen des Todes vorgenommen wurden.«
Sie musste auf ihren Computerbildschirm schauen.
»Nein, aber hier steht, dass der Mord geschehen sein muss, kurz bevor die Tochter ihn gefunden hat. Das war ein paar Minuten nach halb zwölf, am Mittwochabend. Die Leiche wurde zur Obduktion gebracht. Spielt das eine Rolle, das mit der Reihenfolge?«
Bull zögerte seine Antwort hinaus.
»Wenn das vor der Ermordung geschehen ist, kann das auf Sadismus oder ein krankes Hirn hinweisen«, sagte er. »Wurde es danach getan, können wir hier vermutlich von einer Symbolhandlung des Täters reden.«
Heiberg nickte stumm. Sadismus und Leichenschändung waren in dem Polizeidistrikt, aus dem sie kam, keine vordringlichen Probleme gewesen.
»Eine Sache ist allerdings bemerkenswert«, sagte sie und blickte weiter auf den Bildschirm.
Bull wartete auf die Fortsetzung.
»Obwohl laut Aussage der Tochter jede Menge wertvolle Kunst an den Wänden hing, ist nur ein einziges Bild aus Kroghs Arbeitszimmer verschwunden. Ein kleines Ölgemälde eines unbekannten Künstlers.«
5
Lyon, Bahnhof
Donnerstagvormittag, 29. März 1906
Henri Matisse warf einen ratlosen Blick auf seinen norwegischen Malerfreund. Wann hatte er zuletzt einen derart betrunkenen Menschen erlebt? Edvard Munch war sternhagelvoll, obwohl die Uhr noch nicht einmal zwölf geschlagen hatte. Wenn der Mann jetzt noch mehr in sich hineinschüttete, müsste Matisse erwägen, ihn auf seinem Stuhl festzubinden.
Er blickte umher. Gott sei Dank war der Speisewagen fast menschenleer. Die einzigen Gäste außer ihm und Munch waren zwei ältere Herren, die am entgegengesetzten Ende des Waggons saßen und Karten spielten. Gab es in dieser Welt tatsächlich ein zivilisiertes Kartenspiel, das zu zweit gespielt werden konnte?
Und wo blieben eigentlich André und die anderen? Die törichten Abenteurer hatten während des kurzen Aufenthalts in Lyon den Zug verlassen, um einen Blick auf die neu erbaute Basilika auf den Fourvière-Höhen zu werfen. Matisse sah auf seine Taschenuhr. Noch drei Minuten bis zur Abfahrt. Mon dieu! Der Gedanke, nun die ganze Strecke bis hinunter nach Rognac allein mit Munch verbringen zu müssen, war alles andere als erheiternd. Der Norweger war trübsinnig und sagte nicht viel, außer wenn er angesprochen wurde oder sein Glas aufgefüllt haben wollte.
Einige Jahre zuvor hatten die Gerüchte Paris im Eiltempo erreicht. Eine Frau und ein Revolverschuss in Munchs Sommerresidenz. Ob sie geschossen hatte oder ob Munch den Schuss abgegeben und sich dabei die Hand verletzt hatte, blieb ungeklärt. Eines allerdings war sicher: Matisse hatte nicht die Absicht, die Hauptperson des Dramas über die Geschehnisse auszufragen. Ein Mann durfte seine crimes passionnels durchaus für sich behalten. Matisse hatte selbst erfahren, dass die Wege der Liebe dornenreich sein konnten, insbesondere dann, wenn die beteiligte Frau sowohl hübsch als auch intelligent war.
Missmutig starrte Munch in sein leeres Absinthglas. Dann hob er den Kopf und richtete den verschleierten Blick auf seinen Begleiter.
»Was sagen Sie, mein lieber Matisse? Wollen wir uns noch eine kleine Erfrischung gönnen?«
Matisse lächelte tapfer. Am liebsten hätte er Munch vorgeschlagen, sich in sein Coupé zurückzuziehen und den Rausch auszuschlafen, doch da stieß seine Freimütigkeit auf eine Grenze. Er winkte den Kellner heran.
»Oui, Monsieur?«
»Dürften wir wohl noch um eine Runde bitten? Vielen Dank.«
Der Kellner sah Munch mit reserviertem Ausdruck an.
»Sie wissen schon, mon ami, so eine Runde«, sagte Matisse und ließ den Kellner einen kurzen Blick auf den Zehn-Franc-Schein werfen, den er in der Hand hielt.
»Aber natürlich, Monsieur.«
Der Kellner verbeugte sich, während der Schein diskret den Besitzer wechselte. Matisse missbilligte diese Art vulgärer Tricks, doch es galt, den Norweger bei Laune zu halten. Der diesjährige Salon des Indépendants war ein unerhörter Erfolg gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Zum ersten Mal hatte das Publikum eine gemeinsame Ausstellung fauvistischer Künstler bestaunen können, und die Reaktion war überwältigend gewesen. Fast siebentausend Besucher, und Verkäufe, von denen keiner zu träumen gewagt hatte.
Der andere geistige Anführer des Fauvismus, André Derain, war milde ausgedrückt skeptisch gewesen angesichts der Idee, Munch für eine gemeinsame Ausstellung mit den anderen einzuladen. Die Idee sollte zu einem Triumphzug werden – dem endgültigen Durchbruch für die farbenfrohe moderne Kunst. Matisse hatte zwei Wochen benötigt, um den Kollegen zu überreden. Als der schließlich einwilligte, hatte Matisse sich hingesetzt und einen langen Brief an Munch geschrieben, der sich zu dieser Zeit in Deutschland aufhielt. Er hatte sein Ansinnen mit wohldosierten Schmeicheleien sowie mit der Versicherung gewürzt, dass Munchs Ausgaben allesamt gedeckt würden.
Zu seiner großen Freude – und Überraschung, wie er einräumen musste – hatte Munch das Angebot angenommen.
In gewisser Weise hatten sich Derains bange Vorahnungen bestätigt. Das Publikum hatte sich um die fünf Arbeiten des Norwegers geschart, und besonders »Roter wilder Wein« hatte Bewunderung und lautstarke Diskussionen ausgelöst. Matisse konnte ihnen nichts vorwerfen. Das Bild strahlte unterschwellig eine Dramatik aus. Eine regelrechte Machtdemonstration, was Motiv, Farben und Pinselführung betraf. Das Werk war von einem Genie ersonnen und ausgeführt worden, das Matisses Genialität vermutlich überragte.
Direkt nach der Ausstellung hatten sie Munch eine weitere Einladung überreicht. André Derain hatte vor kurzem von seinen Großeltern ein Haus in Cotignac geerbt, und sechs der Fauvisten planten daraufhin einen mehrwöchigen Aufenthalt unter der südfranzösischen Frühlingssonne, um »die freudigen Ereignisse zu verdauen«, wie Matisse es formuliert hatte. Und für die eine oder andere Flasche sowie eine Kostprobe der provenzalischen Küche sollte es auch wohl reichen. Ob Munch sich wohl vorstellen könnte, sie auch bei dieser Gelegenheit mit seiner Anwesenheit zu beehren? Ihm würde ein eigenes Haus zur Verfügung stehen, und das Licht in Cotignac böte nahezu optimale Arbeitsverhältnisse für einen gottbegnadeten Maler.
Munch, der seit seiner Ankunft in Paris kaum einen nüchternen Moment erlebt hatte, sagte auf der Stelle zu.
Hier also saßen sie nun, in einem Zug, der von Paris gen Süden fuhr: Munch, mit stetig steigendem Alkoholspiegel, und Matisse, inständig in der Hoffnung, dass die anderen den Zug auch rechtzeitig erreichten. Die Trillerpfeife des Schaffners auf dem Bahnsteig war nicht zu überhören. Merde! Sekunden später setzte sich der Zug mit einem Ruck in Bewegung, und Matisse lehnte sich erschöpft zurück. Sechs Stunden als einsamer Cicerone für einen beinahe psychotischen Norweger. Möge der Teufel Pétanque spielen mit Derains aufgeblähten Testikeln!