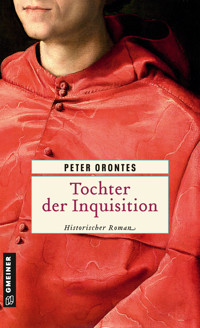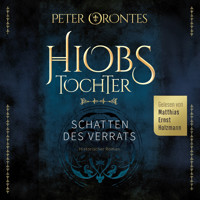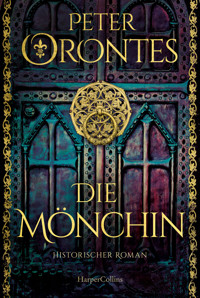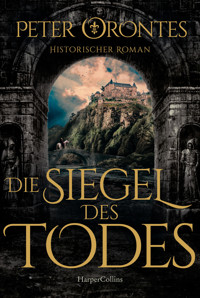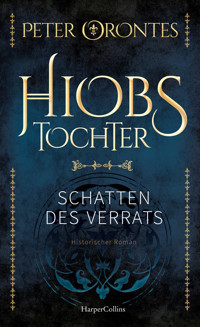
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deggenfeld im Jahre 1338. Die junge Miriam, eine ausgebildete Medica und Jüdin, stürzt in ein Netz aus Intrigen und Gefahr, als sie zufällig eine Verschwörung belauscht. Im Schatten wachsender Spannungen und angesichts einer drohenden Attacke auf die jüdische Gemeinde, muss Miriam Mut, Klugheit und Tatkraft beweisen, um ihre Liebsten zu beschützen und Gerechtigkeit zu suchen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn Miriams eigenes Leben und dass ihrer Tochter Rebecca ist, eng mit der Verschwörung verknüpft. Und auch wenn Miriam als Ärztin einiges an Ansehen genießt und so an manche Information gelangt, bleiben ihr als Frau und Jüdin viele Privilegien verwehrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Deggenfeld im Jahre 1338. Die junge Miriam, eine ausgebildete Medica und Jüdin, stürzt in ein Netz aus Intrigen und Gefahr, als sie zufällig eine Verschwörung belauscht. Im Schatten wachsender Spannungen und angesichts einer drohenden Attacke auf die jüdische Gemeinde, muss Miriam Mut, Klugheit und Tatkraft beweisen, um ihre Liebsten zu beschützen und Gerechtigkeit zu suchen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn Miriams eigenes Leben und dass ihrer Tochter Rebecca ist, eng mit der Verschwörung verknüpft. Und auch wenn Miriam als Ärztin einiges an Ansehen genießt und so an manche Information gelangt, bleiben ihr als Frau und Jüdin viele Privilegien verwehrt.
Zum Autor
Peter Orontes kam in Venezuela zur Welt. Er wuchs als Sohn eines Ungarn und einer Ostpreußin am Bodensee auf, studierte Kommunikationsdesign und arbeitete als Art Director für verschiedenen Medien- und Werbeagenturen. Seit über zwanzig Jahren ist er als freier Kommunikationsdesigner tätig und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Augsburg.
Peter Orontes
Hiobs Tochter
Teil 1 • Schatten des Verrats
Historischer Roman
HarperCollins
Deutsche Erstausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
© Peter Orontes, 2025.
Covergestaltung von Guter Punkt | Agentur für Gestaltung
Coverabbildung von Rawpixel.com / AdobeStock, Antonel / iStock/ Getty Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN9783749909759
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Urhebers und des Verlags bleiben davon unberührt.
Prolog
Dienstag, 28. Mai 1325Krakow am See • Fürstentum Werle-Güstrow
Der Tod würde furchtbar werden, und doch sehnte sie sich nach ihm wie ein Vogel im Käfig nach der Weite des Himmels.
Die Beine angezogen, den Rücken an den Bretterverschlag des Schweinekobens gelehnt und die gefesselten Hände auf die Knie gestützt, kauerte Miriam bat Nathan, Tochter des Arztes Nathan ben Joseph, erschöpft und tränenleer auf dem kotverschmutzten Lehmboden und wartete ungeduldig darauf, dass die Sonne endlich aufging. Der graue Schimmer, der in den stinkenden Koben sickerte, signalisierte ihr, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Die Morgendämmerung schickte sich an, das nächtliche Schwarz zu vertreiben, das wie zähes Pech in den Ritzen des Verschlags klebte. Der Zeitpunkt der Hinrichtung rückte näher.
Trotzdem wünschte sie sich, es möge schneller gehen. Hätte sie doch nur die Macht, den Lauf der Sonne zu beschleunigen. Bei dem Gedanken stahl sich ein schmerzlich ironisches Lächeln in die Mundwinkel der jungen Frau. Nur einmal seit Erschaffung der Welt war es einem Menschen vergönnt gewesen, in die Abläufe des Himmels einzugreifen. Josua, einer der Vorväter ihres Volkes, hatte bei einer Schlacht gegen die Könige der Amoriter die Sonne und den Mond für eine Weile stillstehen lassen. Seitdem war solches nie wieder geschehen. Folgte der Lauf der Gestirne doch jenem ehernen, für alle Zeiten gültigen Gesetz, das den Rhythmus von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis bestimmte. Festgeschrieben und überwacht von dem Einen, Ewigen, den man Adonai, El Schaddai oder auch nur Haschem nannte, weil sein eigentlicher Name zu heilig war, als dass man ihn hätte aussprechen dürfen. Demjenigen, der in seinem unergründlichen Ratsschluss zuließ, dass sein auserwähltes Volk seit Jahrhunderten verfolgt, geschändet und massakriert wurde. Dem Herrn über Leben und Tod. Dem Gebieter über die Zeit.
Miriam versuchte, sich gegen die Verzweiflung aufzubäumen, die wie eine Sturzsee über sie hinwegrollte. Ihre Hände verkrampften sich so sehr, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten und die Nägel sich in die Handflächen bohrten. Sie hoffte inständig darauf, dass man sie endlich abholte. Darauf, dass endlich alles vorbei wäre. Einige, die die Wut des hasserfüllten Mobs überlebt hatten, würden bei Sonnenaufgang auf einem Berg bei Krakow gerädert, sie selbst zusammen mit anderen in die mannshohe, mit Holzscheiten und pechgetränktem Reisig gefüllte Grube geworfen werden.
Gestern Abend, nachdem die Horden Herzog Johanns II., genannt der Kahle, Herr zu Werle-Güstrow, im jüdischen Viertel der Stadt über Stunden hinweg gewütet, gemordet und gebrandschatzt hatten, war sie mit anderen Überlebenden in ein nahe gelegenes Dorf verschleppt worden. Hier hatte man sie auf umliegende Höfe aufgeteilt und beschlossen, sie am darauffolgenden Tag zu verbrennen. Vorher jedoch war ihnen befohlen worden, die Grube auszuheben. Ihr eigenes Grab zu schaufeln. Um so den Scheol, in den sie als lebende Fackeln hinabfahren würden, auf ihre Ankunft vorzubereiten.
Ein Schluchzen schüttelte Miriams Körper. Das Grauen der vergangenen Stunden hallte in ihr nach. Geräusche, Bilder und Gerüche waberten durch ihren Kopf. Der Anblick der ins Leere starrenden Augen ihres Vaters und ihrer Mutter, die, nur wenige Lidschläge bevor sie brachen, das Entsetzliche aufgesogen und eingefroren zu haben schienen. Der Überfall. Das Johlen des Mobs. Das Schreien und Weinen der Kinder, das Flehen der Mütter und Töchter. Die Ohnmacht und das Entsetzen, das den Vätern und Söhnen ins Gesicht geschrieben stand. Die verzweifelt hervorgestoßenen Gebete des Rabbis. Das Schlachten. Leblos daliegende Körper, zerhackte Leiber, verdrehte Glieder. Und Blut. Viel Blut! Feuer, Gestank und Qualm. Erinnerungen, die nur der Tod auszulöschen vermochte. Wie auch die Erinnerung an das, was ihr der maskierte Hüne vor wenigen Stunden angetan hatte. Mit hemmungsloser Geilheit war er über sie hergefallen, um sich an ihrem Körper zu sättigen wie ein brünstiger Stier. Wieder und wieder und wieder. Ihre Tränen, ihr Bitten und Flehen, ihr Strampeln und Schreien, Beißen und Kratzen hatten nichts gegen ihn auszurichten vermocht. Im Gegenteil, es hatte ihn noch befeuert. Mittlerweile waren Stunden vergangen, die Intervalle zwischen den Schluchzern waren immer länger und das Dunkel in ihrem Inneren immer schwärzer geworden.
Unmut wallte in Miriam auf. Sie haderte mit Gott, der das Böse zuließ, sie haderte mit den Eltern, die sich auf die Reise zu den Verwandten begeben hatten, und sie haderte mit dem Schicksal, das ausgerechnet jetzt so schrecklich zugeschlagen hatte. Doch wem half dieses Hadern? Was immer geschah, war schließlich der Wille Adonais, des Ewigen, und gegen Seinen Willen hatte sich niemand aufzulehnen.
Miriam wandte den Kopf, presste die Stirn gegen die Bretterwand und starrte durch ein Astloch auf die Wiese hinaus, die sich unmittelbar hinter dem Koben bis zum Waldrand erstreckte.
Als habe jemand mit einem Schlag unzählige winzige Lichter entzündet, drang plötzlich ein tausendfaches Funkeln in die aschefarbene Dämmerung, Tau auf der Wiese reflektierte das Licht der Sonne, die erste Strahlen über die Baumwipfel im Osten schickte. Miriam drückte die Stirn noch fester gegen das Brett. Leckte die glitzernde Pracht mit ihrem Auge auf wie ein Verdurstender einen Tropfen Wasser. Endlich! Nicht mehr lange, dann würde die rotgoldene Scheibe sich über dem Wald erheben und stetig höher steigen. Und noch bevor sie ihren Zenit erreicht und das Rotgold sich in ein gleißend helles Weißgelb gewandelt hätte, würde alles vorbei sein.
Das Kaddisch! Der Gedanke jagte einen Schrecken durch ihre malträtierten Glieder. Wer würde das Kaddisch beten? Das Gebet, das gesprochen wurde, wenn das Sterben sein Werk vollendet hatte und die Verstorbenen im Scheol angekommen waren, in der Regel während und nach einem Begräbnis. Aber immer in Gegenwart eines Minjan, der Anwesenheit von zehn Männern, die das, was der Betende vortrug, bezeugten. Die es diesmal allerdings nicht geben würde. Nicht geben konnte. Miriam beschloss, das Kaddisch selbst zu beten, es gab keine andere Möglichkeit. Adonai, der Ewige, würde in diesem Fall sicherlich eine Ausnahme machen. Miriam glaubte es aus vollem Herzen.
Sie sah nach oben, schloss die Augen und begann leise die uralten Sätze zu flüstern.
»Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschaffen, und sein Reich erstehe in eurem Leben und in euren Tagen und …«
Ein Wummern ließ sie erschrocken innehalten. Jemand hatte kräftig gegen die Bohlentür geschlagen.
Es war so weit. Miriam spürte eine heiße Welle durch ihren Leib jagen – die Aufwallung einer entsetzlichen Angst vor der zu erwartenden Pein. Sie hoffte inständig, dass der Gedanke daran nicht mit einem Mal so übermächtig wurde, dass er sie daran hinderte, den Tod als Erlöser zu begrüßen. Es machte das Sterben nur schwerer.
Erneutes Wummern. Miriam starrte die Tür an; sie spürte ihr Herz wild gegen die Rippen hämmern. Warum, um Haschems willen, schlugen sie gegen die Tür? Etwa, um sich anzumelden? Unsinn! Aber vielleicht … Nein, nein, du Närrin!, korrigierte sie sich sofort und verscheuchte den Gedanken, der in ihr aufkeimen wollte, noch bevor er zu Ende gedacht war. Es war sinnlos, Hoffnung aufkeimen zu lassen, wo es keine Hoffnung geben konnte.
»Miriam!«, wisperte eine Stimme vor der Tür. »Bist du da drin?«
Miriam erstarrte. Es dauerte einige Wimpernschläge, bis sie begriff, dass das, was sie soeben gehört hatte, nicht ihrer Einbildung entsprang. Sie glaubte sogar, die Stimme zu kennen, war sich aber nicht sicher.
»Miriam! Um des Ewigen willen antworte. Bist du da drin? Ich bin’s, Hoscha.«
Hoscha! Also doch! Er war es. Hosea ben Elieser, ihr Cousin, den alle Hoscha nannten. Der Sohn ihres Onkels Elieser ben Joseph, bei dem sie mit ihren Eltern zu Besuch gewesen war. Hoscha war Arzt. Wie sein Vater, der zusammen mit seiner Frau ebenfalls der Wut der Judenhasser zum Opfer gefallen war. Überhaupt gab es viele Ärzte unter den männlichen Mitgliedern der weitverzweigten Familien der Brüder Elieser ben Joseph und Nathan ben Joseph. Auch der Vater der beiden, Joseph ben Schallum, Miriams Großvater, war Arzt. Das letzte Mal hatte Miriam ihren Cousin vor einigen Tagen gesehen, kurz bevor er zu einer Reise aufgebrochen war, was ihm offensichtlich das Leben gerettet hatte.
»Oh Hoscha, möge Adonai dich segnen!«, rief sie mit erstickter Stimme und ließ ein lautes Schluchzen folgen.
Ein inbrünstig hervorgestoßenes »Gepriesen sei Er!« antwortete von draußen.
Miriam vernahm ein schürfendes Geräusch, dann ein hölzern hallendes Poltern. Der Balken, der die Tür verriegelt hatte, war zu Boden gefallen, was Hoscha einen ärgerlichen Ausruf entlockte. Knarzend öffnete sich die Tür. Der Schimmer der Morgendämmerung fiel in den Koben, und im Türrahmen erschien die dunkle Silhouette eines hochgewachsenen Mannes von kräftiger Statur und mit dichtem schwarzem Bart.
Mit vier, fünf Sätzen war er bei dem Schatten, den er vor der Bretterwand ausgemacht hatte. Durch die offen stehende Tür fiel so viel Licht in den Koben, dass er die Lage der jungen Frau direkt erfasste. »Du bist gefesselt?«
Er zog ein Messer aus dem Gürtel und durchschnitt die Stricke, die sich um ihre Hand- und Fußgelenke schlangen.
»Komm!«, wisperte er. Er wollte sie hochziehen, doch sie schaffte es auch ohne seine Hilfe.
»Fühlst du dich in der Lage zu reiten?«, fragte er.
Sie nickte nur, während sich ihre Augen wieder mit Tränen füllten, von denen sie geglaubt hatte, dass sie versiegt seien. Die plötzliche Veränderung der Situation hatte ihr die Sprache verschlagen.
»Dann komm. Wir müssen uns beeilen!«
Prüfend sah er sich um, als er mit ihr aus dem Koben trat. Nichts rührte sich, niemand war zu sehen. Stille erfüllte den dunstigen Morgen, sah man von vereinzelten Vogelstimmen ab, die hie und da den neuen Tag begrüßten.
Er packte sie bei der Hand und lief mit ihr über die tauglitzernde Wiese auf den Waldrand zu. Die ersten Schritte wollten nur mühsam gelingen, doch dann ging es immer besser, und so hatten sie recht schnell den Waldsaum erreicht.
Dort angekommen, verzogen sie sich tief ins Unterholz zwischen dichtes Strauchwerk, wo sie vor unerwünschten Blicken sicher waren. Heftig atmend vor Anstrengung brauchten sie eine Weile, bis sie so weit zur Ruhe kamen, dass sie sich leise flüsternd unterhalten konnten.
»Wie kommt es, dass du hier bist?«, wollte Miriam wissen. »Du warst doch auf Reisen? Wolltest du nicht erst nächste Woche zurückkommen?«
»So war es geplant, ja. Aber es kam nicht zu den Geschäften, die ich tätigen wollte. Also reiste ich früher zurück und traf gestern Abend ein. Schon in den vergangenen Tagen hörte ich, dass neue Horden von ›Judenschlägern‹ unterwegs waren, möge Haschem sie verfluchen. Als ich mich der Stadtmauer näherte, nahm ich aufrührerischen Lärm wahr; mir war sogleich klar, was geschah. Und auch, dass ich als Einzelner nichts ausrichten würde. Ich versteckte mich außerhalb der Mauern und wartete ab.«
»Woher wusstest du, wo du mich suchen musst?«
»Es war nicht schwer herauszufinden, in welche Richtung der mörderische Haufe dieses gottverfluchten Kahlkopfs zog. Ich bin ihm in sicherem Abstand gefolgt; du weißt, ich kenne mich in der Gegend aus. Ein Bauer, den ich vor Kurzem behandelt habe und der mir wohlgesonnen ist, sagte mir, er wisse, wo sich die Überlebenden befänden. Darunter sei auch eine junge Jüdin, die mit ihrer Familie hier zu Besuch gewesen sei. Mir war klar, dass mit dieser Jüdin nur du gemeint sein konntest. Ich hakte nach und erfuhr, was mit dir geschehen war und wo man dich hingebracht hatte.«
»Und nun?«
»Flieh zurück in deine Heimat nach Deggenfeld, Miriam. Ich habe für dich ein Pferd und Proviant für drei Tage besorgt. Der Rappe steht nicht weit von hier in einer verlassenen Holzerhütte. Sie liegt gut verborgen mitten im Wald. Dort habe ich auch meinen Fuchs auf die Schnelle untergebracht. Du wirst dich dort den Rest des Tages über verstecken und dich kurz vor Einbruch der Dunkelheit in Richtung Süden aufmachen. Reite, wenn möglich, die Nacht durch und mache erst am Morgen irgendwo in einem Waldstück Rast. Sieh zu, dass du den Tag über ordentlich Schlaf bekommst, und reite nachts wieder weiter. Wir haben Vollmond, das Wetter scheint gut zu werden, also dürfte es kein Problem sein. Ab dem dritten Tag kannst du wagen, tagsüber zu reisen. Dann hast du die Grenze von Werle-Güstrow hinter dir.«
Miriam hatte ihrem Vetter mit zunehmender Panik zugehört.
»Wie? Ich soll allein reisen? Bis nach Deggenfeld? Das sind fast dreißig Tagesreisen! Kommst du denn nicht mit?«
»Nein, Miriam, das kann ich nicht. Ich muss mich noch um andere aus unserer Gemeinde kümmern, die überlebt haben und der Hilfe bedürfen; sie sind alt und krank.«
Erneut stürzten Tränen aus ihren Augen. »Aber … aber … allein werde ich das nicht schaffen.«
Hoscha zog ein sauberes Tuch aus seiner Kitteltasche, tupfte ihr vorsichtig die Tränen von den Wangen und legte den Arm um ihre Schulter. »Doch, meine kleine Miriam, das wirst du«, sagte er sanft, aber bestimmt. »Du bist verständig, und du bist stark. Stärker, als du glaubst. In dreißig Tagen wirst du bei deinen Großeltern in Deggenfeld sein. Ich weiß es. Und nun lass uns zu der Holzerhütte aufbrechen.«
Kapitel 1
DREIZEHNJAHRESPÄTER – Samstag/Sonntag 29./30. August 1338Koblenz
Kapitel 1
Langsam, mit zittriger Hand griff der Sterbende in seine Wamstasche, kramte eine Gänsefeder hervor und streckte sie der Frau entgegen, die erschüttert neben ihm kniete. Der Mann mit dem blonden Haar und dem spärlichen Bartwuchs mochte nicht viel mehr als dreißig Jahre zählen. Sein blutdurchtränktes Wams zeugte von den zahlreichen Messerstichen, die ihm beigebracht worden waren, aus seinem rechten Mundwinkel sickerte Blut als dünnes Rinnsal. Die Frau – eine Medica auf der Durchreise und unterwegs zu ihrer Herberge – wusste, dass es mit ihm zu Ende ging. Sie hatte vergeblich versucht, ihm zu helfen. Obwohl er keine Silbe hervorbrachte, glaubte sie in seinen Augen eine letzte flehentliche Bitte zu lesen. Noch ein Stück höher hob er die Hand, in der er die Feder hielt. Eine wortlose Aufforderung an die Frau, sie endlich entgegenzunehmen.
Im selben Moment, als sie der Bitte nachkam, bedeutete er ihr mit der anderen Hand, ihr Ohr an seine Lippen zu legen. Es waren nur Wortfetzen, die sie verstand. Aber sie ließen sie frösteln.
»Versch… Mord … Komp… Wa… Brief … es-eiland«, röchelte er stockend, bevor sein Blick brach.
Da bemerkte die Frau einen weißen Fleck auf der rechten Wange des Mannes. Das sternenförmige Mal hatte in etwa die Größe einer Münze und wurde von dem spärlichen Bartwuchs nur unzureichend verdeckt. Erschrocken zuckte sie zurück.
»Bei Haschem! Wer … wer bist du?«, stammelte sie verstört. Kein Zweifel, sie kannte das Mal, sie musste dem Mann schon einmal begegnet sein. Wann und bei welcher Gelegenheit, wollte ihr allerdings nicht einfallen. Wie gelähmt starrte sie auf die rechte Wange des Toten. Plötzlich wurde ihr bewusst, in welch prekärer Situation sie sich befand – immerhin kniete sie mit blutigen Händen neben der Leiche eines Mannes, der gerade niedergestochen worden war.
Du musst hier weg, sieh zu, dass du hier wegkommst. Ein letzter fragender Blick in die stumpfen Augen des Verblichenen, als ob sie eine Antwort darin lesen könnte – dann sprang sie auf und sah sich gehetzt um. Längst hatte die Nacht den letzten Schimmer der Dämmerung geschluckt. Stille herrschte in der Gasse, die rechts und links von hoch aufstrebenden Fachwerkhäusern gesäumt wurde; durch den schmalen Ausschnitt, der sich nach oben hin öffnete, fiel das bleiche Licht des schon fast vollen Mondes. Von weit entfernt drangen die Geräusche fröhlicher Ausgelassenheit herüber; auf dem Platz vor der Kirche Sankt Kastor, der ab morgen Schauplatz des Hoftages Kaiser Ludwigs IV. sein würde, war bereits die Vorfreude eingezogen.
Ein Geräusch, ein Quietschen!
»Allmächtiger!« Die Frau hielt den Atem an und sah panisch um sich. Die Mörder – kehrten sie zurück? Die beiden Mönche, die, nachdem sie ihr Opfer niedergestochen hatten, an ihrem Versteck vorbeigehastet waren, ohne sie wahrzunehmen. Verborgen im Schatten eines Windfangs, der den Eingang einer Schenke beschirmte, hatte sie sowohl den Mord als auch die lautstarke Auseinandersetzung mitbekommen, die ihm vorausgegangen war. Sie war auf dem Weg zu ihrer Unterkunft gerade auf Höhe der Schenke angekommen, als weiter vorn, auf der rechten Seite der Gasse, mit lautem Knall eine Haustür aufflog. Ein Mann stürzte unter obszönen Flüchen und mit wütenden Schreien ins Freie, gefolgt von zwei anderen im Mönchshabit: Franziskaner, wie sie an der braunen Kutte und dem weißen Zingulum erkennen konnte. Da die Schenke bereits geschlossen hatte, flüchtete die Frau in das Dunkel des überdachten Windfangs, von wo aus sie das Geschehen mit angehaltenem Atem beobachtete. Der größere der beiden Verfolger erreichte den Fliehenden als Erster und stieß ihn von hinten zu Boden, der andere, einen Kopf kleiner und stämmiger gebaut als sein Mitbruder, schloss auf, zog ein Messer unter der Kutte hervor und stach mehrmals auf das am Boden liegende Opfer ein. Anschließend rannten die Männer an ihr vorbei die Gasse hinunter, wobei sie sich einige Sätze zuriefen, die sie nicht verstand. Lediglich das Wort »Becher« glaubte sie zu erkennen. Dem kleineren, stämmigen rutschte im Rennen die Kapuze vom Kopf; im hellen Licht des Mondes konnte sie deutlich sein von einer Hasenscharte verunstaltetes Gesicht erkennen.
Es hatte sie Überwindung gekostet, ihr Versteck zu verlassen und den Weg zu ihrer Unterkunft fortzusetzen, führte er doch zwangsläufig an dem Opfer vorbei, das regungslos auf der Straße lag. Doch dann hatte die Pflicht über die Furcht obsiegt: Bereit, ihrem ärztlichen Eid zu gehorchen, hatte sie sich an der Seite des Mannes niedergelassen.
Angestrengt spähte die Ärztin um sich. Da, wieder dieses Quietschen, direkt hinter ihr! Sie wandte sich um. Ein Frösteln überfiel sie, dem gleich darauf ein nervöses Auflachen folgte – sie war einer Katze auf den Leim gegangen. Das Tier war auf das an einer Kette befestigte Aushängeschild der Schenke Zum Wilden Mann gesprungen, in deren Windfang sie sich verborgen gehalten hatte, und schaukelte darauf quietschend hin und her.
Die Frau warf einen ratlosen Blick auf die Gänsefeder in ihrer Rechten. Jetzt erst sah sie, dass sie rot eingefärbt und der obere Teil abgeschnitten war. Rasch verstaute sie den obskuren Gegenstand in ihrer Gürteltasche, dann lief sie, so schnell sie konnte, weiter die Gasse hinauf. An deren Ende lag ihr Ziel: die Herberge Zum Roten Hirsch.
Es war Zeit, die Kammer aufzusuchen, die für die Dauer des Hoftags für sie angemietet worden war; trotz des aufwühlenden Vorfalls hoffte sie, dort den dringend benötigten Schlaf zu finden. Eine Hoffnung, die sich als vergeblich erwies. Gebeutelt von wilden Träumen verbrachte sie eine zutiefst unruhige Nacht. Grübelnd warf sie sich auf ihrer Bettstatt hin und her – doch nicht einmal die Spur einer Erinnerung, die sie der Lösung des Rätsels um die Identität des Mannes nähergebracht hätte, wollte sich einstellen.
Bis sie kurz vor Morgengrauen schweißgebadet und mit einem Namen auf den Lippen aus dem Schlaf schreckte.
»Jakob Budig!«
Sie wusste nicht, was den Namen aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins an die Oberfläche ihrer Wahrnehmung befördert hatte. Sie wusste nur, dass der Mann, den sie sterbend in seinem Blut liegend vorgefunden hatte, Jakob Budig hieß. Jakob Budig, ein Gefährte aus Kindertagen, nur wenige Jahre älter als sie. Jakob Budig, der schlaksige Junge mit dem Sternenmal auf der rechten Wange. Wie oft waren sie durch die Wälder, Wiesen und Flussauen rund um das heimatliche Deggenfeld gestreift. Hatten zusammen Streiche ausgeheckt, Äpfel aus den Gärten stibitzt, bunte Flusskiesel gesammelt und kleine Boote aus Birkenrinde geschnitzt, die sie auf den sanften Wogen der Donau flussabwärts hatten treiben lassen. Jakob Budig, Sohn von Dominikus Budig, einem der einflussreichsten Ratsmitglieder Deggenfelds. Jakob Budig, der Christ, der mit ihr, dem Judenmädchen Miriam, fast eine ganze glückliche Kindheit hindurch verbunden gewesen war. Bis zu dem Tag, als eine Woge aus Lügen und Hass über die Stadt hinwegschwappte und ihrer Freundschaft ein jähes Ende setzte. Da war sie neun und er elf Jahre alt gewesen.
Miriam schlug die Decke zurück, schwang die Beine aus dem Bett und setzte sich auf die Bettkante.
»Oh Adonai, warum gerade ich?«, stöhnte sie, die Ellenbogen auf die Knie und die Stirn in beide Hände gestützt. Seit einer gefühlten Ewigkeit hatte sie Jakob nicht mehr gesehen, und nun war sie Zeuge des Mordes an ihm geworden. Und das nur wenige Tage vor ihrem Aufbruch nach Deggenfeld, das sie vor zwölf Jahren verlassen hatte. Ein unfassbarer Zufall? Eine Fügung? Eine Prüfung des Allmächtigen? Was überhaupt war der Grund für Jakobs Aufenthalt in Koblenz? Etwa der Hoftag des Kaisers, der heute beginnen und in fünf Tagen mit großem Pomp zu Ende gehen würde?
Auch ihre, Miriams, Anwesenheit in Koblenz war dem Hoftag geschuldet, zu dem sogar der König von England angereist war. Vor bald zwei Monaten war die Neunundzwanzigjährige von Salerno im Schutz einer Handelskarawane aufgebrochen, die ihren Weg nach Koblenz genommen hatte. Balduin von Luxemburg, Kurfürst und Erzbischof von Trier und Gastgeber des glanzvollen Ereignisses, wollte im Bedarfsfall den hohen Herrschaften ausgezeichnete medizinische Behandlung zuteilwerden lassen und hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, die besten Ärzte in Koblenz zu versammeln. Auch die berühmte schola medica salernitana war gebeten worden, einen Vertreter nach Koblenz zu schicken. Die Wahl des leitenden Kollegiums der Schule war auf sie gefallen: Miriam bat Nathan, magistra medicinae, herausragende Absolventin der Medizinschule zu Salerno und mittlerweile zur erfahrenen Medica gereift. Dass man sie ausgesucht hatte, schmeichelte ihr, doch es gab noch einen anderen Grund, warum ihr die Entscheidung des Gremiums mehr als recht gewesen war. Versetzte es sie doch in die Lage, die schon lange geplante Rückkehr in die Heimat endlich in die Tat umzusetzen. Den Umweg über Koblenz nahm sie dafür gerne in Kauf.
Miriam gähnte, sie fühlte sich wie gerädert. Mit schlurfenden Schritten ging sie zum Fenster ihrer im dritten Stock gelegenen Kammer und ließ gedankenversonnen ihren Blick über die schlummernde Stadt gleiten. Ein kühler Hauch wehte herein, es roch nach Regen. Wegen der tief hängenden Wolkendecke wich das aschefarbene Grau der Morgendämmerung nur zögernd den heller werdenden Tönen des heraufziehenden Tages.
Sie seufzte. Gähnend schlurfte sie zur Bettstatt zurück. Vielleicht würde sich ja doch noch das Quäntchen Schlaf einstellen, auf das sie die Nacht über vergebens gehofft hatte. Oder zumindest ein kurzer, erfrischender Schlummer.
Kapitel 2
Samstag, 5. September 1338Koblenz • Hoftag Kaiser Ludwigs IV.
Kapitel 2
Der Kaiser hielt Hof in Koblenz. Innerhalb der Mauern wimmelte es nur so von Menschen. Schon vor Tagen waren Tausende Teilnehmer und Besucher aus den entlegensten Winkeln des Reiches angereist, um sich das Großereignis nicht entgehen zu lassen. Ein Spektakel, dem man regelrecht entgegenfieberte und von dem man noch den Enkeln berichten würde. Die Stadt summte und dröhnte, als habe sich ein gigantischer Hornissenschwarm in ihr niedergelassen. Für die Händler und Krämer, die ihre Waren auf den Märkten und in den Gassen feilboten und satte Geschäfte witterten, ein Grund, sich vergnügt die Hände zu reiben.
Heilloses Gedränge herrschte vor allem auf dem Platz vor der Kirche Sankt Kastor, auf dem heute der Höhepunkt des Hoftages zelebriert werden würde.
Auch das Wetter zeigte sich an diesem Tag von seiner besten Seite. Es war freundlich und warm, der Himmel wolkenlos und von ehernem Blau, sodass die Sonne ungehindert auf die mächtige Tribüne hinunterstrahlen konnte, die auf dem Platz errichtet worden war. Gekrönt wurde sie vom prächtig geschmückten Thron des Kaisers, der sich auf der obersten Stufe befand, gut zwölf Fuß über dem Boden. Daneben, zwei Stufen darunter, war ein weiterer, weniger prächtig geschmückter Thron aufgestellt worden. Auf ihm würde Eduard III., König von England, Platz nehmen.
Auf gleicher Höhe reihten sich, mit kostbaren Seidenkissen gepolstert, sieben weitere Stühle. Die mit wertvollem Hermelinbesatz versehenen Lehnen ließen darauf schließen, dass sie für die Kurfürsten bestimmt waren.
Über die gesamte Tribüne lagen kostbare Stoffe und Teppiche gebreitet. Hatten sich schon an den vergangenen Tagen Massen von Zuschauern vor der beeindruckenden Konstruktion eingefunden, war ihre Zahl heute weiter angestiegen. Denn heute war der Tag, an dem sich seine Majestät, umgeben von den Edlen des Reiches, im festlichen Ornat und versehen mit sämtlichen Insignien seiner von Gott verliehenen Macht seinen Untertanen präsentieren würde. Sogar der englische König würde Ludwig seine Referenz erweisen. Fast alles, was im Reich Rang und Namen hatte, war vertreten. Für die Dauer weniger Tage war Koblenz zum Nabel der Welt geworden. Gewiss, der Kaiser hatte schon Reichstage in größeren Städten abgehalten, etwa zu Aachen, Nürnberg und Frankfurt, doch dieser stellte, was Pracht und Bedeutung anging, alle bisherigen in den Schatten.
Fasziniert betrachteten zwei Männer das bunte Treiben auf dem Platz vor der Kastorkirche, ein älterer und ein jüngerer. Beide waren in die braune Kutte der Franziskanermönche gehüllt. Nicht weit von der Komturei des Deutschen Ordens entfernt, standen sie im Schatten eines Häuschens, das sich im Osten der Stadt an die nördliche Umfassungsmauer schmiegte. Auf der anderen Seite der Mauer strebten die Fluten der Mosel dem Rhein zu. Obwohl ein gutes Stück von Sankt Kastor entfernt, drang der Lärm, den die versammelte Menge verursachte, bis zu ihnen.
»Cum Deo, ich hab noch nie so viele Menschen auf einem Haufen beisammen gesehen. Dieses Gewusel, hier geht’s zu wie in einem Ameisenhaufen«, sagte der jüngere zu seinem älteren Mitbruder in Christo.
»Ja, alle werden sie dem verfluchten Ketzer huldigen. Und der wird sich in ihren Vivat-Rufen suhlen wie die Sau im Schlamm«, konstatierte der ältere abfällig. Der näselnd hohle Ton und die undeutliche Aussprache waren einer Hasenscharte geschuldet.
Ohne auf die Bemerkung seines Mitbruders einzugehen, wies sein jüngerer Begleiter mit der Hand in Richtung Sankt Kastor.
»Sieh doch, Vater Radolfus, da kommen noch mehr Menschen. So wie die herausgeputzt sind, muss es sich um Edelleute handeln. Wie die anderen, die schon vor ihnen da waren. Und dann die vielen Ritter. Man könnte meinen, auf dem Platz findet ein Turnier statt. Diese Rüstungen. Ein Gleißen und Glänzen ist das, dass einem die Augen schmerzen beim Hinsehen.« Der junge Mönch war nicht mehr zu bremsen. Er schwärmte mit zunehmender Begeisterung über das, was er sah. Seine jugendliche Unbekümmertheit und die Art und Weise, wie er mit dem älteren sprach, ließen auf einen Novizen schließen. »Und wisst ihr was, Vater?«, fuhr er euphorisch fort, »heute Morgen in der Stadt habe ich sogar einige Bogenschützen des englischen Königs gesehen, mit ihren berühmten Langbogen.«
Radolfus stieß dem Novizen unsanft den Ellenbogen in die Rippen. »Was höre ich da aus deinen Bemerkungen heraus, Christian? Etwa Begeisterung? Oder gar Entzücken? Du wirst doch wohl nicht mit dem verfluchten Pack, das diesen … diesen Ludwig unterstützt, sympathisieren?«
»Aber nein doch, Vater Radolfus«, wehrte sich der so Angesprochene erschrocken. »Es ist … es ist nur alles so neu für mich … neu und aufregend. Diese vielen Menschen, dieser Glanz, diese Pracht.«
Radolfus schüttelte unwillig den Kopf.
»Werde nicht neidisch auf die Pracht der Gottlosen, mein Sohn. Bedenke, dass all dies vergänglich ist. Sagte nicht unser Herr, als er auf Erden weilte, dass Schätze im Himmel besser sind als jene auf der Erde, die von Motten und Rost zerfressen werden?«
»Schon, aber der Kaiser sieht es nun mal als sein legitimes Recht an, sich in aller Pracht vor seinen Untertanen zu zeigen, wenn er Hof hält. Andere Herrscher tun das auch, sogar unser Papst.«
»Sein Recht? Du stellst diesen exkommunizierten Bastard auf eine Stufe mit unserem Herrn Papst? Das Recht hätte er, wenn er gesalbt wäre, das ist er nicht. Er lehnt es kategorisch ab, sein Amt vom Papst bestätigen zu lassen.« Radolfus’ Stimme zitterte vor Zorn.
»Aber Vater …« Christian wollte etwas einwenden, doch Radolfus, vor Wut in Fahrt gekommen, schnitt ihm einfach das Wort ab.
»Merke dir: Dieser Bayer ist nichts als ein Blender, ein schäbiger Bauer, ein Feind unserer Mutter Kirche, ein Ketzer«, wetterte er einfach weiter. »Er rebelliert gegen unseren Herrn Papst, er ist sein erklärter Feind. Und die Feinde seiner Heiligkeit sind auch unsere Feinde, hast du das vergessen? Wir müssen loyal sein, verstehst du, loyal! Auch wenn andere aus unserem Orden es nicht sind. Wie sollten wir sonst unsere Mission erfüllen können?«
Der Novize senkte peinlich berührt den Kopf – um den Blick gleich wieder selbstbewusst zu heben. »Aber ja doch, Vater Radolfus, ich habe verstanden. Und was meine Loyalität angeht: Habe ich sie nicht vor einigen Tagen unter Beweis gestellt? In jener Nacht, in der …?«
»Wirst du wohl still sein, Unseliger?!«, unterbrach ihn Radolfus leise zischend und fuhr fort: »Du sollst Schweigen bewahren über jenen Vorfall! Waren wir uns darüber nicht einig? Bedenke, überall kann ein feindliches Ohr lauern. Also, halt den Mund!« Und obwohl ein gutes Stück kleiner als der Novize, verpasste er ihm mit seinen knöchernen Fingern eine Kopfnuss, die es in sich hatte.
Christian bekam einen roten Kopf. Erneut senkte er den Blick. »Ja, Vater, ich werde es beherzigen«, sagte er zerknirscht. Wie hätte Radolfus wissen können, dass die Röte kein Zeichen von Scham, sondern Ausdruck eines unbändigen Zorns war, der im Innern des Novizen tobte?
Vor der Tribüne hatten sich mittlerweile nicht nur das Gefolge des Kaisers, sondern auch viele Mitglieder der zahlreich angereisten Entourage des englischen Königs eingefunden. Darüber hinaus Angehörige diverser Fürstentümer und Grafschaften, Vertreter der hohen Geistlichkeit und des Ritterstandes sowie des niederen Adels. Natürlich waren auch die Bürger von Koblenz geladen, allen voran der Innere und Äußere Rat, der Stadtrichter, der Schultheiß und andere Honoratioren der Stadt. Hinter einer bewachten Absperrung war sogar Platz für die niedrigen Stände geschaffen worden. Hier drängelte, schubste und prügelte man sich regelrecht um die besten Plätze. Ein Chronist, so sollte Miriam Jahre später erfahren, schätzte die Anzahl der Menschen auf dem Platz an diesem Tag auf sage und schreibe siebzehntausend.
Auch Miriam war gekommen. Zusammen mit Gawain du Beauchene und Pierre Arnaud, zwei collegae medici, die der medizinischen Fakultät der Universität Montpellier angehörten. Eigentlich gebührte ihnen ein Platz inmitten der vornehmen Bürger. Doch sie hatten sich verspätet, sodass sie mit einem unter den Angehörigen der niederen Stände vorliebnehmen mussten. Sie hatten Mühe, sich den Schubsern und Dränglern gegenüber zu behaupten.
»Mon dieu! Ein Stoßen und Hauen ist das hier, man könnte aus der Haut fahren«, echauffierte sich Gawain du Beauchene. »Zum Henker mit diesen ungebildeten Landwanzen.« Der dem niederen französischen Adel entstammende Medicus war wegen seines Hochmuts bei den Kollegen nicht gerade beliebt.
»Landwanzen? Sagtest du Landwanzen?«, hakte Pierre Arnaud grinsend nach. »Interessanter Begriff. Aber bist du denn nicht selbst eine Landwanze – Baron du Beauchene?«, setzte Pierre mit spöttischer Zunge und süffisanter Miene hinzu. »Stammst du nicht aus einem winzigen Kaff im Roussillon, in dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen?«
Gawain murmelte etwas Unverständliches in seinen blonden Bart, der nicht mehr als ein flaumiger Kinnbesatz war, und vollzog ärgerlich eine Handbewegung, als verscheuche er eine lästige Fliege.
In diesem Moment erhielt er einen Stoß vor die Brust, der ihn taumeln ließ. Er kam von einem besonders hartnäckigen Drängler, dem man schon von Weitem den Stallknecht ansah.
»Diabolus te tollat, monstrum putidum – möge dich der Teufel holen, du stinkendes Ungeheuer«, schimpfte der Baron laut auf Latein, sodass die Umstehenden es hören konnten. Gawain kehrte Ungebildeten gegenüber gerne den Akademiker heraus.
Der Drängler grinste ihn frech an und entblößte ein paar schwarze Zahnstummel.
»Cule stulte – blödes Arschloch«, sagte er nur, was Gawain die Sprache verschlug. Miriam und Pierre brachen in schallendes Gelächter aus.
Plötzlich ebbte der Lärm auf dem Platz ab und erstarb schließlich ganz. Erwartungsvoll sah die Menge zwei Wappenkönigen entgegen, die auf prächtig geschmückten Pferden, gefolgt von Trommlern und Fanfarenbläsern zu Fuß, auf dem Platz erschienen und sich vor der Tribüne in Positur brachten. Es handelte sich um die obersten Herolde Kaiser Ludwigs und König Eduards. Zu erkennen am jeweiligen Wappen ihrer Herrscher, das jeder auf seinem Tappert trug.
Ein lauter Trommelwirbel ertönte, dem mehrere Fanfarenstöße folgten. Der Wappenkönig Ludwigs, zu erkennen an dem doppelköpfigen Adler, richtete sich im Sattel auf und ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Dann räusperte er sich, reckte den Heroldsstab in die Luft und hob an: »Empfangt und begrüßt unseren allergnädigsten Herrn, Seine Kaiserliche Majestät Ludwig, der Vierte seines Namens, römischer und deutscher König von Gottes Gnaden, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, und seinen hochedlen Gast, Seine Königliche Majestät Eduard, den Dritten seines Namens, von England!«
Kaum, dass er geendet hatte, folgte alles einem akribisch festgelegten Protokoll. An der Eingangshalle der Kastorkirche öffneten sich die Flügel des Portals, und unter dem Klang von Trompeten, Pfeifen, Tamburinen und dumpf hallenden Trommelwirbeln erschien eine Abteilung höfischer Musikanten in festlichen Uniformen. Ihnen folgten Speerträger und Bogenschützen, darunter einige der sechsundsechzig englischen archers, deren Langbogen im Kampf außerordentlich gefürchtet waren. Sie gehörten zur Leibwache Eduards. Anschließend traten, angeführt von Standarten- und Fahnenträgern, gemessenen Schrittes die mit Kurmantel und Kurhut bekleideten Kurfürsten aus dem Schatten des Kirchenportals, gefolgt von weiteren Reichsfürsten und geistlichen Würdenträgern. In ihrer Mitte ritten die beiden Herrscher: der Kaiser auf einem prächtigen, reich geschmückten Apfelschimmel, neben ihm König Eduard von England auf einem Rappen. Doch niemand zog die Aufmerksamkeit mehr auf sich als Ludwig in seinem kaiserlichen Ornat, und so brach die Menge bei seinem Anblick in begeisterte Hochrufe aus.
»Sieh dir diesen Antichristen an, unglaublich, was sich dieser Häretiker anmaßt«, giftete Radolfus, seine Lippen bebten vor Empörung. Er hatte sich zusammen mit seinem Novizen bis auf wenige Schritte der Absperrung genähert, die das hintere, dem gemeinen Volk vorbehaltene Areal umgab. Den Entschluss, dem Spektakel aus der Nähe beizuwohnen, hatte er spontan gefasst. Er hielt sich mit Christian hinter einem Karren am Rand der Absperrung verborgen. »Verstehst du nun, weshalb der Papst ihn unter den Kirchenbann gestellt hat?«, fuhr er leise fort.
Christian nickte. »Aber ja, Vater Radolfus. Er trägt nicht nur den Purpur des weltlichen Herrschers, sondern auch Kleider, die dem Bischofsstand vorbehalten sind. Die farbige Dalmatik, die Tunizella, die Stola, die er um den Hals trägt, die goldenen Sandalen und die mitraähnliche Krone mit dem Kreuz, die er aufgesetzt hat – das sind alles Attribute geistlicher Macht.«
»Gut beobachtet, mein Sohn. Ein Affront sondergleichen. Damit will er den Heiligen Vater provozieren. Du siehst, er wurde zu Recht als Ketzer verurteilt.«
»Dass er exkommuniziert wurde, scheint ihm aber nichts auszumachen. Ich glaube, er fürchtet weder Tod noch Teufel, und …«
»Möge Gott den Majestäten ein langes Leben schenken!«, unterbrach die weittragende Stimme des kaiserlichen Herolds den Novizen. Erneut brandete Jubel auf, während Kaiser und König huldvoll winkend die Masse grüßten.
Auch Miriam und ihre Begleiter konnten sich der Faszination dieses Augenblicks nicht entziehen.
»Welch unglaubliche Pracht«, staunte sie.
»Ja, unglaublich«, brummte Gawain etwas geistesabwesend, weil er sich ganz auf das Geschehen auf der Tribüne konzentrierte. Dort schritten Kaiser und König, eskortiert von mehreren Würdenträgern, gerade die Stufen hinauf.
»Ein Prunk, der Eindruck macht, und das soll er auch«, bemerkte Pierre. »Gerade auf den englischen König. Ich habe gehört, dass der Kaiser von ihm den Fußkuss einfordern will.«
»Du glaubst, das wird ihm gelingen?«, fragte Miriam.
Pierre zuckte die Schultern. »Eduard reklamiert immerhin den Thron des französischen Königs für sich und braucht dringend Ludwigs Unterstützung.«
»Und welcher Vorteil ergibt sich für den Kaiser aus dieser Allianz?«
»Der dürfte auf verstärkten Rückenwind in seiner Auseinandersetzung mit dem Papst hoffen. Auf jeden Fall kann er so demonstrieren, dass er potente Unterstützer hat, die sich einen Dreck darum scheren, dass er unter dem Kirchenbann steht. Indem die Reichsfürsten und Eduard Umgang mit ihm pflegen, erkennen sie die Rechtmäßigkeit seiner Amtsausübung ohne Wenn und Aber an. Und das, obwohl er als Ketzer verurteilt ist und … Was gibt’s, Miriam?«
Miriam schien schlagartig jegliches Interesse an Pierres Ausführungen verloren zu haben. Wie vom Donner gerührt starrte sie mit weit aufgerissenen Augen in Richtung eines zweirädrigen Karrens, der außerhalb der Absperrung stand. Ohne jegliche Erklärung verließ sie ihren Platz, schob sich hastig durch die Menge und lief direkt auf den Karren zu. Als sie ihn erreicht hatte, duckte sie sich kurz hinter das mannshohe Rad und spitzelte dahinter hervor, als ob sie jemanden beobachtete. Dann eilte sie geradewegs auf die Kastorgasse zu, die nahe der Stadtmauer in westlicher Richtung zum Stadtkern führte. Kopfschüttelnd sahen Pierre und Gawain ihr nach.
Mit wild klopfendem Herzen ging Miriam, dem Verlauf der Stadtmauer folgend, Richtung Westen, wobei sie darauf achtete, ihre Schrittgeschwindigkeit dem Tempo der beiden Männer anzupassen, die sie verfolgte. Noch während Pierre dabei gewesen war, ihr lang und breit die Zusammenhänge bezüglich der Allianz zwischen den beiden Herrschern zu erklären, war ihr Blick zufällig in Richtung des Karrens am Rand der Absperrung geglitten. Just in diesem Moment waren zwei Franziskanermönche in ihr Sichtfeld getreten, die sich auf die Kastorgasse zubewegten. Beide hatten nur kurz in ihre Richtung gesehen, doch dieser Augenblick hatte ihr genügt, um sie sofort wiederzuerkennen und ihr einen frostigen Schauer über den Rücken zu jagen. Es waren der Mörder mit der Hasenscharte und sein deutlich jüngerer Komplize. Reflexartig, ohne lange zu überlegen, hatte sie beschlossen, ihnen zu folgen, wobei sie darauf achtete, einen gewissen Abstand zu ihnen zu wahren.
Nach einem strammen Stück Weges bog sie, den Mönchen folgend, an der Stiftskirche St. Florin vorbei auf die zur erzbischöflichen Burg führende Holzschuhergasse ein. Just in diesem Moment schob sich ein Fuhrwerk, das aus einer Nebengasse kam, zwischen die beiden Franziskaner und sie. Ausgerechnet an einer Engstelle. Der von zwei Ochsen gezogene Wagen hatte die Kurve in die Holzschuhergasse fast zur Gänze genommen, als das linke Hinterrad am Prellstein einer Hausecke entlangschürfte. Das verdächtige Knirschen verhieß nichts Gutes; das Fuhrwerk stoppte und blockierte die Straße.
»Zum Teufel mit diesen verdammten Pollern!«, fluchte der Fuhrmann und sprang vom Bock.
Hastig quetschte Miriam sich an dem Fuhrwerk vorbei. Doch als sie wieder freien Blick auf die vor ihr liegende Gasse hatte, waren die Männer verschwunden. Wahrscheinlich in einer Seitengasse.
»Mist!«, schimpfte sie. Zögernd ging sie weiter, als sie linker Hand eine Schenke erblickte. Zum Goldenen Becher las sie auf dem Aushängeschild. Schlagartig fiel ihr ein, dass sich die beiden Franziskaner in der Mordnacht das Wort »Becher« zugerufen hatten. Unentschlossen blieb sie stehen, als die beiden Mönche auch schon in Begleitung eines dritten Mannes aus der Schenke traten. Sofort versteckte sie sich hinter einer Hausecke.
Dem Fremden sah man schon auf drei Meilen den Patrizier an; er bot einen überaus eleganten Anblick. Ein kurzer schwarzer Bart rahmte ein kantiges, aber wohlproportioniertes Gesicht mit schmaler Nase und vollen Lippen; unter den dichten, markant geschwungenen Brauen blickte ein auffallend blaues, aber stechendes Augenpaar. Gekleidet war er in eine kostbare pelzbesetzte Herigaut, auf dem Kopf saß eine zu einem Turban gerollte, aus kostbarer Seide geschneiderte und mit Fehpelz gefütterte Gugel, kunstvoll bestickt mit Goldfäden. »Ich werde heute noch abreisen, du wirst die Sache allein klären müssen«, wandte er sich an den Mönch mit der Hasenscharte. Das dunkle Timbre und die Art und Weise, wie er das »R« rollte, verliehen seiner Stimme einen angenehmen, geschmeidigen Charakter.
»Kein Problem, Ihr wisst, dass Ihr Euch auf mich verlassen könnt«, erwiderte der Mönch. Seine schnarrende Stimme und der dem gespaltenen Rachen geschuldete Sprachfehler jagten eine Gänsehaut über ihren Rücken.
»Gut«, der Mann nickte, »alles Weitere dann in etwa drei Wochen. Ich lasse dir rechtzeitig eine Nachricht zukommen.«
»Wann?«
»Sobald ich wieder zu Hause bin.«
»Was geschieht mit ihr?«
»Das lass meine Sorge sein«, knurrte der Mann. So sprach ein Höherstehender mit einem, der unter ihm stand. Jemand, der gewohnt war, Befehle zu erteilen, und erwarten konnte, dass sie befolgt wurden.
Der Mönch nickte, hob die Hand zu einem wortlosen Gruß und schritt mit seinem jüngeren Begleiter weiter in Richtung innere Stadt. Der Patrizier entfernte sich in die entgegengesetzte Richtung.
Hinter der Hausecke verborgen, hatte Miriam die kurze Unterhaltung mit angehaltenem Atem verfolgt. Mit dem, was sie gehört hatte, konnte sie nichts anfangen. Über Jakob Budig war kein Wort gefallen. Nichts, was auch nur ansatzweise mit dem Mord an ihm in Verbindung hätte gebracht werden können. Die einzige Bemerkung, die sie hatte aufhorchen lassen, war die Frage des Mönchs nach »ihr«. Und die kryptische Antwort des Patriziers: »Das lass meine Sorge sein.« Hatten sie über eine Frau gesprochen?
Mit einem Mal merkte Miriam, wie der Mord an Jakob Budig ihre Gedanken völlig zu vereinnahmen drohte. Sie schüttelte unwillig den Kopf und schalt sich eine Närrin. Bei Haschem, was hatte sie sich mit diesem Vorfall zu befassen? Es gab Wichtigeres, Erfreulicheres. Nur noch wenige Tage, und sie würde nach dreizehn Jahren endlich ihre Lieben und ihre Heimat wiedersehen. Gewiss: Sie war Zeugin eines Mordes geworden, und auch, wenn der Ermordete sich zufällig als ein Gefährte aus weit zurückliegenden Kindertagen erwiesen hatte – eigentlich ging sie das Ganze nichts an.
Sie beschloss, die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. Mochte sich die dafür zuständige Obrigkeit damit herumschlagen.
Kapitel 3
Freitag, 18. September 1338Deggenfeld • Herzogtum Niederbayern
Kapitel 3
Über der Talebene hing ein wolkenverhangener, bleierner Morgen. Seit Stunden hüllte dichter Nieselregen die Gegend in einen tristen Schleier aus Nässe. Mit dem Rücken gegen eine Krüppelfichte gelehnt, stand Miriam auf einem Felsen, der sich zwischen einigen licht beieinanderstehenden Bäumen auf der Kuppe eines Waldbergs erhob. Nur wenige Schritte von der Kante entfernt, die jäh in die Tiefe stürzte, blickte sie gedankenversonnen auf die vom Dunst aufgeweichten Konturen der Landschaft, die sich unter ihr auftat. Auf den mattgrauen Flusslauf der Donau und die nur wenige Hundert Fuß vom Ufer entfernte Stadt Deggenfeld. Auf die verwaschene Silhouette der Umfassungsmauer, die die Stadt in Form eines Ovals umschloss.
Ein Frachtkahn, der auf der Donau träge seine Bahn zog, geriet in ihr Sichtfeld. Er steuerte flussabwärts auf die südlich der Stadt gelegene Lände zu, wichtiger Umschlagplatz für unterschiedlichste Güter wie Holz, Wein, Salz und Getreide. Als graue Schemen reihten sich die Hafenanlagen am Ufer entlang, dominiert von den Silhouetten zweier gewaltiger Lastkräne, die in den diesigen Himmel ragten. Hin und wieder hatte sie sich als Kind am Hafen herumgetrieben und sich vorgestellt, wie es wäre, auf einem Schiff das Ufer vorbeiziehen zu sehen und die Welt zu erkunden.
Ihr Blick richtete sich wieder auf die Stadt, suchte das jüdische Viertel, wo sie einst zu Hause gewesen war. Die Synagoge, das Bad – Mikwe genannt –, das Tanzhaus und all die anderen vertrauten Gebäude sowie die engen Gassen und Gässchen ihrer Jugend. Wie würde sie das alles vorfinden? Wie würden ihr Großvater Joseph ben Schallum, von den Bürgern der Stadt Jossel »der Arzt« genannt, und ihre Großmutter Deborah bat Levi wohl reagieren, wenn sie nachher vor ihnen stand? Und wie ihre zwölfjährige Tochter Rebecca, die bei Jossel und Deborah aufwuchs und ihre Mutter bisher nie zu Gesicht bekommen hatte? Ein gedankenversonnenes Lächeln spielte um ihre Mundwinkel – keine Frage, sie würden vor Freude aus dem Häuschen sein!
Miriams rechte Hand umfasste den Riemen, der sich um Brust und Schulter spannte. An ihm war der wasserdichte Lederköcher befestigt, den sie quer über dem Rücken trug. Er barg ein wertvolles Dokument: das Zertifikat, welches, versehen mit dem schweren Siegel der schola medica salernitana, bestätigte, dass sie nach einem Studium der ärztlichen Wissenschaft zu Recht den Titel einer magistra medicinae erworben hatte. Ein Privileg, das sie ihrem Saba, ihrem Großvater, verdankte. Als Arzt wusste er, wie wichtig Bildung war, also hatte er seine Enkelin mit Einverständnis ihrer Eltern bereits sehr früh im Lesen, Schreiben und Rechnen und in Hebräisch unterwiesen, obwohl dies überwiegend den Jungen und Männern in der Gemeinde vorbehalten war. Miriam erinnerte sich gern an die zahllosen Stunden, die sie bei ihm mit Lernen verbracht hatte. Überhaupt war sie in ihrer Kindheit oft bei ihrer Savta und ihrem Saba gewesen, lag das Haus der Großeltern doch unmittelbar neben dem der Eltern.
Vor zwölf Jahren dann hatte Großvater sie nach Salerno geschickt. Zum einen wollte er ihr an der dortigen Medizinschule ein Studium ermöglichen. Zum anderen sollte der Aufenthalt in dem von der Sonne verwöhnten südlichen Zipfel jenseits der Reichsgrenze ihr ermöglichen, das furchtbare Schicksal, das ihr widerfahren war, zu verdrängen. Vergessen würde sie es nie können. Hinzu kam, dass Joseph über ausgezeichnete Beziehungen zu einer einflussreichen Familie verfügte, die der jüdischen Gemeinde zu Salerno angehörte: den Guarnas, Nachkommen jener berühmten Rebecca Guarna, einer jüdischen Ärztin, die in Salerno gewirkt und gelehrt hatte. Bei ihnen war Miriam untergekommen.
»Warum so nachdenklich, junge Frau?«
Erschrocken fuhr Miriam herum, ihre Hand zuckte zum Messer, das im Gürtel steckte. Ein stämmiger alter Mann mit verfilztem grauem Haar stand vor ihr, der Kleidung nach ein Bauer aus der Gegend. Er war von hinten an sie herangetreten; versunken in den Anblick des vor ihr liegenden Panoramas, hatte sie sein Kommen nicht bemerkt. Das wettergegerbte Gesicht zerfurcht wie ein Acker, die blaurote Nase knollig und vernarbt wie eine Runkelrübe, sah er sie aus wasserblauen wachen Augen unter buschigen Brauen an. Ein stacheliger grauer Bart, dessen Stoppeln in alle Richtungen abstanden, sprießte auf seinen hohlen Wangen.
»Aber, aber, warum so misstrauisch? Ich tu euch schon nichts.« Über das Gesicht des Mannes huschte ein gutmütiges Grinsen. Er hatte das Zucken der Hand zum Messer sehr wohl wahrgenommen. »Ihr seid wohl nicht aus der Gegend?«, fuhr er fort und musterte sie mit unverhohlener Neugier.
»Was lässt Euch das vermuten?«, antwortete Miriam reserviert, aber nicht unfreundlich.
»Die Farbe Eurer Haut. Ihr seht aus, als kämt Ihr aus südlicheren, sonnenverwöhnteren Gefilden. Aber anhören tut Ihr Euch, als wärt Ihr von hier.«
Miriam musste schmunzeln. Sie wusste, dass sie einen ziemlich dunklen Teint hatte; die zwölf Jahre unter der heißen Sonne Kampaniens hatten ihre Spuren hinterlassen.
»Ihr seid ein guter Beobachter. Ja, ich bin von hier, aber ich habe viele Jahre in Kampanien gelebt, das liegt im Königreich Sizilien, auch Königreich Neapel genannt, daher meine Hautfarbe.«
»Sizilien! Oh! Dort, wo diese Wilden leben, deren Haut schwarz wie Kohle ist und die splitternackt herumlaufen?« Der Mann trat einen Schritt näher. »Sogar die Frauen!«, raunte er und verdrehte die Augen.
»Wie kommt Ihr denn darauf?«
Der Mann sah sie entrüstet an. »Das weiß doch jeder.«
»Der Menschenschlag, den Ihr meint, lebt noch ein gutes Stück weiter südlich, jenseits des großen Meeres. Die Gegend heißt Afrika.«
»Tatsächlich?«
»Tatsächlich! Aber sagt, guter Mann – ach, wollt Ihr mir nicht Euren Namen nennen?«
»Jobst. Jobst Brugger.«
»Sagt, Jobst Brugger, seid Ihr aus der Gegend?«
»Ich schon«, sagte der Mann gedehnt, legte den Kopf schief und zog die Brauen hoch, als wollte er sagen: Im Gegensatz zu Euch, die ich Euch noch nie hier gesehen habe.
Miriam verstand den Hinweis. Es gab keinen Grund, dem Alten zu verschweigen, wer sie war.
»Ich bin Miriam bat Nathan, Magistra der Medizin, Enkelin von Jossel, dem Arzt, und seinem Eheweib Deborah.«
Jobst Brugger sperrte Mund und Augen auf, als habe ihn der Schlag getroffen.
»I-h-r seid Miriam, die Enkelin von Jossel?«, stieß er ungläubig hervor. »Die Mutter des Bankerts?«
Bankert?! Miriam glaubte, schlecht gehört zu haben, sie wollte zu einer scharfen Bemerkung ansetzen, besann sich aber eines Besseren. Sie trat nah an den Mann heran, reckte das Kinn vor und funkelte ihn zornig an. »Ihr wolltet wohl sagen: die Mutter des Mädchens, das bei Jossel und seinem Weib aufwächst, nicht wahr?«, entgegnete sie eisig.
Jobst trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Natürlich, verzeiht, das … das wollte ich sagen, ja«, beeilte er sich zu versichern. »Es ist nur … es ist …«
»Was ist? Raus mit der Sprache, was wolltet Ihr sagen?«
»Manche in der Stadt nennen Eure Tochter so. Ohne dass sie ihr Übles wollen. Schließlich ist sie … ist sie … nun ja … Ihr wisst, was ich meine.«
Oh ja, das wusste sie nur zu gut. Wenn es etwas gab, das man nicht ändern konnte, dann war es das, was den Menschen von Kindesbeinen an eingetrichtert wurde. Und dazu gehörte auch die Behauptung, dass ein Kind, außerhalb der Ehe gezeugt, ein Bankert sei, ein minderwertiges Wesen, eine »Frucht der Sünde«. Selbst wenn dieses Wesen das Ergebnis einer Vergewaltigung war. Aus den Briefen, die Jossel ihr geschrieben hatte, wusste Miriam, dass in der Stadt und der jüdischen Gemeinde hinter manch vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, auch Rebecca sei »in Sünde empfangen« worden. Hinzu kam, dass das Mädchen, das sie geboren hatte, feuerrotes Haar besaß, was die Verdächtigungen, die man sich zuflüsterte, beförderte.
Zwar hatten Jossel und Deborah nach ihrer Flucht aus Güstrow eine Legende in Umlauf gebracht, um die Schmach, die einer unverheirateten Mutter mit Kind drohte, von Miriam abzuwenden. Doch dies hatte nicht ganz den gewünschten Erfolg gezeitigt. Obgleich sogar der Rat der jüdischen Gemeinde zu Deggenfeld die plausibel klingende Geschichte geschluckt hatte.
Miriam, so die Darstellung ihrer Großeltern, sei mit ihren Eltern ins ferne Güstrow gereist, um einen Mann aus der dortigen jüdischen Gemeinde zu heiraten. Doch nur wenige Tage nach der Vermählung sei es den dortigen Juden ergangen wie vielen andern ihres Volkes. »Judenschläger« hätten der Gemeinde den Garaus gemacht, neben Miriams Eltern sei dabei auch ihr frisch angetrauter Ehemann ums Leben gekommen. Eine Geschichte, die Jossel nicht als Lüge, sondern als List ansah. Und so hatte er beim Judenrat erwirken können, dass Miriam als Witwe und Rebecca als ehelich geborenes Kind anerkannt wurden. Ungeachtet dessen wollten niederträchtige Zungen, die behaupteten, die Wahrheit sei eine ganz andere, einfach nicht verstummen.
Ein schmerzlicher Seufzer entrang sich Miriams Brust. Die gedankenlose Bemerkung des Bauern hatte einen wunden Punkt in ihr berührt. Eine mütterliche Beziehung zu dem Säugling aufzubauen, war ihr nämlich verwehrt geblieben; zu sehr erinnerte sie das Kind an die erlittenen Qualen und Demütigungen. Und so war sie dem Ansinnen ihres Großvaters, sie nach Salerno zu schicken, nur zu gern gefolgt und hatte es den Großeltern überlassen, sich um die Kleine zu kümmern. Doch im Verlauf ihrer ärztlichen Tätigkeit hatte sie unzähligen Müttern geholfen, ihr Kind zur Welt zu bringen. Mit jedem einzelnen war ihr bewusster geworden, dass es ein Wesen in dieser Welt gab, das einst auch in ihrem Leib herangewachsen war. Die Sehnsucht, dieses Wesen kennenzulernen, es zu umarmen und fest an sich zu drücken, war stetig gewachsen …
Ein lautes Räuspern des Bauern holte Miriam in die Gegenwart zurück.
»Sie war ein fröhliches Mädchen, immer gut aufgelegt und zu jedem Schabernack bereit, ich fand sie immer nett«, versicherte Jobst. »Ich meine, als sie … als sie noch hier war, in Deggenfeld«, ergänzte er.
Miriam spürte, wie ihr der Mund trocken wurde. »Als sie noch in Deggenfeld war? Was soll das heißen?«
»Ihr wisst es nicht? Man hat es Euch nicht mitgeteilt? Es ist doch schon über ein halbes Jahr her.«
»Was? Was sollte man mir mitgeteilt haben?«
»Na, dass Eure Tochter verschollen ist. Vor einem halben Jahr verschwand sie von heute auf morgen. Jossel hat die ganze Gegend nach ihr abgesucht. Sämtliche Orte, wo sie sich versteckt haben könnte, einschließlich der Stadt. Ich und ein paar andere haben bei der Suche mitgeholfen. Ich verstehe mich gut mit Eurem Großvater, müsst Ihr wissen, er behandelt mich hin und wieder, einmal hat seine ärztliche Kunst mir sogar das Leben gerettet. Tage später hat Jossel dann herausgefunden, dass sie sich wohl einer Gruppe Fahrender angeschlossen hatte. Gaukler, Musikanten und anderes Gelichter.«
Miriam starrte den Bauern fassungslos an, sie wollte nicht glauben, was sie gerade gehört hatte. Wie sehr hatte sie dem Tag entgegengefiebert, an dem sie ihrer Tochter gegenüberstehen würde. Sich vorgestellt, wie sie inzwischen wohl aussehen mochte, wie es sein würde, wenn sie aufeinander zustürzten, sich laut schluchzend in die Arme fielen, während sie im Überschwang der Gefühle nicht ein Wort herausbrächten, sondern stumm einander festhaltend den Tränen der Wiedersehensfreude freien Lauf ließen …
Und nun diese Nachricht! Rebecca – ihreRebecca – Mitglied einer fahrenden Truppe, bestehend aus Gauklern und Vagabunden, verachtet, verfemt und mit dem Makel des Ausgestoßenseins behaftet? Vielleicht hatte sie sogar den Glauben der Väter verleugnet …
Tränen liefen über Miriams Wangen. »Was … was wisst Ihr noch über meine …« Sie schluchzte, vermochte nicht mehr weiterzusprechen.
Dem Bauern war es sichtlich unangenehm, sie in dieser Verfassung zu sehen. Verlegen trat er von einem Bein aufs andere und kratzte sich die Stirn.
»Nichts. Mehr weiß ich nicht. Eure Großeltern werden Euch sicher mehr sagen können. Also dann – lebt wohl, Magistra.«
Er hatte sich schon zum Gehen gewandt, als er innehielt und sich noch mal umdrehte. »Im Übrigen, was ich noch sagen wollte. Ihr tätet gut daran, den Schleier mit den gelben Streifen anzulegen, und das Messer, das ihr im Gürtel stecken habt, versteckt besser. Wir in Deggenfeld haben eigentlich nichts gegen Juden. Trotzdem legt man in der Stadt Wert darauf, dass Juden ihren Stand offen kundtun und sich entsprechend verhalten. Ich meine es nur gut mit Euch, glaubt mir, Magistra.« Damit wandte er sich um und stapfte davon.
Miriam sah ihm mit bitterer Miene nach. Der jahrelange Aufenthalt in Salerno hatte sie gelegentlich vergessen lassen, was es in ihrer Heimat bedeutete, ein Jude oder eine Jüdin zu sein. Gewiss, auch in Kampanien waren Juden verfolgt worden, noch vor wenigen Jahrzehnten hatte es sogar erzwungene Massenkonversionen in Neapel gegeben. Doch Miriam hatte das Privileg gehabt, sich an der schola in einem Umfeld zu bewegen, in dem der menschliche Geist ein Maß an Freiheit genoss, das anderswo einen Inquisitor auf den Plan gerufen hätte. Die Begegnung mit Jobst hatte ihr drastisch ins Bewusstsein gebracht, dass Juden in Deggenfeld nur geduldet waren. Wie ihre Glaubensgenossen andernorts im Reich auch. Sie war eine Verfemte, eine vom Christengott Verfluchte, die zu dem Volk zählte, das seinen Sohn ans Kreuz genagelt hatte, und die verpflichtet war, ihre schändliche Herkunft öffentlich kundzutun. Und so hatten Jüdinnen als äußeres Zeichen dieses Makels den Schleier mit den gelben Streifen zu tragen und Männer den kegelförmigen Judenhut aufzusetzen; mancherorts mussten sie auch einen gelben Ring an ihr Gewand heften. Selbst das Mitführen von Waffen war Juden verboten, deshalb hatte Jobst Brugger ihr geraten, das Messer besser zu verstecken.
Auf ihrer Reise von Salerno nach Koblenz und weiter nach Deggenfeld hatte niemand in ihr die Jüdin erkannt, obwohl sie unzähligen Menschen begegnet war. Was sicher auch daran lag, dass sie beschlossen hatte, ihren Glauben diskret zu praktizieren, so, wie es die Umstände der Reise gestatteten. Weder durch ihre Kleidung noch durch irgendwelche rituellen Handlungen hatte sie ihre Religion offenbart. Egal, ob es um das Einhalten des Schabbats oder um bestimmte Reinigungsriten ging. Ihr Glaube an den Einen, Ewigen und ihre Zugehörigkeit zur hebräischen Glaubensgemeinschaft hingen nicht vom äußerlichen Befolgen ritueller Regeln ab, sondern von dem, was sie im Herzen trug, davon war sie überzeugt. Ihr Judentum durch das Tragen eines Kleidungsstücks für jeden sichtbar zur Schau zu stellen, kam für sie nicht infrage. Zumindest nicht während der Reise. Dass damit ein gewisses Wagnis einherging, war ihr bewusst: Die Obrigkeit spaßte nicht, wenn Juden oder Jüdinnen es versäumten, ihrer vorgeschriebenen Kennzeichnungspflicht nachzukommen. Doch da keiner sie kannte und ihr Äußeres nicht darauf schließen ließ, wer sie war, hatte sie das Risiko bislang als gering eingestuft. War sie erst einmal bei den Großeltern in Deggenfeld untergekommen, sah die Sache anders aus. Hier würde sie sich den üblichen Gepflogenheiten anpassen müssen.
Miriam wandte sich um und richtete erneut ihren Blick auf das unter ihr liegende Panorama. Energisch schob sie das Kinn vor, rückte den Riemen zurecht, an dem der Köcher auf ihrem Rücken befestigt war, und stieg die felsige Anhöhe hinunter. Unten wartete, am Ast einer Birke festgemacht, ihr Maultier.
»Komm, Grauer, Deggenfeld erwartet uns«, murmelte sie, tätschelte dem Tier den Hals und schwang sich in den Sattel.
Kapitel 4
Kapitel 4
Joseph ben Schallum stand in seiner Arztstube im Erdgeschoss und inspizierte das ärztliche Besteck, das auf dem mit weißen Linnen bedeckten Tisch vor ihm ausgebreitet lag. Eine Knochensäge, mehrere Wundhaken, Zangen und Skalpelle, Scheren mit unterschiedlich ausgeprägten Schneideflächen, ein Dorn, zwei Pinzetten, ein Knochenbohrer und zwei verschieden große Brenneisen. Durch das über dem Tisch befindliche Fenster mit den Butzenglasscheiben fiel milchig-trübes Licht und ließ die Instrumente matt glänzen. Wie jeden Tag hatte Tilda, die Magd, sie abends zuvor gesäubert und ausgekocht. Joseph nahm sich jedes einzeln vor und unterzog es einem akribisch prüfenden Blick, bevor er es an den dafür vorgesehenen Platz in seine Arzttasche steckte. Die aus schwerem Leder gefertigte Tasche war für seine Hausbesuche ein unentbehrliches Utensil, auf das er besondere Sorgfalt verwendete.
Nachdem er sämtliche Instrumente gewissenhaft verstaut hatte, verließ er die Arztstube und trat in den Hausflur. Von hier aus führte eine steile Stiege in den ersten Stock, wo sich seine Schreibstube befand. Dort angekommen, nahm er eine Wachstafel vom Schreibpult, die er für kurzfristige Notizen nutzte und auf der die Namen der Kranken notiert waren, die heute seinen Besuch erwarteten.
»Naomi bat Amos, Habakuk ben Mordechai, Gottfried Rieger, Anton Unseld, Elsslin Kaufhold«, murmelte Jossel vor sich hin; er führte des Öfteren Selbstgespräche. Beim letzten Namen seufzte er und schüttelte bedauernd den Kopf. Bei Elsslin Kaufhold würde er vielleicht noch ein, zwei Mal vorbeischauen müssen, nicht öfter. Leider! Er gab ihr nur noch wenige Tage. Die Gattin des Ratsherrn Leberecht Kaufhold hatte sich vor dem Herd gebückt, um ein Holzscheit aufzuheben, und dabei ungeschickterweise einen großen Kessel mit kochend heißem Wasser umgestoßen, das sich ihr über Kopf, Schultern und Brust ergossen hatte. Die Ärmste hatte schwerste Verbrühungen davongetragen. Der herbeigerufene Bader und Wundarzt Heribert Hofstätter war zu betrunken gewesen, als dass er wirkungsvolle Hilfe hätte leisten können. Erst drei Tage später hatte man sich entschlossen, den Judenarzt zu holen. Doch da war es für eine erfolgreiche Behandlung schon zu spät gewesen; mittlerweile hatte ein großflächiger Wundbrand mit hohem Fieber eingesetzt, und so konnte Jossel nur noch schmerzlindernd eingreifen.
»Jaja, da rufen sie einen Quacksalber, noch dazu einen Saufkopf, und wundern sich, wenn alles schiefläuft«, brummte Jossel ärgerlich. »Und dann muss unsereiner ran und soll es richten.« Beide Hände ausbreitend, sah er zur Decke und fügte sarkastisch hinzu: »Obwohl man ein Christusmörder ist.«
Als Jude verachtet, als Arzt geschätzt, reichte sein Ruf als begnadeter Medicus weit über Deggenfeld hinaus bis nach Regensburg, Würzburg und Passau. Jossel hatte eine ganze Menge christlicher Patienten. Und das, obwohl es einem guten Christen eigentlich nicht erlaubt war, Judenärzte zu konsultieren. Auf den ersten Blick mutete das geradezu aberwitzig an. Aber eben nur auf den ersten Blick. Besser ein lebender Sünder als ein toter Heiliger, schien der Wahlspruch mancher Christen zu lauten, die sich einen Dreck um das kirchliche Dekret scherten, das ihnen untersagte, sich von einem Judenarzt behandeln zu lassen. Dass das Verbot sogar von einigen Päpsten ignoriert wurde, war ein offenes Geheimnis und zugleich ein Paradoxon. Manchmal konnte sich Jossel des Eindrucks nicht erwehren, als ob die Welt der Christen aus lauter Paradoxien bestand.
Es gab nämlich noch einen anderen Grund, weshalb er die Verachtung, die man ihm entgegenbrachte, als widersprüchlich empfand. Steckte ein Christ in Geldnöten, wandte er sich nicht selten an einen gut betuchten Juden, um mittels eines Kredits aus dem finanziellen Schlamassel herauszukommen, in das er hineingeschlittert war. Und so kam es, dass Jossel, wie so manch anderer aus der jüdischen Gemeinde zu Deggenfeld, noch einer weiteren Profession nachging – der des scharf kalkulierenden Geldverleihers. Eine Tätigkeit, die ihn im Laufe vieler Jahre zu einem der reichsten Bewohner Deggenfelds gemacht hatte. Wenn auch längst nicht zu einem der angesehensten. Auch das ein Paradoxon …
Jossels Blick glitt zum Fenster. »Ein Wetter, nass und grau wie zur Zeit der Sintflut«, kommentierte er missmutig das trübe Licht, das durch die Butzenscheiben fiel. Nur wenige konnten sich den Luxus eines Glasfensters leisten.
»Ja, und gleich spazieren Noah und seine drei Söhne herein. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die Taube mit dem Olivenzweig im Schnabel mitbringen.«