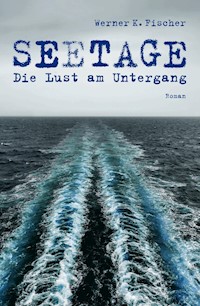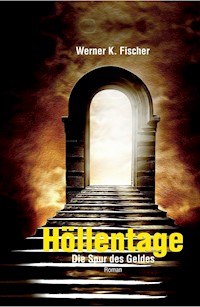
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Johannes Förster, oder wie er sich lieber nennt, John Forster, sieht sich als Top-Verkäufer in der internationalen Immobilienbranche. Sein Problem: Er gehört zu jener Spezies Mensch, die heute im finanziellen Überfluss schwelgt, um sich wenige Wochen später in den absoluten Niederungen menschlichen Daseins wiederzufinden. Pech, falsche Entscheidungen, verkehrte Freunde, Selbstüberschätzung, Verschwendungssucht - so genau lässt sich der Grund nicht feststellen. Wahrscheinlich ein bisschen von jedem. Als ihm von einem Hamburger Anwalt ein lukrativer Job auf Jamaica angeboten wird, glaubt er sich am Ziel aller Wünsche. Der Traumjob entwickelt sich allerdings ganz anders als erhofft. Er führt ins Chaos unberechenbarer Machtspiele. John wird verhaftet und des Mordes beschuldigt. Mithilfe von Freunden gelingt ihm im letzten Moment die Flucht von der Insel. Nach diversen Zwischenstationen landet er in Costa Rica, wo er auf Rache sinnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch:
Johannes Förster, oder wie er sich lieber nennt, John Forster, sieht sich als Top-Verkäufer in der internationalen Immobilienbranche. Sein Problem: er gehört zu jener Spezies Mensch, die heute im finanziellen Überfluss schwelgt, um sich wenige Wochen später in den absoluten Niederungen menschlichen Daseins wiederzufinden. Pech, falsche Entscheidungen, Verschwendungssucht verkehrte Freunde, Selbstüberschätzung – so genau lässt sich der Grund nicht feststellen. Wahrscheinlich ein bisschen von allem.
Als ihm von einem Hamburger Anwalt ein lukrativer Job auf Jamaica angeboten wird, glaubt er sich am Ziel aller Wünsche. Der Traumjob entwickelt sich allerdings ganz anders als erhofft. Er führt ins Chaos unberechenbarer Machtspiele. John wird verhaftet und des Mordes beschuldigt. Mithilfe von Freunden gelingt ihm im letzten Moment die Flucht von der Insel. Nach diversen Zwischenstationen landet er in Costa Rica, wo er auf Rache sinnt.
Der Autor:
Werner K. Fischer lebt als selbständiger Medienkaufmann in Hamburg. „HÖLLENTAGE – Der Weg des Geldes“ ist sein zweiter Roman, in dem er wieder viele Erfahrungen seiner großen Leidenschaft, Reisen, verarbeitet hat. Neben dem neuen Thriller HÖLLENTAGE hat er im November 2015 den Roman „SEETAGE –Die Lust am Untergang“ (ISBN 978-3-7323-7489-2 / www.seetage.info) veröffentlicht , 2014 das Musical „WEST INDIES COMPANY“ (www.west-indies-company.de) getextet, komponiertund eingespielt, sowie 2013, zusammen mit seiner Frau Ulli, das Kinderbuch ZACKY, DER KLEINE ZAUBERDRACHE geschrieben.
Werner K. Fischer
Höllentage
Die Spur des Geldes
© 2020 Werner K. Fischer
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-13677-9
Hardcover:
978-3-347-13678-6
e-Book:
978-3-347-13679-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die gesamte Handlung und alle Figuren des Romans sind der Phantasie des Autors entsprungen. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, fliegenden Kurierpiloten, selbstlosen Lehrern, Bremer Ämtern, Beamten im diplomatischen Dienst und egoistischen Ehemännern sind rein zufällig.
Weiterer Titel des Autors:
Seetage. Die Lust am Untergang
ISBN 9-78300051060-1
Für Ulli und Jameel, mit denen ich immer so gern durch die Welt gereist bin und mit denen ich hoffentlich bald wieder die Koffer packen kann.
Eins.Hamburg/Deutschland.
Er fror erbärmlich. Johannes, oder wie er sich lieber nannte, John, versuchte, die ranzig riechende und viel zu kurze Decke über die Schultern zu ziehen und zu ergründen, warum er mit ausgeleierten Klamotten, verdreckten Schuhen ohne Schnürsenkel und pelzigem Geschmack im Mund auf einem schmalen Brett lag und hämmernder Kopfschmerz sein letztes bisschen Lebenswillen boykottierte. Die unmenschlich blendende Sonne stach ihn wie ein Messer in die Augen und malte surreale Zeichnungen an die ohne Plan bekritzelten Wände und die vergilbte Decke, von der in großen Placken Putz abbröckelte. Giraffen, Löwen, Drachen oder ähnliche Fantasien. Vielleicht auch Palmwedel oder Strichzeichnungen aus grauer Vorzeit. Oder Tintenkleckse aus einem Rorschach-Test, deren Interpretation darüber entscheidet, ob man irre ist oder nicht.
John hatte nicht den geringsten Schimmer, wo er war. In seinem Kopf, zumindest fühlte sich das Ding auf den Schultern an wie sein Kopf, herrschte Leere. Pochende Leere. Langsam, John, ganz langsam. Er versuchte, sich irgendwie zu sortieren. Wusste aber nicht so recht, was es eigentlich zu sortieren gab. Auch ein Blick auf die Uhr brachte ihn nicht wirklich weiter. Im Gegenteil. Er versetzte ihn in endgültige Schockstarre. Dass er keine Uhr mehr umhatte, musste etwas Dramatisches bedeuten. Dieser Verlust machte ihn mit einem Schlag wacher. Von seiner Rolex Daytona Platinum mit Ice blue Baton-Zifferblatt und Platinum-Armband hätte er sich nie im Leben freiwillig getrennt. Sie war das letzte Überbleibsel aus einem Leben, das er irgendwann unterwegs verloren hatte. Zwischen ganz weit oben und ganz weit unten. So eine Art Überlebensversicherung. Gerettet vor deutschen Gerichtsvollziehern, spanischen Immobilienhaien, russischer Moskau Connection und diesen unsäglich eingebildeten Finanzjongleuren, die unbeirrt der Meinung waren, Geld von ihm zu bekommen und penetrant versuchten, dies auch einzutreiben. Mit Erpressung, Morddrohungen, nächtlichem Auflauern, Stalking, Telefonterror. Diesen Geiern war jedes Mittel recht. Hauptsache, sie bekamen die Kohle.
Egal. Unwichtig. Schnee von gestern. Seine geliebte Rolex war weg, also musste etwas Schlimmes passiert sein. Etwas sehr Schlimmes. Prompt stieg Panik in ihm auf. Ruhig John, ganz ruhig. Er bemühte sich, gleichmäßig durchzuatmen und, mit immer noch verschwommenem Blick, den Raum zu erfassen, in dem er aus unerklärlichen Gründen auf diesem Brett lag. Geschätzte vier mal zwei Meter Emotionslosigkeit. Ein Stuhl, ein Tisch, dieses harte Etwas, das wohl ein Bett darstellen sollte, ein vergittertes Mini-Fenster in einer Höhe, die den Blick in die Außenwelt nur mit olympiareifen Turnübungen oder abenteuerlichen Verrenkungen möglich machte. Eine angerostete, ehemals graue Metalltür ohne Türgriff, in der Ecke ein verbeultes, edelstahlglänzendes Waschbecken und etwas, das aussah wie eine Kloschüssel. Auch in Edelstahl, allerdings erblindet. John konnte sich keinen Reim darauf machen, was das sollte und wo er sein könnte. Klassischer Filmriss. Flashlights blitzen durch sein Hirn und setzten Bruchstücke von Erinnerungen frei. Madrid. Autobahn. Frankreich. Autobahn. Elbbrücken. Unter größten Mühen richtete er sich auf, trampelte die ekelhaft stinkende Wolldecke weg, setzte sich hin. Und heulte auf, weil die unkontrollierte Bewegung ein kreischendes und ekelhaft lärmendes Kopfkarussell in Bewegung setzte. Er versuchte, sich über die Lippen zu lecken, merkte aber, dass seine Zunge unlösbar am Gaumen klebte. Was hätte er für ein Zischbier gegeben? Oder auch nur ein einfaches Glas Wasser. Bröckchenweise kamen weitere Erinnerungen zurück. Er hatte geschmissen! Weil er sauer war. Stinksauer. Er war wieder mal von unfähigen Versagern umzingelt gewesen, die intellektuell einfach nicht genug Schmalz in der Birne hatten, die Visionen eines John Forster zu verstehen. Die Revolution des Timesharings. Die erste Masche eines weltumspannenden Netzes. Die eierlegende Wollmilchsau, die Garantie zum Gelddrucken! Und die minderbemittelten Deppen hätten dabei sein können! Aber sie hatten gekniffen, weil sie einfach nicht begriffen, was für eine außergewöhnliche Chance sich ihnen bot. Zumindest dann, wenn man alles richtig machen würde. Und ein John Forster hätte alles richtig gemacht. Immobilien in den schönsten Regionen und den spektakulärsten Sehnsuchtszielen der Welt zu verkaufen. An Urlauber, denen man in ihrer euphorischen Ferienstimmung alles andrehen konnte. Sogar Wohnungseigentum. Denen das geschickt gestreute Argument, ab sofort nicht mehr in der ausgelutschten Ferienwohnung, sondern in eigenen vier Luxuswänden wohnen zu können, Begeisterungsstürme und Endorphin-Ausschüttungen entlockte, weil sie bei den Lieben daheim und, noch wichtiger, den Nachbarn, mit der cleveren Investition auch noch als Hero dastehen und bewundert würden. Und das für wirklich kleines Geld. Dafür aber mit immensen Aussichten auf Gewinnsteigerungen. Zumindest für die Verkäufer. Das Menü wäre unwiderstehlich gewesen. Als Appetizer geile, einladende Bilder der fertigen Anlage. Als perfekten Gourmet-Hauptgang eine ausgesucht luxuriös ausgestattete Musterwohnung, natürlich mit Meeresblick, um die Wirkung des sonst noch ziemlich trostlosen Rohbaus zu kaschieren. Als himmlisches Dessert, die Zusicherung, dass das Eigentum natürlich ins Grundbuch eingetragen werde. Gut, vielleicht war die vorgelegte Rentabilitätsrechnung ein wenig zu optimistisch und das Bild einer Immobilie, die sich quasi von selbst bezahlte, ein wenig zu stark aufgetragen. Aber das Gesamtkunstwerk hätte ganz sicher auch den letzten Bedenkenträger weichgeklopft. Nur nicht die an ihren Schreibtischen klebenden Sesselpupser, die auch noch die letzte Stelle hinterm Komma hinterfragten, weil sie einfach Muffen hatten, Entscheidungen zu treffen. Wesentlich war in diesem Business nun mal nicht, was korrekt war, sondern was für den potenziellen Käufer korrekt, gut und einleuchtend schien und nach sozialem Aufstieg klang. Natürlich erwarben die Käufer kein klassisches Eigentum, sondern lediglich ein verbrieftes Wohnrecht. Selbstverständlich bekamen sie für ihr Geld keine Immobilie und noch weniger ein ganzes Haus, dafür aber die Chance, für eine oder mehrere Wochen im Jahr den bisher unerfüllten Traum von Eigentum, Luxus und Reichtum zu leben. Alles andere war doch Korinthenkackerei. Gut, aufschlussreich wäre möglicherweise die Information gewesen, dass der „traumhafte Meeresblick“ selbstverständlich verbaubar war. Aber derartige Lockversprechen gehörten einfach zum Verkaufsgespräch. Sie waren wichtig, die Phantasie des potenziellen Käufers zu beflügeln und ihn in seiner Entscheidung zu bestärken. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich würde er dieses Versprechen später in dem abgeschlossenen Vertrag vergebens suchen, weil die Bauplanung selbstverständlich vorsah, auf dem kostbaren Grund bis runter zum Strand noch manches andere Haus mit mindestens ebenso vielen Stockwerken zu errichten. Darum baute man ja immer gern von oben nach unten, vom Landesinneren Richtung Wasser. So konnte man noch vielen Unentschlossenen den unverbaubaren Meeresblick präsentieren. Unerwähnt, oder irgendwo im Kleingedruckten versteckt, blieb natürlich auch, dass zusätzlich zu der Kaufsumme jährliche Neben-, Verwaltungs-, Hausmeister- und Reisekosten fällig wurden, die für eine Ferienimmobilie fernab der Heimat nicht ganz unerheblich waren. Aber darum hieß es ja Timesharing. Geteilte Zeit. Und damit auch geteiltes Geld.
Die skurrilen Zeichnungen an den Wänden seines Käfigs waren kürzer geworden, ein Zeichen, dass die Sonne höher stand. Irgendwas zwischen zehn und elf vormittags musste es sein. Inzwischen war ihm zumindest bewusst geworden, dass er im Gefängnis war und dass man ihn in eine dieser Standardzellen gesperrt hatte, die in jedem besseren Krimi zu sehen war. Allerdings wurde hier spätestens nach ein paar Minuten die Tür aufgeschlossen und zwei Aufseher der feineren Art holten den Gefangenen zu einem Termin ab. Besuch, Verhör, Vorführung beim Richter oder Ähnliches. Bei John waren es nur zwei Spatzen, die auf dem Fenstersims saßen, mitleidig auf ihn hinabblickten und ihn in einen Tschilp-Talk verwickeln wollten. Von der anderen Seite der Stahltür war kein Laut zu hören. Für einen Moment hatte John die Angst, dass man ihn in diesem Loch vergessen hatte und er für immer hier vergraben war. Zumal er nach wie vor keine Ahnung hatte, warum er überhaupt hier war. Der Tiger in seinem Kopf war zwar inzwischen zu einem Kätzchen und das Fauchen zu einem Schnurren geworden, aber die Synapsen im Hirn hatten ihren Gegenpart noch nicht wiedergefunden, so dass das Gedankenmischmasch die zuständigen Schubkästen nur schubweise zurückeroberte.
John hatte geschmissen, so viel war ihm jetzt klar. Ob aus Sturheit oder Blödheit wollte ihm einfach nicht einfallen, zumal das keinen großen Unterschied machte. Er hatte geschmissen und musste nun damit leben. Immerhin wären pro Immobilie 25 bis 30 Eigentümer zusammengekommen. Bei durchschnittlich 35 000 Euro und mindestens 100 Wohnungen pro Anlage ein Riesending. Für John wäre der Job nach dem Verkauf erledigt gewesen. Er hätte die Käufer sich selbst überlassen, seinen Schreibtisch aufgeräumt, alle Papiere an die Zentrale geschickt, seine Provision eingesackt und sich mit dem nächsten lukrativen Bauvorhaben beschäftigt. Das wunderbare Leben eines Immobilienverkäufers.
Hätte. Aber die Dumpfbacken in der Konzernleitung hatten nichts kapiert. Nicht das System. Nicht die Gewinnchancen. Und schon gar nicht die Entwicklungsmöglichkeiten. Und darum hatte er geschmissen. Weil er ganz einfach sicher gewesen war, seine verkäuferische Extraklasse anderswo besser einsetzen zu können. Angebote dafür waren ihm im Wochentakt auf den Schreibtisch geflattert. Alle wollten ihn haben. Alle! Und darum würde er seine Visionen eben anderswo verwirklichen. Ein John Forster musste niemandem hinterherlaufen. Immerhin hatte er Kontakte in höchste Chefetagen, und dort warteten sie auf ihn.
Aber Träume sind Schäume, Absichtserklärungen keine Zusagen und Kontakte ein sehr flüchtiges Gut. Niemand hatte auf ihn gewartet. Niemand! Keiner wollte ihn plötzlich mehr kennen, und keiner hatte Interesse an seinen Fähigkeiten und Ideen. Seine egozentrische Art, seine eindimensionale Ausrichtung auf maximalen Profit, seine bekannte Geringschätzung gegenüber Vorgesetzten und die häufig hart an der Grenze zur Legalität laufende Vorgehensweise hatten sich rumgesprochen. Und damit war er ganz weg vom Fenster. Von gleich auf jetzt. Einfach so. Egal, wen er auch anrief, er lief ins Leere. Man ließ sich verleugnen. Gezeigtes Interesse entpuppte sich als reine Neugierde. Offene Jobs waren leider gerade gestern besetzt worden. Selbst seine besten Kontakte spielten auf Zeit. Er hatte gekämpft und musste sich eingestehen, dass er dieses Mal verloren hatte. Letztlich war ihm dann nichts anderes übrig geblieben, als seine Kohle zusammenzukratzen - die Tantieme aus den offenen Abschlüssen war natürlich immer noch nicht auf dem Konto -, seinen aufgemotzten 5-Liter-BMW X5 noch einmal auf Firmenkosten vollzutanken und sich auf den Weg von Madrid nach Hamburg zu machen. Wenn man Geld hat, eine einfache Tour, wenn Ebbe in der Kasse herrscht, problematisch. Die erste Nacht hatte er im Auto gepennt, war am nächsten Tag nach einem Tankstopp irgendwo in Frankreich einfach abgehauen, hatte sich die ganze Fahrt mehr oder weniger von trockenen Brötchen vom Vortag und Leitungswasser ernährt und war dann gestern Abend endlich über die Elbbrücken gefahren. Hamburg. Kurz übermannte ihn dieses wohlige, aber trügerische Gefühl, zu Hause und geborgen zu sein.
John lauschte auf die Geräusche, die plötzlich vom Gang draußen zu ihm drangen. Befehlsartige Rufe. Angst- oder Schmerzensschreie. Hektische Aktivität. Jetzt, nachdem auch die letzten Gedächtniswolken abgezogen waren und er wieder über alle Funktionen seiner Festplatte verfügen konnte, verstärkten sich auch die Bemühungen zu ergründen, warum er hier, in einer Gefängniszelle, saß und was das bedeuten könnte. An das, was passiert war, nachdem er endlich die Elbbrücken passiert hatte, konnte er, sich trotz größter Anstrengungen, immer noch nur bruchstückartig erinnern. Natürlich war er direkt nach Harvestehude in die Isestraße gefahren. In „Die Schleuse“. Seit Jahren sein erster Anlaufpunkt, wenn er nach Hamburg kam. Er war sicher gewesen, dort, wie eigentlich immer, Freunde zu treffen, bei denen er sich erst einmal ein paar Tage einnisten konnte. Aber keiner seiner alten Kumpels hatte sich blicken lassen, und so hatte er mehr oder weniger die halbe Nacht rumgehangen und gewartet, ob nicht vielleicht doch noch einer kam. Ganz weit hinten in dem letzten Stück verklebten Hirns dämmerte dann irgendwas von exzessivem Kampftrinken mit irgendwelchen, vorher noch nie getroffenen Kneipengängern, in das er reingerutscht war, als es draußen vor den dreckig-blinden Fensterscheiben schon langsam wieder dämmerte. Und nun fiel ihm auch die Kleine wieder ein, die an seinem Rockschoß gehangen hatte. Und die er ganz sicher auch abgeschleppt hätte, wenn denn seine Instinkte zumindest noch halbwegs funktioniert hätten. Er hatte schon immer einen Hang zu Junghühnern gehabt, besonders seitdem er letztes Jahr 35 geworden war. Älter als 20 war die ganz sicher nicht gewesen, eher jünger, dafür aber mit allen fantasieaktivierenden Rundungen an den richtigen Stellen. Also genau sein Beuteschema. Sie war herrlich anspruchslos gewesen, hatte ihm bewundernd an den Lippen gehangen und atemlos seinen Übertreibungen gelauscht, in denen er selbst Mr. Superman mühelos in den Schatten stellte, weil er glaubhaft den Eindruck vermittelte, dass er alles und jeden beherrschte. Das ultimative i-Tüpfelchen waren dann die mit cooler Erwähnung von Luxusmarken und Namedropping bekannter Promis ausgeschmückten Geschichten über sein Leben auf der Überholspur gewesen, die jede Frau hätte schwach werden lassen. Seine, zumindest seiner Meinung nach, männliche Erscheinung, seine beinahe zwei Meter Körpergröße und dieser durchtrainierte Body, den er gern durch ein weit aufgeknöpftes Hemd zeigte, taten ein Übriges. Zum Glück hatte die Maus nicht hinter die Kulissen schauen können, denn dort hätte sie genau das Gegenteil von dem gefunden, was er ihr vorgaukelte: ein Chaos aus Schulden, Lebensscherben, Selbstverliebtheit, Gerichtsvollziehern, betrogenen Freunden. Aber hat nicht jeder eine dunkle Seite?
John könnte nicht mal genau sagen, wann sein Leben zu einer Extrem-Achterbahn geworden war. Klar, seine Familienverhältnisse waren von Anfang an chaotisch gewesen. Er war das älteste von vier Kindern, alle von verschiedenen Vätern. Zwei Jungen, zwei Mädchen. Mutter alleinerziehend und ständig überfordert. Hartz-IV-Empfängerin. Seine Existenz verdankte John einem One-Night-Stand. Nach dem Spaß der Nacht hatte sich sein Erzeuger nie wieder blicken lassen. Immerhin war dann aber der Samenspender seiner jüngsten Schwester bei ihnen geblieben und hatte sich um alle gekümmert. Wobei kümmern möglicherweise nicht der richtige Begriff war. Der Typ war regelmäßig wochenlang verschollen, zauberte dann aber, wenn er irgendwann ohne Ankündigung wieder auftauchte, Bündel von Geldscheinen aus der Tasche, strahlte dabei wie ein Honigkuchenpferd und erfüllte ihnen jeden Wunsch. Immerhin hatte er so immer das Gefühl gehabt, einen Vater und eine richtige Familie zu haben. Aber vielleicht war ja auch Familie die falsche Beschreibung für diese zusammengewürfelte Lebensgemeinschaft. Aber woher hätte John damals auch wissen können, was eine Familie war. Es hörte und fühlte sich einfach gut an. Und hatte John immer stark gemacht, weil ihm diese Erinnerungen, besonders in schier ausweglosen Situationen, die Kraft gegeben hatten, aufzustehen und weiterzumachen. Und weil diese Bilder für ihn Hoffnung und Zukunft bedeuteten. Und genau diese Hoffnung war immer sein stärkster Motor gewesen. Sofort fiel ihm wieder das Lied ein, das er immer wieder gedudelt hatte: „Hoffnung ist die große Kraft, die uns weiter vorwärts spült, die ohne Umweg mitten in das Seelenleben zielt, die grenzenlos nach oben fliegt, die uns liebevoll umschlingt. Hoffnung lässt uns wirklich glauben, dass Träume Wahrheit sind.“ Aber das war eine andere Geschichte.
Was es dann letztlich gewesen war, das ihn in dieses unstete Achterbahnleben aus höchsten Höhen und tiefsten Niederungen geführt hatte, konnte John nicht sagen. In Erfolgsphasen hatte er keine Notwendigkeit gespürt, dieser Frage nachzugehen, und nach Fehlschlägen waren wichtigere Probleme zu lösen, als solch sinnlosen Fragen nachzugehen. Wahrscheinlich war er an irgendeiner Kreuzung falsch abgebogen und in eine Sackgasse geraten. Und hatte nicht mehr wenden können. Oder so ähnlich. So was nennt man wohl Pech, vielleicht auch Unvermögen. Je nach Standpunkt.
Wieder Lärm auf dem Gang. Wieder dieses beklemmende Gefühl, dass gleich etwas passieren würde, das ihn erneut aus der Bahn werfen würde. Nur warum? Warum hatte man ihn hier eingesperrt und warum kümmerte sich niemand um ihn? Hatte man als Delinquent nicht auch Rechte? Zum Beispiel das Recht auf regelmäßiges Essen und Trinken. Oder innerhalb einer bestimmten Zeit dem Haftrichter vorgeführt zu werden. Oder zu wissen, warum man überhaupt eingesperrt ist. Oder auf Rechtsbeistand durch einen Anwalt. John meinte sich sogar zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass jeder Gefangene ein Telefonat führen durfte. Nur, wem sollte er das sagen? Irgendwie hatte er das Gefühl, dass die – wer immer die waren – ihn weichkochen wollten.
Um sich von seinem Dilemma abzulenken, begann John, die Wandzeichnungen zu entziffern, die zumindest davon zeugten, dass er nicht der Erste war, der diese zweifelhafte Gastfreundschaft genießen durfte. „Fuck you, Bastard!“ Wen der Schreiber wohl gemeint hatte? Daneben die üblichen Striche einer Gefängniszelle, die die Aufenthaltsdauer eines Inhaftierten dokumentierten. John zählte nach. Die größte Strichsammlung ging bis 116. Konnte das sein? Konnte jemand wirklich so lange Zeit in diesem Schuhkarton eingesperrt sein? Johns Befürchtungen und Ängste wuchsen weiter. Diverse Strichmännchen in unterschiedlichsten Stellungen, Lagen und Deutlichkeiten zeigten, jede auf ihre Art, welchen individuellen Nöten seine Vorgänger ausgesetzt waren. „Highway to hell“. Der alte AC/DC-Song war auch verewigt, vermutlich nicht unbedingt, weil der Autor hier über „living easy, living free“ jubelte, Stoppzeichen und Speedlimits ignorierte oder seinen Aufenthalt als Weg ins versprochene Land ansah, sondern weil er, im Gegenteil, genauso eingeschränkt, ratlos und verzweifelt war wie John.
Ganz sicher konnten nur wenige Menschen Ereignis-Kurven wie John vorweisen: Top-Verkäufer mit blendenden Ergebnissen. Luxus pur als Lebensphilosophie. Kohle bis zum Abwinken. Glamour-Partys mit den Big Playern der Branche. Porsche und Ferrari als Alltags—Vehikel. Bentley und Rolls als Statussymbol. Frauen und Champagner als Grundnahrungsmittel. Und dann wieder der tiefe Absturz in die Hölle. Eine Welt, die krasser nicht sein konnte und von der er geglaubt hatte, sie ein für alle Mal hinter sich gelassen zu haben. Eine menschenverachtende Mischung aus Einsamkeit, Obdachlosigkeit, Alkohol-Exzessen, Geldproblemen, Frauengeschichten, Ausgeliefertsein, Existenzkampf und Resignation. Bodensatz. Tiefer ging es nicht mehr. Ein nicht enden wollender Gang über heiße Kohlen.
Schuld waren natürlich immer die anderen. Zumindest aus Sicht von John. Die, die unfähig waren, wahre Größe, außergewöhnliche Management-Fähigkeiten und seine intuitive Art zu erkennen, Menschen zu manipulieren und für eigene Ziele auszunutzen. Die, die zwar Regeln aufstellten, sich aber selbst nie daranhielten. Die, die einen Heidenspaß daran hatten, andere zu schikanieren und sich einen Scheißdreck darum kümmerten, was sie damit anrichteten. Die, die ihre Untergebenen ausbeuteten und gnadenlos kaltstellten, um deren Erfolge als die ihren zu präsentieren und ihre Sklaven um die verdiente Anerkennung zu bringen. Vieles von dem, was ihm wichtig gewesen war, war irgendwo in der Vergangenheit versunken und vergessen. Na ja, besser: vergraben. Bei dem ersten Lebenstaumel vor ein paar Jahren boten ihm wenigstens seine Frau Laura und seine damals gerade 2-jährige Tochter noch Halt. Aber auch dieses letzte bisschen Rückendeckung hatte er verloren, weil er sich wieder nicht beherrschen konnte und Abwechslung bei einer seiner Angestellten gesucht hatte. Ausgerechnet bei einer Frau, die Laura sehr gut kannte. Und so hatte es nicht besonders lange gedauert, bis sie es mitbekommen und ihn in hohem Bogen rausgeschmissen hatte. Einfach so. Aus seiner eigenen Wohnung. Die er in guten Zeiten finanziert und eingerichtet hatte. Und keinen Moment danach gefragt, was mit ihm wird und wo er bleiben würde. Aber wie alle hatte auch sie nie verstanden, dass Genies mehr Freiraum brauchen als Normalsterbliche. Seine Ex war eben immer schon gnadenlos konsequent gewesen. Und dieses Mal ganz besonders. In dieser Phase, in der alles hoffnungslos den Bach runterging, lernte er Peter kennen. Eines Abends in seiner Lieblingskneipe in Harvestehude. Peter machte sein Geld mit Mode und war immer auf der Suche nach guten Typen für den Verkauf der typischen, spanischen Lederklamotten. Die farbenprächtigen Jacken und Mäntel, die zu Tausenden im Ankunftsbereich deutscher Flughäfen bewundert werden konnten, wenn Touristenbomber ihre tiefgebräunte Ladung aller Altersklassen und Lebensstufen ausgeschüttet hatten. Die Kanaren waren, wie Peter blumig ausschmückte, ein absolutes Supergebiet für seine Trendmode. Billig einkaufen, teuer verkaufen, Gewinn einstreichen. Ein einfaches, überschaubares und überzeugendes Geschäftsmodell. John hatte nicht lange überlegt. Wenn man am Boden liegt, gibt es üblicherweise nicht besonders viele Wege zurück nach oben. Und die, das hatte er ziemlich schnell gelernt, sollte man dann auch nutzen. Statt Immobilien Mode. Statt Festland-Spanien Kanarische Inseln. Statt Madrid Gran Canaria. Why not? Ein guter Verkäufer kann eben an den Mann oder die Frau bringen. Und er, John, war ein Superverkäufer. Peters Idee war, Menschen genau dann vermeintliche Schnäppchen anzudrehen, wenn sie besonders empfänglich dafür waren. Im Urlaub beispielsweise. Trupps von Helfern schwärmten aus, um die Rezeptionisten der Hotels zu schmieren. Als Gegenleistung legten sie dann Handzettel in die Schlüsselfächer ihrer Gäste, die marktschreierisch auf „Eine sensationelle Modenschau in den besten Hotels der Insel“ aufmerksam machten, natürlich mit „Abholung durch Luxusbusse, internationalem Rahmenprogramm, exklusivem Imbiss, persönlicher Stilberatung und Verkauf von Trendmode zu Schnäppchenpreisen, die mindestens – das mindestens war dick unterstrichen - 50 Prozent unter dem Ladenpreis in Deutschland lagen. Die „Luxusbusse“ waren dann ausrangierte Gefährte, die für andere Zwecke kaum noch einsetzbar waren, das „internationale Rahmenprogramm“ ein ergrauter Keyboard-Entertainer, der die überwiegend älteren Käufer mit billigen Witzen und bekannten Uralt-Melodien in der Vergangenheit schwelgen ließ, der „exklusive Imbiss“ die Wahl zwischen einem Stück Blechkuchen oder einer Bockwurst mit Senf. Für die Modenschau hatten sie junge Spanierinnen engagiert, die für kleines Geld den Traum einer steilen Modelkarriere träumten und auf einem behelfsmäßigen Catwalk die spanische Mode „Made in China“ vorführten. Und die angeblichen „Schnäppchenpreise“ hätte man in jeder deutschen Billig-Modekette genauso bekommen. Aber in entspannter Ferienstimmung ist man weniger misstrauisch, und wenn der Rahmen stimmt, noch weniger. Es gab viele Hotels auf Gran Canaria. Und noch mehr Touristen. Das Geschäft lief wie geschnitten Brot. Wieder erlebte John goldene Zeiten mit all den wunderbaren Begleiterscheinungen, die er so sehr schätzte. Geld floss reichlich, die Welt lag ihm zu Füßen. Zumindest die von Playa del Inglés. Bald bestimmte er die Kollektionen, handelte die Konditionen mit den Lieferanten und Hotels aus und bestimmte die Preispolitik. Er war der ungekrönte Mode-King. Er lernte viele Menschen kennen, am liebsten Frauen, das kanarische Klima brachte ihn jeden Morgen in absolute Hochstimmung, und, wenn dann doch mal ein Tief im Anflug war, warf er ein paar Stimmungsmacher ein. Er hatte es wieder mal geschafft und träumte bereits von einem eigenen Mode-Label und selbst entworfenen Kollektionen. „JF-Collection“ würde die Welt erobern. Aber für John war das nur eine Etappe. Er wollte mehr. Als ersten Schritt die Teilhaberschaft in Peters Modefirma, weil der sowieso nur noch das Geld absahnte, den Lebemann spielte und alles andere John überließ. Aber er lief mal wieder gegen Beton. Alle wohldurchdachten und mit Zahlen belegten Expansionspläne stießen bei Peter auf taube Ohren, Unverständnis und sogar Misstrauen. „Spinner“ war noch die netteste Bewertung seiner Ideen, die das Unternehmen, ihr Unternehmen, weit nach vorn gebracht hätte. Weil er aber felsenfest davon überzeugt war, dass sein Noch-Chef gerade einen Riesen-Fehler machte, versuchte er, seine Pläne, über Peters Kopf hinweg, direkt bei den Herstellern anzubringen. Aber diese Blödmänner verstanden noch weniger, welche Chance John ihnen bot und hatten nichts Besseres zu tun als Peter zu erzählen, dass er - an ihm vorbei - eigene Interessen durchsetzen wollte. Und das war’s dann mal wieder. Die Unfähigen taten sich zusammen, und er war draußen. Wieder mal von gleich auf jetzt, wieder mal ein freier Fall von ganz oben nach ganz unten, wieder mal schuldlos. Wohnung weg, Luxuskarosse weg, Frauen weg und die Gelder, die er noch von Peter zu bekommen hatte, sowieso. Und mangels Kohle gab es nicht mal die Möglichkeit, ihn zu verklagen. Oder sogar mit neuen Ideen durchzustarten. Luxus kostete Geld, und ganz besondere Ansprüche noch mehr. Besondere Ansprüche hatten aber die fiese Konsequenz, dass in der Kasse schnell Ebbe herrscht, so dass kaum etwas übrigblieb, das man hätte zurücklegen können. Aber wer denkt schon in Phasen des Überflusses ans Zurücklegen für schwierigere Zeiten?
Johns Gedanken wurden durch ein furchtbar knirschendes Geräusch gestört. Ein – wie es klang – ziemlich schwerer Schlüssel wurde in das Türschloss geschoben, mindestens zwei Mal umgedreht, ein Riegel zur Seite geschoben, und dann schwang die graue Stahltür quietschend nach außen auf. Im Türrahmen stand ein Männlein, dessen Uniform ihm viel zu groß war und konturenlos um den Körper schlabberte. Er schepperte mit dem riesigen Schlüsselbund, und die ganze Szene erinnerte John vage an ein Märchen, das ihm seine Mutter immer erzählt hatte. Der Name fiel ihm partout nicht mehr ein, dafür aber explosionsartig der Rest der Nacht. Er war gestern Nacht so sehr mit der Eroberung einer neuen Flamme beschäftigt gewesen, dass er mit seinem inzwischen reichlich besoffenen Kopf nicht mitgekriegt hatte, dass seine Saufkumpanen sich nach und nach vom Acker gemacht hatten, natürlich ohne zu bezahlen. Und als er die Kleine dann endlich überzeugt hatte, dass es bei ihr zu Hause doch viel kuscheliger wäre als in dem unromantischen Bett seines Luxus-Hotels an der Alster - das er natürlich gar nicht hatte, aber wen interessierte das schon? –, rutschte er mühsam und unkontrolliert von seinem Barhocker und kündigte den wenigen noch anwesenden Gästen lautstark an, vor dem Aufbruch mit seiner Süßen noch mal dringend pinkeln zu müssen. Die Rechnung, die ihm die Schlampe von Kellnerin daraufhin präsentierte, fegte er fahrig vom Tresen und erklärte sich dafür nicht zuständig, weil er schließlich von den anderen immer eingeladen worden war. Daraufhin hatte die kampferprobte Frau den Wirt geholt, den er schon seit Jahren kannte und der ihm schon manchen Euro aus den Rippen geleiert hatte. John sah das Problem damit in besten Händen. Er erzählte Manni in seinem Suffkopf noch mal die gleiche Geschichte, zog dessen Argument, dass er schließlich alle Runden geordert hatte, lautstark ins Lächerliche und schlug dem Wirt die Hand weg, mit der er die Rechnung vor seiner Nase herumwedelte. John hatte einfach keinen Bock auf diese Nerverei. Die unverhohlenen Drohungen des Wirtes cool ignorierend, ging, oder besser wankte er, wie angekündigt zum Pinkeln. Er stolperte durch die nächste Tür und landete prompt auf dem Damenklo. Dumpfbacken! Konnten die das nicht deutlicher beschriften? Leise vor sich hin schimpfend, versuchte erungeschickt, die Hose aufzubekommen. Was sollte das eigentlich, ihn wegen dieser bescheuerten Rechnung anzumachen! Die müssten doch wissen, dass nicht er die vielen Runden bestellt hatte. Aber wahrscheinlich hatte Manni, dieser Dröhnkopf, nicht mitbekommen, dass die anderen sich nach und nach verpissten, und wollte jetzt seine Kohle retten. Aber nicht mit ihm. Die anderen hatten die Zeche geprellt, nicht er! Als John dann mangels Männer-Urinal schwankend vor der Kloschüssel des Frauen-ECs stand und seinen Strahl spielerisch von links nach rechts und wieder zurück steuerte, hatte er den Disput mit dem Wirt schon vergessen und schwelgte in der Bewunderung für sich selbst und sein unnachahmliches Talent, Menschen manipulieren und konsequent seine Interessen umsetzen zu können. So wie eben mit der Rechnung oder mit seinem Übernachtungsproblem, das er auf so köstliche, vielversprechende Art gelöst hatte. Die Vorfreude auf die kommende Nacht ließ ihn geil werden. Und morgen würde er dann schon eine andere Blöde finden. Schließlich war die Welt voll davon.
Als er in den Schankraum zurückstolperte, stand er einem Riesenaufruhr gegenüber. Zwei mürrisch dreinblickende Polizisten – „Pat und Patachon“ schoss es ihm durch seinen vollgedröhnten Kopf, und er musste unwillkürlich grinsen - und die restlichen Gäste hatten sich zusammengerottet und warteten auf ihn. Und seine neue Eroberung zeigte ungeniert mit ihren grellrot lackierten Fingernägeln, die eben noch eine herrliche Hauptrolle in seinen amourösen Phantasien gespielt hatten, auf ihn. Der dickere der beiden Polizisten kam direkt auf ihn zu.
„Ihre Papiere, bitte“. Immerhin klang das nicht unfreundlich; da hatte John schon ganz andere Sachen mit Gesetzesvertretern erlebt. „Warum?“ Johannes – auf einmal fühlte er sich wieder wie Johannes - versuchte akzentuiert und deutlich zu sprechen und seine üblicherweise schnell aufkeimende Aggressivität gegenüber jeder Art von Autorität zu unterdrücken.
„Warum wollen Sie meine Papiere sehen? Ich bin deutscher Staatsbürger und ich habe das Recht, darüber informiert zu werden.“ Selbst mit seinem besoffenen Kopf merkte er, welchen Quatsch er da von sich gab und dass der angestrebte deutliche und selbstbewusste Vortrag eher ein unverständliches Gelalle war. „Gibt es irgendeinen besonderen Grund dafür, dass Sie meine Papiere sehen wollen?“ Der Dicke musterte ihn missbilligend.
„Sie werden von dem Wirt der Zechprellerei beschuldigt. Und, wenn ich Sie mir so ansehe, kann die Summe nicht gerade gering sein. Sie können ja kaum noch auf den Beinen stehen.“
„Sechshundertzweiundsiebzig Euro und 70 Cent. Ohne Trinkgeld natürlich“, tönte es anklagend aus der Ecke des Wirtes. Er sah auf seinen Zettel. „12 Essen, 3 Flaschen vom besten Schampus, diverse Bier, Obstbrände, Calvados, Grappas und Avernas. Einmal quer durchs Getränke-Sortiment.“
John war nicht auf Anhieb klar gewesen, was „Avernas“ waren. Aber irgendwie war ihm das auch egal. „Verstehe ich nicht“, versuchte er die Situation zu retten. „Alle hier können bezeugen, dass ich eingeladen war. Von den Typen, mit denen ich zusammengehockt habe. Meine Bekannte…“, er versuchte verzweifelt, sich an den Namen seiner neuen Flamme zu erinnern, zeigte dann aber einfach mit dem Finger auf sie, „die da kann das bestätigen. Sie saß schon mit den Kerlen zusammen, als ich dazukam. Fragen Sie sie doch.“
Der lange, dürre Polizist wandte sich an – plötzlich fiel John auch der Name wieder ein – an Chantalle. „Können Sie das so bestätigen?“
„Eigentlich nicht, jedenfalls nicht so direkt“, fiel ihm das Junghuhn in den Rücken. „Zumindest klang es ständig so, als ob der da“, sie zeigte nun ihrerseits unmissverständlich auf ihn, vermutlich, weil ihr Johns Name nicht mehr besonders wichtig war und sie ihre Haut retten wollte, „im Geld schwimmen würde und die ganze Welt kaufen könnte. Obwohl, das ist nicht ganz o.k.“ John atmete durch, weil er sicher war, dass Chantalle nun alles so erzählen würde, wie es wirklich war. „Wenn ich ihn richtig verstanden habe, gehört sie ihm ja schon“, setzte sie dann etwas leiser hinzu und lächelte ironisch.
„Typisch“, dachte John noch. „Wenn sie glauben, dass man ihnen die Welt zu Füßen legt, schnurren sie wie ein liebestolles Kätzchen, und wenn dann der Traum zu zerplatzen droht, fauchen, kratzen und beißen sie um sich. Und ziehen weiter.“ John spürte eine leichte Übelkeit aufsteigen, fühlte, wie die Magensäure unaufhaltsam immer höher stieg, und machte schließlich dem ganzen Theater ein jähes Ende, indem er das, was er die ganze Nacht in sich reingeschüttet hatte, mit einem Riesenschwall wieder von sich gab. Mitten in die gute Stube.
„So, jetzt bin ich nichts mehr schuldig. Schließlich habe ich eben alles wieder zurückgegeben. Ich gehe dann mal. Einen schönen Tag noch.“
Für John war die Sache damit erledigt und er machte sich Richtung Ausgangstür auf. Die angeekelten Proteste der wenigen noch gebliebenen Gäste, den wütenden Aufschrei des Wirtes und die resoluten Griffe der Polizisten, die ihn zum Streifenwagen zerrten und auf den Rücksitz drückten, nahm er dann auch schon mehr im Rausch wahr. Witzigerweise erinnerte er sich aber noch deutlich, dass er plötzlich laut loslachen musste, gar nicht wieder aufhören konnte und dafür genervt-fragende Blicke seines Abschleppkommandos einfing. Das war mal wieder ein typischer John. Zwar war der Abend nicht ganz so verlaufen wie erhofft, aber immerhin hatte er es wieder mal geschafft. Er hatte eine Bleibe für die Nacht gefunden. Und dann noch auf lau.
Zwei. Hannover/Deutschland.
Eigentlich hatte sie es schon lange gewusst. Viel zu lange. Aber einfach nicht wahrhaben wollen. So wie ein Kind, das die Augen ganz fest zukneift und sicher ist, damit unsichtbar zu sein. Oder eine Marathonläuferin, die einfach nicht anhalten will, obwohl sie das Ziel längst passiert hatte. Dabei gab es unübersehbare Indizien. Die sie aber konsequent ignorierte, weil sie sie partout nicht wahrhaben wollte. Diese spontan angesetzten Überstunden zum Beispiel, die natürlich sein mussten, weil sie Thomas’ nächstem Karrieresprung dienten, der, das spürte er ganz deutlich, unmittelbar bevorstand. Oder die geflüsterten Telefonate, die komischerweise immer gerade dann zu Ende waren, wenn Lissy unerwartet ins Zimmer trat. Der gemeinsame email-Account, der für sie ohne Vorankündigung plötzlich gesperrt war. Aus rein technischen Gründen, wie Thomas ihr wichtigtuerisch erklärte. „Weißt du, Schatz, die vielen vertraulichen Mails, die ich jetzt von der Bank bekomme. Das verstehst du doch. Richte dir doch einfach einen eigenen Account ein.“ Als ob sie das mal eben so könnte! Und dann diese ständigen SMS, die eigenartigerweise meist spät abends, kurz vorm Insbettgehen, mit penetrant anschwellendem Beep einliefen und die ihr Mann mit der unmöglichen und wirklich rücksichtslosen Arbeitsweise des Chefs kommentierte, der sich gerade von seiner Frau getrennt hatte und plötzlich nachtaktiv war. Bei allem und jedem ging es um seine Karriere. Schließlich opferte sich Thomas doch nur für ihre gemeinsame Zukunft auf. Und das müsste Lissy ja wohl verstehen, akzeptieren und vor allem mittragen.
Sie hatten sich vor etwas über drei Jahren auf einer Vernissage im Sprengel-Museum am Maschsee kennengelernt, und es hatte einfach Bang gemacht. Lissy - eigentlich hieß sie nach ihrer Oma Elisabeth, aber schon in der Schule war daraus Lissy geworden, und genauso fühlte sie sich auch - hatte die Einladung von ihrer Chefin und Freundin Brigitte bekommen, für die solche Events das ideale Terrain waren, ihrem liebsten Hobby nachgehen würde: Männerjagen. Wie sie es selbst nannte. Brigitte war entgegen ihrer Überzeugung immer noch Single, obwohl jede neue Bekanntschaft genau der Mann war, auf den sie schon ein ganzes Leben gewartet hatte. Bis sich der Traumtyp wieder als Mogelpackung entpuppte und die Jagd von vorn begann. Nicht, dass Brigitte zu der Art Frauen gehörte, die ständig mit einem anderen ins Bett hüpften. Im Gegenteil: sie setzte die Sprunghöhe für ihre Kandidaten sehr hoch an und ließ sich auch dadurch nicht beirren, dass die meisten schon beim ersten Mal rissen. Sie gab die Höhe der Messlatte an, und damit basta. Das problematischste Hindernis in diesem Parcours war wohl Brigitte selbst, ihr schier unbesiegbares Selbstbewusstsein und dieser vehement gelebte „Hoppla jetzt komme ich“-Anspruch, an dem jeder Kerl scheitern musste, dessen männertypisches Rumgegockele primär schwanzgesteuert war. Nicht etwa, dass Brigittes Stärken auf der intellektuellen Ebene lagen und tiefsinnige Gespräche ihr viel bedeuteten. Diese Geduld hätte sie gar nicht aufgebracht. Sie wollte anerkannt sein, und zwar so, wie sie nun mal war. Ihr Lebenszug fuhr ständig unter Volldampf. Sie war lebenslustig, kontaktfreudig, flirtintensiv, verdrehte den Männern mit einer unnachahmlichen Art den Kopf und ließ sie dann mit ihren pochenden Erwartungen einfach stehen. Ihre Maxime waren Luxus, Großzügigkeit und Stil. Wer ihr das bieten konnte, war schon ganz schön weit vorn. Allerdings, um neben Brigitte bestehen zu können, mussten verdammt viele weitere Punkte ihrer Stellenausschreibung erfüllt werden. Und von solchen Männern, das musste Lissy sich jeden Tag anhören, von solchen Männern gab es einfach viel zu wenig. Leider.
Und so war Lissy, wie die Jungfrau zum Kind, zu einer VIP-Einladung für die Vernissage im Sprengel-Museum gekommen. Weil Brigitte einen Lückenbüßer brauchte. Sie konnte, trotz der hohen Zahl von Bewerbern, keinen passenden Begleiter auftreiben, und allein aufzulaufen, war nun mal nicht ihr Stil. Das Sprengel-Museum ist einer von Hannovers Museumstempel für moderne Kunst und zählt mit Exponaten aus dem deutschen Expressionismus und der französischen Moderne zu den bedeutendsten Kunst-Museen des 20. und 21. Jahrhunderts. Lissy hätte wirklich zu gern gewusst, wie Brigitte wieder an solche VIP-Karten gekommen war. Aber letztlich war es auch egal. Sie hatte eher Feierabend gemacht, sich richtig aufgebretzelt, ihren schönsten Fummel und die unbequemen, aber sexy aussehenden Highheels aus dem Schuhkarton ganz hinten im Kleiderschrank geholt und aufgeregt dem weiteren Abend entgegengesehen, weil sie wieder mal in eine Welt eintauchen würde, die nicht die ihre, aber umso spannender war. Brigitte wurde wie immer schnell von Männern umschwärmt und zog ihre Show ab. Lissy fühlte sich dagegen ein wenig verloren. Alleingelassen, klein und unwichtig. Sie hatte sich etwas abseits hingestellt, auch weil sie nicht recht wusste, was von der Besucherin einer Vernissage eigentlich erwartet wurde. Geduldig hatte sie den langweiligen Begrüßungsreden und Lobeshymnen auf Künstler, Gastgeber und Sponsoren gelauscht und höflich mitgeklatscht, wenn alle anderen in Bravorufe und schiere Begeisterungsstürme ausgebrochen waren. Und schließlich hatte sie dann, mit dem dritten oder vierten Glas Champagner in der Hand, das erste Mal in ihrem Leben vor einem echten Picasso gestanden. Mühsam hatte sie versucht, das glänzende Messingschild zu entziffern. Woman in an armchair. Leihgabe Collection Mrs. Victor Gantz, New York. Und sich dabei wichtig und, dem Schampus sei Dank, plötzlich wunderbar leicht und beschwingt gefühlt. Auch, weil sie es in ihrer Vorbereitungshektik nicht geschafft hatte, noch etwas Essbares runterzuschlingen. Ihr Magen knurrte laut und vernehmlich, so dass sie sich immer wieder, peinlich berührt, umsah, ob es jemand der umstehenden Gäste hören würde. Brigitte hatte schließlich angekündigt, dass es auf einer Vernissage immer richtig gute Sachen zu essen gibt. Aber davon war weit und breit nichts zu sehen gewesen.
Indem sie ihren Kopf mal nach links, mal nach rechts verbog, versuchte sie zu erkennen, warum das Bild ausgerechnet so hieß, weil sie weder die Frau noch den Sessel wirklich erkennen konnte. Dazu hatte sie, wie alle anderen Gäste auch, diese nachdenklich wissende Miene aufgesetzt, die allen signalisierte, dass hier Sachverstand dominierte, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Ahnung von Kunst hatte. Als plötzlich jemand neben ihr vorlaut witzelte, dass dieses berühmte Kunstwerk doch eigentlich so aussehe, als hätte der dreijährige Sohn seines Freundes seine Buntstifte ausprobiert, begann sie in ihrer Champagnerstimmung hemmungslos loszuprusten, weil sie just den gleichen Gedanken gehabt hatte. Und da der irre gut aussehende Kommentator nicht gerade flüsterte, hatte er postwendend die geballte Ladung von entsetzten Bemerkungen und empörten Blicken der wahren Kunstkenner, oder von denen, die es meinten zu sein, abbekommen. Allerdings schien ihm das wenig auszumachen. Er hatte unbekümmert weitergeblödelt und Lissy mit jeder Sekunde mehr in seinen Bann gezogen. Jedes Wort war ein elektrisierender Schlag gewesen und jedes Lächeln eine weitere Prise Zauberstaub. Schlagartig war es ihr klar geworden, dass er der Prinz sein musste, dem sie in ihren Träumen schon tausendmal begegnet war. Sie konnte nicht anders, als immer wieder zu ihm rüber zu sehen. Und gleichzeitig krampfhaft den Eindruck zu vermitteln, dass sie die Kunstwerke viel mehr interessierten. Er sah umwerfend süß aus, schlank und groß, dazu ein Drei-Tage-Bart, der ihm das verwegene Etwas eines unerschrockenen Abenteurers gab. Und dann diese blitzenden Augen, in denen sich das ganze Universum widerzuspiegeln schien. Verziert mit einem verschmitzten Lächeln, das, wenn er es anknipste, liebevolle Grübchen in sein Gesicht zauberte. Über allem Wuschelhaare, die offensichtlich, wenn überhaupt, nur mit ganz viel Gel in den Griff zu bekommen waren. Wie mochte erst sein Body aussehen? Sie hatte sich sofort in ihn verliebt und war absolut sicher, dass sie gerade ihrem zukünftigen Mann begegnet war. Und als er sie dann auch noch direkt ansprach, war Lissy endgültig auf Wolke sieben angekommen. Natürlich hatte es schon den einen oder anderen Mann in ihrem bisherigen Leben gegeben, aber so einer…
„Darf ich mal ehrlich sein?“ Lissy hatte ihn fragend angesehen. „Du siehst nicht unbedingt so aus, als könntest du viel mit Kunst anfangen.“ Der macht ja keinen großen Umweg, der geht ja gleich ganz frontal auf dich los, war es Lissy durch den Kopf geschossen. Und dann noch per du. „Oder liege ich damit falsch?“, entschärfte der die Szene.
Nicht ungeschickt, mein Lieber, dachte Lissy, fragte dann aber bewusst in der Sie-Form, um es ihm nicht zu einfach zu machen: „Wie kommen Sie darauf?“
„Na ja, du hast eben gelacht. Alle anderen hätten mich liebend gern in Grund und Boden gestampft. Aber du hast gelacht.“ Er grinste. Die Grübchen hatten sich wieder in sein lächelndes Gesicht gegraben, seine Augen das ganze Universum versprochen und die Schmetterlinge in ihrem Bauch Rock n’ Roll getanzt. Und zwar in Höchstform.
„Erwischt. Eigentlich bin ich nur per Zufall hier“, hatte sie drauflos geplappert, um ihre Unsicherheit zu verstecken. „Habe die Einladung von einer Freundin geschenkt bekommen und war einfach mal neugierig, was auf einer Vernissage so abgeht. Kunst ist tatsächlich nicht so mein Ding. Die Bilder gehen ja noch, aber die Menschen? Das Gegackere, Gescharre und Gehacke hat was von einem Hühnerhof, wenn der Bauer kommt, um Körner auszustreuen und die Eier zu holen. Ist nicht meine Welt.“
Mein Gott, hatte Lissy in sich hineingestöhnt, was redest du da für einen Scheiß, bemerkte dann aber überrascht, dass Traummann sie unverhohlen neugierig und interessiert anstarrte.
„Oh je, wenn die Kunstwelt wüsste, dass sich jetzt schon zwei Banausen eingeschlichen haben“. Er war elegant über ihre offensichtliche Unsicherheit hinweggegangen. „Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe die Karte von einer…, äh Freundin und hatte heute Abend nichts Besseres vor. Man muss ja schließlich nicht gleich Experte sein, um ein paar Bilder anzuschauen. Schließlich hat ein Pilot auch keine Ahnung vom Flugzeugbau, und trotzdem fliegt er.“ Ihr Kunstbanausen-Freund schmunzelte über seine witzige Pointe. „Für freies Trinken und Essen kann man seine Ideale ja schon mal ein Stündchen über Bord werfen, oder?“
Lissy war förmlich dahingeschmolzen und hatte versucht, seine flapsige Art aufzunehmen. „Fragt sich, wann es endlich die versprochenen Schnittchen gibt. Wenn das so weitergeht, bin ich breit wie ´ne Natter und tanze noch einen Schleiertanz auf dem Tisch.“
„Na, das wäre doch mal eine echt spannende Show-Einlage, da würdest du die Spießer so richtig aufmischen. Soll ich schon mal den Tisch freiräumen?“ Er wurde laut und blickte herausfordernd umher. „Bitte alle mal herhören…“ Die alle hatten überrascht zu ihnen rüber geschaut. Lissy war knallrot geworden, hatte die ein bis zwei Meter zwischen ihnen mit einem Schritt überbrückt, ihm die Hand vor den Mund gehalten und sich nun ihrerseits an das neugierig gewordene Publikum gewandt.
„Entschuldigung. Ist gar nichts. Ist wirklich nichts.“
Das Interesse des erlauchten Publikums hatte allerdings nicht wirklich nachgelassen. Im Gegenteil. Nun sahen alle neugierig zu ihnen rüber, auch die, die bisher noch nichts mitbekommen hatten. Die Sprachlosigkeit war zu verstehendem Lachen geworden, das Getuschel zu einem gespannten Gemurmel.
„Ehrlich“, wiederholte Lissy laut, während sie dem Schönen immer noch den Mund zuhielt, „da ist wirklich nichts, was interessanter wäre als diese wunderschönen Bilder hier.“ Lissy konnte einfach nicht glauben, dass sie es gewesen war, die den Mut aufgebracht hatte, sich lautstark an völlig fremde Menschen zu wenden. „Bist du wahnsinnig“, zischte sie dem fremden Typen zu. „Findest du das etwa witzig? Was soll das, bitte schön?“
„Super-Show. Echt abgefahren. Findest du nicht? Kompliment! Du bist einsame Spitze. Habe ich im ersten Moment gespürt. Ich heiße übrigens Thomas. Und du?“, entgegnete er völlig ungerührt, nachdem er zuerst ihr Handgelenk umschlossen, ihr intensiv in die Augen gesehen, ihre Hand geküsst und sie schließlich festgehalten hatte, als ob er sie nie wieder loslassen wollte. „Müssen wir unbedingt wiederholen. Das ist’s, was die Welt sehen will. Und ich auch.“ Dann hatte er sich blitzschnell um die eigene Achse gedreht und sich erneut an die Vernissage-Besucher gewandt, die die beiden immer noch beobachteten. „Diese bezaubernde junge Dame hat recht, es ist tatsächlich nichts passiert, das Sie interessieren müsste, meine Damen und Herren. Aber“, nach „aber“ machte er eine bedeutungsschwere Pause, „da Sie offensichtlich sehr neugierig sind und damit Sie nachher nicht unbefriedigt nach Hause gehen müssen und morgen Ihren Lieben was zu berichten haben, erzähle ich jetzt was ganz Wichtiges: Ich, Thomas Krantz, habe mich gerade unsterblich in diese wunderbare Frau verliebt und gedenke, sie zu heiraten.“
Plötzlich war die Vernissage Nebensache geworden, sie beide waren die Stars. Begeisterter Beifall war aufgebrandet, weil die Menschen gerade das real erlebten, was ihnen sonst nur in ihrer Daily Soap im Vorabendprogramm das Herz zerreißt. Lissy hätte im Boden versinken mögen, aber Thomas hatte sie immer noch festgehalten, was ihr, wenn sie ehrlich war, gefiel. Am liebsten hätte sie sich ihm so richtig in den Arm geschmissen und ihm ins Ohr gesäuselt, dass er sie nie wieder loslassen dürfe. Aber das hatte sie dann doch nicht gewagt.
„Lissy“, flüsterte sie wie in Trance, „ich heiße Lissy.“
Anfangs lief es nicht so besonders gut mit ihnen, weil er noch in einer anderen Beziehung steckte, was er ihr allerdings nicht erzählte. Lissy war selbst darauf gekommen. Als sie gemeinsam das Museum verlassen hatten, war der Zauber ein wenig abgeflaut, und die Schmetterlinge tanzten nur noch langsamen Walzer. Er hatte sie bis vor die Haustür gebracht, sie zart links und rechts auf die Wange geküsst, ihr artig für den wunderschönen Abend gedankt und war mit einem letzten Winken einfach so abgeschwirrt, nachdem sie immerhin die Nummern ausgetauscht und verabredet hatten, am nächsten Tag zu telefonieren. Kein „Gehen wir zu dir oder zu mir?“, kein „Noch einen Kaffee oben bei ihr?“, keine Briefmarkensammlung. Nicht mal ein Kuss, der Hoffnung auf mehr machte. Lissy war aufgewühlt und verunsichert zurückgeblieben und wusste nicht so recht, ob er nun raffiniert oder doof war.
Lissy entschied sich für raffinert und interpretierte den Austausch der Telefonnummern für sich selbstverständlich so, dass Thomas anrufen würde. Schließlich war sie durch die sehr konservativen Einstellungen ihrer Mutter geprägt. Und die hätte ihr bestimmt genau den Ratschlag gegeben, dass es sich nicht schickt, Kerlen hinterherzutelefonieren, weil es nun mal so wäre, dass der Mann das Heft in der Hand halten und Frauen eben abwarten müssten. Aber der Typ ließ sie zappeln, bis sie schließlich am dritten Tag die Nerven verlor und Thomas anrief. Sie schob den Zettel mit seiner Telefonnummer ewig lange hin und her, nahm das Handy xmal in die Hand und legte es wieder ab, bevor sie schließlich das erste Mal seine Nummer wählte. Dann aber nach dem zweiten Freizeichen ganz schnell auf das rote Telefon-Symbol drückte, so als wäre das Mobiltelefon plötzlich glühend heiß geworden. Der zweite Anlauf ging dann total daneben. Sie hatte ihren ganzen Mut zusammengenommen, erneut gewählt und durchgehalten, aber als sich dann endlich jemand meldete, war das nicht Thomas gewesen, sondern eine ziemlich schrille und verrauchte Frauenstimme. „Angie Persdorf“. Da sie an ihren Museumsabend total aufgeregt und unkonzentriert gewesen war, war sie sicher, eine falsche Nummer aufgeschrieben oder sich verwählt zu haben.
„Oh, Entschuldigung, da bin ich wohl falsch verbunden“, stotterte Lissy und wollte schon auflegen.
„Mit wem wollen Sie denn sprechen?“, unterbrach sie Rauchstimme.
„Äh, mit Thomas“. Lissy musste auf den Zettel gucken, weil ihr sein Nachname nicht sofort einfiel, „mit Thomas Krantz“. In ihren Träumen hieß ihr Märchenprinz eben immer nur Thomas.
„Ach Thomas. Der ist eben mal weg und hat sein Handy hier liegenlassen“.
Hier? Lissy wurde noch unsicherer und drohte, in das Loch zu stürzen, das sich gerade vor ihr auftat. Was mag „hier“ bedeuten? Wer war die Frau überhaupt? Lissy war nur noch verwirrt. Eigentlich hatte sie gehofft, unmittelbar an die wunderschönen Stunden im Sprengel-Museum anknüpfen zu können. Und jetzt das!
„Wer sind Sie überhaupt?“ Die Frage der Unbekannten brachte sie nun vollends aus dem Konzept. Am liebsten hätte sie einfach aufgelegt.
„Ich…, ich bin Lissy“. Ihr Hals war wie zugeschnürt, und jedes Wort kostete sie unendliche Überwindung. „Thomas und ich haben uns vorgestern auf einer Vernissage kennengelernt und hatten verabredet zu telefonieren.“
Die Stimme am anderen Ende zögerte. „Ach, schon wieder so ne Tusse. Thomas schleppt ständig irgendwelche bescheuerten Zufalls-Bekanntschaften an. Langsam nervt das!“
„Sind Sie seine Mutter oder so?“
„Mutter?“ Ihr Gegenüber wurde noch rauer. „Pass mal auf, Herzchen. Ich lebe seit zwei Jahren mit Thomas zusammen und behaupte einfach mal, dass er in festen Händen ist. Am besten, du vergisst den Knaben und verpisst dich. Ruf ja nicht wieder an. Tschüss.“ Damit legte sie auf und ließ eine verdatterte, enttäuschte und entmutigte Lissy zurück. Der Traumprinz war soeben wieder zum Frosch geworden.
Der Frosch rief dann am nächsten Nachmittag an, und ganz offensichtlich hatte ihm seine Zwei-Jahres-Angie nichts von ihrem Anruf erzählt. Er war wieder der große, vorlaute Junge vom ersten Abend, und Lissys Hormone liefen sofort wieder Amok. Sie war hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Prinz und Frosch, zwischen Lissy und Frau.
„Ich bin’s. Thomas. Sorry, ich habe es gestern einfach nicht geschafft, anzurufen. Immer kam irgendwas dazwischen.“
Wieso gestern? Sie waren für vorgestern verabredet gewesen! Lissy fand seinen Einstieg ziemlich enttäuschend, er punktete nicht besonders. 1: 0 für den Verstand, zählte sie für sich. 1: 0 gegen Thomas.
„Ich muss immer wieder an unseren Abend denken. Du warst umwerfend, Lissy, einfach umwerfend. Ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben.“
Na, schon besser. Könnte man durchaus als Treffer bewerten. 1: 1.
„Weißt du eigentlich, was du mit mir angestellt hast? Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich laufe rum wie Falschgeld, muss zu den unmöglichsten Gelegenheiten an dich denken, wache mitten in der Nacht mit Herzklopfen auf und schwebe neuerdings ständig mindestens nen Meter überm Boden. Ich muss einfach mehr von dir wissen.“
Das klingt gut. Lissy merkte, wie ihr Gefühlsbarometer weiter nach oben kletterte und ihr Widerstand in gleichem Maße bröckelte. Weiter so, Thomas. Weiter! Das waren mindestens 2 Punkte. 3: 1 für Dich, mein Lieber.
„Wir müssen uns sehen! Gleich heute Abend. Hast du Zeit? Ich kenne da ein kuscheliges Restaurant in Herrenhausen. Ich hole dich ab. Ist acht o.k.?“ Die Worte sprudelten ungebremst aus seinem Mund. Und mit jedem Satz schoss die Punkteskala nach oben. 5: 1, 6: 1, 7: 1.
Langsam, Lissy, ganz langsam. Sie versuchte, sich und ihre Gefühle zu bremsen. Der spielte doch mit gezinkten Karten. „Acht Uhr? Heute Abend? Ja, das würde gehen.“ Und dann schoss sie ihren Giftpfeil ab. Einfach so, ohne Vorwarnung. „Sag mal, kommt Angie auch mit?“
Sie hörte, wie Thomas zischend einatmete und die Luft anhielt. „Wie kommst du darauf?“, fragte er gedehnt und spielte auf Zeit.
„Ist doch egal. Ich habe dir eine Frage gestellt und will eine Antwort.“ Lissy versuchte, überlegen zu wirken und fand, dass sie das richtig gut machte. „Also, wer ist Angie?“ Lissy hatte durchs Telefon hören können, wie seine Gehirnzellen ratterten, um eine passable Erklärung zu finden. Das war ganz klar ein Punkt gegen Thomas. Nur noch 7: 2.
Endlich erwachte Thomas aus seiner Starre. „Es ist nicht so, wie du denkst. Ich kann das erklären.“ Lissy lächelte in sich hinein. Der ist auch nicht anders. Die klassische Standard-Antwort von Typen, die bei irgendwas erwischt wurden und nun verzweifelt nach einer Antwort suchten, um die Situation irgendwie zu retten. Das gibt einen deutlichen Zwei-Punkte-Abzug. 7: 4. „Na, dann erklär mal, da bin ich aber mehr als gespannt.“
„Aber erzähl doch erst mal, wie du auf Angie kommst. Kennst du die? Ne, die kannst du gar nicht kennen. Die verkehrt in ganz anderen Kreisen.“ Lissy merkte Thomas die Verunsicherung deutlich an und genoss ihre momentane Überlegenheit.
„In ganz anderen Kreisen? Na, die würde ich gern mal kennenlernen. Was sind denn das für Kreise, die du mir ja offensichtlich nicht zutraust? Aber ist ja auch egal. Offensichtlich fehlt dir der Mut zur Wahrheit. Also lass uns das Ganze einfach beenden. Tschüss, mach’s gut! War ein schöner Traum, ist aber bestimmt besser so.“
Lissy wollte schon auflegen, als sie seine verzweifelte Stimme hörte. „Warte, bitte warte, Lissy. Nicht auflegen. Bitte. Woher kennst du Angie?
Die Verzweiflung in Thomas’ Stimme schürte Lissys Hoffnung. „Als ich gestern die Nummer angerufen haben, die du mir gegeben hast, hatte ich eine Angie Persdorf dran, die mir schlicht und ergreifend erklärt hat, dass du schon längere Zeit mit ihr zusammenwohnst, dass du regelmäßig neue Tussen anschleppst und dass ich mich verpissen soll. Und darum stelle ich dir eine ganz einfache Frage“, sie überdehnte die Worte förmlich, „Wer ist Angie Persdorf?“
Und Thomas erklärte. Dass er tatsächlich seit knapp zwei Jahren mit Angie zusammenwohnen würde, dass sie aber inzwischen von einer Krise in die nächste schlitterten und sich nur noch zerfleischten. Dass Alkohol, Tabletten und Drogen im Spiel waren. Dass es jedes Mal dramatischer wurde, wenn er ankündigte, ausziehen zu wollen. Und er dann doch wieder blieb. Aus Angst um Angie, aus Bequemlichkeit, aus falscher Rücksichtnahme, aus Feigheit. Er konnte es wirklich nicht genau sagen. Keinerlei Schuldzuweisungen, keinerlei Ausflüchte, keinerlei überflüssige Erklärungen. Eine einfache Analyse der Situation, eine ehrliche Antwort. So empfand es zumindest Lissy.
Zwei Wochen später war Thomas bei ihr eingezogen, und ein halbes Jahr später waren sie verheiratet. Thomas war Banker und ordnete alle Facetten seines Lebens seinem großen Traum unter: der Karriere. Geldzähler sind von Haus aus konservativ. Stockkonservativ. Ein paar Wochen, nachdem er einen Großteil ihres Kleiderschranks in Beschlag genommen, seine umfangreiche Toilettenutensilien-Sammlung in ihrem Bad ausgebreitet und, weil Lissy gern auf rechts einschlief und die Löffelchenstellung liebte, die linke Seite ihres Bettes besetzt hatte, erzählte sie ihrer Mutter endlich von ihrer großen Liebe. Und postwendend kam die drängende Einladung nach Wolfenbüttel, einer Kleinstadt im Vorharz, wo die Eltern seit der Pensionierung ihres Vaters wohnten. Natürlich zum Mittagessen. Sonntags. Die abwartende Zurückhaltung wurde durch die blendende Erscheinung von Thomas, seine formvollendeten Manieren, die vielversprechenden Perspektiven einer Banklaufbahn und der gleich zu Beginn des Besuchs entdeckten Übereinstimmung ihrer konservativen Ideale schnell überwunden. Ihre Eltern waren von Thomas schwer begeistert, was, wie sie bald und häufig erfuhr, auf Gegenseitigkeit beruhte. Bald hatte sie das Gefühl, nur noch eine unbedeutende Statistenrolle zu spielen. Die Hauptrolle hatte Thomas übernommen.
Anfangs konnte sie prima damit leben, weil ihr Traumprinz sie jeden Tag auf Händen trug. Bald zogen sie in eine größere Wohnung, und Lissy begann das Leben einer Bankiersgattin zu leben. Luxus, Empfänge, Showbiz, bewundernde Komplimente, und, weil Thomas‘ Eltern recht früh bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren und ihm, ihrem einzigen Kind, ein ganz passables Vermögen hinterlassen hatten, keine Geldsorgen. Ihre Hochzeit war der perfekte Traum. So eine, wie sie sie bisher nur aus diesen Hochglanz-People-Magazinen kannte. Natürlich ganz in Weiß, mit Unmengen von illustren Gästen, von denen sie allerdings die meisten überhaupt nicht kannte, und mit vor Stolz platzenden Eltern, die jedem erzählten, dass diese wunderschöne Frau - damit war sie, ihre kleine Lissy, gemeint - ihre Tochter sei. Und natürlich hatte es auch die filmreife Hochzeitsreise gegeben. Das Ziel hatte Thomas ihr, trotz unablässigen Bohrens und Drängens, bis zuletzt nicht verraten. Den einzigen Hinweis, den er ihr gab, war, dass es dort, wo sie hinfahren würden, warm war und sie alles einpacken sollte, von Bikinis über Strandfummel bis zur eleganten Abend-Garderobe. Und so hatte sie immer noch keinen blassen Schimmer, was sie erwartete, als in der Morgendämmerung eine schneeweiße Stretchlimousine vorfuhr, die Hochzeitsgäste ein Spalier bildeten, rhythmisch klatschten, als sie durchschritten, letzte Abschiedsküsse verteilten und schließlich unter lautem Gejohle in den Tag hineinfuhren. Sie hatte sich noch nie im Leben so wunderbar leicht gefühlt und wünschte sich, als sie sich in dem Riesen-Innenraum des Wagens an Thomas schmiegte, dass dieser Traum niemals enden würde. Die erste Etappe ihrer Hochzeitsreise war der Flughafen Frankfurt. Sie wurde zu einer Rallye aus Champagnerprickeln, Endlosküssen, Sehnsuchtskuscheln, Körpererkundung, Intensiv-Berührung und Vor-sich-Hindösen. Die Turbulenz der letzten Tage und die monotone Autobahnfahrt forderten immer wieder Ruhepausen. Aber, obwohl sie Thomas immer unanständigere Angebote ins Ohr flüsterte, widerstand er standhaft ihrem Drängen, endlich das Reiseziel zu verraten.
Auf dem Frankfurter Flughafen wurde es dann noch spannender. Thomas hatte ihr nach dem Einchecken sogar noch die Augen verbunden, damit sie ihr Ziel nicht zufällig auf einer der zahlreichen Anzeigetafeln erspähen konnte. Es war ein ungeheuer verwirrendes Gefühl gewesen, blind und verunsichert durch eine Masse drängelnder und schubsenden Menschen zu schlurfen, das auf- und abschwellende Stimmgewirr fremder Sprachen in sich aufzunehmen, die dringlichen „Last Calls“ unterschiedlichster Flüge gedanklich einzuordnen, die latente Angst zu unterdrücken, trotz Führung von Thomas mit irgendwem oder irgendwas zusammenzustoßen, undefinierbares Gescharre, Kichern, Gejohle zu verarbeiten, zwischendurch aber immer wieder Thomas‘ beruhigende Stimme und dann endlich sein befehlendes „Stopp“ zu hören. Er hatte sie ein paarmal um die eigene Achse gedreht und ihr dann mit einem zirkusreifen „Ta-ta-ra-ta“ die Augenbinde abgenommen. Sie stand vor ihrem Abfluggate und auf dem Display stand „Montego Bay“, „Montego Bay, Jamaica“.
Sie hatte einen Freudentanz hingelegt und ihn so heftig umarmt, dass er gerade noch so verhindern konnte, das Gleichgewicht zu verlieren und längs hinzuschlagen.
„Mensch, Thomas, das glaub ich nicht! Wie oft haben wir von den West Indies gesprochen, und jetzt…“, Lissy hatte vor Rührung geschluchzt, „und jetzt fliegen wir dort hin.“ Die Freudentränen waren immer heftiger gelaufen, sie hatte keinen Ton mehr rausbekommen und rechnete damit, jeden Moment umzukippen.
„Weißt du was, mein Schatz? Ich liebe dich von ganzem Herzen!“ Er hatte sie unerwartet heftig an sich gedrückt, und wieder hatte Lissy einen dieser magischen Momente erlebt, die unauslöschlich in ihr Lebensbuch eingebrannt sein würden. „Und ich bin unendlich glücklich mit dir. Wir haben zwei Super-Wochen in einem der besten Hotels auf der Insel vor uns. Wenn das nicht der absolute Mega-Start in unser gemeinsames Leben ist. Ich wünsche mir, dass wir diese Zeit nie vergessen werden.“ Und etwas sachlicher fügte er hinzu: „Ich wäre wirklich gern länger geblieben. Aber mehr als zwei Wochen geht leider nicht. Die Bank. Du verstehst.“
Und sie hatten wirklich eine märchenhafte Zeit in einer der luxuriösen Traumvillen Des Trident in Anchovy, Port Antonio. Der Blick aufs Meer war einzigartig, sensationell. Jeden Morgen hatte sie sich gekniffen, weil sie Angst hatte, alles nur im Traum zu erleben. Aber es war real, und viel zu schnell gewöhnte sie sich an diesen herzöffnenden Ausblick und wollte und wollte ihn nie wieder missen. Sonst hatten sie das Hotel kaum verlassen und jede Menge Spaß. Schließlich gab es diese riesigen, kuscheligen Lustmatratzen, perfekten und dezenten Roomservice und, wenn es dann sein musste, ein exzellentes Restaurant, das auch die exklusivsten Wünsche ohne großes Zögern und wie selbstverständlich erfüllte. Und mit unmittelbar ins Mark gehender Livemusic, die Bob Marley wieder lebendig werden und den karibischen Rhythmus ohne Umwege in Körper und Blut fließen ließ. Lissy war jedes Mal traurig gewesen, wenn der Reggae-Zauber vorbei war. Natürlich hatten sie das Hotel dann doch ab und zu verlassen, um auch die anderen Annehmlichkeiten des Hotels zu genießen. Die super cool aussehenden Lebensretter an ihrem Privatstrand zum Beispiel. Die Tauchausflüge zu vorgelagerten Korallenriffen, die von einer Vielfalt farbiger Fische bevölkert wurden, wie sie es sich nie hätten vorstellen können und die sie so wahrscheinlich auch nie noch einmal sehen würden. Das Standup-Paddeling, bei dem Lissy schon nach kurzer Zeit Weltmeisterin war. Zumindest war es ihr so vorgekommen, weil sie den sonst so sportlichen Thomas jedes Mal locker abgehängt hatte. Sonst waren sie nur selten vor mittags aus den Federn gekommen und genossen jede Sekunde ihrer Zweisamkeit. Thomas war täglich zu neuer Höchstform aufgelaufen und hatte jeden mit seiner fröhlichen und unkomplizierten Art mitgerissen. Bald waren sie im ganzen Hotel als die „Honeymooner“ bekannt, was für immer neue Jokes, schlüpfrigen Gesprächsstoff und viele Bekanntschaften sorgte. Die Zeit war sprichwörtlich wie im Flug vergangen, und als sie in Montego Bay in ihre Maschine nach Deutschland gestiegen waren, hatte Lissy das sichere Empfinden gehabt, einen unwiederbringlichen Traum zurückzulassen.