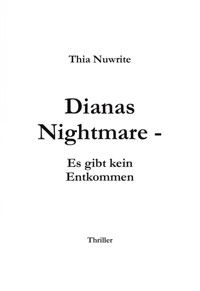Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn alles, woran du geglaubt hast, eine einzige Lüge war? Als Sue Lancasters Sohn zu einer Reise aufbricht und nicht zurückkehrt, beginnt für sie der wahre Albtraum. In der Dunkelheit aus Täuschung und Verrat, begreift Sue, dass nichts ist, wie es scheint - nicht einmal die Menschen, die sie liebt. Ein fesselnder Psychothriller über Vertrauen, Verlust und die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Thia Nuwrite
Home,
dead,
home
Psychothriller
Inhalt
Cover
Impressum
Prolog
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun - Ben -
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig -Ben-
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Epilog
Bisher von mir erschienen
Low Content Bücher
Danksagung
Über mich
Impressum
Cynthia Petereit
Lippstädter Str. 37
33397 Rietberg
Copyright © 2025 Thia Nuwrite
Alle Rechte vorbehalten
Die in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten, realen Figuren ist zufällig.
Kein Teil des Buches darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Herausgeberin kopiert, vervielfältigt, reproduziert oder verwendet werden.
Geschrieben und gestaltet von Thia Nuwrite
Coverdesign: Thia Nuwrite
Für meinen geliebten Ehemann Marcel Petereit.Mit zwei Kindern ist unser Leben manchmal auch ein echter Thriller. Wir sind aber großartige Autoren und schreiben jeden Tag einen Bestseller. Ich liebe dich.
Prolog
Traurig ließ er die Schultern hängen. Es war die Niedergeschlagenheit eines heranwachsenden, siebzehnjährigen, jungen Mannes. Monatelang hatte er auf die Reise nach Summersford gespart und sich irrsinnig gefreut. Er hatte bei versnobten Leuten den Rasen gemäht, war zum Jäten des Unkrauts auf die Knie gegangen und hatte sein verdientes Geld in diese eine Reise investiert. Doch bevor es am nächsten Tag losgehen sollte, verreckte sein Wagen mitten auf der Landstraße. Sie hörte seine Verzweiflung bereits am Telefon, als er sie anrief. Es brach ihr das liebende Mutterherz. Ben war immer noch ihr kleiner Junge. Für sie war er nie zu dem jungen Mann geworden, der er war. Ihm war bewusst, dass er die Reise streichen konnte. Ben war auf den Wagen angewiesen und die Reparatur würde sein emsig gespartes Geld verzehren.Der Wagen wurde in die Werkstatt und Ben freundlicherweise nach Hause gebracht. Schützend legte seine Mutter den Arm um ihn. Dabei dachte sie nach, wie sie ihm helfen könnte.
Er hatte sich so gefreut. Ben lief sogar eine Träne über die Wange. Er weinte eigentlich so gut wie nie und erklärte, dass er etwas ins Auge bekommen habe.
Doch seine Mutter kannte ihn besser, als jeder andere. Sanft strich sie ihrem kleinen Jungen über den haselnussbraunen Schopf. Ihr kam die eiserne Reserve in den Sinn, die sie für Notfälle aufbewahrte.
Wenn das keiner ist, weiß ich auch nicht, dachte sie und lächelte ihrem Sohn zu.
»Du gehst morgen auf deine Reise!«, flüsterte sie ihm zu. Ben blickte sie irritiert an. Seine Mutter verließ das Zimmer und kam kurze Zeit später mit einem Umschlag zurück.»Aber das ist doch deine Reserve für Notfälle?!«Wieder lächelte sie. Aus Ben hatte sie einen wirklich klugen Jungen gemacht, der sehr scharfsinnig war und sich gut Dinge merken konnte. Sie nickte.
»Das kann ich nicht annehmen, Mama«, flüsterte Ben und ließ abermals die Schultern hängen.
»Ich bestehe darauf, mein Schatz. Du warst so fleißig und du hast es dir einfach verdient.«Lächelnd überreichte sie ihm den Umschlag. In diesem befanden sich eintausend Dollar.
»Danke Mama.« Ben fiel ihr um den Hals. Seine Tränen waren umgehend verschwunden, er lächelte verwegen und seine Freude flammte wieder auf.
Er packte seine restlichen Sachen zusammen.
Am nächsten Tag war es so weit.
Sie war sicher, dass sie ihm etwas Gutes getan und ihm eine Freude bereitet hatte.Als sie ihn am Bus in den Arm nahm und ihm einen Kuss auf die Stirn gab, hätte sie nicht ahnen können, dass es das letzte Mal dieser sanften Geste sein würde, denn Ben kam in einem Sarg zurück.
Kapitel Eins
Sein Tod war noch kein Jahr her. Dieletzten Monate
hatte sie wie in Trance erlebt. Es kamen immer wieder neue Details ans Tageslicht. Sie hatte den mutmaßlichen Täter im Gericht gesehen. Selbstgefällig grinsend stand er da, bedeckte sein Gesicht mit einem Aktenordner und schien sich gegenüber der Öffentlichkeit keiner Schuld bewusst. Für die Termine im Gericht versuchte sie, nüchtern zu bleiben, obgleich es ihr schwerfiel, diese Welt ohne den täglichen Rausch zu überstehen. Doch sie raffte all ihre Kraft zusammen, stand auf, zog sich ordentlich an und kämpfte gegen den lähmenden Schmerz. Niemand hätte geglaubt, dass sie abhängig war. Niemand hätte vermutet, dass sie eine gebrochene Frau war, die eigentlich mehr tot als lebendig war. In gewisser Weise gab sich Sue Lancaster selbst die Schuld am Tod ihres Sohnes.
Warum?Womöglich hätte Ben seine Reise nicht antreten können, weil ihm schlichtweg das Geld fehlte. Das hatte sie ihm gegeben. Er war so glücklich, dass er fahren konnte.
Dieses Strahlen in seinen Augen. Auf ewig würde sie
daran denken, wenn sie an ihren Jungen dachte.
Aber hätte sie ihm das Geld nicht gegeben … wäre er nicht gefahren…Es waren Spekulationen, und vielleicht war die zuvor verreckte Karre ein Warnsignal, dass er nicht hätte fahren sollen, aber all das machte ihn nicht wieder lebendig und sie nur noch mehr verrückt.
Zu oft hatte sie verschiedene Szenarien durchgespielt: In den meisten davon kam er lebendig zurück nach Hause und schloss sie glücklich in seine Arme. Froh darüber, seine Reise gemacht haben zu können.
Doch ihr kleiner Junge kam in einem verdammten Sarg zurück.
Sue erinnerte sich noch genau an den Anruf der Polizei aus Summersford. Schon als sie sich meldeten, hatte sie es gewusst. Instinktiv und mit der größten Angst im Herzen hatte sie geahnt, was ihr der Polizist gleich mitteilen würde. Und sie sollte Recht behalten.
»Sein Name ist Ben!«, hatte sie dem Polizisten entgegengeschrien, nachdem er mehrmals von Benjamin Lancaster gesprochen hatte. Der Polizist hatte sich entschuldigt. Sue hatte nichts mehr gesagt. Man erklärte ihr, dass der Sarg überführt werde, dass er bald bei ihr sei.
Nach dem Telefonat war Sue blind und völlig besinnungslos in den nächsten Supermarkt gegangen und hatte sich eine Flasche billigsten Fusel gekauft. Zurück zu Hause hatte sie nicht lange gezögert, den Drehverschluss geöffnet und das Zeug in sich hineingekippt.
Es dauerte nicht lange, da war nicht nur die Hälfte der Flasche leer, sondern sie auch betrunken.
Doch sie machte weiter, versuchte die Dämonen in ihrem Kopf zu bändigen.
Er ist tot. Er ist tot. Ihr kleiner Junge würde nie wieder lächeln. Sue wusste nicht, wie lange sie auf dem Fußboden vor ihrem Kühlschrank gelegen hatte, ehe sie sich aufraffte und schwankend ins Bad fiel, sich den Kopf an der Toilettenschüssel anschlug, ehe sie den Deckel aufklappte und förmlich ihre Seele in die Keramik erbrach. Lange hing sie kotzend und einen elendigen Anblick bietend über der Toilette.
Sie musste ein abscheuliches Bild abgegeben haben. Beinahe mitleiderregend, mit strähnigen Haaren, die
Schüssel umarmend, animalische Brülllaute von sich gebend und mit einer blutenden Verletzung am Kopf. Danach war sie erschöpft ließ sich einfach neben der Toilette zu Boden sinken. Es war ihr schlichtweg egal, wie sie in diesem Moment aussah. Sue war auch irgendwann erschöpft eingeschlafen.
Sie lebte allein. Niemand würde nach ihr schauen oder sich auch nur einen Dreck um sie scheren.
Sie hatte doch nur noch Ben gehabt!Sue war zwar nach wie vor verheiratet, doch das galt mehr auf dem Papier als emotional. Von Greg hatte sie sich schon längst entfernt, nicht nur in Bezug auf die wohnliche Situation. Der Kontakt war eher sporadisch.
Greg schien sich seit jeher wenig für seinen Sohn zu interessieren. Doch daran dachte Sue in jenem Moment nicht. Einzig und allein die Frage, was in Summersford geschehen war, geisterte in ihrem Kopf herum.
Doch das schien auch nach Monaten nicht eindeutig geklärt werden zu können. Es gab widersprüchliche Aussagen, wenig bis gar keine Beweise und keine Augenzeugen. Sue befürchtete, dass der Tod ihres Sohnes nie aufgeklärt werden würde. Schlimmer noch, dass der Täter wieder auf freien Fuß kam und vielleicht ein neues Opfer fand.Doch das wollte und konnte sie nicht zulassen. Sie war überzeugt, dass er der Täter war. Sie war sicher, dass er sich seiner Schuld bewusst war, denn sie hatte sein hinterhältiges, dreckiges Lachen gesehen. Das, das der Öffentlichkeit verborgen geblieben war.
Kapitel Zwei»Sue klang beinahe flehend. Irgendjemand musste ihr
doch glauben.
Ihre Psychologin Dr. Angelica Baker räusperte sich. »Mrs. Lancaster«, sie sprach ruhig wie immer, »setzen Sie sich bitte.«
Sue wurde in diesem Moment bewusst, dass sie von dem dunkelbraunen Sofa im Chesterfield-Design aufgesprungen sein musste. Sie hatte es nicht bemerkt. Dabei hatte sie heute Morgen auf den Drink verzichtet, mit dem sie sonst in den Tag startete. Sue war dabei, die Kontrolle über ihr Leben endgültig zu verlieren. Sie stand an dem Rand einer Klippe, von der sie abzustürzen drohte. Gelegentlich verlor sie das Gleichgewicht, ruderte mit den Armen, fand aber immer wieder einen halbwegs sicheren Halt. Doch irgendwann würde sie fallen. Ins Bodenlose. Und dort landen, wo Ben war. Wo auch immer das war.Sue schüttelte sich, als wolle sie die Dämonen loswerden, die seit seinem Tod an ihr hafteten und nicht die Absicht hatten, sie zu verlassen.
Sie nahm auf Geheiß ihrer Psychologin wieder Platz auf dem Sofa.
»Ich weiß, dass Sie das Thema sehr beschäftigt. Das würde es jeden von uns. Das Schlimmste für jemanden ist es, sein eigenes Kind zu verlieren. Der Schmerz ist unvorstellbar.«Dr. Baker machte eine kurze Pause.
»Ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss. Ich weiß, dass Sie sich Gerechtigkeit wünschen, dass Sie den Täter hinter Gittern sehen wollen, aber der Prozess läuft nach wie vor. Wo stehen wir da eigentlich?«
Sue war zuerst der Meinung, die Psychologin stelle eine rhetorische Frage. Doch als sie nichts mehr sagte, wurde ihr klar, dass ihr die Frage galt. Sue fasste sich an die heiße Stirn. Sie brauchte einen verdammten Drink. Jetzt sofort.
Sie atmete laut hörbar aus. Wo standen sie? Eigentlich nach wie vor bei null. Und wenn nicht bald – aus welcher Ecke auch immer – ein wundersamer Zeuge auftauchte, dann würde das auch so bleiben. Kurzum: Es wusste eigentlich niemand, was geschehen war. Es war ein reiner Indizienprozess, der Sue nicht nur um den Schlaf, sondern vor allem um den Verstand brachte. Sam K. hatte man festgenommen, weil er definitiv am Tatort war, weil Spuren von ihm gesichert wurden. Ob er Ben getötet hatte?
Sue war davon überzeugt. Allein dieses dreckige Grinsen, mit dem er sie an jedem Verhandlungstag strafte, war ein Beweis dafür, dass er zumindest etwas wissen musste. Sue war sich sicher, dass er der Mörder ihres Sohnes war. Er verhöhnte sie, er fühlte sich mächtig, während sie an der ganzen Geschichte langsam aber sicher zugrunde ging. »Das habe ich mir fast gedacht«, fasste Dr. Baker nach ihrer Ausführung zusammen. »Sie müssen damit abschließen, Mrs. Lancaster. Das Ganze zerstört Sie.«
Wenn sie ihr doch nur sagen könnte, wie sie das anstellen sollte. Sue wusste im Moment nicht weiter. Sie befand sich in einer verdammten Sackgasse, seitdem das geschehen war. Ihr Leben geriet aus den Fugen.
»Haben Sie eine Freundin oder eine andere nahestehende Person, mit der Sie darüber sprechen können? Sie dürfen das nicht weiter mit sich allein ausmachen.« Die Worte der Psychologin trafen sie wie eine Warnung, wie ein Alarmsignal. Sue wusste unlängst, dass sie es nicht mehr allein schaffte.
Aber wen sollte sie mit ins Vertrauen ziehen?
Freunde hatte sie nicht, und eigentlich wusste ihre Psychologin darüber Bescheid. Ihre Eltern waren bereits tot. Nachbarn?Warum sollte sie diesen Aasgeiern mehr erzählen als nötig?Die stürzten sich doch auf jedes Häppchen, auf jedes Detail, das durch die Presse sickerte. Der Prozess hatte bereits große Wellen geschlagen, das musste nicht noch mehr aufgebauscht werden. Es bedeutete nur wieder jede Menge Aufmerksamkeit für Sam K., den Täter.
Das wollte Sue auf gar keinen Fall.
Und wen gab es sonst noch?
Ihren Noch-Ehemann Greg. Es hatte schon seinen
Grund, warum sie sich vor gut drei Jahren getrennt hatten. Sie wollte nichts mehr von ihm wissen. Es reichte, dass sie ihn an den Verhandlungstagen sah. Greg warf ihr Blicke zu, die sie nicht deuten konnte.
Nein, er war keine Option.
Dr. Baker fing ihre Blicke und damit auch ihre Gedanken ein. Sue schüttelte den Kopf.
»Nein, es gibt da niemanden.«
»Und die vorgeschlagene Selbsthilfegruppe ist nach wie vor keine Möglichkeit?«
Wieder ein Kopfschütteln ihrerseits. Auf gar keinen Fall. In einem Kreis sitzen mit lauter Leuten, die sie nicht kannte und die sich gegenseitig volljammerten??Nein, das war keine Option.Dann doch eher Greg. Oder doch lieber niemand? Einen imaginären Freund vielleicht?
Ohnehin dachte man vermutlich unlängst, dass sie verrückt sei. Da würde es auch niemanden wundern, wenn sie sich in Selbstgespräche vertiefen würde. Die Leute zerrissen sich eben gerne das Maul und jeder schaute auf den anderen, ohne vor seiner eigenen Haustür den ganzen Dreck wegzukehren.
»Mit irgendjemandem sollten Sie sprechen.«
Dr. Baker setzte ein strenges Gesicht auf.
Das passte zwar zu ihrem angeschlagenen Oberlehrerinnen-Ton, keinesfalls aber zu ihrem fast jugendlichen Aussehen. Ihr gütiges und vor allem hübsches Gesicht zierten kaum Falten, obwohl sie bereits jenseits der Fünfzig war. Ihr glattes, hellbraunes Haar trug sie bei fast jeder Sitzung zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. Die rahmenlose Brille war zierlich und passte perfekt zu ihrem schmalen Gesicht, dessen markantestes Merkmal die schimmernden, grünen Augen waren. Die sie jetzt ermahnten. Sue rutschte nervös hin und her.
Warum zum Henker sollte sie plötzlich mit jemandem sprechen?Sie kam prima allein zurecht.
Nein, das war gelogen, aber war es so verdammt offensichtlich? War es ihr anzusehen, dass sie nicht mehr lange durchhielt?
Dr. Baker behandelte sie bereits seit über einem Jahr und sie war sicherlich vom Fach, aber trug Sue es dermaßen offenkundig vor sich her? Sie blickte nervös zu der großen Uhr an der Wand. Noch nie zuvor hatte sie sich gewünscht, dass die fünfundvierzig Minuten vorbei seien.
An diesem Tag konnte sie es kaum abwarten, dass sie endlich nach Hause konnte. Dr. Baker folgte ihrem Blick. Sie spürte die Unsicherheit ihrer Patientin.
»Ich möchte ihnen helfen, Mrs. Lancaster. Aber das geht nur, wenn Sie mich auch lassen.«
Nun klangen ihre Worte beinahe flehend. Natürlich hatte sich Sue hilfesuchend an sie gewandt. Sie wollte sprechen, und dafür war sie alle zwei Wochen in der Praxis. Doch die Psychologin vermochte ihr nicht zu helfen. Das konnte niemand. Das war unmöglich. Ben würde nicht wiederkommen!
»Wir sehen uns nächste Woche wieder.«
Sue blickte ihre Psychologin überrascht an.
Eigentlich war der nächste Termin in vierzehn Tagen. »Ich möchte, dass Sie eine Zeitlang wöchentlich kommen, wenn das auch in Ihrem Interesse ist«, klärte Dr. Baker auf.
Sue schien einen Augenblick nachzudenken, wobei sie eher daran dachte, dass sie an diesen Tagen nicht mit einem Drink starten konnte. Doch sie willigte letztendlich ein und antwortete etwas lapidar:
»Ich habe ohnehin nichts Besseres vor.«
Sue war sich nicht sicher, aber es war möglich, dass Dr. Baker für eine Sekunde ihre Mimik nicht unter Kontrolle hatte und mit den Augen rollte. Genau sagen konnte sie das aber nicht. Es war ihr aber auch schlichtweg egal. »Gut, dann sehen wir uns nächste Woche um dieselbe Zeit.«
Sue verließ die Praxis im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.
Auf dem Weg nach Hause beschäftigten sie eigentlich nur zwei Gedanken:
Was würde sie in den eigenen vier Wänden als Nächstes trinken?Zur Auswahl standen der billige Rotwein aus dem Tetrapak, eine Flasche Whiskey und der bislang unangerührte Wodka. Sie brauchte irgendwas, was sie akut denk- und handlungsunfähig machte. Dafür wäre der Rotwein am
besten geeignet. Der schoss ihr bekanntlich direkt in den Kopf. Der zweite Gedanke, der sich bei ihr manifestierte, war, ob Dr. Baker eventuell recht hatte.
Musste sie mit jemandem reden?
Sue hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon, dass sich diese Frage sehr schnell von allein beantworten würde.
Kapitel Drei»Bitte nicht«, flehte er und krallte sich beinahe ins Lenkrad. Der Motor seines Wagens stotterte, bevor er letztendlich komplett ausging. »Nein, nein, nein!« Er schrie, fluchte und war den Tränen nahe. Das durfte jetzt einfach nicht passieren. Nicht jetzt. Ein paar Minuten blieb Ben in seinem Wagen sitzen. Er war gerade auf dem Weg von Craven nach Saltbury zurück. Den ganzen Tag hatte er Unkraut gejätet. Ben war schmutzig und müde. Außerdem war er immer noch wütend. Die blöde Kuh wollte letztendlich doch lieber weniger bezahlen. Sie hatte ihn heruntergehandelt und er hatte mal wieder nicht das Maul aufbekommen, um dem Ganzen zu widersprechen. Er hätte darauf bestehen sollen, was vereinbart war. Geizkragen!Stattdessen gab er sich mal wieder mit weniger zufrieden und ärgerte sich im Nachhinein darüber. Wie gern hätte er auf den Tisch gehauen und sie zur Schnecke gemacht. Generell diese ganzen versnobten Leute, die ihren Reichtum nach außen trugen und trotzdem so wenig wie möglich zahlen wollten. Das letzte, verdammte Hemd hatte eben keine Taschen.Diese Tatsache vergaßen solche Leute gern. Sie vergaßen, wo sie herkamen!Den ganzen Sommer war Ben auf Knien herumgerobbt, hatte Rückenschmerzen billigend in Kauf genommen und in der gleißenden Sonne schutzlos geschwitzt wie ein Wahnsinniger.
Er hätte beinahe einen Sonnenstich bekommen. Und wofür das Ganze? Ben wollte unbedingt nach Summersford fahren. Urlaub machen, Ruhe und Entspannung, die Nächte genießen, die Tage chillen, weg von seinen Eltern, weg von all dem Stress, der ihn tagtäglich umgab. Und dann verreckte ihm die Karre. Mitten im Nirgendwo. In der Abenddämmerung eines heißen Sommertages. Ben griff in seine Hosentasche und zog sein Smartphone heraus. Er suchte nach der Nummer eines Abschleppdienstes in der Nähe und wurde schnell fündig. »Dauert ’ne gute Stunde«, hatte ihm der Mann am anderen Ende der Leitung, kaugummikauend, mitgeteilt. Ben fehlten die Optionen, also hatte er augenrollend eingewilligt. In der Zwischenzeit konnte er ein paar andere Dinge erledigen. Zunächst wählte er die Nummer seiner Mutter. »Mom, es ist etwas richtig, Blödes passiert.« Er schluckte den vermeintlichen Kloß herunter, wirkte weinerlich. Seine Mutter verstand es und nahm ihm die Verzweiflung. Anschließend rief er seinen Vater an. Ben erklärte ihm die Situation. Auch sein Vater reagierte verständnisvoll und erklärte, dass er ihn am Abend abhole. Ben willigte ein. Er freute sich, seinen Dad vor seiner Reise noch einmal zu sehen. Eigentlich freute er sich eher darauf, dass Dad noch ein paar Dollar locker machen würde. Nach rund eineinhalb Stunden kam der Abschleppwagen.
Ben stand seitlich hinter dem Wagen und ließ genervt die Schultern hängen, als er den Wagen sah. »Schneller ging es nicht, Kollege«, hatte der Fahrer des Abschleppwagens ungefragt erklärt und damit seine Gestik richtig interpretiert. Ben seufzte. »Ach, das ist schon in Ordnung. Ist einfach nicht mein Tag heute, sorry.«Der Fahrer sah ihn verständnisvoll an. »Altes Schätzchen, wa?«, bemerkte dieser. Ben nickte erschöpft. »Ich kann den Wagen in die Werkstatt und dich nach Hause bringen«, schlug er vor. Ben rang sich ein Lächeln ab. »Das wäre super. Vielen Dank.«Ben und Ed – so der Name des Fahrers – unterhielten sich überraschend gut. Der kaugummikauende, unweigerlich dumme Typ – mit dem er telefoniert hatte – entpuppte sich als intelligent und freundlich. Ben begann die Rückfahrt zu genießen. Er versuchte, die Gedanken an seinen Wagen abzuschütteln. Nicht ganz einfach, wenn er daran dachte, dass er im Abschleppwagen fuhr, an dem das Auto am Haken hing. Aber er bemühte sich. Wie so oft. Immer war Ben darum bemüht, freundlich zu bleiben, höflich, anständig, und schluckte vieles herunter. Das war nicht immer von Vorteil. Es brachte ihm neben dem unschönen Sodbrennen und den Magenschmerzen auch ein schlechtes Gefühl. Er war siebzehn. Er sollte sich über sämtliche Dinge keine Gedanken machen müssen. Und dennoch tat er es. Zum Beispiel über das Zerwürfnis seiner Eltern. Die beiden hatten sich getrennt, als er vierzehn Jahre alt war.
Warum begriff er erst nach und nach. Es gab immer zwei Seiten der Medaille. Deshalb war ihm auch der Kontakt zu seinem Vater wichtig, den seine Mutter unterbinden wollte. Daher musste er sich heimlich mit ihm treffen. Sie würde es irgendwann erfahren. Irgendwann. Aber das war ihm egal. Vielleicht würden sie sich dann wieder annähern?Ben blickte gedankenverloren aus dem Fenster. »So ist das mit dem Leben: Es gibt haufenweise Probleme und nur selten die passende Lösung dazu«, erklärte Ed, der seinem Blick gefolgt war. Ben sah ihn an und nickte vehement. »Du weißt gar nicht, wie recht du damit hast.«Ed war fünf Jahre älter als er und arbeitete mit im Abschleppservice seines Vaters. Er kannte die Problematik. Auch seine Eltern waren geschieden, was ihn augenscheinlich zu einer Art Verbündetem machte. Ben musterte ihn. Er hatte eine eher knabenhafte Figur. Sehr schlank, Brille und mittellanges Haar. Ed war ebenfalls der Typ, der mehr auf Intelligenz setzte als auf Muskeln. Bei Ben war es ganz ähnlich. Er war einen Kopf größer, hatte wuscheliges Haar – schon als kleiner Junge hatte er tolle Naturlocken, die er selbst gar nicht so cool fand –, eine eher schlanke Statur mit kleinem Bauchansatz und dunkelbraune Augen. »Die durchschnittlichen Typen müssen mit Intelligenz punkten oder einer besonderen Fähigkeit«, sagte Bens Freund Martin immer, der selbst mit Intelligenz statt eines Surferboy-Aussehens gesegnet war.
In dem spätpubertären Alter, in dem auch Ben war, blieb der Erfolg beim anderen Geschlecht daher meist aus. Davon konnten Ben und Martin ein Lied singen und vermutlich auch Ed. Im Alter würde sich das sicherlich legen, so hofften sie jedenfalls. In dieser Richtung erzählte er aber auch nichts. Sie erreichten die Ortseinfahrt von Saltbury. Es war bereits dunkel. Bis zur Langley Road war es nicht mehr weit. Seine Mutter war sicherlich schon krank vor Sorge. Sie war einfach jemand, der sich ständig Sorgen machte. Egal um was. Ben war sicher, dass sie dachte, er bekäme es überhaupt nicht mit, aber er wusste mehr, als sie meinte. Ben navigierte Ed zu der Zieladresse. Er hielt an. »Dir alles Gute, mein Lieber!«, rief Ed, als Ben im Begriff war auszusteigen. »Danke, dir auch. Wir sehen uns, wenn ich die Karre abhole.«Ed fuhr weiter Richtung Werkstatt und Ben ging ins Haus. Seine Mutter saß am Küchentisch und sah seine traurig hängenden Schultern. Ihm gelang es sogar, eine Träne aus dem Auge in die Freiheit zu entlassen. Seine Mutter Sue brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass es sich bei dieser um eine echte Notsituation handelte, und gab ihm ihre eiserne Reserve. Tausend Dollar steckten in einem weißen, zerknitterten Umschlag. »Mom, ich kann das unmöglich annehmen«, wollte Ben widersprechen. Sue meinte, dass er es verdient habe.
Er fiel ihr um den Hals, bedankte sich und erklärte, dass er noch mit Martin losfahre, nachdem er den Rest seiner Sachen gepackt hätte. Dass es nicht Martin war, mit dem er sich traf, musste seine Mutter nicht wissen.
Kapitel Vier»Also für fünfundzwanzig Dollar die Nacht, können wir gern noch länger hierbleiben. Warum war das nochmal so günstig?«, fragte Melissa an ihren Mann Paul gewandt und bestaunte die wundervolle Ausstattung des Ferienhauses. Paul zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Ich habe das Häuschen über eine Angebotsseite im Preisvergleich gefunden und es war mit Abstand das Preiswerteste.«Melissa gab sich mit der Antwort zufrieden. Eigentlich war es ihr auch egal, warum das Feriendomizil so unverschämt günstig war. Sie war einfach froh, dass sie eine ganze Stange Geld sparen konnten. Für den Preis war die Villa toll ausgestattet. Im Erdgeschoss befanden sich eine Küche mit Essbereich, ein großes Wohnzimmer und ein Bad. In der ersten Etage gab es Schlafzimmer und ein weiteres Badezimmer. Der Garten, auf den man durch die großen Flügelfenster im Wohnbereich sehen konnte, bot eine kleine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und eine großzügige Grünfläche. Den Schlüssel hatte man in einem Tresor im Garten hinterlegt. Die Zahlenkombination wurde ihr per SMS zugesendet. Es lief alles zu Melissas Zufriedenheit ab. Ihr Mann scherte sich nicht um das Organisatorische. Er genoss seinen Urlaub, den sich beide redlich verdient hatten. Für die Details war meistens Melissa zuständig.
»Schau mal, Schatz, es gibt sogar eine PlayStation!«, rief Paul aus dem Wohnzimmer in die erste Etage, wo sich seine Frau gerade das Badezimmer ansah. Sie rollte bloß mit den Augen. Manchmal war ihr geliebter Gatte einfach ziemlich einfältig und verdammt leicht zu begeistern. Melissa widmete sich der hübschen Eckbadewanne unter dem Fenster. Alles war sauber und stilvoll eingerichtet. Man legte hier viel Wert auf seine Besucher, dachte sie und lächelte. Sie ließ ihren Blick schweifen, betrachtete die Wände und die Decken und stutzte kurz. War da etwas in der Deckenverkleidung?Noch bevor sich Melissa darüber Gedanken machen konnte, tauchte Paul hinter ihr auf, nahm sie in den Arm und küsste sanft ihren Hals. »Es ist wirklich schön hier«, erklärte er lächelnd. Melissa schloss kurz die Augen. Sie drehte sich zu ihrem Mann um. »Oh, ja, das ist es. Du hast es toll ausgesucht.«Die beiden wollten zunächst ein bisschen spazieren gehen und die Umgebung erkunden, bevor sie es sich in ihrem vorübergehenden Zuhause gemütlich machten. Das Ferienhaus lag mitten in einem Wald. Sogar ziemlich versteckt. Wenn man den Standort nicht genau gekannt hätte, würden es Gäste sicherlich nicht finden. Es war märchenhaft und wunderschön. Melissa und Paul waren sich schnell einig, dass sie ein wahres Juwel unter den Ferienhäusern gefunden hatten.
Rund um das Haus befand sich der Wald, der tief und dicht schien. Melissa und Paul mussten lange laufen, bis sie ans Ende kamen. Eine Lichtung, von der es aus in ein kleines Dorf ging. Hier war die Welt noch in Ordnung, dachten sie einmal mehr, als sie sich an ihrem Urlaubsort umsahen. Melissa und Paul hatten sich nach Ruhe und Entspannung gesehnt und wurden nicht enttäuscht. Sie gingen eine Weile, händchenhaltend wie schon ewig nicht mehr, völlig losgelöst von ihrem sonst so stressigen und lauten Alltag, und kamen nach einer Weile wieder an ihrem Häuschen an. Melissa erklärte ihrem Mann, dass sie sich ein heißes Bad einlasse, er solle schon einmal im Schlafzimmer auf sie warten. Paul wusste genau, was das bedeutete. Er vergötterte seine Frau, er begehrte sie und ihren Körper. Auch wenn es in letzter Zeit stressig für die beiden gewesen war und wenig Momente der Zweisamkeit blieben, so freute er sich auf den baldigen Sex. Es muss lange her gewesen sein. Zu lange. Der Alltag hatte das Ehepaar eingeholt und mit ihm die Unruhe, Hektik und der Stress. Melissa zog sich das Kleid über den Kopf und stand nur noch in Dessous vor der schaumigen, heißen Badewanne. Ihre Sinne wurden von dem wundervollen Lavendelduft des Schaumbades vollständig vernebelt. Sie öffnete den BH und zog das Höschen herunter. Ihr schlanker Körper schien im Gegensatz zu ihrem Nervenkostüm keinen Tag gealtert zu sein. Beinahe makellos, mit der richtigen Portion Kurven, stieg sie in das Schaumbad, setzte sich und schloss für einen Augenblick die Augen.